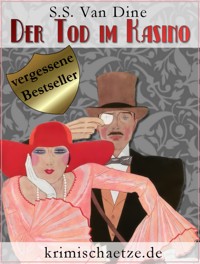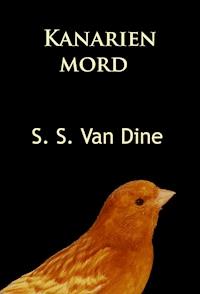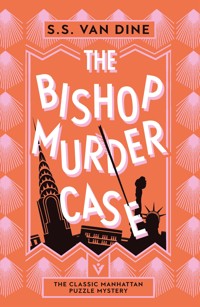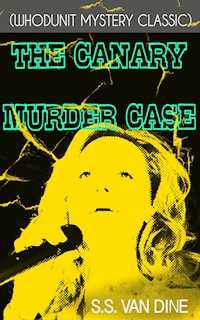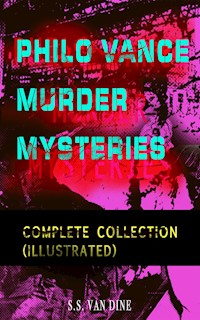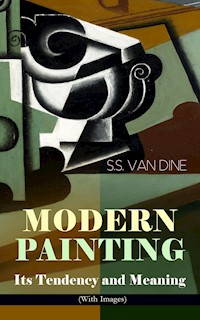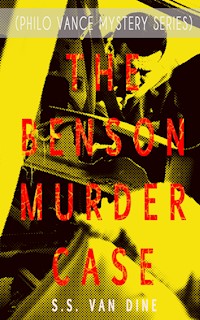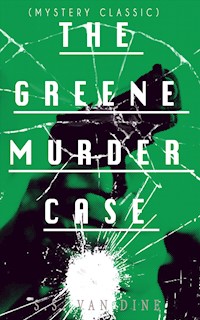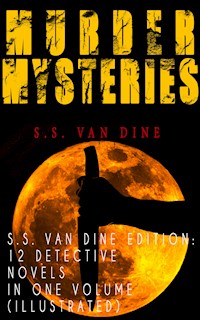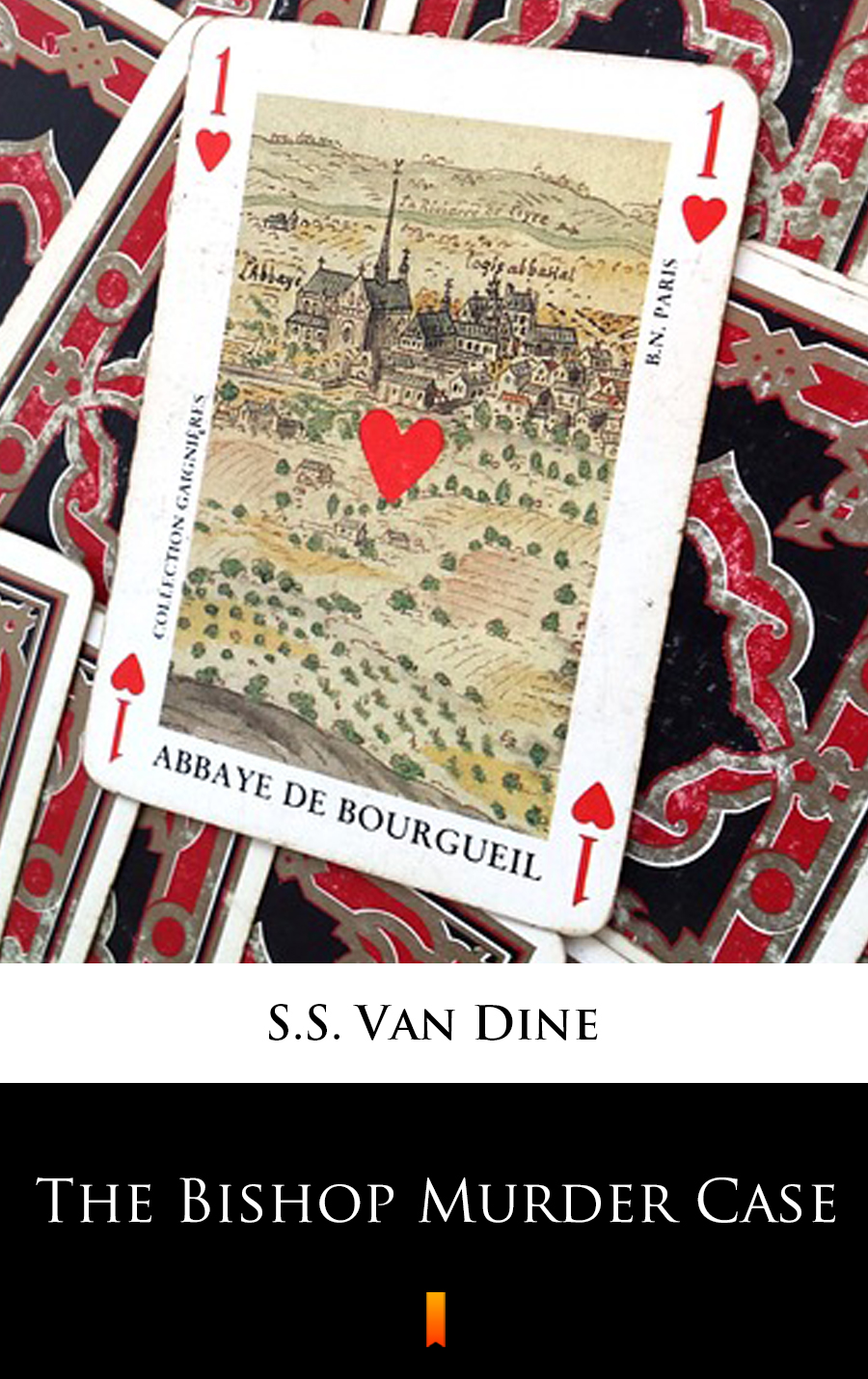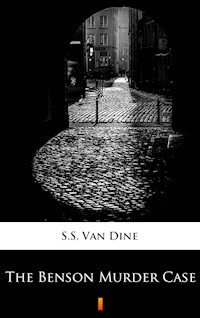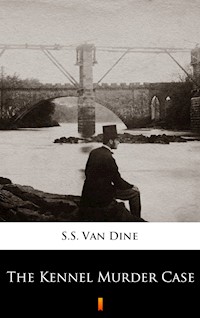Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An diesem Morgen des vierzehnten Juni, als der ermordete Alvin H. Benson gefunden wurde, frühstückte ich zufällig bei Philo Vance in dessen Wohnung. Dieser Mordfall war eine Sensation, und er ist es auch heute noch. Es war nicht ungewöhnlich für mich, hin und wieder mit Vance zusammen zu Mittag oder zu Abend zu essen, aber zusammen zu frühstücken war schon außergewöhnlich. Er war ein Spätaufsteher, und es gehörte zu seinen Gewohnheiten, bis zur Zeit des Mittagessens nicht recht ansprechbar zu sein ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S. S. Van Dine
Mordakte Benson
Kriminalroman
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Benson Murder Case
idb
ISBN 9783962249595
Einleitung
Wenn man die entsprechende Statistik der Stadt New York ansieht, kann man feststellen, daß während der vier Jahre, in denen John F. X. Markham Bezirksanwalt war, wesentlich mehr Kapitalverbrechen aufgeklärt wurden als vorher. Markham hatte nämlich das Bezirksanwaltsbüro in ein kriminalistisches Forschungszentrum verwandelt. Dadurch gelang es ihm, manches mysteriöse Verbrechen, an dem die Polizei hoffnungslos gestrandet war, doch noch aufzuklären.
Markham wurde berühmt, weil er so viele wichtige Fälle gelöst und eine Verurteilung der Täter erreicht hatte. In Wahrheit gebührte der Ruhm jedoch einem anderen Mann – jenem, der die Verbrechen in Wirklichkeit aufgeklärt und das Beweismaterial für die Prozesse beschafft hatte. Dieser Mann gehörte allerdings nicht zur Staatsanwaltschaft, und die Öffentlichkeit erfuhr nie seinen Namen.
Ich war damals der Freund und der Rechtsberater dieses Mannes, und von ihm habe ich auch alle Informationen über seine Tätigkeit. Da er mir jedoch nie erlaubt hat, seinen richtigen Namen zu nennen, habe ich mich entschlossen, ihn in diesen offiziellen Berichten als Philo Vance zu bezeichnen.
Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß einige seiner Bekannten bei der Lektüre meiner Aufzeichnungen herausfinden, um wen es sich handelt. Sollte dies der Fall sein, bitte ich sie jedoch, ihr Wissen für sich zu behalten. Der Mann lebt inzwischen zwar in Italien und hat mir außerdem erlaubt, über die Fälle zu berichten, in deren Mittelpunkt er stand, aber er beharrte ausdrücklich auf der Wahrung seiner Anonymität. Mir wäre es sehr unangenehm, wenn durch meine Indiskretion sein Geheimnis gelüftet werden würde.
Der vorliegende Bericht befaßt sich mit der Lösung des Mordfalls Benson durch Vance. Die Öffentlichkeit interessierte sich brennend für diese Verbrechen, in das prominente Personen verwickelt waren und das durch überraschende Beweise aufgeklärt wurde. Dieser sensationelle Fall war der erste von vielen, bei denen Vance sich bei Markhams Ermittlungen als hilfreicher Freund erwies.
S. S. Van Dine
1. Zu Hause bei Philo Vance
Freitag, 14. Juni, 8.30 Uhr
An diesem Morgen des vierzehnten Juni, als der ermordete Alvin H. Benson gefunden wurde, frühstückte ich zufällig bei Philo Vance in dessen Wohnung. Dieser Mordfall war eine Sensation, und er ist es auch heute noch. Es war nicht ungewöhnlich für mich, hin und wieder mit Vance zusammen zu Mittag oder zu Abend zu essen, aber zusammen zu frühstücken war schon außergewöhnlich. Er war ein Spätaufsteher, und es gehörte zu seinen Gewohnheiten, bis zur Zeit des Mittagessens nicht recht ansprechbar zu sein.
Der Grund für dieses frühzeitige Treffen war ein geschäftlicher – oder besser gesagt, ein ästhetischer. Am Nachmittag des Vortages war Vance ein Katalog von Vollard's Sammlung von Cézanne-Aquarellen, die in der Kessler Galerie gezeigt wurden, zugegangen, und da er verschiedene Bilder gesehen hatte, die er besonders gern haben wollte, hatte er mich zu diesem Frühstück eingeladen, um mir über den Ankauf Anweisungen zu geben.
Es ist wohl besser, wenn ich mein Verhältnis zu Vance gleich zu Beginn deutlich mache. In meiner Familie ist die Juristerei schon lange Tradition, und als meine Schulzeit vorbei war, wurde ich selbstverständlich nach Harvard geschickt, um Jura zu studieren. Und eben dort begegnete ich Vance, einem zurückhaltenden, zynischen und sarkastischen jungen Mann, der der Schrecken seiner Professoren und der Alptraum seiner Kommilitonen war. Warum er sich ausgerechnet mit mir einließ, habe ich nie ganz verstanden. Meine Sympathie für Vance ließ sich dagegen leicht erklären: er faszinierte und interessierte mich, und ich bewunderte seinen Verstand. Er mußte jedoch andere Gründe für seine Freundschaft mit mir haben. Ich war damals – und bin es heute noch – ein gewöhnlicher Durchschnittsmensch, mit konservativen und recht konventionellen Ansichten. Aber wie auch immer, jedenfalls waren wir häufig zusammen, und im Laufe der Jahre, entwickelte sich diese Verbindung zu einer untrennbaren Freundschaft.
Wenn ich bis zu dem Zeitpunkt, da Vance mich wegen des Ankaufs der Cézannes sprechen wollte, der Firma Van Dine, Davis and Van Dine nur mit meinen mittelmäßigen juristischen Fähigkeiten gedient hatte, so änderte sich dies schlagartig an jenem bedeutungsvollen Morgen. Angefangen mit dem merkwürdigen Mordfall Benson wurde ich nämlich während eines Zeitraumes von beinahe vier Jahren naher Zuschauer und Beobachter einer Reihe der seltsamsten Kriminalfälle, welche einem jungen Rechtsanwalt je unter die Augen gekommen sein mögen. In der Tat setzten sich aus den makabren Dramen, deren Zeuge ich im Laufe dieser Zeit wurde, die erstaunlichsten Geheimdokumente in der Polizeigeschichte dieses Landes zusammen.
Wegen meiner besonderen Beziehung zu Vance war es so, daß ich nicht nur an all den Fällen teilnahm, mit denen er zu tun hatte, sondern daß ich außerdem auch an den meisten der inoffiziellen Besprechungen teilnahm, die zwischen ihm und dem Staatsanwalt geführt wurden, und da ich eine recht methodische Veranlagung habe, führte ich ein einigermaßen lückenloses Protokoll darüber. Darüber hinaus notierte ich – so korrekt, wie es ein gut ausgeprägtes Erinnerungsvermögen zuläßt – die einzigartigen psychologischen Methoden von Vance, mit denen er die Schuldigen überführte.
Der erste Fall, in den Vance auf diese Weise hineingezogen wurde, war der Mordfall von Alvin Benson. Er erwies sich schließlich nicht nur als einer der berühmtesten New Yorker causes célè-bres, sondern er gab Vance eine ausgezeichnete Gelegenheit, sein seltenes Talent von analysierender Überlegung zu demonstrieren. Dieser Fall war wie kein anderer dazu angetan, sein Interesse an einer Sache zu wecken, mit der er sich nie zuvor befaßt hatte.
Dieser Fall platzte völlig unerwartet und überraschend in Vances Leben.
Tatsächlich überfiel uns das Ganze bereits, bevor wir auch nur unser Frühstück an diesem Morgen im Juni beendet hatten. Damit waren vorübergehend auch alle geschäftlichen Gespräche über den Ankauf der Gemälde von Cézanne zu Ende. Als ich im Laufe des Tages an der Kessler Galerie vorbeiging, waren bereits zwei der Aquarelle, die Vance besonders gern gehabt hätte, verkauft; und ich bin überzeugt, daß er bis heute den Verlust dieser beiden kleinen Skizzen, an die er sein Herz gehängt hatte, nicht verwunden hat, obwohl er den mysteriösen Mordfall Benson so erfolgreich geklärt hat.
An diesem Morgen wurde ich von Currie, einem der seltenen, alten englischen Bediensteten, der sowohl Butler und Diener von Vance, sowie bei besonderen Gelegenheiten auch sein Spezialitätenkoch war, in den Salon geführt. Vance saß in einem großen Sessel, angetan mit einem seidenen Sarong und grauseidenen Pantoffeln. Auf seinen Knien lag aufgeschlagen Vollard's Cézanne-Buch.
»Entschuldige, daß ich nicht aufstehe«, sagte er zur Begrüßung, »aber ich habe das ganze Gewicht der modernen Evolution der Kunst auf meinen Knien.« Er ließ die Seiten durch seine Finger blättern.
»Dieser Vollard«, meinte er schließlich, »ist recht lässig mit unserem kunstfürchtigen Land umgesprungen. Er liefert hier allerdings eine gute Sammlung vom Werk Cézannes. Ich habe es gestern mit dem gebührenden Respekt studiert, aber gleichzeitig nicht zu auffällig, denn Kessler war dabei und beobachtete mich. Ich habe diejenigen Bilder angestrichen, die du für mich kaufen sollst, sobald die Galerie heute morgen aufmacht.« Er überreichte mir einen kleinen Katalog. »Ein unangenehmer Auftrag, ich weiß«, setzte er lächelnd hinzu.
Vances einzige Leidenschaft – wenn man einen rein intellektuellen Enthusiasmus als Leidenschaft bezeichnen darf – war Kunst; nicht Kunst aus enger, persönlicher Sicht, sondern in ihrer weitläufigen, alles umfassenden Bedeutung. Und der Kunst galt sein Hauptinteresse, er beschäftigte sich fast ausschließlich mit ihr. Er war so etwas wie eine Autorität, was japanische und chinesische Drucke anbelangte; er kannte sich aus bei Wandteppichen und Keramik und Porzellan, und einmal hörte ich, wie er einigen Gästen ganz nebenbei einen Vortrag über Tanagrafiguren hielt, der, wäre er schriftlich festgehalten worden, einen entzückenden und höchst instruktiven Aufsatz abgegeben hätte.
Vance verfügte über ausreichende Mittel, um seiner Sammlerleidenschaft nachzugeben, und er besaß eine sehr schöne Sammlung von Bildern und Kunstgegenständen. Die einzelnen Stücke seiner Sammlung hatten nur eines gemeinsam: jedes Stück, das er besaß, paßte entweder in seiner Form oder Linie zu den anderen. Jemand, der sich in der Kunst auskannte, spürte den Zusammenhang aller Gegenstände, mit denen er sich umgab, gleichgültig, wieweit die einzelnen Epochen auseinanderlagen. Ich hatte immer das Gefühl, daß Vance zu den seltenen Kunstkennern gehörte, die ihre Sammlung nach ganz bestimmten philosophischen Gesichtspunkten anlegen.
Seine Wohnung in der Achtunddreißigsten Straße bestand aus den beiden oberen Etagen eines alten Herrschaftshauses. Sie war angefüllt, jedoch nicht überfüllt mit seltenen Exemplaren orientalischer, alter und moderner Kunst. Seine Gemäldesammlung reichte von den italienischen Primitiven bis zu Cézanne und Matisse; und in seiner Sammlung von Originalzeichnungen waren Arbeiten von Michelangelo und von Picasso zu finden. Seine chinesischen Drucke galten als die beste Privatsammlung dieses Landes.
»Die Chinesen«, sagte Vance einmal zu mir, »sind die wirklich großen Künstler des Ostens. Diese Männer waren es, deren Arbeit am intensivsten einen weitläufig philosophischen Geist ausdrückten. Im Gegensatz dazu waren die Japaner oberflächlich. Selbst wenn die chinesische Kunst unter den Manchus degenerierte, finden wir darin eine tiefe philosophische Qualität. Und in den modernen Kopien der Kopien gibt es noch immer Bilder von echter Bedeutsamkeit.«
Viele hätten Vance als Dilettanten bezeichnet. Aber diese Bezeichnung trifft nicht auf ihn zu. Er war ein Mann von ungewöhnlicher Kultur. Durch Geburt und Instinkt ein Aristokrat schirmte er sich ganz bewußt von der gewöhnlichen Menschheit ab. In seiner ganzen Art lag eine ausgeprägte Ablehnung von allem Unwichtigen. Die meisten Menschen, mit denen er in Berührung kam, hielten ihn für einen ausgesprochenen Snob. Und trotzdem war er nicht überheblich. Sein Snobismus war sowohl intellektuell als auch sozial. Dummheit verabscheute er, glaube ich, noch mehr als das Vulgäre oder schlechten Geschmack. Mehrfach habe ich gehört, wie er Fouchés berühmten Satz zitierte: Das ist mehr als ein Verbrechen, es ist ein Fehler. Und das meinte er wörtlich.
Vance war ganz sicher ein Zyniker, aber verbittert war er kaum. Vielleicht könnte man ihn am besten als gelangweilt und hochmütig bezeichnen, aber gleichzeitig war er ein sehr bewußter und genauer Beobachter des Lebens. Er war äußerst interessiert an jeglichen menschlichen Reaktionen; aber es war das Interesse des Wissenschaftlers, nicht die des Humanisten. Alles in allem war er ein Mann von seltenem persönlichen Charme.
Vance sah ungewöhnlich gut aus, obwohl sein Mund sarkastisch und grausam war, wie die Lippen auf einigen der Medici-Porträts. Darüber hinaus lag ein leicht spöttischer Zug in der Art, wie er die Augenbraue hochzog. Seine Stirn war hoch und gewölbt – es war eher die eines Künstlers, denn die eines Schülers. Seine kalten grauen Augen lagen weit auseinander. Seine Nase war schlank und gerade, sein Kinn eng aber energisch mit einem ungewöhnlich tiefen Grübchen darin.
Vance war fast zwei Meter groß, elegant, und man hatte den Eindruck einer sehnigen Strenge und nerviger Ausdauer. Er war ein exzellenter Fechter und war einstmals der Captain seiner Universitäts-Fechtmannschaft. Von sportlicher Aktivität hielt er nicht allzuviel, aber er konnte eigentlich alles, ohne sich sonderlich darum zu bemühen. Trotzdem hatte er eine entschiedene Abneigung gegen das Zufußgehen, und er ging keine hundert Schritt, wenn es eine Möglichkeit gab, zu fahren.
Er war immer sehr modisch angezogen – selbst das kleinste Detail mußte stimmen –, jedoch immer unaufdringlich. Sehr viel Zeit verbrachte er in seinen Clubs: der liebste war ihm der Stuyvesant, weil, wie er mir einmal erklärte, dessen Mitglieder überwiegend Politiker oder Kaufleute waren, so daß er niemals in Gespräche verwickelt wurde, die irgendeinen geistigen Aufwand verlangten. Nur gelegentlich ging er in eine moderne Oper, dagegen besuchte er regelmäßig Symphoniekonzerte und Kammermusikveranstaltungen.
Übrigens war er einer der unfehlbarsten Pokerspieler, die ich je kennengelernt hatte. Diese Tatsache erwähne ich, um zu erklären, daß seine Kenntnisse von der Wissenschaft der menschlichen Psychologie, die beim Poker eine große Rolle spielen, auch bei der folgenden Geschichte von wesentlicher Bedeutung sind.
Er hatte die Gabe, instinktiv die Menschen richtig zu beurteilen, und seine Studien und Nachforschungen ließen diese Gabe immer größer werden. Er hatte natürlich gut fundierte Kenntnisse der Psychologie, und die Vorlesungen, die er auf der Universität besuchte, drehten sich fast ausschließlich um dieses Thema oder waren doch eng damit verbunden. Er befaßte sich außerdem mit dem gesamten Gebiet der kulturellen Entwicklung. Seine Semester setzten sich aus Religionsgeschichte, griechische Klassik, Biologie, Philosophie, Anthropologie, Literatur, theoretischer und experimenteller Psychologie sowie alter und neuer Sprachen zusammen.
Vance führte ein angeregtes, aber keinesfalls ehrgeiziges Gesellschaftsleben. Er war kein Salonlöwe. Ich kann mich nicht entsinnen, je einen Mann mit so geringem Herdentrieb kennengelernt zu haben, und wenn er sich in das Gesellschaftsleben begab, dann meist nur unter Zwang. So hatte er auch eine seiner ›Pflicht‹-Gesellschaften in der Nacht vor diesem denkwürdigen Juni-Morgen hinter sich gebracht; sonst hätten wir uns womöglich schon am Abend vorher über die Bilder von Cézanne unterhalten; und darüber brummte Vance auch eine ganze Weile, während Currie das Frühstück servierte. Später habe ich mich sehr beim Gott des Zufalls bedankt, daß Vance an diesem Morgen um neun Uhr, als der Staatsanwalt kam, mit mir frühstückte, denn sonst wäre ich wahrscheinlich um die interessantesten und aufregendsten Jahre meines Lebens gebracht worden; und viele von New Yorks gemeinsten und schlimmsten Kriminellen würden noch frei herumlaufen.
Vance und ich hatten uns gerade bequem in unsere Sessel zurückgelehnt, um unsere zweite Tasse Kaffee und eine Zigarette zu genießen, als Currie, nachdem er auf das ungeduldige Läuten hin die Haustür geöffnet hatte, den Staatsanwalt in den Salon führte.
»Bei allen Heiligen!« rief er aus und hob in spöttischem Erstaunen beide Hände, »New Yorks führender Kunstkenner ist schon auf den Beinen!«
»Und gleich werde ich erröten wegen des Undanks, den ich dafür ernte«, gab Vance zurück.
Es war jedoch offensichtlich, daß der Staatsanwalt nicht sehr gut aufgelegt war. Plötzlich wurde sein Gesicht ernst.
»Vance, mich bringt eine ernste Angelegenheit hierher. Ich bin sehr in Eile und bin nur vorbeigekommen, um mein Versprechen zu halten. Tatsache ist, daß Alvin Benson umgebracht wurde.«
Vance zog überrascht die Augenbraue hoch. »Tatsächlich«, meinte er. »Wie unangenehm! Aber er hatte es zweifellos verdient. Auf jeden Fall solltest du deshalb nicht so mürrisch sein.«
2. Am Tatort
Freitag, 14. Juni, 9 Uhr
John F. X. Markham war Staatsanwalt von New York. Er war ein unermüdlicher Arbeiter, und er stattete die Staatsanwaltschaft mit allem Zubehör eines Ermittlungsbüros aus. Da er absolut unbestechlich war, hatte er nicht nur die glühende Bewunderung seiner Wählerschaft, auch seine politischen Gegner hatten das Gefühl, sich auf ihn verlassen zu können.
Er hatte seinen Posten erst seit ein paar Monaten inne, als er in einer der lokalen Zeitungen als ›Wachhund‹ bezeichnet wurde, und dieser Spitzname hing ihm an.
Markham war ein großer, kräftig gebauter Mann Mitte Vierzig. Sein bartloses, recht jugendliches Gesicht paßte eigentlich gar nicht zu seinem graumelierten Haar. Gemessen am gängigen Ideal war er nicht eigentlich schön, aber er besaß eine gewinnende Art und hatte auch auf vielen Gebieten seinen politischen Kollegen einiges voraus.
Wenn er sich von beruflichem Stress und Verantwortung frei machte, war er überaus großzügig. Aber schon ganz im Anfang unserer Bekanntschaft erlebte ich einmal, wie seine freundliche, gewinnende Art urplötzlich in strenge Autorität umschlug. Der Wechsel war so abrupt, als wäre in diesem Moment aus Markham eine völlig andere Persönlichkeit geworden. Bevor unsere Beziehungen endeten, sollte ich diesen Wechsel noch oft erleben. An diesem bestimmten Morgen zum Beispiel in Vances Salon lag mehr als nur eine Andeutung von dieser aggressiven Sturheit in seiner Art, und ich wußte, daß er äußerst besorgt war über den Mord an Alvin Benson.
In eiligen Schlucken nahm er seinen Kaffee zu sich. Dann setzte er seine Tasse ab, als Vance, der ihn die ganze Zeit amüsiert beobachtet hatte, bemerkte: »Na und? Warum dieser Trauerflor wegen des Hinscheidens von einem der Bensons? Sie waren doch nicht vielleicht zufällig der Mörder?«
Markham ignorierte Vances Lässigkeit: »Ich bin auf dem Weg zu Bensons Haus. Willst du mitkommen? Du hast mich um praktische Anschauung gebeten, und ich kam nur vorbei, um mein Versprechen zu halten.«
»Du vergißt nie etwas, oder?« antwortete Vance. »Eine bewundernswerte, wenn auch unbequeme Gabe.« Er warf einen Blick auf die Uhr über dem Kaminsims: es war kurz vor neun. »Aber welch' unmögliche Tageszeit! Was ist, wenn mich jemand sieht?«
Markham rutschte ungeduldig auf seinem Sessel hin und her. »Komm, beweg dich, du Faultier. Diese Sache ist kein Witz. Es ist verdammt ernst; und so, wie es bisher aussieht, wird daraus ein höchst unangenehmer Skandal. Was ist jetzt, kommst du mit?«
»Ich? Was sonst! Ich werde dem großen Rächer in Demut folgen«, gab Vance zurück, erhob sich und machte eine ironische Verbeugung.
Er läutete Currie und befahl, daß ihm seine Kleider gebracht würden. »Ich nehme an einer Veranstaltung teil, die Mr. Markham bei einer Leiche arrangiert hat, deshalb brauche ich etwas Ausgefallenes. Ist es warm genug für einen Seidenanzug? Und auf jeden Fall einen Lavendelbinder.«
»Hoffentlich steckst du dir nicht noch eine grüne Nelke an.«
»Du weißt sehr gut, daß ich niemals Blumen trage. So etwas hat man heutzutage nicht mehr. Die einzigen Leute, die sich das noch leisten können, sind Saxophonisten und Wüstlinge ... Aber jetzt erzähl' mir mal von dem verblichenen Benson.«
Mit Curries Hilfe zog sich Vance dann mit einer Geschwindigkeit an, wie ich sie selten gesehen hatte.
»Ich glaube, du kanntest Alvin Benson so beiläufig«, sagte der Staatsanwalt. »Also, heute früh rief seine Haushälterin die zuständige Polizeistation an und berichtete, daß sie ihn erschossen aufgefunden habe. Er war angezogen und saß in seinem Lieblingssessel in seinem Salon mit einem Loch in der Stirn. Diese Nachricht wurde natürlich sofort an das Hauptkommissariat weitergeleitet, und mein diensthabender Assistent benachrichtigte mich umgehend. Erst wollte ich den Fall der normalen Polizeiroutine überlassen; aber eine halbe Stunde später rief mich Major Benson, Alvins Bruder, an und fragte mich, ob ich ihm einen besonderen Gefallen tun und den Fall persönlich übernehmen könnte. Ich kenne den Major seit fast zwanzig Jahren, und so konnte ich nicht gut ablehnen. Also frühstückte ich schnell und machte mich auf den Weg zu Bensons Haus. Er wohnte in der Achtundvierzigsten Straße und als ich hier um die Ecke kam, fiel mir deine Bitte wieder ein. Also kam ich schnell 'rein, um zu sehen, ob du Lust hast, mitzukommen.«
»Sehr aufmerksam«, murmelte Vance und band sich vor dem Spiegel die Krawatte. Dann wandte er sich an mich. »Komm, Van. Wir wollen alle einen Blick auf den verblichenen Benson werfen. Ich bin sicher, daß einer von Markhams Bluthunden mit der Tatsache aufwarten wird, daß ich den alten Herrn verabscheute und deshalb das Verbrechen begangen haben müßte. Und deshalb fühle ich mich sicherer, wenn mein Rechtsbeistand bei mir ist. Du hast doch nichts dagegen, Markham?«
»Keineswegs«, stimmte der Staatsanwalt zu, obwohl ich das Gefühl hatte, daß er mich lieber nicht dabei gehabt hätte. Ich war inzwischen viel zu interessiert an der ganzen Angelegenheit, als daß ich auch nur der Form halber abgelehnt hätte. Also folgte ich Vance und Markham die Treppen hinunter.
Während wir im Wagen unterwegs waren, erschien Markham geistesabwesend und in Gedanken versunken. Seit wir die Wohnung verlassen hatten, war noch kein Wort gesprochen worden; aber als wir in die Achtundvierzigste Straße einbogen, fragte Vance: »Wie sieht die gesellschaftliche Etikette aus bei derlei morgendlichen Mordbesichtigungen, abgesehen davon, daß man wohl seinen Hut abnimmt angesichts der Leiche?«
»Du kannst den Hut aufbehalten«, brummte Markham.
»Tatsächlich? Wie in der Synagoge, was? Höchst interessant! Vielleicht sollte man die Schuhe ausziehen, um die Fußabdrücke nicht zu ruinieren.«
Markham war zu geistesabwesend, um den Unsinn von Vance weiter zu verfolgen. »Es handelt sich nur um ein oder zwei Dinge«, sagte er, »auf die ich euch hinweisen möchte. So wie es im Augenblick aussieht, scheint dieser Fall viel Staub aufzuwirbeln, außerdem wird es Eifersüchteleien geben. Man wird uns nicht mit offenen Armen empfangen, wenn wir der Polizei in diesem Stadium dazwischenfunken; also seid vorsichtig, daß ihr ihnen nicht auf die Zehen tretet. Mein Assistent, der jetzt bereits dort ist, sagte mir, daß Sergeant Heath auf den Fall angesetzt wurde. Heath ist ein Detektiv der Mordkommission, und er ist zweifellos der Überzeugung, daß ich jetzt nur erscheine, um etwas für meine Publicity zu tun.«
»Stehst du nicht über ihm?« fragte Vance.
»Ja, natürlich; und daher ist die Situation besonders delikat. Ich wünschte wirklich, der Major hätte mich nicht angerufen.«
»Naja!« seufzte Vance. »Die Welt ist leider voller Heaths. Blödes Volk.«
»Mißverstehe mich nicht«, warf Markham ein. »Heath ist ein ausgezeichneter Mann – eigentlich der beste, den wir haben. Allein die Tatsache, daß er auf diesen Fall angesetzt wurde, zeigt, wie wichtig die Angelegenheit Benson ist. Man wird mir keine Hindernisse in den Weg legen, verstehst du. Ich möchte jedoch die Atmosphäre nicht vergiften. Heath wird mir ohnehin böse sein, daß ich euch beide als Zuschauer mitbringe. Deshalb, Vance, bitte ich dich, so zurückhaltend wie möglich zu sein.«
»Ich will mir Mühe geben, Ehrenwort«, sagte Vance.
Wir hatten plötzlich vor einem alten Residenzhaus am oberen Ende der Achtundvierzigsten Straße angehalten. Es war ein besseres Haus aus der Zeit, als in der Architektur Beständigkeit und Schönheit noch etwas galten.
Eine beträchtliche Menschenmenge hatte sich vor dem Haupteingang des Hauses versammelt; und auf den Stufen lungerten einige drahtig aussehende junge Männer herum, die ich für Zeitungsreporter hielt. Die Tür unseres Taxis wurde von einem uniformierten Polizisten aufgerissen, der Markham mit übertriebenem Respekt grüßte und uns dann energisch einen Weg durch die schaulustige Menge bahnte. Ein weiterer Uniformierter stand in dem kleinen Vestibül, und als er Markham erkannte, riß er die Außentür auf und salutierte mit großem Respekt.
»Sei gegrüßt, Cäsar«, flüsterte Vance und grinste.
»Halt den Mund!« brummte Markham. »Ich habe genug Ärger, auch ohne deine respektlosen Kommentare.«
Als wir durch die massive, geschnitzte Eichentür traten, wurden wir von dem Stellvertreter des Staatsanwalts Dinwiddie begrüßt, einem ernsthaften, kräftigen jungen Mann mit vorzeitig gefurchtem Gesicht, dessen Aussehen einem den Eindruck gab, als lägen die meisten Laster der Menschheit ausschließlich auf seinen Schultern.
»Guten Morgen, Chef«, begrüßte er Markham, offensichtlich höchst erleichtert. »Ich bin verdammt froh, daß Sie hier sind. Dieser Fall wird noch viel Staub aufwirbeln. Glasklarer Mordfall – und keine einzige Spur.«
Markham nickte finster und sah an ihm vorbei in das Wohnzimmer. »Wer ist alles da?« fragte er.
»Der ganze Verein, vom Hauptkommissar angefangen«, antwortete Dinwiddie.
In diesem Augenblick kam ein großer, schwerer Mann in mittleren Jahren und kurz geschnittenem, hellgrauem Schnurrbart durch den Eingang zum Wohnzimmer. Als er Markham sah, streckte er steif seine Rechte aus. Ich erkannte ihn sofort als Hauptkommissar O' Brien, der die gesamte hiesige Polizei unter sich hatte. Zurückhaltende Begrüßungen wurden zwischen ihm und Markham ausgetauscht, dann wurden ihm Vance und ich vorgestellt. O'Brien bedachte uns je mit einem kurzen, schweigenden Kopfnicken und wandte sich dann wieder dem Wohnzimmer zu, wohin Markham, Dinwiddie, Vance und ich ihm folgten.
Der Raum, in den man durch eine doppelflüglige Tür gelangte, war weitläufig, fast quadratisch und sehr hoch. Zwei Fenster gaben den Blick zur Straße frei; und an der äußersten Rechten der Nordwand, gegenüber der Front des Hauses, war noch ein Fenster, durch das man zum gepflasterten Hof hinaussah. Links von diesem Fenster waren die Schiebetüren zum dahinterliegenden Eßzimmer.
Der Raum war mit prunkvoller Üppigkeit ausgestattet. An den Wänden hingen mehrere kostbare Gemälde von Rennpferden und einige ausgestopfte Jagdtrophäen. Ein farbenprächtiger Orientteppich bedeckte fast den ganzen Fußboden. In der Mitte der östlichen Wand, gegenüber der Eingangstür, war ein gigantischer Kamin, dessen Sims aus Marmor gehauen war. Diagonal dazu, in der rechten Ecke des Raumes, stand ein Piano aus Walnußholz mit Kupferbeschlägen. Dann gab es noch einen verglasten Bücherschrank aus Mahagoniholz, einen kostbaren Schreibtisch, eine venezianische Truhe mit Perlmuttereinlegearbeiten, einen Teakholztisch mit einem mächtigen kupfernen Samowar und einen Mitteltisch, der fast sechs Fuß lang war. An der Tischseite, die dem Flur am nächsten war, stand, mit der Rückenlehne zu den Vorderfenstern, ein sehr großer Korbsessel mit breiter, fächerartiger Rückenlehne.
In diesem Sessel saß Alvin Benson – die Leiche.
Bensons Körper ruhte in einer so natürlichen Haltung in dem Sessel, daß man eigentlich erwartete, er müßte sich jeden Augenblick umdrehen und uns fragen, warum wir ihn störten. Sein Kopf lehnte an der Rückenlehne des Sessels. Sein rechtes Bein war, wie in bequemer Entspannung, über das linke gekreuzt. Sein rechter Arm ruhte leicht auf dem Tisch und sein linker Arm auf der Sessellehne. Aber was den Eindruck der Natürlichkeit besonders überzeugend vermittelte, war ein kleines Buch, das er in seiner rechten Hand hielt. Sein Daumen lag zwischen den Seiten, die er offensichtlich zuletzt gelesen hatte.
Er war von vorn durch die Stirn erschossen worden; und das kleine kreisrunde Loch war jetzt beinahe schwarz, weil das Blut an den Rändern der Wunde geronnen war. Ein großer dunkler Fleck auf dem Teppich hinter dem Sessel bezeichnete den Punkt, wo die Kugel, aus dem Schädel wieder austretend, gelandet war.
Er hatte ein altes Smoking-Jackett und rote Filzpantoffeln an, aber er trug noch immer seine Ausgehhose und das Abendhemd, wenn auch der Kragen abgenommen war. Das Kragenband war gelöst. Rein äußerlich war er nicht als attraktiv zu bezeichnen, denn er war fast kahlköpfig und etwas mehr als nur untersetzt. Sein Gesicht war schlaff, und die Schwammigkeit seines Halses wurde durch den fehlenden Kragen nur noch unterstrichen. Mit einem leichten Schauer beendete ich meine kurze Beobachtung und wandte mich den übrigen Anwesenden im Raum zu.
Zwei kräftige Männer mit gewaltigen Händen und Füßen, die schwarzen Filzhüte weit ins Genick geschoben, untersuchten minuziös die eisernen Gitter vor den Frontfenstern. Sie schienen sich besonders für die Stellen zu interessieren, an denen die Eisenstäbe in die Wand zementiert waren. Einer von den beiden hatte gerade mit beiden Händen das Gitter gepackt und rüttelte daran, um die Festigkeit zu prüfen. Ein anderer Mann mit einem kleinen blonden Schnurrbart stand über den Kamin gebeugt und starrte auf die staubigen Scheite. Am anderen Ende des Tisches stand ein dicker Mann im blauen Anzug und mit Derbymütze, die Hände in die Hüften gestemmt, und betrachtete die stumme Gestalt in dem Sessel. Seine harten, hellblauen Augen hatten sich leicht verengt. Er starrte angestrengt auf Bensons Leiche, als hoffte er, durch ausdauernde Konzentration hinter das Geheimnis des Mordes zu kommen.
Ein anderer Mann stand an dem rückwärtigen Fenster. Er hatte in das eine Auge eine Juwelierlupe geklemmt und studierte einen kleinen Gegenstand, den er in der Hand hielt. Ich hatte Fotos von ihm gesehen und daher wußte ich, daß es Captain Carl Hagedorn war, der berühmteste Feuerwaffenexperte Amerikas. Er war ein großer, breitschultriger Mann, ungefähr fünfzig Jahre alt, und sein schwarzer, glänzender Anzug war mehrere Nummern zu groß für ihn. Sein Kopf war rund und unnatürlich groß, und seine Ohren schienen in den Schädel eingesunken zu sein. Sein Mund war hinter einem struppigen, graumelierten Bart verborgen. Captain Hagedorn arbeitete schon seit dreißig Jahren mit der New Yorker Polizei zusammen, und wenn er auch wegen seiner Art und seines Aussehens bespöttelt wurde, war er doch ein Mann, der von allen Seiten respektiert wurde.
Im hinteren Teil des Raumes, nahe der Tür zum Eßzimmer, standen zwei Männer zusammen und unterhielten sich ernsthaft. Der eine war Inspektor William M. Moran, Hauptkommissar des Detektivbüros; der andere war Sergeant Ernest Heath von der Mordkommission, von dem uns Markham schon erzählt hatte.
Als wir mit Hauptkommissar O'Brien das Zimmer betraten, ließ jeder einen Augenblick lang von seiner Beschäftigung ab und sah den Staatsanwalt an, nicht mit Begeisterung, jedoch voller Respekt.
Inspektor Moran und Sergeant Heath traten vor. Nach kurzem Händeschütteln stellte Markham Vance und mich vor und erklärte, warum wir uns hier befanden. Der Inspektor verbeugte sich höflich und akzeptierte unser Eindringen, aber mir fiel auf, daß Heath Markhams Erklärungen völlig überhörte und uns auch weiterhin so behandelte, als ob wir gar nicht da wären.
Inspektor Moran unterschied sich von den anderen Leuten im Zimmer. Er war ungefähr sechzig Jahre alt, hatte weißes Haar, einen braunen Schnurrbart und war makellos gekleidet. Er wirkte eher wie ein erstklassiger Makler der Wall Street als wie ein Polizist.
»Ich habe den Fall Sergeant Heath übertragen, Mr. Markham«, erklärte er in tiefer, wohlklingender Stimme. »Es sieht so aus, als gäbe es einigen Ärger, bevor die Sache ausgestanden ist. Sogar der Hauptkommissar hielt es für notwendig, uns mit seiner Gegenwart moralische Unterstützung zukommen zu lassen, denn er ist schon seit acht Uhr früh hier.«
Inspektor O'Brien hatte uns gleich nach Betreten des Zimmers verlassen. Er stand jetzt zwischen den beiden Fenstern und sah dem Treiben mit ernstem, undurchdringlichem Gesicht zu.
»Nun, ich glaube, ich werde jetzt gehen«, setzte Moran hinzu. »Man hat mich schon um halb acht aus dem Bett geholt. Ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Jetzt, da Sie hier sind, werde ich sowieso nicht mehr gebraucht.« Man gab sich wieder die Hände.
Als er gegangen war, wandte sich Markham an seinen Assistenten: »Kümmern Sie sich um diese beiden Herren, ja, Dinwiddie? Sie kennen sich überhaupt nicht aus und wollen wissen, wie so eine Untersuchung durchgeführt wird. Erklären Sie ihnen alles.«
Dinwiddie nahm seinen Auftrag begeistert an.
Während wir drei uns rein instinktiv dem Ermordeten zuwandten – schließlich war er die Hauptperson dieses Dramas – hörte ich, wie Heath resigniert sagte: »Jetzt werden Sie wohl den Fall übernehmen, Mr. Markham.«
Dinwiddie und Vance unterhielten sich miteinander, und ich beobachtete Markham, nachdem was er uns über die Rivalität zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft erzählt hatte, mit großem Interesse.
Markham lächelte Heath höflich an und schüttelte den Kopf. »Nein«, entgegnete er, »ich bin hier, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Deshalb möchte ich auch, daß unser Verhältnis von vornherein geklärt ist. Ich wäre gar nicht da, wenn mich nicht Major Benson heute früh angerufen und darum gebeten hätte, daß ich mich persönlich um die Sache kümmere. Und ich möchte unbedingt, daß mein Name aus dieser Geschichte herausgehalten wird. Es ist leider ziemlich bekannt, daß der Major ein alter Freund von mir ist. Deshalb wird es viel besser sein, wenn meine Verbindung mit diesem Fall nicht an die große Glocke kommt.«
Ich konnte nicht verstehen, was Heath murmelte, aber er schien doch beruhigt zu sein.
»Wenn bei dieser Angelegenheit irgendwelcher Ruhm zu ernten ist«, fuhr Markham fort, »so wird ihn die Polizei bekommen; deshalb halte ich es auch für richtig, daß Sie sich mit den Reportern unterhalten. Und sollte es Schwierigkeiten geben«, fügte er gutmütig hinzu, »wird das ebenfalls eine Angelegenheit Ihrer Leute sein.«
»Das ist nur fair«, gab Heath zu.
»Also dann, Sergeant, gehen wir an die Arbeit«, sagte Markham.
3. Die Handtasche einer jungen Dame
Freitag, 14. Juni, 9.30 Uhr
Der Staatsanwalt und Heath gingen zu der Leiche und blieben davor stehen. »Sehen Sie«, erklärte Heath, »er ist genau von vorn erschossen worden. Es war ein Schuß von großer Wucht, denn das Geschoß ist am Hinterkopf wieder ausgetreten und gegen die Holzverkleidung dort drüben am Fenster geprallt.« Er wies auf einen Punkt in der Holztäfelung etwa eine Handbreit über dem Fußboden, nicht weit vom Vorhang des ersten Fensters entfernt. »Wir haben die Geschoßhülse gefunden und Captain Hagedorn hat die Kugel.«
Er wandte sich an den Feuerwaffenexperten. »Wie sieht es aus, Captain? Irgend etwas Besonderes?«
Hagedorn hob langsam den Kopf und sah Heath stirnrunzelnd an. Dann, nach einem Moment des Schweigens, antwortete er mit Bedacht: »Das Geschoß stammt aus einer fünfundvierziger Armeepistole, einem automatischen Colt.«
»Kann man schon sagen, wie nahe die Waffe an Benson herangehalten wurde?« fragte Markham.
»Jawohl, Sir, kann man«, antwortete Hagedorn in seiner bedächtigen Weise. »Wahrscheinlich zwischen fünf und sechs Fuß.«
Heath schnaufte. »Wahrscheinlich«, wiederholte er zu Markham gewandt. »Aber wenn es der Captain sagt, können Sie Gift darauf nehmen. Verstehen Sie, Sir, höchstens eine Vierziger oder Fünfundvierziger kann einen Mann aufhalten, und diese Stahlmantelgeschosse gehen durch einen menschlichen Schädel, als wäre er aus Butter. Aber wenn das Geschoß danach noch tief in das Holz da drüben eindrang, mußte die Mündung der Pistole schon sehr nah an ihrem Opfer sein; und da es andererseits keinerlei Pulverspuren im Gesicht gibt, kann man sich hundertprozentig auf die vom Captain angegebene Entfernung verlassen.«
In diesem Augenblick hörten wir, wie sich die Haustür öffnete und wieder schloß, und Dr. Doremus, der Gerichtsmediziner, kam in Begleitung von seinem Assistenten herein. Er gab Markham und Inspektor O'Brien die Hand und nickte Heath freundlich zu. »Ich konnte leider nicht eher kommen«, entschuldigte er sich.
Er war ein nervöser Mann mit stark zerfurchtem Gesicht. »Was haben wir denn hier?« fragte er sofort und machte ein angewidertes Gesicht beim Anblick der Leiche im Sessel.
»Das sollen Sie uns ja sagen, Doc«, gab Heath zurück.
Dr. Doremus ging auf den Toten zu, mit der Gleichgültigkeit, die man bei langjähriger Tätigkeit in seinem Beruf wohl automatisch bekommt. Zuerst untersuchte er eingehend das Gesicht des Toten. Ich glaube, er suchte nach Pulverspuren. Dann sah er sich das Einschußloch in der Stirn an und die zerfaserte Wunde am Hinterkopf. Er hob den Arm des Toten in die Höhe und beugte die Finger. Vorsichtig bewegte er den Kopf von einer Seite auf die andere. Als er sich sein Bild über das Stadium der Todesstarre gemacht hatte, wandte er sich an Heath. »Können wir ihn da drüben auf die Anrichte legen?«
Heath warf einen fragenden Blick auf Markham. »In Ordnung, Sir?«
Markham nickte, und Heath winkte den beiden Männern an den Vorderfenstern und befahl ihnen, die Leiche auf die Anrichte zu legen. Der Tote behielt seine sitzende Position bei – wegen der eingetretenen Muskelstarre nach dem Tode –, bis der Doktor zusammen mit seinem Assistenten mit sanfter Gewalt die Glieder ausstreckte. Dann zog man ihn aus, und der Doktor untersuchte den Körper sorgfältig nach anderen Verletzungen. Besonders eingehend befaßte er sich mit den Armen. Er öffnete auch beide Hände weit und erforschte eingehend die Handflächen. Schließlich richtete er sich wieder auf und wischte sich die Hände in einem großen Seidentaschentuch ab.
»Durch die linke Stirnhälfte erschossen«, erklärte er. »Genau von vorn. Die Kugel ging glatt durch den Schädel. Austrittswunde am linken Hinterkopf. Sie haben die Kugel ja sicherlich gefunden. Er war wach, als er erschossen wurde, und der Tod trat sehr plötzlich ein – wahrscheinlich wußte er nicht einmal, woher der Schuß kam. Der Tod ist eingetreten vor – sagen wir mal – acht Stunden; vielleicht auch schon eher.«