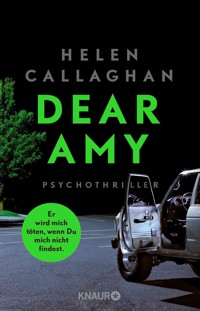0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mörderische Aussichten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Lieben Sie Nervenkitzel und Gefahr? Warten Sie bereits auf neue raffinierte Spannung von Val McDermid und ihrem Ermittlerduo Carol Jordan und Tony Hill? Trauen Sie sich mit S.K. Tremayne in die finsteren Abgründe des Dartmoors? Wollen Sie herausfinden welches dramatische Geschwister-Schicksal Mechtild Borrmann aus der deutschen Nachkriegszeit ans Licht bringt? Wollen Sie mehr über eine wahre Mordserie in Norddeutschland erfahren? Faszinieren Sie ungelöste Mordfälle, die ihre Schatten bis in die Gegenwart werfen? Oder ist es einfach mal wieder Zeit für eine Auszeit vom Alltag und damit für ein spannendes Buch? Hier sind Ihre mörderischen Aussichten – Nervenkitzel garantiert. Das kostenlose Leseproben eBook enthält Leseproben zu: - Helen Callaghan: »Lügen. Nichts als Lügen« - S.K. Tremayne: »Mädchen aus dem Moor« - Carine Bernard: »Lavendel-Tod« - Petermann/Fischer: »Die Elemente des Todes« - Oliver Ménard: »Der Kratzer« - Vanessa Savage: »Mörderhaus« - Chris McGeorge: »Escape Room« - Val McDermid: »Rachgier« - Joseph Knox: »Dreckiger Schnee« - Mechtild Borrmann: »Grenzgänger« - Kerstin Cantz: »Fräulein Zeisig und der frühe Tod«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Ähnliche
Möderische Aussichten: Thriller & Krimi bei Knaur
Ausgewählte Leseproben S.K. Tremayne, Val McDermid, Mechtild Borrmann, Axel Petermann / Claus Cornelius Fischer u.v.m
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
S. K. Tremayne
Mädchen aus dem Moor
Über das Buch:
Gruselatmosphäre auf dem Dartmoor – »Es gibt sie tatsächlich noch, diese Psychothriller, die einem förmlich das Blut in den Adern gefrieren lassen.« Booksection.de
Seit man ihr gesagt hat, sie habe im Dartmoor Selbstmord begehen wollen, scheint Kath Redways Leben langsam, aber sicher in einen finsteren Abgrund zu trudeln: An den Vorfall selbst kann sie sich nicht erinnern, auch die Woche davor scheint aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Kath glaubt, sie sei glücklich gewesen, doch verhält ihr Mann Mark sich nicht seltsam abweisend? Welches Geheimnis verbirgt ihr Bruder vor ihr? Und was treibt ihre kleine Tochter Lyla nachts draußen im Moor? Verliert Kath den Verstand – oder ist sie einer furchtbaren Wahrheit auf der Spur?
Adam, tief in Gedanken, folgte dem Weg schon seit zehn Minuten, als ihm aufging, dass er auf dem Lych Way war, dem alten Leichenweg. Der Name stammte aus der Zeit, als die Leute aus den Dartmoor-Dörfern die Särge mit ihren Toten noch zum offiziellen Kirchhof hatten tragen müssen, genau auf die andere Seite des Moors, nach Lydford.
Im Windschatten einer düsteren Kieferngruppe blieb er stehen und stellte sich das bildlich vor – ein paar abgerissene Kleinbauern, wie sie die Holzkiste von Bellevor Tor über den Cowsic Brook hievten, hügelan und hügelab über die kahlrasierten Kuppen, vorbei an Lynch Tor, über die Steinbrücke Baggator Clapper und zu den Cataloo Steps.
Und wenn der Fluss bei Cataloo viel Wasser geführt hatte? Was hatten sie gemacht? Bauchtief mussten sie, den Sarg über die Köpfe gestemmt, durchs eisige Wasser gewatet sein, bevor sie auf der Corps Lane weitergehen konnten nach Willsworthy. Alles, um ihre Toten zur letzten Ruhestätte zu bringen.
Zwanzig Kilometer weit hatten sie die Leichen geschleppt. Zwanzig elende Kilometer.
Im Weitergehen spähte er zum Horizont, hielt nach Tieren Ausschau, suchte Trost in der Natur. Als er die nächste Anhöhe erreichte, sah er einen Turmfalken am weißen Winterhimmel schweben. Unwillkürlich blieb er stehen, um die Kunstfertigkeit zu bewundern, das leichte Zittern der Federspitzen, den majestätischen Flug.
Windbespringer hatte sein Onkel sie genannt. Wenn Turmfalken in ihrem Rüttelflug an einer Stelle verharrten, sah es aus, als wollten sie den Wind bespringen – ihn beherrschen –, dann folgte der Sturzflug, das plötzliche Herabstoßen auf eine Beute, und schon waren sie weg.
Schließlich ging er weiter, immer noch auf dem Lych Way, dem alten Leichenweg. Irgendwo hier musste das Kreuz sein, nicht weit von den Siedlungen aus der Eisenzeit.
Wir haben ein beschädigtes Steinkreuz gesehen. An der Straße nach Sittaford. Vandalismus, hatten die Wanderer im Büro mitgeteilt.
Aber es fiel ihm schwer, sich auf seine Arbeit als Ranger zu konzentrieren. Seine Stimmung war düsterer als die Kiefern. Er tat, was er konnte, aber an diesem Tag kam er auch auf dem Dartmoor nicht auf andere Gedanken. Die Menschenwelt zwängte ihn ein; er hatte keine Gewalt über das, was er für seine Frau empfand, diesen Groll, den er – aus Vernunft und um seiner Tochter willen – so verzweifelt zu verbergen suchte. Wie sollte er dieses Gefühl denn verbergen? Was sie getan und was sie gesagt und was sie ach so bequem vergessen hatte – wie sollte er damit fertigwerden und noch so tun, als spiele es keine Rolle?
Er hatte nie etwas anderes gewollt als dieses Leben: seine Familie lieben und in seiner Arbeit aufgehen, sich um das Moor kümmern, die Hecken in Schuss halten, Touristen helfen, die Bussarde über Sourton Down beobachten – und normalerweise war er glücklich. Sie waren alle glücklich gewesen. Aber nun ging seine Familie in die Brüche.
Als er an einen Zaunübertritt kam, hielt Adam kurz inne, dann sprang er hinüber und atmete einmal tief durch, bevor er, das Karomuster aus Koniferen-Schonungen hinter sich lassend, weiterging. Er versuchte, nicht an seine Familie zu denken, weder der Verzweiflung nachzugeben noch der wachsenden Abneigung, die auch noch sein Gewissen belastete. Er liebte und begehrte seine Frau, und trotzdem empfand er ihr gegenüber einen brennenden Zorn.
Lyla. Was machte das alles mit seiner Tochter Lyla?
Er schloss kurz die Augen, um sich zu beruhigen, und dann konzentrierte er sich wieder auf die Landschaft.
Zu seiner Linken erstreckte sich die grelle Grasnarbe auf einem Sumpf, Sprenkel nassen, giftigen Grüns, das im Licht der plötzlich durchbrechenden Wintersonne blitzte. Ihm kam eine Erinnerung: Er war acht gewesen oder neun und hatte neben seinem Onkel Eddie gekauert, um eine Schnepfe zu beobachten, die ihr Hochzeitskleid zur Schau stellte. Blitzschnell war der Vogel steil in den Himmel gestiegen und hatte dann im Herunterstoßen, die Flügel kaum ausgebreitet, seinen Schwanz ausgestellt. Dabei war jenes seltsame Geräusch entstanden, dieses traurige Surren der ausgebreiteten Schwanzfedern beim Sturzflug. Einmal gehört, nie vergessen.
Und wenn sie nach solchen Tagen, an denen er Vögel und Felsen und Bäche kennengelernt hatte, auf dem Heimweg waren, hatte sein Onkel ihm die alten Moorland-Wörter beigebracht: Dimmity bedeutete Zwielicht. Owl-light eine besonders düstere Abenddämmerung. Ein radjel war eine Anhäufung aufgetürmter Steine. Spuddle bedeutete herumalbern, ein tiddytope war ein Zaunkönig, ein gallitrop ein Feenring.
Appledrain hieß Wespe. Herrlich.
Moor-gallop: wenn Wind und Regen über das Hochmoor jagten. Drix: morsches Holz. Ammil: die dünne, silbrige Eisschicht, die Blätter, Zweige und Grashalme überzog, wenn auf trügerisches Dartmoor-Tauwetter strenger Dartmoor-Frost folgte, wie ein Eissturm, nur feiner. So genau mussten die Bauern sein; sie brauchten noch für die schönste und ungewöhnlichste Erscheinungsform von Frost, Tau und Eis ein eigenes Wort. Von dieser Genauigkeit hingen Leben ab: Man musste wissen, wann es Zeit war, das Vieh zusammenzutreiben, den Ponys Obdach zu gewähren, sich um die Ernte zu kümmern, die Lämmer, die noch gesäugt wurden, zu versorgen.
Der nächste, noch höhere Zaunübertritt. Er hielt die Luft an, bevor er hinüberkletterte, dann blieb er stehen und schaute zum Horizont.
Jeden Quadratmeter, jeden Hektar. Er hatte das alles so oft gesehen und liebte es immer noch. Im Herbst beim Steeperton Tor die Moorhühner, die sich an Heidekraut und Heidelbeeren satt fraßen. Die sumpfigen Lichtungen mit dem Bruchwald und den Sanddornbüschen, zu denen die gelben Schmetterlinge – Vorboten des späten Dartmoor-Frühlings – kamen, um ein Festmahl zu halten. Die Höhlen in den Cuckoo Rocks, in denen einst die Schmuggler ihren Brandy versteckt hatten. Und das weite, karge Land bei Langcombe, wo er im Sommer gern herumstrich; wo man sich vorstellen konnte, der einzige Mensch auf Erden zu sein; endlose Flächen aus sich sanft wiegendem Gras und Ried um einen her, kilometerweit nichts, kein Mensch weit und breit, nichts zu tun, sengende Sonne und kein anderes Geräusch als das Sirren und Brummen von Insekten – das und die still dahingleitenden Wolken und der eigene Herzschlag.
Das waren vielleicht seine glücklichsten Augenblicke; die und die Zeit, die er mit Lyla draußen verbrachte. Wenn er seiner Kleinen etwas über Raben und Felsenkessel erzählte, über Libellen und violette Orchideen. Sie liebte das Moor genauso wie ihn. Ewig konnten sie an sonnigen Tagen draußen sein, den Abbot’s-Weg hinuntergehen bis nach Rundlestone oder bei der Ruine, die Königsofen genannt wurde, nach der alten Zinnschmelze suchen, oder oben bei Dunstone und den Shilstone Rocks Blaubeeren naschen, bis Finger und Lippen lila und die Zähne rosa waren, und darüber lachen – und dann, wenn der Tag sich neigte, wohlig erschöpft heim nach Huckerby fahren, dann hatte Kath bei einem Supermarkt haltgemacht, und sie saßen zusammen bei Tee und einem Teller mit Früchtekuchen und waren glücklich und zufrieden. Und Lyla legte auf dem Küchentisch Muster aus den hübschen Blütenblättern, die sie unterwegs gesammelt hatte. Schöne, komplexe Muster, die nur sie verstand. Oder Muster extra für Papa.
Was für glückliche Zeiten.
Jetzt war alles anders. Jetzt war Lyla verwirrt und ängstlich und traurig und sträubte sich oft, wenn er – ihr Vater! – sie in den Arm nehmen wollte, wie er es immer getan hatte. Neuerdings starrte sie ihn manchmal an, als ob er irgendwas falsch gemacht hätte, und das alles wegen Kath und ihrer Familie, diesen Kinnersleys. Und dann wieder kam Lyla vorm Schlafengehen zu ihm und drückte ihn so fest, so verzweifelt, als habe sie Angst, dass auch er über Nacht verschwinden könnte – wie ihre Mutter es um ein Haar getan hätte.
Das war nicht gut. Er versuchte, die gefährliche Gedankenspirale aus dem Kopf zu kriegen. Es war, als würden sie alle in ein Dartmoor-Sumpfloch gezogen, Dead Lake, Fox Tor, Honeypool: Je mehr sie kämpften, um sich zu befreien, desto tiefer versanken sie in Frust und Zorn. Das Beste war, sich zu beruhigen. Es nicht noch schlimmer zu machen. Nichts zu überstürzen.
Nun sah er das alte Kreuz. Einen Meter hoch, mit einer verwitterten, flechtenbewachsenen grün-grauen Granitscheibe obenauf. Anglokeltisch vielleicht, um die tausend Jahre alt oder noch älter. Jemand hatte es gerammt und umgestoßen, irgendein Idiot in einem SUV, betrunken oder bekifft, der offroad gefahren war und sich einen Spaß daraus gemacht hatte. Die Steinscheibe hatte Risse und war an einer Seite zersplittert. So viele Jahrhunderte hatte sie überstanden, und jetzt war sie massiv beschädigt, vielleicht irreparabel. Hier war etwas Gutes gestorben.
Adam kniete sich neben den alten Stein und strich über den Granit, als handele es sich um die Mähne eines verletzten Ponys. Spürte die kratzigen Flechten unter der Hand, empfand eine große Hilflosigkeit. Und sträubte sich gegen noch mehr vergebliche Emotionen. Versuchte, praktisch zu denken.
Er rieb die rauen Hände gegeneinander, um die Kälte abzuwehren, richtete sich auf und machte sich auf den langen Weg zurück zu seinem Land Rover. Noch unterwegs traf er eine Entscheidung. Wie schwierig es auch sein mochte, sie würden versuchen, es zu reparieren. Denn das war sein Job: diesen kostbaren Ort zu bewahren, von den antiken Funden über die Landschaft bis hin zu den schnatternden Wacholderdrosseln auf der Soussons-Farm. So viel wie möglich davon zu bewahren und der nächsten Generation zu übergeben. Lyla und Lylas Kindern.
Er würde die Archäologen in Exeter anrufen und bitten, einen Fachmann zu schicken. Ja. Es konnte gerettet werden.
Wenn es nur mit der Liebe auch so wäre, dachte er, während er den Leichenweg hinunterging. Wenn sie wieder aufgerichtet und restauriert werden könnte. Aber waren Loyalität und Verlässlichkeit einmal über den Haufen geworfen, war eine Familie erst mal angeschlagen, dann war’s das wohl. Und wurde die Liebe von Argwohn abgelöst, oder gar von Verachtung – was wurde dann aus einem? Wo trieb einen das hin? In welchem finsteren Wald wachte man auf? Vielleicht führte der Weg, den man einschlug, einen immer tiefer hinein ins Dunkle?
Fast hatte er den Land Rover erreicht, als er noch einen Turmfalken sah; eingerahmt von den blassgrünen Hügeln der Hurston-Ridge-Steinreihen schwebte er am Himmel. Der Vogel war so schön, er war perfekt; leicht zitternd stand er in der Luft und tat genau das, weswegen er hergekommen war. Er zitterte vor Entschlossenheit, aus dem unwiderstehlichen Drang heraus, zu töten. Zu überleben.
Was hatte Kath an jenem Abend gemacht? Und an all den anderen Abenden, an denen er nicht da gewesen war? Die Frage war ebenso bedrohlich wie unumgehbar. Wenn er die Antwort hatte, würde er Kaths Schuld ermessen können – und ihre Ehe war am Ende. Bekam er die Antwort nicht, würden ewig Misstrauen und Zorn in ihm brodeln – und ihre Ehe war am Ende.
So oder so würde Lyla die Mutter verlieren. Also sollte er es lieber auf sich beruhen lassen, aber das konnte er nicht. Er liebte sie, er hasste sie, er liebte sie, er hasste sie. Dieser Gefühlswirrwarr glich einem nassen Moorlandfeuer, das mehr Rauch hervorbrachte als Wärme; es nahm ihm die Luft. Es tötete die Hoffnung, es erstickte alles.
Als er die Autotür öffnete, ging ihm durch den Kopf, was sein Onkel über die Wildheit des Dartmoors gesagt hatte, wenn sie Widder kastriert und schreiende Kühe enthornt und ängstlich blökende Ochsen zum blutnassen Schlachthof gebracht hatten, wo ganze Bäche von Blut, glänzend wie Lack, Strudel von Scharlach- bis Dunkelrot gebildet hatten.
Das Moor ist schön, Junge, weil es gefährlich ist.
Heute ist schon wieder Fortbildung. Die Lehrer der Princetown Primary werden geschult, und die Kinder haben einen Tag frei. So was kommt ziemlich häufig vor, und es bedeutet jedes Mal, dass einer von uns – Adam oder ich – zu Hause bei Lyla bleiben muss. Eins-zu-eins-Betreuung. Das ist immer intensiv, denn Lyla hat keine richtigen Freunde; Verabredungen zum Spielen kommen also nicht infrage.
Trotzdem freue ich mich normalerweise über die Gelegenheit, etwas mit ihr zu unternehmen. Mit ihr aufs Moor rauszufahren oder, im Sommer, schwimmen zu gehen, oder, im Herbst, zum Reiten. Aber heute ist es feucht und sehr kalt. Gut möglich, dass es noch schneit.
Und in Gedanken bin ich sonst wo, was Lyla vielleicht spürt. Mich beschäftigen die Hexensteine, die vor unserem Bürofenster abgelegt worden sind. Kann sein, dass tatsächlich ein Wanderer sie dort deponiert und dann vergessen hat. Kann sein, dass Kinder sich einen Spaß gemacht haben. Aber hat derjenige, wer immer es war, gewusst, dass diese Steine als Hexen-Bannmittel gelten? Und warum gerade vor meinem Büro?
Während ich gedankenverloren das Frühstücksgeschirr spüle, tritt meine Tochter gegen das Tischbein. Tack-tack-tack. Tack-tack-tack. Sie fordert die Aufmerksamkeit ihrer Mutter.
Und die steht ihr zu.
»Mami? Was wollen wir machen?«
»Ich weiß nicht, Süße, es ist scheußlich draußen. Irgendwas Indoor-mäßiges? Schloss Drogo besichtigen?«
Tack.
»Dort ist es schön, aber die erlauben keine Hunde. Können wir bitte was anderes machen?« Sie schaut mich sehnsüchtig an. »Mit Felix und Randal?«
Ich überlege angestrengt. Man braucht nur eine gute Karte anzuschauen oder einen Reiseführer, da findet man unzählige verlockende Orte auf dem Dartmoor, Orte, deren Name schon märchenhaft klingt – die Verlorenen Kreuze, Hameldown-Dolch, Quintin’s Man –, aber heute locken sie mich alle nicht. Trotzdem muss für Lyla etwas passieren. Ich will nicht, dass sie den ganzen Tag allein zubringt und sich in Büchern verliert. Nicht schon wieder.
Eine Idee nimmt Gestalt an.
»Ich weiß«, sage ich und schaffe es, zu strahlen. »Wir fahren raus und schauen uns Steine an.«
Ihre Miene hellt sich auf. Sie liebt die alten Steinkreise und Menhire.
»Merrivale? Scorhill?«
»Nein.« Ich mache es ein bisschen spannend. »Welche, die du noch nicht kennst.«
Jetzt strahlt sie. »Wo? Sag’s mir!«
»Nö.«
»Sag schon, Mami!«
»Du machst dich fertig, ich packe uns ein kleines Picknick ein, und dann gehen wir auf Überraschungsfahrt. Zieh deine Stiefel an und den Mantel. Ansonsten kannst du so bleiben.«
Meine Tochter schaut an sich hinunter: Sie hat schwarze Jeans an, ein graues Hemd und darüber einen gelben Pullover. Mit den Farben geht es bei ihr oft wild durcheinander; ich bin nicht sicher, ob sie weiß, welche Sachen zusammenpassen und welche nicht, aber sie kann fast alles tragen, so ähnlich, wie sie ihrem Vater sieht mit den blauen Augen, den hohen, slawisch anmutenden Wangenknochen, der hellen Haut und dem tiefdunklen Haar. So schön. Ich weiß noch genau, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, im Pub, ich war siebzehn, und seitdem liebe ich ihn, den Jungen mit den blauen Augen, der mir die Tochter mit den blauen Augen geschenkt hat. Adam Redway, mein Jugendschwarm.
»Muss ich die Stiefel? Ich will keine Gummistiefel. Die kratzen.«
»Doch, musst du. Bei den Sümpfen ist es nass und matschig. Also los, hol dein Zeug, ich mache uns schnell ein paar Brote.«
»Erdnussbutter? Also ist es ein besonderer Anlass!«
Ich muss lachen. Lyla muss lachen. Wir nehmen auf jeden Ausflug Erdnussbutterbrote mit, so unweigerlich, dass es schon zum Familienwitz geworden ist. Lyla springt auf, rennt los und ruft ins Wohnzimmer, wo die Hunde liegen und dösen: »Felix! Randy! Wir gehn raus! Eine ganz große Runde!«
Gleich darauf höre ich sie die Treppe hinaufstampfen und die Hunde hinterherjagen; eifrig klicken die Klauen auf den Holzstufen.
Es dauert kaum zehn Minuten, bis ich etwas Proviant in eine Tüte gepackt und den Rucksack in den Kofferraum gestellt habe; die Hunde springen auf die Rückbank und postieren sich links und rechts von Lyla, während ich den Motor anlasse. Wir machen uns einen schönen Tag, heute mal nicht auf der Huckerby Farm. Mein Ziel sind die Grey Wethers, zwei geheimnisvolle Steinkreise am äußersten östlichen Rand des Moors. Allein dorthin zu kommen wird schon ein Abenteuer. Wir werden den ganzen Tag brauchen. Und es wird trotz Kälte und trübem Licht ein guter Tag sein: draußen, mit den Hunden.
Als ich wende, sagt Lyla von hinten: »Weißt du, Mami … ich hab einen Mann gesehen.«
Ich zuckele über den schmalen Weg zur Einmündung in etwas, das in den entlegenen Teilen des Dartmoors als Straße durchgeht. »Was sagst du, Süße?«
»Ich hab einen Mann gesehen.«
Alles in mir spannt sich an. Ich drossele das Tempo, um meine Tochter besser verstehen zu können. »Wann? Was für einen Mann?«
Ich suche ihren Blick im Rückspiegel, doch sie beugt sich über Felix und krault ihn hinter dem Ohr. Lange sagt sie gar nichts.
»Lyla?«
Mit vielleicht zehn Stundenkilometern fahre ich durch den winterlichen Dartmoor-Matsch, über winzige mittelalterliche Brücken, die nie für Autos gedacht waren.
Endlich: »Es war ein Mann, den du kennst. Ich hab ihn auf Huckerby gesehen. In der Nähe von Huckerby.«
Wen meint sie? Es scheint wichtig zu sein, aber ich weiß nicht, warum. Im Prinzip kann sie jeden meinen; vielleicht hat sie auch geträumt.
»Wann, Lylamaus? Und wie sah der Mann aus?«
»Zwei- oder dreimal. Ich weiß nicht. Er war weit weg. Er sah …« Sie windet sich. »Ein bisschen sah er wie Papa aus. Sehr wie Papa. Und ich glaube, er war an dem Abend da, als du in …« Jetzt wird ihre Stimme dünn. »An dem Abend. Als du mich bei Tante Emma gelassen hast.«
So nennt sie unsere Nachbarin, Emma Spalding. An dem Tag, an dem ich abends mit dem Auto auf eine Eisplatte geriet und in den See gestürzt bin, musste ich länger arbeiten; deshalb hat Emma auf Lyla aufgepasst. Emma ist wie eine Tante oder wie die Großmutter, die Lyla nie hatte. Adams Mutter ist schon vor Jahren gestorben, und meine Eltern sind beide nicht mehr.
Wir fahren weiter. Die Straßen versinken in Matsch und altem Laub. Was genau hat Lyla gesagt? Dass sie einen Freund von mir gesehen hat – an jenem Abend und auch danach noch. In der Nähe von Huckerby? Oder meint sie tatsächlich Adam? Ausgeschlossen. Mein eigener Mann verfolgt mich doch nicht. Aber vielleicht jemand, der ihm ähnlich sieht? Harry? Oder einer von seinen zahlreichen anderen Cousins? Redways gibt es übers ganze Moor verstreut.
Aber warum sollte überhaupt irgendwer mich verfolgen?
Meine Hände, die das Lenkrad fest umklammern, werden plötzlich müde. Ich fahre langsamer und blicke starr geradeaus. Versuche zu verstehen.
Die Bäume biegen sich im Wind, Fetzen von grauem Moos flattern ihnen voraus. Vögel sitzen zwischen die kahlen Zweige geduckt. Die einzige Farbe in all dem eintönigen Grau liefern die zitternden gelben Stechginsterbüsche.
Lylas Gesicht im Rückspiegel sieht aus wie festgefroren. Ich kenne diesen Zustand: Sie will nicht reden. Schlimmstenfalls verfällt sie in totales und anhaltendes Schweigen. Selbst gewähltes Stummsein. Auch ein Asperger-Symptom. Aber jetzt lasse ich das nicht zu.
»Das ist wichtig, Lyla. Du sagst, du hast jemanden gesehen, den ich kenne.«
Schweigen.
Wir biegen in die Hauptstraße Richtung Widecombe und Fernworthy ein. Hier kann ich schneller fahren und bremse doch gleich wieder. Zu beiden Seiten der Fahrbahn stehen Moorland-Ponys. Der Wind zaust die vollen schwarzen Mähnen. Wenn sie so dastehen, kommen sie mir immer vor wie die Wächter des Moors, als verkörperten sie den wahren Geist dieser Gegend.
»Lyla? Bitte.«
Nichts.
»Lyla …«
»An dem Tag, an dem du mich zurückgelassen hast.« Jetzt sucht ihr bohrender Blick im Spiegel meinen. »Als du mich alleingelassen hast. Das musst du doch noch wissen.«
Und sofort erstarrt ihre Miene wieder. Sie ist blass und sieht zornig aus. Ich weiß, wenn ich jetzt auch nur noch eine Frage stelle, wird sie stunden-, wenn nicht tagelang kein Wort mehr sagen. Oder eine Woche lang. Dabei kann ich mich kaum bremsen, sie weiter auszuquetschen. Worum geht’s? Was genau ist es, das sie sagen will und scheinbar nicht kann? Ist es so unaussprechlich, dass sie es nicht über die Lippen bringt?
Was sie bereits gesagt hat, ist schon schmerzlich genug. Offenbar gibt sie mir die Schuld an dem Unfall. Ich konnte nichts dafür, will ich ausrufen.
Da trabt schon wieder ein Pony über die Straße. Ich mache eine Vollbremsung. Sich unserer Nähe nicht bewusst, wie in einer anderen Welt, trottet es noch ein Stück am Straßenrand entlang, galoppiert schließlich davon und verschwindet hinter der nächsten Hügelkuppe. Die Mähne fliegt wie eine dunkle Flamme hinter ihm her.
Das Bild erinnert mich an meine Tochter, wie sie bei Wind und Wetter mit wehendem schwarzem Haar mit den Hunden herumtollt. Allein mit ihren Gedanken und Träumen, geheimnisvoll wie das Wetter jenseits der Haytor Rocks.
Eine Stunde sind wir bis hierher gelaufen, erst durch die Kiefernschonungen von Fernworthy, dann über freies braunes Moorland.
»Da«, sage ich.
»Wo?«
Ich zeige auf Grey Wethers, die beiden Steinkreise, die, noch kaum auszumachen, an einem Abhang stehen und ins Weite zu schauen scheinen. Grey Wethers ist einer meiner Lieblingsorte auf dem Dartmoor: Dieser stille doppelte Kreis – errichtet vor dreitausend Jahren von Menschen, die eine Landschaft zu nutzen und auf sie einzugehen wussten, um sie zu schmücken, nämlich mit einfachen Ringformen aus braunem Moorlandstein – hat etwas Poetisches.
Für mich ist Grey Wethers so schön wie ein Palast oder Schloss. Ich komme nur deshalb nicht öfter her, weil man einen so weiten, langweiligen Fußweg zurücklegen muss, durch endlose Kiefernpflanzungen und dann über matschigen Boden, wo die Stiefel unverhofft in überwucherten Pfützen versinken und man sich an Felsbrocken die Schienbeine aufschürft.
»Wie findest du es?«, frage ich. »Schön, oder?«
Ich forsche in ihrem ausdruckslosen Gesicht nach einem Hinweis. Wen hat sie auf Huckerby gesehen? Wenn es wirklich jemand war, den ich kenne, dann ist das Ganze umso seltsamer. Ich habe hier in der Gegend kaum Freunde, und schon gar keine männlichen; meine alten Studienfreunde leben fast alle in London, einige auch über den Erdball verteilt.
Also muss sie einen Verwandten meinen. Und da kommen nicht viele infrage. Mein Bruder wohnt unten in Salcombe, im Haus meiner Mutter. Es ist uns ganz recht, dass wir nicht so dicht beieinander hocken; so zanken wir uns weniger. Und mein Vater – der ist lange tot.
Es läuft also auf jemanden hinaus, der aussieht wie Adam, wie Lyla gesagt hat. Der Mann auf dem Moor. Kann es doch Adam selbst gewesen sein?
Nein, absurd.
Schweigend gehen wir auf die Steinkreise zu. Die Hunde toben voraus, und ausnahmsweise scheint Lyla sich nicht für ihre Erkundungen zu interessieren.
Stattdessen späht sie, die Stirn leicht gerunzelt, erst zu den Steinen, dann zum Horizont. Irgendetwas nimmt sie wahr. Schließlich geht sie in die Mitte des näher gelegenen Kreises. Setzt sich hin.
»Ist alles in Ordnung?«
Sie nickt. Ich lasse mich im Schneidersitz neben ihr nieder. Der kalte Wind hat sich gelegt, und ein schwacher Strahl Januarsonne bohrt sich durch die Wolkendecke. Das Gras ist sehr trocken. Offenbar hat es hier schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Das Wetter auf dem Dartmoor ist seltsam. Adam sagt, an manchen Julitagen kann er Touristen zu einem Plätzchen am Fluss führen, wo sie sich sonnen können, dann steigt er einen Hügel hinauf und gerät in ein Schneetreiben, und wenn er wieder ins Tal kommt, sind die Kinder immer noch beim Baden und spielen in der Sonne.
»Wollen wir ein Brot essen?«
Lyla gibt ein leises bitte von sich. Ich nehme den Rucksack ab und fische die Brotbox heraus, und eine Weile sitzen wir einträchtig schweigend da, essen unsere Erdnussbutterbrote und lauschen dem sanften Rauschen des Windes im Ried und dem Plätschern eines kalten Wasserlaufs irgendwo weiter weg. Auch die Hunde höre ich; ausgelassen toben sie über den nächsten Hügel, jagen Kaninchen oder Feldhasen. Oder wühlen menschliche Gebeine aus einer Steinzeit-Grabstätte. Steinkisten. Darin finden sich uralte Skelette, grausam gekrümmt und zusammengepresst, damit sie überhaupt da hineingepasst haben: die Knie unterm Kinn, als sei die Bestattung selbst noch eine Folter gewesen. Vielleicht haben sie damals auch Leute lebend begraben. Genau weiß das niemand.
Lyla lässt die Hand mit dem Brot sinken und sagt: »Tut mir leid, dass ich das mit dem Mann gesagt habe. Ich glaube, ich habe niemanden gesehen. Entschuldige, Mami. Mir war unheimlich.«
»Ach … aha.«
Es wird immer wirrer. Manchmal fürchte ich, irgendwann aufzuwachen und festzusitzen; gefangen zu sein im Reich der Absonderlichkeit. Aber Lyla steht noch unter Schock. Ihre Mutter wäre beinahe gestorben – kein Wunder, dass sie verwirrt ist.
Sie beißt von ihrem Brot ab und kaut gründlich. Dann sagt sie: »Es ist schön hier. Es gefällt mir, dass es so still ist. Und der Wald da drüben gefällt mir. Steinkreise gefallen mir immer.«
»Das freut mich.«
»Ich mag Scorhill und Totterton und Sourton und Buttern Hill und Mardon, alle, aber das sind nicht die besten. Weißt du, welchen ich am liebsten mag?«
»Nein …« Ich knülle die Folie zu einer Kugel zusammen und lege sie in die Brotbox. »Sag’s mir.«
»Merrivale!« Jetzt strahlt sie.
Ich erwidere das Lächeln. Bei Merrivale waren wir schon mehrmals, das ist auf jeden Fall einer ihrer Lieblingsplätze. Merrivale mit seiner Steinkiste und den Steinreihen auf dem kahlen, zugigen Abhang.
»Warum magst du Merrivale?«
»Weil es früher Pestmarkt hieß. Das habe ich gelesen. Weißt du, wo der Name herkommt? Ich musste es nachschlagen.«
»Nein.«
Sie schaut mich mit großen Augen an. »Als der Schwarze Tod hier umging, haben die Leute Essen in den Steinkreis gelegt. Und ein bisschen später sind die anderen gekommen, die Leute von der Küste, die die Pest schon hatten, und haben das Essen genommen. Zum Bezahlen haben sie Gold und Silber in einen Trog mit Essig getan, und dann sind sie wieder gegangen. So haben sie versucht, es zu verhindern. Dass der Schwarze Tod sich weiter ausbreitet.« Sie blinzelt kurz und fährt fort: »Gut, oder? Ein Markt extra wegen der Pest. Hier zwischen den Steinen, damit die Leute sich nicht treffen mussten. Die haben sich nie gesehen. Ein bisschen, als wären sie alle Geister. Und dann das viele Gold und Silber in dem Essig.« Stirnrunzelnd spielt sie mit einem Grashalm. »Aber … es hat nicht geklappt. Jedenfalls hab ich das gelesen. Der Schwarze Tod hat sich trotzdem auf dem ganzen Moor ausgebreitet. Die Leute sind alle gestorben. Es hilft noch nicht mal, das Gold in Essig zu legen. Alle sterben.«
Der Wind trägt den Duft von frisch geschlagenen Kiefern zu uns herüber. Ich weiß nicht, ob ich von Lylas langem Monolog – einem ihrer typischen Asperger-Vorträge – irritiert sein oder mich darüber freuen soll, dass sie überhaupt mit mir spricht.
»Bist du fertig mit trinken?«
Sie nickt und drückt mir den leeren Saftkarton in die Hand.
»Danke, dass du mit mir hergekommen bist.«
»Na, hör mal, das ist für mich genauso schön! Ich mag die Steinkreise auch sehr. Genau wie du.«
Sie nickt und schüttelt gleichzeitig den Kopf.
»Was ist?«
»Aber du hast dich geirrt, Mami. Geirrt.«
»Wieso? Womit habe ich mich geirrt?«
»Du hast gesagt, ich wär noch nie hier gewesen. Aber ich war schon mal hier. Genau hier, bei den Grey Wethers. Ich erinnere mich daran.« Während sie spricht, fegt sie nicht vorhandene Brotkrümel von ihren Hosenbeinen. Noch mal und noch mal. »Ich war schon mal hier. Mit Papa und dir.«
Sanft erwidere ich: »Nein, Süße, du warst noch nicht hier, jedenfalls nicht mit mir. Vielleicht mal mit Papa oder mit Onkel Dan, aber mit mir nicht.«
Lyla schüttelt den Kopf. Hört auf zu fegen. »Ich war hier. Du hast es vergessen.«
»Nein, Süße, ich …«
Und jetzt fällt es mir ein. »Doch, natürlich … o Gott«, murmele ich. Lyla hat recht. Sie war schon hier. Adam hat mich hergeführt, um mir Grey Wethers zu zeigen, und ich hatte Lyla im Tragegestell auf dem Rücken. Sie war neun Monate alt.
Für einen Moment bin ich sprachlos.
Ich weiß, dass meine Tochter – wie viele andere, die sich im gleichen Bereich des Spektrums bewegen wie sie – in der Lage ist, sich an Dinge zu erinnern, die normalerweise weit außerhalb des menschlichen Erinnerungsvermögens liegen, aber es überrascht mich immer wieder. Und es freut mich. Sie hat Schwierigkeiten, aber sie hat auch besondere Gaben. Und das, so irritierend es auch sein mag, ist eine davon.
Lyla steht auf. Das Picknick ist vorbei. Wir machen uns auf den Weg zurück zum Auto.
»Hat’s dir gefallen?«
»Ja. Danke, Mami. Guck, da sind Felix und Randal. Wir haben doch noch Brote übrig! Wollen wir ihnen die geben? Bitte!«
Die Hunde kommen über braunes, windgepeitschtes Gras auf uns zugeprescht. Lyla holt die Box aus dem Rucksack, wickelt die letzten Brote aus und verteilt sie. Die beiden stürzen sich darauf, als hätten sie seit Welpentagen nichts mehr zu fressen gekriegt. Sicher wäre ihnen frisches Fleisch lieber, aber aus Lylas Hand würden sie auch Sand und Kies fressen: Sie sind ihr vollkommen ergeben.
Unser langer, kalter Fußmarsch zum Auto verläuft still, die Fahrt nach Huckerby verläuft still, alles ist still – bis Lyla anderthalb Kilometer vor zu Hause fragt, ob wir noch zum Hobajob-Wald fahren können. Auch ein Lieblingsplatz von ihr: Da findet sie seltene Gewächse – Augentrost und Schachblumen – oder die schillernden Panzer namenloser blauschwarzer Käfer. Blumen und Insekten und verwitterte Tierkrallen.
Ich schaue in den Winterhimmel hinauf. »Es wird schon dunkel, Süße. Wir müssen zusehen, dass wir nach Hause kommen.«
»Ach bitte, Mami! Wir sind so nah dran.«
»Hm.« Der Tag war schön. Einer meiner besten seit dem Unfall. Plötzlich schwelge ich in reinem Mutterglück. Warum soll ich ihr nicht die Freude machen? »Na gut. Aber nur für ein paar Minuten. In einer halben Stunde ist es stockfinster.«
Ich parke in einer Haltebucht, und wir stapfen durch das kalte Tal zu dem dichten Wald aus krummen, moosbehangenen Eichen, die sich in den fahlen Winterhimmel zu krallen scheinen. Hobajob’s Wood ist wie eine Miniaturausgabe des berühmten Wistman’s Wood weiter oben auf dem Moor. Vielleicht nicht ganz so gespenstisch-märchenhaft, aber auch nicht ganz so touristisch. Versteckt eben.
Unser Geheimnis.
Die Hunde laufen voraus, setzen federleicht über große Felsbrocken. Sie kennen den Weg, und es sieht aus, als witterten sie einen Dachs oder Fuchs. Suchend klopfe ich meine Taschen ab; wünschte, ich hätte eine Taschenlampe dabei. Noch zwanzig Minuten, dann ist das Tageslicht weg. Angst kriecht in mir hoch. Ich will nach Hause. Mich vor ein schönes, prasselndes Kaminfeuer setzen. Das bisschen Milde, das der Tag zu bieten hatte, ist verflogen.
Vor uns liegt eine bitterkalte Winternacht auf dem Moor.
Wir sind zwischen den Bäumen angelangt. Kalte Zweige scharren über meinen Anorak. Es muss jetzt unter null Grad sein: Die ewige Dartmoor-Feuchtigkeit wird im Hobajob’s Wood zu gnadenlosem Frost. Zweige und Laub knistern und knarren unter unseren Schritten. Lyla ist nur darauf aus, die Hunde nicht aus den Augen zu verlieren; sie folgt ihnen zu der kleinen Lichtung mitten im Wald, wo sie immer ihre Schätze findet. Möglich, dass dort in der Steinzeit – vor Tausenden von Jahren – eine Behausung stand. Oder es war eine Grabstätte. Das weiß niemand.
Wir müssen eine Abtrennung überwinden, eine kleine Mauer, die zweihundert, aber auch zweitausend Jahre alt sein könnte, danach geht es ein Stück hügelan, und dann senkt der Boden sich zur Lichtung hin wieder ab. Käfig im Käfig; kein Vogel singt.
Die Hunde sind schon da. Im abnehmenden Licht sehe ich ihre Silhouetten im Kreis traben wie Wölfe in einem viktorianischen Bilderbuch. Sie bellen wie wild. Seltsam. Solche Laute habe ich von ihnen noch nie gehört. Was haben sie gefunden?
Lyla schaut mich ängstlich an.
»Was ist denn mit Felix und Randal? Mama? Da ist doch was?«
Auf einmal möchte ich nur noch kehrtmachen und weglaufen, den ganzen düsteren Weg zurück zum Auto rennen. Es ist eisig. Es ist so gut wie dunkel. Ich habe Angst vor … ich weiß nicht, was.
Aber Lyla soll von dieser Angst nichts spüren. Hol die Hunde und fahr nach Hause. Jetzt.
Als das Bellen noch ungebärdiger wird, läuft Lyla hin. Ich kann kaum noch etwas erkennen; dunkelgrau und schwarz bricht die Winternacht herein, und die krummen, moosbewachsenen Bäume machen sie noch dunkler.
»Mami!«
Der Schrei geht mir durch Mark und Bein.
Sie ist ein paar Meter vor mir auf der Lichtung. Ich schiebe Brombeerranken beiseite, um sie überhaupt sehen zu können. Die Hunde laufen unentwegt im Kreis und jaulen. Teuflisch. Vielleicht macht ihnen das Wetter Angst. Das viele Weiß um sie her: Hier hat mitten im finsteren Wald dieses seltsame Dartmoor-Phänomen stattgefunden, es hat angefangen zu tauen, und dann hat plötzlich wieder einsetzender Frost alles mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Ammil.
Im letzten, schräg einfallenden Tageslicht sieht das wunderschön aus. Ein Moorland-Eissturm hat den Wald in eine Welt aus Glas verwandelt.
Meine Mutter war immer hingerissen, wenn es einen ammil gab.
Während das Klagelied der Hunde ständig lauter wird, schaue ich mich in dem Wunderland um wie ein Kind am Weihnachtsabend: Sämtliche Zweige an sämtlichen Ästen noch der kümmerlichsten Bäumchen sehen aus wie Finger eines kandierten Skeletts; dünne, durchscheinende Knochen aus Zucker. Die Stechpalmenblätter sind in starre weiße Flammen verwandelt; zwischen den Bäumen hindurch sehe ich jenseits des Waldes Hochlandkühe über Gras trotten, das aus winzigen Kristallnadeln besteht.
Die Hunde hören einfach nicht auf. Wovor haben sie solche Angst?
»Guck mal, Mami!«
Lyla zeigt auf die Mitte der Lichtung. Da liegen mehrere tote Vögel und drei oder vier tote Mäuse, platt auf dem Rücken, die Pfoten in der Luft; wahrscheinlich sind sie dem Kälteeinbruch zum Opfer gefallen. Sie liegen mehr oder weniger in einer Reihe, aber das hat nichts zu sagen. Neben ihnen zieht sich eine Spur Hausmüll hin. Ganz normaler Abfall. Es ärgert mich jedes Mal, wenn Leute ihren Müll im Dartmoor abwerfen. Und Lyla ärgert es noch viel mehr.
Manchmal weint sie sogar.
Aber irgendwas ist komisch. Ich schaue mir die Müllspur auf dem überfrorenen Boden genauer an. Da liegt eine Haarbürste. In einem völlig unpassenden Pink und jetzt von einer dünnen Eisschicht überzogen.
Das ist meine. Ich bin ganz sicher. Ich vermisse sie schon seit einiger Zeit. Und als ich etwas näher herangehe, erkenne ich ein paar feine braune Haare zwischen den Borsten, in der Kälte wie zu Draht erstarrt; neben der Bürste gammeln zusammengeknüllte Kosmetiktücher mit roten Spuren, entweder Lippenstiftküssen oder Blut. Mich schaudert. Ist das Blut von mir? Und dahinten, unter dem Baum, ist das ein Tampon? Ein benutzter Tampon von mir? Ich muss sie in Tüten stecken und in den Müll werfen, um unsere Kanalisation zu schonen, aber warum liegt ein Tampon von mir hier draußen herum?
Mir wird schlecht. Ein Gefühl, als wäre ich überfallen worden. Oder vergiftet. Geschändet. Diese Gerüche, das Blut, die Haare, der Müll – die machen die Hunde verrückt, irritieren die beiden, die sich jetzt, knurrend und mit gesträubtem Fell, von der Lichtung zurückziehen.
Lyla ruft ihnen hinterher. Ich starre auf die Tücher, die so obszön mit meinem Blut beschmiert sind. Wer macht so was? Wer hat meinen Müll geholt, Haare von mir, meine Bürste, und hier draußen im Wald neben den traurigen erfrorenen Vögeln verstreut? Ich schaue meine Tochter an. Kann sie das gewesen sein? Ein Scherz, irgendein Ritual, ein Muster? Warum? Das entspricht ihr nicht, sie macht nichts heimlich, sie ist nicht hinterhältig. Außerdem wirkt sie genauso entsetzt wie ich.
»Was ist denn nur mit den Hunden?«, fragt sie, noch blasser als ohnehin schon. »Wo wollen sie hin?«
Das Blut pocht in meinen Ohren. War ich das womöglich selbst? Habe ich die Sachen hier hingeworfen oder versehentlich fallen lassen und es vergessen? Ist das die Amnesie? Aber warum dieser intime Müll? Blut, Tücher, Haare.
Plötzlich krallt Lyla sich mit eiskalten Fingern an meiner Hand fest und stößt einen Schrei aus.
»Mami! Da kommt jemand. Ich hör’s!«
Chris McGeorge
Escape Room
Über das Buch:
Ein Hotelzimmer, eine Leiche, fünf Verdächtige, drei Stunden Zeit – ein packender Locked-Room-Thriller.
TV-Star Morgan Sheppard erwacht in einem fremden Hotelzimmer, mit Handschellen ans Bett gefesselt. Außer ihm befinden sich noch fünf weitere Personen im Raum – und eine Leiche in der Badewanne, bei der es sich um Morgans Psychiater Simon Winter handelt. Über den Fernseher meldet sich ein maskierter Mann: Morgan habe drei Stunden Zeit, unter den Anwesenden Winters Mörder zu enttarnen. Gelinge das nicht, würden sie alle sterben. Aus dem Zimmer gibt es kein Entkommen, und während die Uhr gnadenlos heruntertickt, greifen Panik und Misstrauen immer mehr um sich, bis die Situation eskaliert.
Als ich zurückkomme, ist es ganz still in der Schule. Wenn ich was vergesse, hat mich meine Mum immer einen Schussel genannt, aber was das eigentlich ist, hat sie mir nie richtig erklärt. Jetzt war ich wieder ein Schussel. Ich war nämlich schon halb zu Hause, und als ich in meine Tasche sah, wusste ich sofort, dass ich es im Mathezimmer hab liegen lassen. Mein Notizbuch mit den Hausaufgaben für heute. Ich habe noch überlegt, ob ich es dort lassen soll, aber ich wollte Mr. Jefferies nicht enttäuschen. Deshalb bin ich jetzt hier.
Ich schleiche mich übers Feld und dann durch den Haupteingang. Nach Einbruch der Dunkelheit – wenn keiner mehr da ist – sind Schulen richtig gruselig. Sonst ist es immer laut hier, überall sind Menschen, aber jetzt sind die Gänge leer, und meine Schritte klingen wie das Stampfen von Elefanten, weil alles so hallt. Ich sehe niemanden, nur einen Typen in einer grünen Latzhose, der mit so einer komischen Maschine den Boden putzt. Er sieht aus, als wäre er der unglücklichste Mensch auf der Welt. Dad sagt, wenn ich nichts lerne, wird mir so was auch blühen. Der Mann tut mir leid, und dann tut es mir leid, dass er mir leidtut, weil Mitleid nichts Schönes ist.
Ich gehe schneller und betrete den Matheraum. Die Tür steht halb auf. Mum hat mir beigebracht, immer höflich zu sein, also klopfe ich sicherheitshalber an. Als ich die Tür öffne, quietscht sie wie eine Maus.
Ich sehe ihn nicht gleich. Die Tür klemmt wegen der Blätter und Übungshefte, die überall auf dem Boden liegen. Eines erkenne ich und hebe es auf. Meines. Mr. Jefferies hat sie am Ende der Stunde eingesammelt.
Etwas stimmt hier nicht, das wird mir jetzt klar, und ich hebe den Kopf und sehe ihn. Mr. Jefferies, den Mathelehrer, meinen Mathelehrer. Meinen Freund. Er hängt in der Mitte des Raums und hat einen Gürtel um den Hals. Sein Gesicht hat eine seltsame Farbe, und seine Augen sind so groß wie von einer Comicfigur.
Aber er ist keine Comicfigur. Er ist echt. Es dauert viel zu lange, bis ich weiß, was ich hier wirklich sehe – zu lange, bis mir klar wird, dass das kein schrecklicher Scherz ist.
Er ist da, direkt vor mir.
Mr. Jefferies. Und er ist tot.
Irgendwann fange ich an zu schreien.
Ein lauter, an- und abschwellender Ton, der sich ihm ins Gehirn bohrte. Als er sich darauf konzentrierte, wurde ein Klingeln daraus. In seinem Kopf oder dort draußen – in der Welt, irgendwo anders. Irgendwo, das unmöglich das Hier und Jetzt sein konnte.
Bbring, bbring, bbring.
Brring, brring, brring.
Tatsächlich – es kam von gleich neben ihm.
Die Augen offen. Alles verschwommen – finster. Was war da? Schwerer Atem – er brauchte eine Sekunde länger als sonst, bis ihm klar wurde, dass es sein eigener Atem war. Flackernd wie die Lichter in einem Kino schaltete sich seine Wahrnehmung an. Und dann, ja – er spürte, wie sich sein Brustkorb hob und senkte, dazu die in die Nase strömende Luft. Sie schien nicht zu reichen. Er wollte mehr, öffnete den Mund, aber der war wie ausgedörrt – seine Zunge raspelte über Sandpapier.
Herrschte jetzt Stille? Nein, das Brring, brring, brring war immer noch zu hören. Er fing gerade an, sich daran zu gewöhnen. Ein Telefon.
Er versuchte die Arme zu bewegen, es ging nicht. Sie waren über seinen Kopf gestreckt, sie zitterten leicht und drohten einzuschlafen. An beiden Handgelenken spürte er etwas Kaltes – etwas Kaltes und Hartes. Metall? Ja, so fühlte es sich an. Metall an den Handgelenken – Handschellen? Er versuchte die tauben Hände zu bewegen, wollte feststellen, woran er befestigt war. Eine Stange, die sich an seinem Rücken entlangzog. Und er war mit Handschellen daran gefesselt?
Beide Ellbogen pochten – beide angewinkelt, während er sich zu bewegen versuchte. Er saß an diesem Ding, was immer es sein mochte. Aber er saß auf etwas Weichem, und unwohl fühlte er sich nur, weil er ein Stück weit hinuntergerutscht zu sein schien. Halb saß er, halb lag er – eine unbequeme Stellung.
Er spannte sich an, stemmte sich mit den Füßen gegen den weichen Untergrund und schob sich hoch. Ein Fuß glitt weg, weil er keinen Halt fand (Schuhe, er trug Schuhe, er musste sich das erst wieder ins Gedächtnis rufen), aber es reichte. Sein Hintern war nun etwas erhöht, und damit ließ die Spannung in den Armen nach. Und da er sich jetzt nicht mehr auf die Schmerzen konzentrieren musste, nahm das Verschwommene um ihn herum langsam Gestalt an.
Als Erstes tauchten die Gegenstände links von ihm auf – die, die am nächsten waren. Er sah einen Nachttisch, der sich zwischen ihm und einer weißen Wand befand. Auf dem Nachttisch ein schwarzer Zylinder mit roten Ziffern. Eine Uhr. 03:00:00 leuchtete auf. Drei Uhr? Aber nein – die Anzeige änderte sich nicht, solange er hinsah. Beleuchtet wurde sie von einer Lampe daneben.