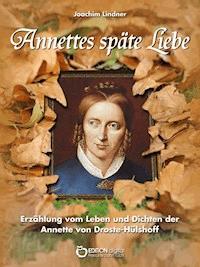7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Anfangs weiß man nicht, wer er eigentlich war, der Gast, der am 8. Juni 1768 in Triest ermordet wurde. Er hatte alles versucht, sein Inkognito zu wahren. Doch dann wird in seinem Koffer auch sein Pass gefunden: Johann Joachim Winckelmann. Präfekt der Altertümer Roms – eine europäische Berühmtheit. Die Ermittlungen laufen an. Was aber war das Motiv? Joachim Lindner nutzte für sein Buch über den historischen Kriminalfall vor inzwischen fast 250 Jahren die amtlichen Dokumente, die lange als verschollen galten und erst sehr spät dort wiederentdeckt worden waren, wo man sie am ehesten hatte vermuten können: „Nachdem die Mordakte jahrzehntelang unbeachtet in den Archiven gelegen hatte, war sie von einem italienischen Gelehrten ausgeliehen worden, der sie für eine Publikation benutzte. Seitdem galt sie als verloren, bis ein anderer italienischer Gelehrter endlich, im Jahre 1964, den klugen Einfall hatte, an Ort und Stelle in der Stadtbibliothek von Triest nachzusehen. Und er entdeckte den Lederband unversehrt an dem Platz, wo er hingehörte, ein wenig verstaubt zwar, aber auf dem Rücken stand noch deutlich zu lesen: Kriminalfall gegen Francesco Arcangeli wegen Mordes.“ Diese Dokumente erlauben es Joachim Lindner, die Untersuchungen im Mordfall W. authentisch nachzuvollziehen und in seiner Erzählung die Fragen der damaligen Kriminalisten wie auch die Aussagen des Mörders und von Zeugen zu verwenden. Die Handlung setzt ein am Morgen des 8. Juni 1768, als Winckelmann, obschon schwer verletzt, sogar noch kurze Zeit zu leben hatte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Joachim Lindner
Mordfall W.
Ein Kriminalroman über die Ermordung von Johann Joachim Winckelmann
ISBN 978-3-86394-622-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals1978 im Verlag Neues Leben Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Vorbemerkung
Vor knapp vierzehn Jahren wurde Näheres über einen Mordfall bekannt, der vor über zweihundert Jahren verübt wurde und damals beträchtliches Aufsehen erregte. Die amtlichen Dokumente nämlich, die über das Verfahren gegen den Mörder Aufschluss geben, waren lange Zeit verschollen und sind erst kürzlich wieder entdeckt worden. Eigentlich waren sie gar nicht verschwunden oder gar verborgen gehalten worden, es handelte sich vielmehr um ein Versehen, wie es bei jeder ordentlichen Behörde vorkommt. Nachdem die Mordakte jahrzehntelang unbeachtet in den Archiven gelegen hatte, war sie von einem italienischen Gelehrten ausgeliehen worden, der sie für eine Publikation benutzte. Seitdem galt sie als verloren, bis ein anderer italienischer Gelehrter endlich, im Jahre 1964, den klugen Einfall hatte, an Ort und Stelle in der Stadtbibliothek von Triest nachzusehen. Und er entdeckte den Lederband unversehrt an dem Platz, wo er hingehörte, ein wenig verstaubt zwar, aber auf dem Rücken stand noch deutlich zu lesen: Kriminalfall gegen Francesco Arcangeli wegen Mordes.
Das Dokument wurde sofort veröffentlicht und unmittelbar darauf von Heinrich Alexander Stoll ins Deutsche übertragen.
Ein Verbrechen, das sich vor zweihundert Jahren zutrug, hätte gewiss kein so großes Interesse mehr erregt, wäre der Ermordete nicht eine seinerzeit sehr berühmte Persönlichkeit gewesen. Bei dem Ermordeten handelt es sich um Johann Joachim Winckelmann, einen Mann, der wirklich aus dem Winkel kam; aus niederdrückenden Verhältnissen hatte er sich emporgearbeitet zum Präfekten der Altertümer Roms und zum Begründer der Archäologie. Seine Bedeutung beruht weniger auf der hohen Stellung, die er innehatte, noch auf seinen Verdiensten um die Archäologie, sondern vielmehr darauf, dass er der Kunst und Literatur seiner Zeit neue Wege wies.
Es erregte daher in ganz Europa Aufsehen, als er, noch nicht einundfünfzig Jahre alt, 1768 in Triest ermordet wurde. Goethe erinnerte sich noch im Alter daran, dass ihn, den damals neunzehnjährigen Studenten der Universität Leipzig, die Nachricht vom Tode Winckelmanns »wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel« erschüttert hatte. »Dieser ungeheure Vorfall tat eine ungeheure Wirkung«, schrieb er in »Dichtung und Wahrheit«, »es war ein allgemeines Jammern und Wehklagen, und sein frühzeitiger Tod schärfte die Aufmerksamkeit auf den Wert seines Lebens. Ja, vielleicht wäre die Wirkung seiner Tätigkeit, wenn er sie auch bis in ein höheres Alter fortgesetzt hätte, nicht so groß gewesen, als sie jetzt werden musste, da er, wie mehrere außerordentliche Menschen, auch noch durch ein seltsames und widerwärtiges Ende vom Schicksal ausgezeichnet worden.«
Um das seltsame Ende Winckelmanns geht es in unserer Erzählung, die sich weitgehend an das hält, was die Mordakte überliefert. Das betrifft sowohl das Verhalten des Mörders und die Vorgänge auf seiner Flucht als auch die Aussagen der Zeugen. Mit Ausnahme einer Nebenfigur sind weder Namen noch Herkunft oder Beruf erfunden; Briefe und amtliche Schriftstücke werden wörtlich wiedergegeben nach der »Mordakte Winckelmann«, die 1965 als Jahresgabe der Winckelmanngesellschaft Stendal im Akademie-Verlag, Berlin, veröffentlicht wurde.
Besonders interessiert uns das Verhalten der Behörden, obwohl wir von denjenigen, die mit der Aufklärung des Verbrechens beauftragt waren, in der Mordakte nur die Namen erfahren. Wer war zum Beispiel jener Kriminalaktuar, der mit sauberer Handschrift, ohne sich zu verschreiben, das Protokoll führte, wer der Polizeibeamte, der den Mordanschlag meldete, wer waren die Richter und Verteidiger?
Bei der Klärung dieser Fragen sind wir nur auf Indizien angewiesen. Aus der Art, wie die Untersuchung geführt wurde, lässt sich manches erschließen, ebenso aus der Befragung der Zeugen wie die Behandlung des Mörders, aus dem, was die Kriminalisten für wesentlich oder unwichtig hielten. Anderes blieb im Dunkel oder erklärt sich nur unzureichend. Die wissenschaftliche Deutung und Einordnung der aus der wiedergefundenen Akte gewonnenen Erkenntnisse bleibt der Winckelmannforschung Vorbehalten. Wir haben im Rahmen dieser Erzählung die Möglichkeit, über die Fakten hinauszugelangen, und wollen versuchen, uns in das Triest des Jahres 1768 zurückzuversetzen und die Ereignisse, die am 8. Juni begannen, wieder lebendig werden zu lassen.
1. Kapitel
Am Morgen des 8. Juni 1768 betrat der Kriminalaktuar Piechl von Ehrenlieb pünklich mit dem siebenten Glockenschlag der Kirchturmuhr das Gerichtsgebäude von Triest, ein stattliches Haus mit starken Mauern, hinter denen es angenehm kühl war trotz der Hitze, die schon zu dieser frühen Stunde in der Hafenstadt an der Adria herrschte. Ehrenlieb war einigermaßen zufrieden mit sich, weil er wieder einmal rechtzeitig sein Ziel erreicht hatte, denn er war alles andere als ein Frühaufsteher. Es ärgerte ihn, dass seine Vorgesetzten so viel Wert auf Pünktlichkeit legten. Es machte keinen Spaß, den ganzen Tag in einem muffigen Amtszimmer über langweiligen Akten zu hocken.
Ehrenlieb legte Wert auf modische Kleidung. Selbst auf die hellgelbe Weste zum dunkelblauen Überrock hatte er heute nicht verzichtet. Nur den Dreispitz trug er der Hitze wegen in der Hand anstatt auf dem Haupt, von dem die Haare lang herabfielen, da Ehrenlieb sich weder für den Zopf noch für die Perücke entschieden hatte. Dass ihm die Kopfbedeckung sogleich beim Betreten der Kanzlei vom Gerichtsdiener abgenommen wurde, ließ er sich gern gefallen, wenn ihn der alte Francesco nur nicht immer mit »Euer Hochwohlgeboren« anreden würde, einem Titel, der ihm als Adligem zwar zukam, auf den er aber gern verzichtete.
Ehrenlieb war sicher, dass Zanardi, der Polizeipräfekt oder Barigello, wie er im Triester Italienisch genannt wurde, längst im Amt erschienen war. Francesco Presteiner, der die Akte brachte, an der Ehrenlieb augenblicklich arbeitete, bestätigte diese Vermutung. Der Kriminalaktuar hatte sich noch nicht zu seinem Schreibpult begeben, als der an Übergewicht leidende Zanardi ein wenig schnaufend den Raum betrat, um seinen jungen Kollegen mit italienischer Überschwänglichkeit zu begrüßen.
»Da sind Sie ja schon, lieber Ehrenlieb«, sagte er, »pünktlich wie immer! Recht so, dass Sie meine Ratschläge befolgen, denn der Adelstitel genügt heutzutage nicht mehr, wenn man vorankommen will. Tüchtig und zuverlässig muss man überdies noch sein. Und womit beginnt die Zuverlässigkeit? Mit der Pünktlichkeit, sage ich Ihnen!«
»Sicher haben Sie recht«, erwiderte Ehrenlieb etwas gequält, da er diese Worte nicht zum ersten Male hörte, »und ich gebe mir auch alle Mühe, nur habe ich mich nicht nach Triest versetzen lassen, um auch hier bloß mit Bagatellen beschäftigt zu werden!«
Zanardi reagierte verständnisvoller, als es Ehrenlieb erwartet hatte. Zwar hielt er ihm vor, dass auch die Untersuchungen von Diebstählen, Fälschungen, Betrügereien und dergleichen kleineren Delikten mit aller Sorgfalt geführt werden müssten, wo blieben sonst Ordnung und Recht, versicherte aber, dass Ehrenlieb seine Aufgaben bisher pflichtgemäß erfüllt habe. Überdies habe er nun einmal ein Herz für die Jugend, sei sie nun weiblich oder männlich, kurz und gut, er werde sich bei Doktor von Kupfersein dafür verwenden, ihn, Ehrenlieb, bei der nächsten Gelegenheit — und daran fehle es leider hierorts nicht — in geeigneter Weise verantwortlich einzusetzen.
So verlief das Gespräch zwischen dem erfahrenen Barigello und dem jungen Aktuar am Morgen des 8. Juni, und es versteht sich, dass Ehrenlieb wenig von Zanardis Zusicherungen hielt. Nachdem der Barigello wieder gegangen war, vertiefte er sich in die von Francesco bereitgelegte Akte, die er seufzend, aber sorgfältig mit der Aufschrift »Verfahren gegen Guiseppe Manucchi wegen Einbruchs« versah. Ehrenlieb stammte aus einer verarmten österreichischen Adelsfamilie. Da das Gut des Vaters traditionsgemäß vom ältesten Sohn übernommen worden war, mussten die beiden jüngeren Söhne selbst für ihr Fortkommen sorgen. Ehrenliebs Bruder Alois hatte sich für den Militärdienst entschieden, weil man nach des Vaters Ansicht dafür am wenigsten Verstand brauchte, während Piechl, der Jüngste, für die Offizierslaufbahn zu wenig Schneid besaß und es daher mit der Juristerei versucht hatte. Sauer genug war ihm das Studium geworden, und nur mit Mühe hatte er es geschafft, zumal ihm davor graute, sein Leben lang in einer kleinen österreichischen Gerichtskanzlei arbeiten zu müssen. Daher hatte er nicht ohne Witz, worunter man damals die Fähigkeit verstand, seine geistigen Gaben klug zu gebrauchen, sich als unternehmungslustiger Mann entschlossen, Italienisch zu lernen, und seine Rechnung war aufgegangen. Vielleicht verfügte auch der Vater über gute Beziehungen, jedenfalls war es Ehrenlieb mit Glück und Geschick gelungen, aus den österreichischen Stammlanden herauszukommen und nach Triest versetzt zu werden, das in jener Zeit zu Österreich gehörte und dessen bedeutendste Hafenstadt war. Hier aber fühlte sich Ehrenlieb unglücklicher als zu Hause. Wenn die Leute ihn auch verstanden und er sie, so hatte er doch in dem halben Jahr, das er bereits in Triest zubrachte, das Gefühl, in einer fremden Welt zu leben, nicht überwinden können. Auch im Amt hatte er wenig Kontakt gefunden. Die Vorgesetzten waren meist ältere Leute wie Zanardi, der sich immerhin ein wenig um ihn kümmerte. Der Stadtrichter Kupfersein dagegen hatte von ihm bisher kaum Kenntnis genommen, und was er von Domenico Sacchi, dem gewandten und glatten Kriminalrichter, zu halten hatte, darüber war sich Ehrenlieb bisher nicht klar geworden.
Zanardi, der Polizeipräfekt, hatte sich inzwischen davon überzeugt, dass in der vergangenen Nacht nichts Aufregendes in Triest vorgefallen war, und dem Gerichtsgebäude alsbald seinen breiten Rücken zugekehrt. Er liebte den Aufenthalt in dem düsteren Gemäuer ebenso wenig wie Ehrenlieb und wollte den schönen, sonnigen Morgen für eine Inspektion nutzen. So nannte er seine scheinbar ziellosen Spaziergänge durch Triest, die von allen, die die Polizei zu fürchten hatten, nicht gern gesehen wurden, da der Barigello nicht selten dort auftauchte, wo seine Anwesenheit höchst unerwünscht war.
An diesem Mittwochmorgen zog es ihn wieder einmal zum Hafen, der schon in der Kindheit sein Lieblingsaufenthalt gewesen war. Zuerst hatten ihn wohl die Schiffe angelockt, die großen Dreimaster, die aus fernen Ländern kamen, und die abenteuerlichen Gestalten der Matrosen, die in der Takelage hantierten, um die Segel zu setzen oder zu bergen. Später, als er bereits beschlossen hatte, in den Polizeidienst zu gehen, hatte er sich mehr für die Schmuggler interessiert, ebenso abenteuerliche Gestalten wie die Matrosen, nur nicht so leicht zu erkennen und noch weniger leicht zu fassen. Von seinem Vorgänger im Amt, dem alten Paolini, erfuhr er dann, dass es bei der Verfolgung der Schmuggler nicht so aufregend zuging, wie er es sich vorgestellt hatte. Die Polizei wandte nämlich eine verhältnismäßig einfache Methode an, um den Schmuggel in Grenzen zu halten. Sie bediente sich einiger Spitzel, die, um nicht aufzufallen, selbst schmuggelten und ihrerseits überwacht werden mussten. Zanardi, damals noch ein junger Mann in Ehrenliebs Alter, war enttäuscht gewesen. Er hatte einen harten, aber ehrlichen Kampf erwartet und fand statt dessen Praktiken, die er für fragwürdig hielt.
Der alte Paolini, dem er seine Bedenken nicht vorenthielt, hatte ihn zu beruhigen versucht und ihm erklärt, dass bei der Polizei der gerade Weg meist nicht der erfolgreichste sei. Das ginge noch an, wenn nur nicht immer, und selbst bei Kapitalverbrechen, Adel und Geistlichkeit schonend behandelt werden müssten. Doch wolle er ihm nicht alle Freude am Dienst nehmen, er werde die Grenzen, die ihnen gezogen wären, noch früh genug kennenlernen.
Zanardi hatte bald erfahren müssen, dass der Alte nicht zu schwarz gemalt hatte. Mit der Schmuggelei freilich war es über Nacht vorbei gewesen in Triest, denn noch der Vater der Kaiserin Maria Theresia, Karl VI., hatte die Stadt zum Freihafen erklärt, in der durchaus berechtigten Erwartung, den Handel durch die zollfreie Ein- und Ausfuhr zu beleben.
Während der Barigello sein Ziel, die Hafenmeisterei, noch nicht erreicht hatte, war der Stadtrichter, Doktor Stanislaus von Kupfersein, gerade aufgewacht, und zwar mit einem schweren Kopf. Er verdankte ihn dem vergangenen Abend, den er wie jeden Dienstag am Stammtisch zugebracht hatte. Spät war es dabei wieder geworden, aber zu seinem geliebten Schachspiel oder wenigstens zu einer Partie Tarock war er dennoch nicht gekommen, und außerdem hatte er zu viel von dem schweren Roten getrunken.
Wer hatte eigentlich zu streiten begonnen, überlegte der Stadtrichter noch im Bett und ließ sich von den Ermahnungen seiner Frau, doch endlich aufzustehen, nicht im Nachdenken stören. Der biedere Benedikt Fleck, der Wundarzt oder Chirurg, wie er sich lieber nennen hörte, doch gewiss nicht, und Lovisoni, der Offizialanwalt, auch nicht. Domenico Sacchi, der Kriminalrichter, war es gewesen, und den Streit ausgelöst hatte eigentlich er, Kupfersein selbst, allerdings erst, nachdem ihn Sacchi zum Widerspruch gereizt hatte. Aber mussten denn diese Italiener sich immerzu abfällig äußern über die kaiserlich-königliche Regierung in Wien, und durfte er als Stadtrichter und stellvertretender Staatsanwalt dazu schweigen? Wie er auch selbst darüber dachte, seinem Amt war er es jedenfalls schuldig, derlei nicht zu dulden. Sacchi, dieser Fuchs, hatte es wie immer schlau angefangen, indem er sich zuerst anerkennend über das neue Strafgesetzbuch und den verbesserten Zivilgesetzkodex geäußert hatte, natürlich nur, um hinzuzufügen, dass es allerhöchste Zeit gewesen sei, und die Folter, die sei noch immer nicht abgeschafft in den österreichischen Ländern, in Preußen dagegen schon seit dem Regierungsantritt Friedrichs II. Hier schon hätte er kraft seines Amtes Einspruch erheben müssen, aber Lovisoni war ihm zuvorgekommen — immer hielten die Italiener zusammen, wenn es gegen Österreich ging. Von der Folter hatte der Offizialanwalt das Gespräch auf die Todesstrafe gelenkt, die seiner Meinung nach viel zu häufig angewendet wurde. Und wenn man schon außer Mördern und Gewaltverbrechern auch Diebe zum Tode verurteile, dann gäbe es doch humanere Methoden als Vierteilen und Rädern.
Hier war es ihm, Stanislaus von Kupfersein, endgültig zu viel geworden, und er hatte, zuerst noch ruhig, geantwortet, sie wüssten doch genau, dass von der Tortur kaum noch Gebrauch gemacht würde in Österreich, und was die Todesstrafe anginge, so seien, wie er bestimmt versichern könne, Bestrebungen im Gange, sie einzuschränken. Schließlich sei man in Wien genauso aufgeklärt wie in Berlin, wenn nicht noch mehr.
Leider hatte er es dabei nicht bewenden lassen. Der Teufel musste ihn geritten haben, auszusprechen, was man besser ungesagt sein ließ. Er wüsste schon, hatte er behauptet, dass sie, die Italiener, mit den Preußen sympathisierten und es Maria Theresia gönnten, dass sie ihr schönes Schlesien endgültig verloren habe im Siebenjährigen Krieg.
Da war es ausgewesen mit dem Stammtischfrieden, mit dem Schach und dem Tarock. Protestiert hatten die beiden Italiener, Sacchi ruhig, Lovisoni heftig, von böswilliger Unterstellung, ja von Beleidigung hatten sie gesprochen, er hatte hitzig erwidert und Fleck vergeblich zu vermitteln versucht. Schließlich waren sie in Unfrieden auseinandergegangen, und das ärgerte ihn, war aber nicht mehr zu ändern. Jedenfalls musste er jetzt ins Amt, sonst war der Vormittag vorüber. Stöhnend, weil ihm der Kopf noch immer schmerzte, erhob sich der Doktor Stanislaus von Kupfersein, zog sich an und ging trotz des Protestes seiner Frau ohne Frühstück aus dem Haus.
Ehrenlieb hatte währenddessen das Studium seiner Akte beendet und sich vom Gerichtsdiener Francesco eben neue Federn bringen lassen, als Zanardi gemeinsam mit Doktor Kupfersein die Kanzlei betrat.
»Es ist soweit«, sagte der Barigello, wider seine Gewohnheit kurz angebunden, während der Stadtrichter schweigend seine Brille putzte. »Sie begleiten uns als Protokollant, Ehrenlieb! Francesco, Sie laufen zum Stadtchirurgen Albrici und auch gleich zum Sanitätsphysikus Enenkel. Die beiden sollen nach der Osteria Grande kommen, aber schnell. Dort hat es eine Messerstecherei zwischen einigen Logiergästen gegeben, einer ist verletzt, ein anderer geflohen. — Sind Sie fertig?«, fragte er Ehrenlieb, der bereits sein Schreibzeug einpackte. »Herr von Kupfersein wird mit uns gehen als Vertreter des Herrn Staatsanwalts.«
Die drei Amtspersonen durchquerten rasch die trotz der Hitze belebten Straßen von Triest, erwartungsvoll der junge Ehrenlieb, missmutig der Stadtrichter und gelassen der Barigello, der schon zu viel erlebt hatte während seiner langen Dienstzeit, als dass ihn eine Messerstecherei noch hätte aufregen können. Sie hatten bald die Piazza Grande, den Hauptplatz von Triest, erreicht, an dem sich die Osteria befand, ein mehrstöckiges Hotel, das vorwiegend von gut situierten Reisenden besucht wurde. Vor dem Portal hatten sich zahlreiche Neugierige versammelt, die der Polizeidiener Pietro Stregar vergeblich zu vertreiben suchte.
»Im zweiten Stockwerk, Zimmer Nummer zehn«, meldete er dem Stadtrichter und seinen Begleitern. Die drei erstiegen schweigend die Treppe rechter Hand vom Eingang, voran der Barigello, dicht hinter ihm der Stadtrichter und am Schluss in einigem Abstand, wie es sich gehörte, der Kriminalaktuar Ehrenlieb. Im zweiten Stock standen am Ende des Korridors einige Leute vor der Tür mit der Nummer zehn. Zanardi klopfte an, öffnete, blickte in das Zimmer und ließ dann Doktor Kupfersein den Vortritt.
Ehrenlieb erschrak bei dem Anblick, der sich ihm bot, obwohl nichts Auffälliges zu bemerken war. Es handelte sich um ein gewöhnliches Hotelzimmer mit dem üblichen Mobiliar, einem Schrank, einem Tisch, einigen Stühlen, einem Waschtisch mit Schüssel, Krug und Wasserkaraffe, dem Bett in der Ecke; aber auf all dies achtete Ehrenlieb nicht. Er sah nur die Männer, die mit dem Rücken zur Tür eigentümlich stumm in der Mitte des Raumes standen und zu Boden starrten. Zanardis Stimme ließ ihn auffahren. »Platz für das Gericht«, forderte der Barigello barsch. Die Männer traten zur Seite, und Ehrenlieb erblickte auf einer Matratze, die auf dem Fußboden lag, einen Mann mit blassem, eingefallenem Gesicht, der schwer atmete und ein Stöhnen mühsam unterdrückte. Neben ihm kniete Benedikt Fleck und verband ihm die rechte Hand. Auch die linke war verbunden, die Brust mit weißen Leinentüchern dick umwickelt, die sich blutig rot färbten. Warum hatte man den Mann auf den Fußboden gelegt und nicht in das Bett in der Ecke? Wahrscheinlich hatte der Arzt dort nicht genügend Platz gehabt, um ihn zu versorgen.
Die Tür öffnete sich, und ein Priester trat ein, begleitet vom Ministranten. Fleck nickte ihm zu. Der Geistliche begriff, verzichtete auf die Kommunion und nahm sogleich die Letzte Ölung vor. Während der Zeremonie suchte Ehrenlieb seiner Bestürzung Herr zu werden. Der Mensch, der dort mit dem Tode kämpfte, hatte sich gewiss nicht leichtfertig in eine Messerstecherei eingelassen. Zweifellos war er ein Mann von Stand, vielleicht sogar ein Adliger. Das feine weiße Hemd, das er trug und das man aufgeschnitten hatte, um ihn verbinden zu können, war über und über blutbefleckt. Jung war der Mann nicht mehr, die kurz geschnittenen grauen Haare deuteten darauf hin, dass er eine Perücke trug — ein Gelehrter wahrscheinlich. Während der Priester ihn segnete, wies Zanardi die Neugierigen aus dem Zimmer, und Kupfersein flüsterte mit dem Chirurgen. Dann winkte er Ehrenlieb zu, der sich an dem kleinen Tisch niederließ, die Schreibmappe öffnete und die Feder zur Hand nahm.
Der Stadtrichter beugte sich zu dem Verletzten nieder und fragte nach Namen und Stand. Ehrenlieb bezweifelte, dass der Mann imstande war zu antworten, doch wider Erwarten öffnete er die Augen, deutete mit der Rechten auf einen Koffer, der nicht weit von ihm entfernt auf dem Fußboden stand, und sagte mit schwacher Stimme: »Pass.« Als er dabei eine Kopfbewegung machte, erblickte Ehrenlieb an seinem Halse eine dunkle Färbung, als ob jemand versucht hätte, ihn zu erwürgen. Da der Mann trotz seiner schwindenden Kräfte bemüht war, sich verständlich zu machen, fragte Kupfersein weiter, bestrebt, sich kurz und präzise auszudrücken: »Wer hat Euch verletzt?«
»Der Schurke von Zimmer neun nebenan.« Der Mann sprach stockend und mit großen Pausen. Das Sprechen bereitete ihm Mühe, dennoch zwang er sich zu antworten. »Wie kam er dazu?«
»Er hatte sich mit mir befreundet. Ich zeigte ihm« — die Stimme versagte ihm, er schloss die Augen wieder, rang nach Luft und sprach dann abgehackt weiter — »Silbermünzen und zwei Münzen aus Gold, hatte mir die Kaiserin in Schönbrunn geschenkt. Heute Morgen kam er, wollte die Münze wieder sehen, wissen, wer ich bin. Ich sagte, will nicht, dass mein Name bekannt wird. Da plötzlich — Strick um meinen Hals. Wehrte mich, er zog das Messer, stach zu, weiß nicht wie oft, und floh ...«
Kupfersein ließ dem Verletzten, den das Reden sehr erschöpft hatte, Zeit sich zu erholen. Dann fragte er, während Ehrenlieb eifrig mitschrieb, dass die Feder auf dem Papier kratzte: »Wie hieß derjenige, der die Tat beging?«
Da der Mann nach Luft rang und kein Wort hervorbrachte, wiederholte der Stadtrichter: »Der Name, nur der Name!« Der Verletzte schüttelte den Kopf, zwang sich dann aber mit äußerster Anstrengung zu der Erwiderung: »Gastwirt weiß es, ihn fragen!«
Kupfersein ließ ihm dennoch keine Ruhe, sondern bat ihn, dem Gericht zu sagen, wie er selbst heiße und woher er stamme.
»Lasst mich«, antwortete der Mann, »Koffer — Pass.«
Da auch Benedikt Fleck eine verneinende Gebärde machte, ließ Kupfersein von dem Manne ab, wandte sich dem Koffer zu und ergriff ein mehrfach gefaltetes Papier, das obenauf lag. Er öffnete es und las laut und langsam vor: »Für Johannes Winckelmann; Präfekt der Altertümer Roms, geboren am 9. Dezember 1717 in Stendal, der in die Heilige Stadt zurückkehrt. Das Dokument ist ausgestellt am 28. Mai 1768 und ordnungsgemäß unterzeichnet von Heinrich Gabriel von Collembach.«
Kupfersein faltete das Papier wieder sorgfältig zusammen und legte es auf den Koffer zurück. Da erschien Zanardi wieder, der kurz vorher das Zimmer verlassen hatte. In der Hand hielt er einen blutigen Strick, den er dem Stadtrichter zeigte: »Ich habe den Strick von Andreas Harthaber erhalten, dem Kellner. Er erklärte, dass der Entflohene damit den Verletzten erwürgen wollte.«
Kupfersein nickte und diktierte Ehrenlieb für das Protokoll: »Ein kräftiger Strick mittlerer Stärke, blutig, etwa drei Fuß lang, an einem Ende mit einer Schlinge versehen.«
Nun wies Zanardi ein Messer vor, und der Stadtrichter diktierte weiter: »Ein Messer, anscheinend neu, Länge etwa ein halb Fuß, die Klinge blutig, mit einem eingravierten V. Griff achteckig, aus Horn, mit eingelegten Verzierungen aus Zinn.«
Kupfersein blickte den Barigello fragend an, und Zanardi sagte: »Das Messer habe ich dort auf dem Tisch gefunden.« Dabei wies er auf den Tisch neben der Tür. »Es lag neben dem kleinen Tablett mit der Wasserkaraffe. Wahrscheinlich hat es jemand auf dem Fußboden gefunden und auf den Tisch gelegt.«
Man hörte ein unterdrücktes Stöhnen, und Benedikt Fleck sagte: »Der Verletzte braucht Ruhe.«
»Ich glaube, wir können das Zimmer jetzt verlassen«, erwiderte Kupfersein, nickte dem Arzt zu und wandte sich zum Gehen, gefolgt von Zanardi und Ehrenlieb, der die Tür leise hinter sich schloss.
Eben kamen Stadtchirurg Albrici und Sanitätsphysikus Enenkel die Treppe herauf, hinter ihnen der Gerichtsdiener Francesco Presteiner und der Kriminalrichter Sacchi, der offenbar noch später aufgestanden war als Kupfersein. »Nichts mehr zu tun für Sie!«, rief der Stadtrichter den beiden Ärzten zu. »Der von mehreren Messerstichen Getroffene wird bereits von Benedikt Fleck versorgt. Immerhin können Sie sich den Patienten ansehen, doch wird Ihre Kunst in diesem Falle leider nichts mehr ausrichten können. — Francesco, Sie bleiben in dem Zimmer des Verletzten. Falls er noch etwas sagt, verständigen Sie uns bitte sofort. Sie sorgen ferner dafür, dass kein Neugieriger den Raum betritt. Wir andern wollen uns jetzt das Zimmer des mutmaßlichen Täters ansehen. Sie haben doch bereits dafür gesorgt, dass er verfolgt wird, Zanardi?«
»So wahr ich der Barigello bin, der Schurke soll mir nicht entwischen«, erklärte Zanardi etwas pathetisch und fuhr dann in sachlicherem Tone fort: »Die Zivil- sowie die Militärstatthalterei sind verständigt und haben ihre Mithilfe zugesichert.«
»Gut«, sagte Kupfersein, »während der Barigello den Täter verfolgt, führen Sie die weitere Untersuchung, Signor Sacchi. Mit dem Verhör des Schwerverletzten konnten wir allerdings nicht warten, bis Sie kamen. Kriminalaktuar Ehrenlieb wird Ihnen nachher das Protokoll vorlesen und die nötigen Erläuterungen geben. Jetzt also das Zimmer des Täters!« Eben noch, als Kupfersein den Verletzten befragte, hatte Ehrenlieb Respekt vor ihm gehabt, da er zu spüren glaubte, dass der sonst so sichere Stadtrichter betroffen war und sich bemüht hatte, den Mann nicht unnötig zu quälen. Nun aber schien sich Kupfersein wieder gefasst zu haben und ganz der alte zu sein, überzeugt von sich und der Würde seines Amtes.
Zimmer Nummer neun war ein kleiner Raum, durch dessen Fenster man ebenso auf das Meer blicken konnte wie aus dem Zimmer nebenan. Das spärliche Mobiliar bestand aus einem Holzbett mit Strohsack, einem Kleiderschrank, zwei Stühlen an einem kleinen Tisch, einer Waschkommode mit Schüssel und Wasserkrug.
Als sie eintraten, bemerkte Sacchi auf dem Tisch eine Messerscheide aus schwarzem Leder, und Zanardi probierte sofort, ob das Messer, das er im Nebenzimmer gefunden hatte, hineinpasste. Da es offenbar in die Scheide gehörte, wies Kupfersein den Kriminalaktuar an, diese Feststellung ins Protokoll aufzunehmen. »Es ist zweifellos ein wichtiges Beweisstück«, fügte er in amtlichem Ton hinzu, »das zur Überführung des Täters beitragen kann.« Auch die übrigen Gegenstände, die man vorfand, vermerkte Ehrenlieb im Protokoll: einen Hut, ein Paar abgenutzte Lederhandschuhe, schmutzige Strümpfe, zwei Kragen, ein ehemals weißes, durch längeren Gebrauch grau gewordenes Hemd und ein ebenfalls abgenutztes türkisfarbenes Tuch.
Diese Kleidungsstücke lagen unordentlich auf einem der beiden Stühle. Über der Lehne des anderen hing eine Weste mit verschlissenen Leinenärmeln und darüber ein alter Schoßrock. Bei der Untersuchung der Taschen fand Zanardi zwei verschlossene Briefe, die Kupfersein öffnete und vorlas. Der erste war an eine Frau namens Justina Naimo in Venedig gerichtet und lautete: (
Meine allerliebste Frau! Mit Schmerz meines Lebens bitte ich Sie, eine heilige Geduld mit mir zu üben, denn ich hoffe, bald zu Euch zu kommen, wenn es Gott, dem Allerhöchsten, gefällt, aber ich wünsche mir, Euch zu sehen, wie Ihr, meine Getreue, vergnügt seid, denn bald bin ich bei Euch, wenn es unserem Gott gefällt.
Ich bin immer zu Euren Befehlen, meine treue Gattin, und verbleibe mit der Sehnsucht, Sie zu sehen. Dieses wünschend, 7. Juni 1768
ich, Francesco Archangeli, Ihr Ehemann
»Nun das zweite Schreiben«, sagte Kupfersein. »Es ist adressiert an einen Herrn Angelo Saligri, Kammerdiener Seiner Exzellenz Ritter Morosini in Venedig.
Herr Angelo!
Ich bin sehr verpflichtet, da ich Ihnen schon dreimal geschrieben habe, aber ich habe keine Antwort gehabt. Ich bin ziemlich in Zorn, und deshalb bitte ich Sie, mich wissen zu lassen, was mit Frau Giovanna ist. Anderes will ich nicht, mein liebster Angelo. Ich bitte Sie, mir die Freundlichkeit zu erweisen, an Pater Antonio Bosizio zu schreiben, dass er mir, wie er gewöhnt ist, den Gefallen tut, mir den Brief zustellen zu lassen. Anderes will ich nicht. Hundert Grüße, tausend Komplimente. Ich grüße meine Frau. Wie viel Schmerz erdulde ich, aber ich hoffe auf Gott, sie zu sehen.
Ihr lieber Giuseppe Rachaelli.
Nanu«, sagte Kupfersein, «eben hieß der Mann Francesco Archangeli und jetzt Giuseppe Rachaelli, die Schrift ist nämlich dieselbe. Das sollten wir im Protokoll ausdrücklich festhalten, Ehrenlieb! — Gibt es sonst noch etwas Bemerkenswertes?«
Domenico Sacchi hatte inzwischen den Kleiderschrank geöffnet, ihn aber leer gefunden. »Nein«, sagte er.
»Dann kann ich wohl gehen«, erwiderte der Stadtrichter. Zanardi wickelte die Kleidungsstücke in ein Handtuch, das an der Wand hing, und übergab Ehrenlieb die beiden Briefe. Darauf erteilte Kupfersein dem Barigello den offiziellen Auftrag, den Verbrecher mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verfolgen. »Der Herr Präfekt der Altertümer von Rom, der nebenan im Sterben liegt, ist zweifellos eine Persönlichkeit von hohem Rang, und es ist anzunehmen, dass sich die allerhöchsten Herrschaften in Wien für das Verbrechen interessieren, das an ihm begangen wurde, und seine unverzügliche Sühne fordern werden.«
Als er Sacchis verstohlenes Lächeln bemerkte, setzte er hinzu: »Darüber hinaus ist es selbstverständlich unsere Pflicht, einem jeden Bürger, ob hoch oder niedrig, Rechtsschutz zu gewähren. Ihre Aufgabe, Herr Kriminalrichter, ist es, sofort mit den Untersuchungen zu beginnen, die, wie ich hoffe, zur raschen und vollständigen Aufklärung der blutigen Tat führen werden. Ich bitte, mich über die Ergebnisse der Vernehmungen ständig zu informieren.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er. Der Barigello schloss sich ihm an, wandte sich aber noch einmal Ehrenlieb zu. »Es ist anders, als Sie es sich vorgestellt hatten«, sagte er, »immer ist es anders. Wir müssen sehen, wie wir damit fertig werden, und unsere Pflicht tun, so gut wie möglich.«
»Freilich müssen wir das«, sagte Sacchi zu Ehrenlieb, als sie allein waren. »Ich glaube, wir sind da in eine ziemlich heikle Sache hineingeraten, das hat Kupfersein gleich gemerkt. Doch zunächst wollen wir uns den Verletzten ansehen, vielleicht kann man noch etwas von ihm erfahren.«
Im Zimmer Nummer zehn standen die drei Ärzte vor dem Lager Winckelmanns, der die Augen geschlossen hatte und schwer atmete. Enenkel erklärte leise, dass sich sein Befinden zusehends verschlechtere und an eine weitere Vernehmung nicht zu denken sei. Behutsam verließen Sacchi und Ehrenlieb den Raum und setzten sich in das Hinterzimmer der Gaststube. Hier ließ sich der Kriminalrichter das Protokoll von Ehrenlieb vorlesen.
Als Ehrenlieb geendet hatte, sagte Sacchi: »Ehe wir mit den Verhören beginnen, wollen wir uns zunächst klar werden über das, was unklar ist, das müssen wir nämlich zuerst zu erfahren suchen. Eile, wie sie Kupfersein fordert, ist gut, aber planmäßige Eile, Ehrenlieb, und präzise Fragen, sonst kommen wir nicht weit. — Wenden wir uns jetzt dem Mann in Nummer zehn zu. Was wissen wir über ihn?«
»Er ist etwa fünfzig Jahre alt und stammt aus Deutschland«, begann Ehrenlieb, wurde aber sofort von Sacchi unterbrochen: »Genauigkeit ist die Seele der Kriminalistik, Herr Aktuar! Der Mann ist laut Protokoll im Dezember 1717 geboren, ist also nicht etwa fünfzig, sondern genau fünfzigeinhalb Jahre alt. Außerdem stammt er nicht aus Deutschland, sondern aus Stendal, das in Preußen liegt.«
Ehrenlieb hatte Sacchi nicht für einen Pedanten gehalten, aber er bemühte sich, sachlich zu bleiben. »Nach Angabe des Passes ist er Präfekt der Altertümer Roms und kehrt in die Heilige Stadt zurück.«
»Nicht so schnell«, unterbrach in Sacchi abermals. »Was heißt das, Präfekt der Altertümer? Präfekt bedeutet so viel wie Vorsteher. Ihm unterstehen also die Altertümer?«
»Gemeint sind wohl die alten Figuren und Statuen, auf die man neuerdings so viel Wert legt«, ergänzte Ehrenlieb.
»Ja, besonders seitdem man mit den Ausgrabungen von Herculanum und Pompeji begonnen hat. Sie sehen, Ehrenlieb, der Kriminalist muss auch ein gutes Allgemeinwissen haben. Kupfersein hat also recht, wenn er behauptet, es handle sich um eine Persönlichkeit von hohem Range, denn einem Beliebigen wird man die Oberaufsicht über die alten Kunstwerke gewiss nicht anvertrauen. Über Rang und Beruf des Mannes sind wir uns also ziemlich klar.«
»Er ist zweifellos ein Gelehrter«, meinte Ehrenlieb. »Genauer, Herr Aktuar, genauer. Gewiss ein Kenner der Antike, denn um antike Kunstwerke handelt es sich ja. Vielleicht könnte man präzise sagen, ein Altertumswissenschaftler. — Der Beruf, mein lieber Ehrenlieb, ist keine Nebensache, oft steht er im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verbrechen. Nun fragt es sich, in wessen Diensten hat er diesen Beruf ausgeübt, denn auch das ist wichtig.«
»Im Dienst der Kirche«, antwortete Ehrenlieb prompt, »denn er kommt aus Rom.»
»Er kommt zwar nicht aus Rom, sondern kehrt nach Rom zurück, und das ist ein großer Unterschied. Aber recht haben Sie schon, Ehrenlieb, wer in eine Stadt zurückkehrt, wohnt gewöhnlich dort. Wer aber in Rom in einer offiziellen Stellung tätig ist, und das war der Präfekt der Altertümer bestimmt, steht zweifellos im Dienst der Kirche. Das erschwert unsere Untersuchungen allerdings, denn nicht nur die Regierung in Wien wird sich unter diesen Umständen für den Fall interessieren, wie Kupfersein meint, sondern auch die Kirche, obwohl der Mann, das geht aus seiner Kleidung hervor, kein Geistlicher ist.«
»Zum Wiener Hof scheint er jedenfalls einen engen Kontakt zu haben«, sagte Ehrenlieb, »denn er behauptete, die Kaiserin selbst habe ihm Goldmünzen — wahrscheinlich wertvolle alte Stücke — geschenkt.«
»Richtig«, erwiderte Sacchi, »wir können seiner Behauptung zunächst glauben, da nicht anzunehmen ist, dass uns ein Mann in seiner Lage täuschen will, werden seine Angabe aber überprüfen.«
»Außerdem«, fuhr Ehrenlieb fort, »kommt er vermutlich von Wien, denn sein Pass ist dort ausgestellt worden.«
»Das will noch nichts besagen«, wandte Sacchi ein, »aber das Datum der Ausstellung spricht für Ihre Annahme. Wenn der Pass am 28. Mai dort ausgestellt wurde, muss der Mann an einem der letzten Maitage von Wien abgereist sein, sonst wäre er noch nicht hier. Auch wenn er eine Extrapost genommen hat, kann er nicht viel später aufgebrochen sein. Doch das werden wir genau ermitteln bei dem Verhör des Gastwirts, der wissen muss, wann der Mann hier angekommen ist. — Ich glaube, das ist alles, was wir im Augenblick mit ziemlicher Gewissheit feststellen können. Kommen wir jetzt zu den Unklarheiten. Was ist Ihnen bei dem Verhör des Mannes aufgefallen, Ehrenlieb?«
»Aufgefallen ist mir«, erwiderte der Kriminalaktuar, nachdem er einen Augenblick nachgedacht hatte, »dass er sagte, er wolle nicht, dass sein Name bekannt wird.«
»Was ebenfalls für seinen hohen Rang spricht«, ergänzte Sacchi, »ein Unbekannter braucht nicht inkognito zu reisen, er ist es ohnehin. Doch dürfen wir uns deswegen nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen. Zunächst müssen wir zu erfahren suchen, was dieser inkognito reisende Altertumswissenschaftler in Triest wollte. Nehmen wir an, er befand sich nur auf der Durchreise von Wien nach Rom, weil er statt des schlechten Weges über die Alpen die gut instand gesetzte Straße von Wien nach Triest vorzog und von hier nach Venedig oder Ancona den Seeweg benutzen wollte. Das wird sich bei den Vernehmungen noch heraussteilen. Trifft diese Vermutung zu, dann wäre sein Inkognito nichts Ungewöhnliches.«
»Weshalb nicht?«, fragte Ehrenlieb.
»Wenn es sich, wie wir mit ziemlicher Sicherheit wissen, um eine hochgestellte Persönlichkeit im Dienste der Kirche handelte, hätte er sich hier bei den hohen weltlichen und geistlichen Würdenträgern sehen lassen müssen, sofern sein Name und Rang bekannt geworden wären. Befand er sich nur auf der Durchreise und hatte er es vielleicht eilig — was wir herausbekommen werden —, dann hätten ihn diese Besuche mehrere Tage aufgehalten. Aber wie auch immer — dieses Inkognito ist ein Problem, das wir lösen müssen. Haben Sie sonst noch etwas Außergewöhnliches bemerkt?«