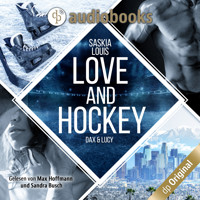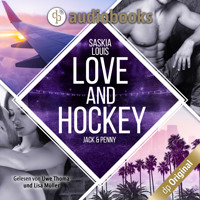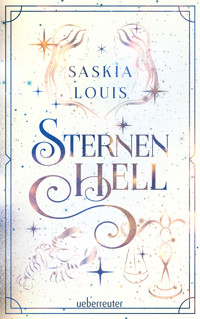7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Louisa Manu-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein totes Funkenmariechen bleibt selten allein
Louisa Manu ermittelt wieder … als Käse verkleidet
Louisa Manus Lieblingsjahreszeit hält Einzug in Köln: Karneval. Sie will trinken, feiern und die anstrengenden letzten Monate vergessen … und kein totes Funkenmariechen unter einem Umzugswagen finden. Doch Lou bekommt selten, was sie will. Das Gute ist, dass die Katastrophen-Rentnerin Trudi nicht mitmischen kann, weil sie ihre Spontan-Hochzeit planen muss. Das Schlechte, dass Lous schwangere Chaoten-Schwester lieber auf Mörderjagd geht, als dem Vater von der frohen Kunde zu erzählen. Aber alles ist besser, als sich mit ihrer Beziehungs-Baustelle namens Rispo zu beschäftigen – also kämpft Lou sich durch eine Menge Pailletten, persönliche Krisen und eine Horde Jecken, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Und schon sehr bald werden zwei Dinge klar: Betrunkene Zeugen sind keine guten Zeugen – und die Tote ist nicht das einzige Funkenmariechen, auf das es der Mörder abgesehen hat!
Alle Bände der Louisa-Manu-Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Erste Leser:innenstimmen
„Endlich geht meine liebste Cosy Crime-Reihe weiter, ich habe wieder so viel gelacht!“
„Mit Louisa Manu wird es einfach nie langweilig.“
„Diesmal ermittelt Lou an Karneval – herrlich witzig, spannend und an die Seiten fesselnd!“
„Ich liebe Saskia Louis‘ humorvollen Schreibstil und ihre chaotisch, aber charmanten Charaktere sehr.“
Über die Autorin
Saskia Louis lernte durch ihre älteren Brüder bereits früh, dass es sich gegen körperlich Stärkere meistens nur lohnt, mit Worten zu kämpfen. Auch wenn eine gut gesetzte Faust hier und da nicht zu unterschätzen ist … Seit der vierten Klasse nutzt sie jedoch ihre Bücher, um sich Freiräume zu schaffen, Tagträumen nachzuhängen und den Alltag einfach mal zu vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast, und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
Louisa Manus Lieblingsjahreszeit hält Einzug in Köln: Karneval. Sie will trinken, feiern und die anstrengenden letzten Monate vergessen … und kein totes Funkenmariechen unter einem Umzugswagen finden. Doch Lou bekommt selten, was sie will. Das Gute ist, dass die Katastrophen-Rentnerin Trudi nicht mitmischen kann, weil sie ihre Spontan-Hochzeit planen muss. Das Schlechte, dass Lous schwangere Chaoten-Schwester lieber auf Mörderjagd geht, als dem Vater von der frohen Kunde zu erzählen. Aber alles ist besser, als sich mit ihrer Beziehungs-Baustelle namens Rispo zu beschäftigen – also kämpft Lou sich durch eine Menge Pailletten, persönliche Krisen und eine Horde Jecken, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Und schon sehr bald werden zwei Dinge klar: Betrunkene Zeugen sind keine guten Zeugen – und die Tote ist nicht das einzige Funkenmariechen, auf das es der Mörder abgesehen hat!
Alle Bände der Louisa-Manu-Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Impressum
Erstausgabe September 2022
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98637-635-2 Hörbuch-ISBN: 978-3-98637-673-4 Taschenbuch-ISBN: 978-3-98778-043-1
Covergestaltung: ArtC.ore-Design / Wildly & Slow Photography unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © Andrii Komashko, © Bella_photo Lektorat: Janina Klinck Korrektorat: Katrin Gönnewig
E-Book-Version 21.11.2025, 15:27:36.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Jetzt auch als Hörbuch verfügbar!
Ein totes Funkenmariechen bleibt selten alleinLouisa Manu ermittelt wieder … als Käse verkleidet
Für Veit, weil er immer über meine Witze lacht … bevor er mich glucksend ansabbert. Es ist mir eine Ehre, deine Tante zu sein!
Kapitel 1
„Willst du … mich heiraten?“
Ich lächelte und seufzte schwer. „Ja.“
„Bist du sicher?“ Mein Gegenüber kratzte sich nachdenklich das Kinn. Seine Gesichtsfarbe wirkte neben all den Pflanzen in meinem Verkaufsraum gleich noch ein wenig grünlicher.
„Bin ich.“
„Ich weiß nicht so recht, Louisa. Vielleicht ja eher: Willst du meine Frau werden?“
„Nein, nein. Wirklich.“ Ich schüttelte den Kopf und drehte den Ritterhelm in meinen Händen. „Mir gefällt die Heiraten-Version deutlich besser. Gerade die dramatische Pause in der Mitte. Sehr schön.“
Manfred rieb sich noch immer unschlüssig über das Gesicht, sodass seine Falten Wellen schlugen. Als hätte man einen Stein in einen See geworfen. Mit der freien Hand klammerte er sich sichtlich nervös an meinem Verkaufstresen fest, sodass ich Angst um das weiche Kiefernholz bekam.
„Du hast keinen Grund, so nervös zu sein“, versicherte ich ihm aufmunternd. „Trudi wird mit Sicherheit Ja sagen!“
Manfred war seit fast einem Jahr mit meiner ehemaligen Mitarbeiterin und jetzt nur noch verrückten Freundin Trudi zusammen. In Seniorenzeit also schon eine halbe Ewigkeit. Zumindest hatte er mir versichert, dass ein Mann von seiner Klasse eine elegante Frau wie Trudi einfach nicht länger warten ließ. Sie waren schließlich keine sechzig mehr!
„Wird sie“, stimmte jetzt auch meine Schwester Emily zu, die neben mir auf einem Hocker saß und in einem Handspiegel prüfte, ob ihre blaue Gesichtsfarbe noch saß. „Weil sie Partys toll findet und eine schmeißen darf, wenn sie dich heiratet – das lässt sie sich nicht entgehen.“
„Und natürlich, weil sie dich liebt“, setzte ich pflichtbewusst hinzu.
Emmi winkte ab. „Jaja, das auch.“
„Meint ihr?“, fragte er unsicher und strich sich nervös den Frack glatt, bevor er sich mit den Fingern die Haare über die Glatze kämmte.
„Ja“, sagte ich fest. „Sie ist begeistert von dir!“
Er war schließlich ein reicher ehemaliger Steuerberater in seinen späten Siebzigern, der noch alle Zähne hatte, das Rockinstrument Akkordeon beherrschte und einen nicht allzu haarigen Rücken besaß. Der menschliche Jackpot, wenn man Trudi fragte. „Und ich muss sagen, Manni, deine Verkleidung als Bräutigam ist auch sehr cool.“ „Bräutigam?“ Verdutzt blickte er an sich hinunter. „Ich bin ein Pinguin.“
Oh. Das erklärte die orangene Nase. Ich war davon ausgegangen, dass er zu viele Karotten gegessen hatte. „Meine ich doch!“, sagte ich hastig, stellte den Ritterhelm auf dem Tresen ab und klopfte ihm lächelnd auf die Schulter.
Einige Sekunden lang sah er mich skeptisch an, dann nickte er jedoch. „Danke. Okay, ich geh noch mal kurz in dein Büro und übe den Antrag. Es ist schon fast elf, Trudel wird bald hier sein!“
Mit roten Flecken auf Wangen und Hals wuselte er durch die Tür neben dem Tresen, die in mein Arbeitszimmer führte, das aus siebzig Prozent Schreibtisch und dreißig Prozent Kekskrümeln bestand.
„Wow, mit Ende siebzig heiraten“, meinte Emily, sobald die Tür ins Schloss fiel, und zog meinen Ritterhelm vom Tisch. „Eigentlich keine schlechte Idee, oder? Vielleicht sollte ich auch so lange warten – dann ist eine Scheidung zumindest sehr viel unwahrscheinlicher. Ich meine, es klingt irgendwie besser, wenn man sagt: Ich bin verwitwet und nicht etwa: Ich bin geschieden.“ Nachdenklich knibbelte sie an der Alufolie meines Helms herum. „Meinst du nicht?“
„Ich finde, beides hört sich nicht sonderlich erquickend an“, stellte ich trocken fest. „Und hey, pass auf.“ Ich schnalzte mit der Zunge und zog ihr ungeduldig das Prunkstück meiner Verkleidung aus den Händen. „Nachher geht der Helm kaputt, bevor ich ihn überhaupt benutzt habe. Er ist etwas fragil. Ich hab ihn selbst gebastelt!“
Es war das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich wieder Alufolie benutzt hatte. Zum Kochen verwendete ich sie nämlich nie – Herde und Öfen mochten mich einfach nicht, weil ich sie jahrelang schlecht behandelt hatte. Es war nur fair, ihre Wünsche zu respektieren und mich ihnen nicht auf mehr als drei Metern zu nähern. Seit ich einen Freund hatte, der mit einem Kochlöffel genauso gut hantieren konnte wie mit einer Handfeuerwaffe, musste ich es Gott sei Dank auch nicht mehr.
Meine jüngere Schwester seufzte und verdrehte ausdrucksstark die Augen. „Du bist so ein Nerd, Lou.“
Vermutlich hatte sie recht. Aber ich bezeichnete mich gern als leidenschaftlich. Wenn mich jemand fragen würde, welche drei Dinge ich im Leben am meisten liebte – Menschen ausgeschlossen –, dann wäre die Liste sehr einfach.
Erstens: Blumen und Pflanzen.
Zweitens: Schokolade und ihre Anwendungsbereiche (größtenteils jedoch die in meinem Magen).
Drittens: Karneval.
Und da heute Weiberfastnacht, der Startschuss des Kölner Straßenkarnevals war, hatte ich die letzten Wochen damit verbracht, drei Kostüme zu basteln. Denn nur der jämmerlich einfallslose Karnevalsenthusiast trug sechs Tage lang dasselbe. Ich mochte ein fauler Mensch sein – aber ich war kein fauler Jeck.
Das war nicht weiter verwunderlich, als gebürtige Kölnerin – mit einer Mutter, die die witzigsten roten Pusteln bekam, wenn Konfetti ihren Teppich verunreinigte – floss mir Karneval praktisch durchs Blut. Aber ich hatte bereits mit fünf erkannt, dass Karneval nicht einfach ein Event war. Es war eine Lebenseinstellung. Die Chance, für eine Woche im Jahr jemand anderes zu sein.
Damals hatte meine Mutter mich als Prinzessin verkleidet in den Kindergarten geschickt.
Ich war äußerst unzufrieden mit der Kostümwahl gewesen. Denn eigentlich hatte ich als Kartoffel gehen wollen. Mein Bruder Jannis hatte mir erzählt, dass diese innerhalb von neunzig Tagen ausgewachsen waren – was mir zu dem Zeitpunkt wie ein gutes Ziel erschienen war.
Aber nein, meine Mutter hatte mich in ein pinkes Kleid gesteckt, mir die Haare geflochten und meinen Kopf mit einer Krone verziert.
Der Kragen des Kleides hatte furchtbar gekratzt, der Saum meine Knöchel gekitzelt und die Krone unangenehm gedrückt. Also hatte ich, sobald meine Mutter mich an der Garderobe abgesetzt hatte, den Kragen zerrissen, die Krone zerbrochen und den Saum fachmännisch mit einer Schere zerfetzt.
Den Erzieherinnen hatte ich erzählt, dass ich als Prinzessin gehen würde, die soeben siegreich aus einem Kampf mit einem Drachen hervorgegangen war.
Die anderen Kinder waren so beeindruckt von meinem Aufzug gewesen, dass ich an diesem Tag das bunteste Glitter, die schönsten Wachsmalstifte und drei Schokopuddings mein Eigen hatte nennen dürfen.
Das war es definitiv wert gewesen, am selben Abend von meiner Mutter ohne Nachtisch ins Bett geschickt zu werden. Ich hatte ohnehin Bauchschmerzen gehabt.
Was mir dieser Tag also bewiesen hatte: Karneval war magisch und machte Träume wahr. Wenn man wollte, konnte man ein völlig anderer Mensch sein!
Als Jugendliche, die den Großteil ihrer Schulzeit damit verbracht hatte, lateinische Pflanzennamen auswendig zu lernen und den Spitznamen Loser-Lou nicht allzu ernst zu nehmen, war das wundervoll gewesen. Mittlerweile war ich jedoch kein unsicherer Teenager mehr und nutzte Karneval so wie jeder andere vernünftige Erwachsene auch: um sich zu betrinken, albern anzuziehen, kölsche Lieder zu grölen, zu viele Berliner zu essen und generell zu ignorieren, dass man keine achtzehn mehr war. Und Emmi konnte mir erzählen, was sie wollte, ich war nicht die Einzige, die Karneval liebte. „Um elf Uhr elf machen wir aber schon zu, oder?“, fragte sie und betrachtete ihre blauen Fingernägel. „Ich meine … wir können nicht nicht zu machen! Das wäre Ketzerei.“
Ich grinste. „Natürlich. Wir haben eine Tradition aufrechtzuerhalten. Also schließen wir den Laden und gucken den Reiterzug Jan von Werth an. Wie jedes Jahr.“
Erleichtert ließ sie die Schultern sinken. „Gut, ich hab Finn nämlich schon gesagt, dass wir uns dort treffen. Es ist übrigens gemein, dass Leonie heute freibekommen hat.“
Leonie war die zweite Azubine meines Blumenladens Louisa’s Flower Power und zu Emilys Verdruss eine weitaus bessere und fleißigere Mitarbeiterin als sie.
„Leonie läuft gleich als Tanzmariechen im Eröffnungszug mit“, erinnerte ich sie. „Natürlich hat sie freibekommen.“
„Mhm“, machte Emily unzufrieden, bevor sie eine äußerst lädiert aussehende PET-Flasche aus ihrer Handtasche zog, die mit einer dunkelroten Flüssigkeit gefüllt war, die verdächtig nach Wein aussah aus.
Ungläubig schnappte ich sie ihr aus den Fingern. „Emmi!“, zischte ich. „Du bist schwanger. Du darfst nicht trinken.“
Meine Schwester hatte vor wenigen Wochen erfahren, dass sie überraschenderweise ein Kind erwartete. Vater war Finn, ihr bester Freund, Bruder meiner besseren Hälfte Josh und ahnungsloser Schlucker – denn Emily hatte ihn noch nicht von seinem Glück unterrichtet.
„Danke, Mama, das weiß ich selbst“, erwiderte Emily verärgert. „Es ist Traubensaft. Ich muss doch wenigstens so tun, als würde ich saufen. Sonst wird Finn misstrauisch.“
Ich seufzte schwer. „Wäre es nicht simpler, es ihm einfach zu sagen?“
Emily presste die Lippen zusammen. „Nein, wäre es nicht. Ich weiß ja selbst noch nicht, ob ich es behalten will oder nicht. Abgesehen davon will ich, dass Finn mit mir zusammen sein möchte, weil ich der beste Mensch auf der ganzen Welt bin – nicht, weil sein Samen in mir gesprossen ist.“
Ich zog eine Grimasse. „Nette, bildliche Beschreibung – und das verstehe ich, Emmi. Aber du verpasst hier womöglich eine Chance. Ich meine: Sag es ihm doch, wenn er richtig betrunken ist“, schlug ich vor. „Um den Schlag zu mildern.“ „Gott, nein.“ Emmi schüttelte heftig den Kopf. „Dann vergisst er es wieder und ich muss es ihm noch mal sagen. Nein, nein. Ich werde Traubensaft trinken, so tun, als wäre ich angeschippert, mich von Pralinenschachteln am Kopf treffen lassen und Kindern ihre Strüßje klauen. Wie jedes Jahr. Finn schöpft keinen Verdacht, ich habe Pralinen und Strüßje … alle gewinnen.“
Seufzend legte ich einen Arm um ihre Schultern. „Emily, ich weiß, dass du Angst hast, es ihm zu sagen … aber vielleicht würde es dir ja guttun, ehrlich zu sein. Nicht mehr allein zu sein. Zu wissen, was Finn denkt.“
Sie schnaubte und schüttelte meinen Arm ab. „Ehrlichkeit hat noch niemandem geholfen und wenn Finn dieses Wochenende wieder versucht, mich ins Bett zu bekommen, dann weiß ich zumindest, dass wir eine Chance haben. Das würde mich beruhigen.“
„Schön“, kapitulierte ich und hob die Hände. „Es ist deine Sache. Aber es tut mir schon leid für dich, dass du dieses Jahr keinen Alkohol trinken darfst.“
„Warum?“ Aufmüpfig reckte Emily das Kinn. „An Karneval geht es doch nicht ums Trinken.“
Ich schwieg.
„Na gut, nicht nur!“, korrigierte sie sich verärgert. „Aber ich brauche keinen Alkohol oder Gras, um Spaß zu haben.“ Wehleidig verzog sie das Gesicht. „Auch wenn sie wirklich helfen.“
Ich wollte Emily gerade ein paar tröstende Worte schenken, als die Tür aufging und Josh hereinkam.
Kommissar Joshua Rispo war eine dunkelhaarige, eins neunzig große Erscheinung, die mein Herz noch immer höherschlagen ließ. Ein Mann mit Marshmallowherz, aber dreckigen Fantasien – also genau nach meinem Geschmack.
Er war seit zwei Jahren mein Freund, seit seiner Kindheit ein bekennender Schwarzmaler, seit seiner Ausbildung zum Kriminalkommissar zertifiziertes Megafon und seit ich ihn kannte, davon überzeugt, dass ich der Grund seines frühen Todes in Form eines Herzinfarktes sein würde. Und das nur, weil ich den Hang dazu hatte, mich in gefährliche Situationen zu begeben, blutrünstigen Mördern nachzustellen und unsere gemeinsame Wohnung in ein Gewächshaus zu verwandeln, wann immer ich gestresst war.
Meiner Meinung nach war er einfach ein wenig zu zart besaitet.
Heute trug er Jeans, einen schwarzen Mantel und einen verdrießlichen Gesichtsausdruck, sah also aus wie immer. Normalerweise mochte ich diesen Aufzug. Aber nicht an Weiberfastnacht!
„Du hast dich nicht verkleidet!“, rief ich entrüstet. „Klar hab ich das“, sagte er leichthin und ließ die Tür fallen. „Ich geh als Inkognito-Polizist.“ Ich stemmte die Hände in die Seiten. „Josh! Du meintest, du hättest ein Kostüm, ich müsse mir keine Gedanken darum machen.“
„Nun, ich habe offensichtlich gelogen“, stellte er sachlich fest. „Reiner Selbstschutz. Du hättest mich sonst als Einhorn verkleidet oder so was.“
Oh, Rispo als Einhorn. Das war eine fantastische Idee! Das musste ich mir merken.
„Siehst du!“, meinte er vorwurfsvoll und deutete mit dem Zeigefinger auf mich. „Du hast jetzt schon dieses verrückte Glitzern in den Augen bekommen, das da sonst nur erscheint, wenn du mal wieder über eine Leiche stolperst und Miss Marple spielst.“
Verärgert verschränkte ich die Arme. „Es ist egal, wie ich gucke. So nehme ich dich nicht mit auf den Umzug.“
„Ich weiß gar nicht, was du hast, Lou“, meinte Emmi abwesend. „Er hat sich doch verkleidet. Er geht offensichtlich als Spielverderber.“
„Nehm ich“, sagte Josh zufrieden.
„Nein!“, rief ich sofort.
Ich hatte noch nie mit Josh Karneval gefeiert, weil er die letzten Jahre über immer hatte arbeiten müssen, und er würde mir den Spaß nicht verderben. „Ernsthaft, Josh! Du bist Kölner! Wenn du dich nicht verkleidest, schmeißen sie dich aus der Stadt.“ Rispo verdrehte die Augen. „Ein bisschen dramatisch, findest du nicht? Ich hab Bereitschaft – und ich mag Karneval nicht.“ Emmi zog schockiert die Luft ein. „Aber du bist Kölner!“, echote sie meine Worte „Ich weiß.“ „Du wurdest hier geboren!“ „Ich weiß!“ „Josh, das ist Ketzerei!“ „Oh, großer Gott, ist es nicht! Glaubt mir, wenn ihr Polizist wärt, würdet ihr Karneval auch nicht mögen.“
Emily und ich wechselten einen Blick und schüttelten dann unisono den Kopf. „Dumme Ausrede“, verkündete ich.
„Das ist noch lange kein Grund, sich nicht zu verkleiden“, unterstützte Emily mich.
Josh hob nur die Schultern. „Ist mir egal. Ich wiederhole: Ich hab Bereitschaft. Und es könnte mitunter peinlich werden, als Einhorn verkleidet bei einem Tatort aufzutauchen.“ „Ach was.“ Emily schüttelte den Kopf. „Viele Zeugen reden sehr viel lieber mit einem Einhorn als mit einem Polizeibeamten. Abgesehen davon: Kein vernünftiger Kölner mordet an Karneval. Das wäre als ob … ein Pastor am Sonntag mordet!“
Ich lächelte unschuldig. „Dagegen kannst du nicht argumentieren, Josh.“
Düster sah er mich an.
„Setz dir zumindest einen komischen Hut auf, oder so“, schlug ich vor. „So können wir wirklich nicht mit dir vor die Tür.“ „Ich hab keinen komischen Hut!“ „Oh, ich weiß!“ Meine Miene erhellte sich und hastig lief ich um den Tresen herum, um mir einen der Blumenkränze zu schnappen, die ich für Hochzeiten verkaufte. Zufrieden fuhr ich durch Joshs Haare, bevor ich ihn kunstvoll darauf drapierte und mit einer Klammer aus meinen eigenen Haaren fixierte. „Tadaa. Jetzt gehst du als Blumenmädchen.“ Joshs Blick wurde gleich noch ein wenig griesgrämiger. „Als unzufriedenes Blumenmädchen“, spezifizierte ich.
„Schön“, sagte er, sein Tonfall überraschend leicht und freundlich. „Von uns allen sehe ich trotzdem am hübschesten aus. Ich meine: Wenigstens gehe ich nicht als Käselaib.“ Er deutete an meinem löchrigen, gelben Gewand hinab.
„Ich gehe nicht als Käse!“, stellte ich klar, nahm mir den Ritterhelm und setzte ihn auf. „Das hier ist mein ganzes Kostüm.“
Stirnrunzelnd betrachtete er mich. „Was soll das sein?“
Ich klappte das Visier nach oben und lächelte breit. „Ich gehe als Mittelalter Gouda.“
Rispos Mundwinkel zuckten. „Ah, du hast dich also für das sexy Kostüm entschieden.“ „Humor ist sexy“, unterrichtete ich ihn angesäuert.
„Oh, auf jeden Fall“, sagte Josh ernst und drückte meine Hand. „Wer wäre ich, mich gegen ein wenig guten Käse-Humor auszusprechen?“
Emily kicherte. „Du siehst aber wirklich albern aus, Lou.“
„Natürlich tue ich das!“, meinte ich verärgert. „Ariane und Trudi sind ja auch nicht hier. Es ist ein Gruppenkostüm. Ohne jungen und alten Gouda wirkt es nicht.“
„Mhm, klar“, meinte Emmi süffisant grinsend.
Ich entschloss, sie zu ignorieren. Ich war sehr stolz auf das Kostüm und nur, weil Rispo und sie keinen Geschmack hatten, würde ich mir den Tag nicht versauen lassen.
„Was bist du denn, Emily?“, riss Josh mich aus den Gedanken und betrachtete verwirrt meine blau angemalte und stark gepolsterte Schwester.
„Ein Blauwal!“, sagte sie und verdrehte die Augen. „Ernsthaft Joshi, du hättest in Bio besser aufpassen sollen. Das ist doch offensichtlich.“ „Ah.“ Er nickte. „Sorry. Ich dachte, du wärst vielleicht ein Schlumpf, der in einer Keksdose gefangen gehalten wurde.“
Ich lächelte, doch Emmi fand das überhaupt nicht witzig. „Weißt du, ich würde sehr viel lieber als sexy Krankenschwester oder süße Erdbeere gehen oder so, aber ich dachte, wenn ich so tue, als wäre ich dick, kann sich Finn schon mal an den Gedanken gewöhnen. Weil ich ja bald ohnehin aufgehen werde wie ein Ballon.“ Sie räusperte sich und lief rot an. „Falls ich das Baby behalte, natürlich.“
Rispo und mir wurde es verwehrt, einen weiteren Kommentar zu machen, denn die Tür ging auf ein Neues auf.
Meine ehemalige Angestellte Trudi war ja schon zu Nicht-Karnevalistischen Anlässen eine fantastische Erscheinung. Doch heute hatte sich die laut Manni eleganteste Frau, die er jemals kennengelernt hatte, selbst übertroffen.
Ein löchriges Käseleibchen schlackerte lose um ihren dürren Körper. Das Lätzchen um ihren Hals passte farblich zu der Babyrassel in ihrer Hand. Und die Windel, die ihr als Hose diente, ließ jedes Baby in zwei Kilometern Entfernung vor Neid erblassen. Die grauen Haare hatte sie zu zwei kleinen Zöpfen gefasst, die frech von ihrem Kopf abstanden.
Wow, sie hatte ihre Kostüminstruktionen wirklich sehr ernst genommen.
„Habe ich das richtig verstanden: Trudi ist der junge Gouda?“, flüsterte mir Josh zweifelnd ins Ohr. „Na ja, Trudi meinte, sie ist schon alt, da hat sie es nicht eingesehen, sich auch noch als alt zu verkleiden“, wisperte ich achselzuckend zurück.
„Windeln sind unglaublich bequem und praktisch, Louisa!“, begrüßte sie mich begeistert. „Das vergisst man schnell.“
„Du siehst wundervoll aus, Trudi“, bemerkte Emily und schaffte es dabei, todernst auszusehen. „Einen hübscheren jungen Gouda habe ich noch nicht gesehen!“
Die alte Dame lief babybelrot an. „Oh, vielen Dank, Emmi. Du bist aber auch eine schöne Seifenblase.“ „Ein Blauwal! Ich bin ein Blauwal!“, stöhnte Emily. „Mist. Ach, egal. Seifenblasen sind auch dick und rund. Es macht also eigentlich keinen Unterschied.“
„Und ich bin es, der im Biologieunterricht besser hätte aufpassen sollen …“, murmelte Josh.
„Sagt mal, ist Manfred schon hier?“, wollte Trudi wissen und sah sich um, als könnte der alte Herr sich hinter dem Tresen verstecken.
„Oh ja“, fiel mir ein. Hastig lief ich zur Tür meines Büros und klopfte.
Showtime. Ich hoffte sehr, dass Manfred genug geübt hatte. Zumindest die Entscheidung zwischen „Willst du mich heiraten?“ und „Willst du meine Frau werden?“ sollte gefallen sein.
Manni riss die Tür auf, sodass ich ihm beinahe auf die Nase geklopft hätte. Doch er beachtete meine Hand in seinem Gesicht gar nicht, sondern schubste mich hektisch aus dem Weg und atmete tief ein und aus. So als hätte er Angst, gleich den Mut zu verlieren.
Im nächsten Moment presste er beide Hände auf die Brust und fixierte Trudi. „Trudel. Du siehst wunderschön aus. Ich habe mich zu einem Laib Gouda noch nie so sexuell hingezogen gefühlt“, sagte er feierlich.
Trudi lief rosarot an und machte eine wegwerfende Handbewegung. „Du bist immer so ein Charmeur, Manni.“
Wir würden da alle ihrem Urteilsvermögen vertrauen müssen. Uns blieb auch gar keine Zeit, zu widersprechen, da Manfred eine Sekunde später auf die Knie sank.
„Trudel, du bist der Sprudel in meinem Wasser. Die Tasten meines Akkordeons … Willst du meine Frau heiraten?“
Mein Herz zog sich schmerzlich-süß zusammen und ergriffen legte ich eine Hand auf die Brust. Manfred hatte völlig umsonst geübt, aber rührend war das Ganze trotzdem.
Trudi trat einen Schritt vor und beugte sich irritiert zu ihrem Liebhaber hinunter. „Was?“, fragte sie laut.
„Ähm, entschuldige, ich habe gefragt: Willst du mich heiraten?“
„Oh mein Gott“, hauchte ich.
„Ich glaube, Trudi hat ihn immer noch nicht verstanden“, murmelte Josh an meinem Ohr.
„Pscht“, machte ich scharf, den Blick noch immer auf den am Boden knienden Mann gerichtet.
„Ich verstehe dich nicht, Manni, du musst lauter reden“, bemerkte Trudi seufzend. „Und was tust du auf dem Boden? Von da kommst du doch nie wieder hoch.“
Man musste es Manni lassen. Er bewies eine Menge Geduld. Ich hätte jetzt schon das Handtuch geworfen. Doch mit ernsten, großen Augen sah er zu seiner Angebeteten hoch und schrie: „Heiraten, Trudi! Willst du heiraten!“
Perplex sah sie ihn an. „Wen?“
„Mich natürlich!“
„Oh.“ Ihre Miene erhellte sich und sie strahlte in ganzer Käsepracht. „Auf jeden Fall!“
Manfred lächelte selig. „Fantastisch. Ich hab jetzt keinen Ring, weil nie Platz an deinen Fingern ist.“ Er deutete zu ihren Händen, an denen bestimmt sieben verschiedene Klunker hingen. „Aber ich dachte, du willst ihn ohnehin lieber selbst aussuchen.“ Trudis Jauchzen nach zu urteilen, lag er mit dem Gedanken völlig richtig. „Ich würde dich jetzt sehr gern küssen, aber ich kann mich unmöglich so weit herunterbeugen.“ Tadelnd schüttelte sie den Kopf. „Das hättest du dir wirklich vorher überlegen sollen, Manni. Deine Knie sind doch auch nicht mehr die besten.“
„Welche Knie?“, fragte er verwundert. „Ich spüre sie nicht mehr …“ Sein Blick glitt zu Josh und mir. „Kann mir mal jemand aufhelfen? Ich komm von allein nicht hoch.“
„Oh, klar“, sagte ich hastig und griff zusammen mit Josh unter seine Arme, um ihn zurück auf die Füße zu hieven. Trudi fiel Manfred um den Hals, sie küssten sich … und seufzend ließ ich mich gegen Joshs Schulter sinken. „So süß!“, hauchte ich. „Ja. Käselaib und Pinguin. Eine Liebesgeschichte für die Geschichtsbücher“, erwiderte er trocken.
Ich musste lachen und stieß ihm mit den Ellenbogen in die Seite. „Benimm dich. Sonst wirst du vielleicht kein Blumenmädchen auf ihrer Hochzeit.“
Josh schnaubte und legte den Arm um mich, kam jedoch nicht zu einer Antwort, denn Emmi nutzte die zeitweilige Stille, um fest in die Hände zu klatschen.
„Okay, Leute!“, verkündete sie und wedelte mit den Händen über ihrem Kopf hin und her. „Das war ja alles ganz toll und romantisch und alles, aber wir müssen jetzt wirklich los. Es ist elf Uhr elf. Ich will betrunkenen Leuten dabei zusehen, wie sie versuchen, Kamelle zu fangen, und dabei hinfallen.“ Das war ein sehr ehrenwertes Vorhaben – und wer war ich, einem so majestätischen Blauwal wie ihr zu widersprechen?
Kapitel 2
Die Kölner Südstadt an Weiberfastnacht musste man sich wie einen Kindergeburtstag vorstellen, der vollkommen aus dem Ruder gelaufen war.
Es fing gesittet an. Die Gäste waren hübsch verkleidet und sorgfältig geschminkt, für fröhliche, moderne Musik war gesorgt. Doch dann war die Limo durch Kölsch ausgetauscht worden, sodass die Eltern sturzbesoffen durch den Garten taumelten, etliche Süßigkeiten mit zu Boden rissen und der angemietete Clown bewusstlos unterm Tisch lag. Die fröhliche Musik war durch alte Schunkelmusik von Oma ersetzt worden, sodass schöne, wortgewaltige Gesänge wie: „Ich ben e’ne Kölsche Jung, wat willste maache?“ oder „Ich kumm us dä Stadt met K, Schalalala … Schalalala … Schalalala …“ laut wurden.
Es war fantastisch!
Geordnetes Chaos. Okay, nein. Chaotisches Chaos. Aber damit war ich vertraut. Mein halbes Leben bestand daraus.
Der „Wieverfastelovendzoch“ startete traditionell am Chlodwigplatz und circa zwanzig befreundete Korps und Gesellschaften nahmen an dem „Zoch mit Jan un Griet“ teil. So auch die Goldfunken, die Tanzgruppe, der Leonie angehörte.
Da es am Chlodwigplatz jedoch unfassbar voll war, arbeiteten wir uns die Severinstraße entlang und suchten nach einem Platz, an dem noch keine Dutzenden Minions, Tom-Cruise-Top-Gun-Verschnitte oder betrunkene Teletubby-Teenies standen.
Emily lief mit gerecktem Kinn vor, auf der Suche nach Finn und Ariane, die wir hier treffen wollten, während das frisch verlobte Paar hinter uns herdackelte. Sie bräuchten die Zweisamkeit, hatte Trudi mir erklärt. Wie sie die haben wollten, während Betrunkene Kölle Alaaf in ihre Ohren grölten und ihnen Kölsch auf die Schuhe kippten, war mir schleierhaft – andererseits waren sie ein sehr schwerhöriges Paar. Das könnte heute von Vorteil sein.
Zu meiner Überraschung hatte Josh, der die letzten Minuten über verdächtig still gewesen war, sich den Blumenkranz noch nicht vom Kopf gerissen. Er gab sich wirklich Mühe, wenigstens so zu tun, als hätte er Spaß, und das wusste ich zu schätzen.
Nachdenklich sah ich zu ihm auf. War er nur ein guter Schauspieler, oder …?
„Du hasst alles hier dran, oder?“, mutmaßte ich.
„Jup“, war seine knappe Antwort.
Ich lachte. Okay, er war ein guter Schauspieler.
„Ich fang dir einen Blumenstrauß, dann wird alles gut“, versprach ich und klopfte aufmunternd auf seinen Bizeps.
Er hob einen Mundwinkel und nickte, schien aber immer noch etwas abwesend.
„Alles okay?“, hakte ich nach.
„Ja, ich hab nur gerade gedacht … na ja.“ Er kratzte sich den Nacken und blickte zu mir herunter. „So kann ein Heiratsantrag auch laufen. Er fragt. Sie antwortet. So schwer ist das nicht, oder?“ Vielsagend hob er die Augenbrauen.
Meine Wangen wurden heiß und ich war versucht, hastig den Ritterhelm über den Kopf zu stülpen. Doch Josh hatte es ja ohnehin schon gesehen. Durch seine Arbeit als Kriminalkommissar war er leider lächerlich aufmerksam. Ein gutes Gedächtnis hatte er durch seinen Job auch.
Was fast schade war, denn es hätte mir deutlich an Druck genommen, wenn er einfach wieder vergessen hätte, dass er mich vor zwei Wochen gefragt hatte, ob ich ihn heiraten wolle und ich ihm noch immer keine richtige Antwort gegeben hatte.
„Na ja, Manni hat die letzten Monate auch nicht versucht, wie ein Besessener den Mord an seiner Mutter aufzuklären“, verteidigte ich mich langsam. „Er ist nicht beinahe gestorben und hat nicht vergessen, was wichtig in seinem Leben ist.“
„Sieh ihn dir an, Lou“, meinte Josh seufzend und nickte über seine Schulter zu Manni, der gerade stirnrunzelnd seinen Kopf abtastete. „Er hat vergessen, dass die Brille auf seiner Nase sitzt – sicher, dass er nicht auch ab und an vergisst, was wichtig im Leben ist?“
Ich zog eine Grimasse. „Ich antworte dir noch, Josh“, murmelte ich und griff nach seiner Hand. „Wirklich. Wenn ich sicher bin, dass wir wieder … wir sind.“
Die letzten Monate waren unfassbar anstrengend gewesen. Josh und ich hatten uns kaum gesehen, zu viel gestritten und zu vielen Mördern nachgestellt. Es war eine schwere Zeit mit einer Menge Probleme gewesen. Problemen, die ich lösen wollte, bevor wir heirateten.
Ich wollte mit Josh zusammen sein. Auf die kitschige „Für immer und ewig“ Art und Weise. Aber ich wollte sicher sein, dass er der Mann war, den ich liebte, nicht der Verrückte, der Auftragskillern in Gewächshäusern nachstellte und sich beinahe umbringen ließ. Der Mann, der den Mord seiner Mutter ruhen lassen und wieder im Jetzt leben konnte.
Josh seufzte leise und drückte meine Finger. „Ja, und ich will dich nicht drängen. Du kannst dir die Zeit nehmen, die du brauchst. Aber wenn du erst in zwei Wochen oder aber auch erst in zwei Monaten deine Entscheidung fällst, ist mein Antrag eigentlich schon wieder verjährt“, stellte er fest.
„Anträge können verjähren?“, fragte ich perplex.
„Jap. Mord ist das Einzige im Leben, das nicht verjährt“, erklärte er sachlich. „Ich müsste also noch mal fragen und wenn du schon wieder keine Antwort hättest, könnte das ernsthaft an meinem Ego kratzen.“
Ich verdrehte die Augen, musste jedoch schmunzeln. „Dein Ego ist groß genug, Josh. Du wirst es verkraften. Und ich kann dir ja einfach sagen, wenn du noch mal fragen sollst.“
„Ah, aber das würde dem Ganzen doch etwas die Romantik nehmen, meinst du nicht?“
Ich blies die Wangen auf und wiegte den Kopf von der einen auf die andere Seite. „Ja, vermutlich schon. Aber ich weiß nicht recht, wie wir dein Problem sonst lösen sollen.“
„Oh, ich weiß, wie“, antwortete er sofort. „Ich frag dich einfach nicht mehr.“
Abrupt blieb ich stehen, während mein Herz zwei Stockwerke tiefer sank. „Was? Du willst mich nicht mehr heiraten?“
„Doch!“, sagte er hastig und strich beruhigend mit dem Daumen über meinen Handrücken. „Aber du bist jetzt dran“, erklärte er. „Du weißt, was ich will … wenn du bereit bist, kannst du ja mich fragen. Dann muss ich nicht mehr die ganze Zeit darüber nachdenken.“
Verblüfft öffnete ich den Mund. „Ist das dein Ernst?“
„Jap.“ Er nickte, sichtlich zufrieden mit sich selbst. „Im Zeitalter der Emanzipation ist es doch ohnehin nicht mehr wichtig, wer die Frage stellt, richtig?“ Erwartungsvoll hob er die Augenbrauen.
„Ähm … na ja …“ Etwas überfordert kratzte ich mir den Kopf.
Er hatte schon recht. Eigentlich war es vollkommen egal, wer die Frage stellte. Aber das Zeitalter der Emanzipation unterschied sich leider vom Zeitalter der Liebesromane, die ich las, und den vorviktorianischen Netflix-Dramen, die ich sah. Und eigentlich …
„Gut, dann ist die Sache entschieden“, sagte er knapp. „Du bist es, die mir einen Antrag machen muss. Und ich will Blumen und einen Kniefall und den ganzen Mist.“ Er richtete den Zeigefinger auf mich. „Deine Chance, mir zu beweisen, wie sehr du mich liebst.“
„Du hast deinen Antrag neben der Mülltonne meiner Mutter gemacht!“, sagte ich ungläubig.
„Ja, aber mein eigentlich geplanter Antrag hat Kerzenlicht, mittelmäßigen Wein, hübsche Blumen und Lasagne involviert. Das ist es also, was es zu schlagen gilt.“
Oh Gott. Wie sollte ich Rispos Lasagne etwas entgegensetzen? Das war unmöglich!
Ich war auch wirklich keine romantische Person. Ich hatte meine Kuscheltiere früher immer zwischen Pappkartons und Rasenmäher in unserer Garage verheiratet. Und das auch nur, um am Ende so tun zu können, als würde ich Torte essen.
Der Heiratsantrag müsste persönlich auf Josh zugeschnitten sein – und er mochte Blumen nicht einmal besonders. Pralinen, Herzchen und Kerzen ebenso wenig.
Also … würde ich zwischen seinen Hanteln und seiner Dienstwaffe auf die Knie sinken? Das erschien mir irgendwie nicht richtig.
„Muss ich dir dann auch einen Ring besorgen?“, wollte ich wissen und kniff die Augen zusammen. „Ich weiß deine Ringgröße gar nicht. Wie zur Hölle hast du überhaupt meine herausgefunden?“
„Hab einen deiner Ringe geklaut und mit zum Juwelier genommen“, meinte er achselzuckend. „Und nein, ich brauch keinen Ring. Aber du kannst mir gern irgendetwas anderes schenken.“
Oh nein. Irgendetwas anderes war viel zu vage! Und überhaupt …
„Du hast mir einfach einen meiner Ringe gestohlen? Das ist ganz schön kriminell von dir“, stellte ich überrascht fest.
„Hallo, Felsblock, hier spricht das Glashaus“, murmelte er freundlich und legte eine warme Hand in meinen Nacken. „Ich stelle dir jetzt eine Frage: Was ist schlimmer? Ein Schmuckstück seiner Freundin auszuleihen, um ihr einen passenden Verlobungsring kaufen zu können – oder aber geheime Polizeiakten in der Badewanne zu versenken, in den Zoo einzubrechen, an einem illegalen Autorennen teilzunehmen …“
„Ist ja schon gut, du kannst aufhören“, meinte ich augenverdrehend. Dieses Spiel konnte ich nur verlieren. Ach, ich hasste es, wenn er mit Vernunft und guten Argumenten kam!
„Sicher?“, hakte er unschuldig nach. „Denn ich habe noch eine unfassbar lange Liste in meinem Kopf.“
Seufzend ließ ich mich in seine Berührung sinken. „In Ordnung. Ich mache dir den Antrag und besorge dir keinen Ring. Es ist nur fair. Ich halte dich im Moment wirklich etwas hin. Und so musst du dir keine Gedanken mehr darum machen und kannst dich entspannen.“
„Danke“, sagte er lächelnd und küsste mich sacht auf die Schläfe. „Kann ich jetzt den albernen Blumenkranz von meinem Kopf nehmen?“
„Auf gar keinen Fall. Es ist äußerst wichtig, dass du ihn den restlichen Tag aufbehältst.“ Denn ich hatte soeben Finn und Ariane in der Menge vor uns entdeckt und beide wollten sicherlich bewundern, was für ein hübsches Blumenmädchen Josh abgab.
Ich zog ihn an der Hand hinter mir her und setzte den Ritterhelm auf, um meine beste Freundin Ari gebührend zu begrüßen, die eine graue Perücke trug und einen Krückstock in der Hand hielt.
Doch selbst das gelbe Käselaibchen und die falschen Falten auf ihrem Gesicht konnten niemanden täuschen. Sie war noch immer der attraktivste alte Gouda, den ich je gesehen hatte.
„Hallihallo“, rief sie über die laute Musik der Karnevalskapelle hinweg, die den Umzug anführte, und nun an uns vorbeilief. „Mensch, Josh! Du bist ja die schönste Waldnymphe der Welt.“
„Waldnymphe!“, rief ich triumphierend. „Das ist viel besser als Blumenmädchen.“
Josh warf mir einen düsteren Blick zu, der mir zu verstehen gab, dass ich keine Ahnung hatte, was das Wort besser bedeutete.
Finn lachte laut, als er seinen Bruder entdeckte und zückte im nächsten Moment sein Handy, um ein Foto zu machen. „Oh, Joshi, das druck ich mir als Poster aus und hänge es an die Wand!“
„Jaja“, sagte Rispo trocken. „Ich bin wunderschön – und du offensichtlich eine Flasche.“
„Eine Bierflasche“, korrigierte Finn ihn stolz. „Hab die Krone selbst gebastelt.“ Er deutete auf den Wust an Kronkorken auf seinem Kopf, die scheinbar mit Heißklebepistole zu einem künstlerisch nicht wertvollen Müllberg zusammengefügt worden waren. „Und es ist ironisch, weil Glasflaschen doch verboten sind und ich aber eine Glasflasche bin.“ Er deutete an seiner grünen Kleidung hinab.
Emily lachte, bevor sie beeindruckt nickte.
Wenn das kein Beweis dafür war, dass sie noch immer in Finn verschossen war, wusste ich auch nicht – denn das Kostüm sah furchtbar aus.
Irgendwie erleichterte mich der Gedanke, dass Emmi noch Gefühle für Finn hatte. Es konnte nur hilfreich sein, wenn sie den Vater ihres Vielleicht-Kindes mochte. Und Gott sei Dank war Finn im echten Leben keine Flasche.
„Wollt ihr was trinken? Hab Rum-Cola mitgebracht.“ Finn zog eine große Plastikflasche mit dunkler Flüssigkeit aus dem Rucksack, der zwischen seinen Füßen stand. „Aber ist okay, wenn ihr nichts davon wollt, Josh, Lou. So hartes Zeug ist wohl eher was für junge, abenteuerlustige Leute. Hey, Trudi! Willst du einen Schluck?“
Ich klappte mein Visier hoch und presste die Lippen zusammen.
Na ja, meistens war er keine Flasche.
„Oh, nein“, sagte Trudi, die vor ein paar Sekunden mit Manfred zu uns gestoßen war, und winkte ab. „Ich trinke an Karneval ausschließlich Kölsch. Wenn man nur eine Sorte Alkohol trinkt, ist man am nächsten Tag nicht verkatert.“
„Ich wünschte, das wäre wahr“, meinte Ariane seufzend.
Ich musste ihr recht geben. Ich trank mittlerweile nur noch fast ausschließlich Wein und fühlte mich nach einer Flasche am Morgen fast ausschließlich beschissen.
„Emmi, willst du?“ Finn wedelte mit der Flasche vor Emilys Gesicht herum.
„Nein, danke“, sagte sie fröhlich. „Ich hab mir selbst was mitgebracht.“ Sie hielt ihre PET-Flasche mit Traubensaft hoch.
„Rotwein?“, fragte er verwirrt. „Du magst keinen Rotwein.“
Emmi öffnete den Mund und runzelte dann die Stirn.
Sie hatte wohl vergessen, dass das der Fall war.
„Doch“, sagte sie hastig und lief lila an. Rot und Blau waren eine hübsche Kombi. „Ich schätze, meine Geschmacksknospen haben sich weiterentwickelt.“ Sie öffnete die Flasche und trank einen Schluck.
„Okay.“ Finn zuckte die Achseln. „Kann ich auch was haben? Es ist vielleicht klüger, mit Wein einzusteigen.“
Es konnte wohl darüber debattiert werden, ob man überhaupt von klug sprechen konnte, wenn es um frühmorgendliches Trinken ging. Aber das Entsetzen auf Emmis Gesicht, als Finn nach ihrer Flasche griff, rechtfertigte es trotzdem nicht.
„Nein!“, rief sie laut und drückte sie an ihre Brust. „Die ist allein für mich.“
Verdutzt zog Finn die Hand zurück. „Was?“
Emmi riss die Augen auf und sah Hilfe suchend zu mir.
„Ähm …“, sagte ich hastig. „Es ist einfach ein sehr guter Jahrgang. Den würde ich auch nicht teilen wollen.“
„Du hast für Karneval guten Wein gekauft, um ihn dann in eine Plastikflasche zu füllen?“, fragte Finn verwirrt. Das Entsetzen in seiner Stimme hingegen war definitiv gerechtfertigt.
Guten Wein für Karneval zu kaufen, war einfach nur dämlich. Das war, als würde man Meissener-Porzellan bei McDonald’s benutzen.
„Oh, guckt mal! Da ist Leonie“, rief Trudi in diesem Moment und lenkte die Aufmerksamkeit dankenswerterweise auf den Zug vor uns.
Die Gruppe der Goldfunken führte einen großen, als Schiff geformten Umzugswagen an und machte ihrem Namen alle Ehre. Die Jacken der jungen Mädchen waren über und über mit goldenen Pailletten bestickt, die im Sonnenlicht glitzerten und die umherstehenden Leute blendeten. Ihre Faltenröcke hingegen waren rot und mit diversen goldenen Schleifen versehen. Sie waren farblich perfekt auf den Wagen abgestimmt, auf dem Frauen und Männer in ähnlichem Aufzug standen und Süßigkeiten in die Menge warfen.
„Kamelle!“, schrien hundert Leute, während die Goldfunken-Mariechen stehen geblieben waren, um eine Hebefigur zu machen, die mit begeistertem Klatschen und Jubelrufen belohnt wurde.
Meine Mitarbeiterin Leonie stand in der Mitte ihrer Reihen, strahlte in die Menge und schwenkte ihre Arme rhythmisch im Klang der Blaskapelle, die hinter dem Wagen herlief. Ihre dunklen Haare waren zu zwei Zöpfen gebunden und baumelten im Takt der Trommeln um ihr Gesicht.
„Sehr fesch, Leonie!“, rief Trudi so laut, dass selbst der schwerhörige Manni neben ihr zusammenzuckte.
„Das Kostüm sieht süß aus“, stimmte Finn zu.
Emmi warf ihm einen bösen Blick zu. „Jeder in einem Funkenmariechenkostüm sieht süß aus!“
Vielsagend sah Finn zu seinem Bruder. „Ich weiß nicht. Ich glaub, Joshi würden der kurze Rock und die Pailletten nicht stehen.“
„Hey“, verteidigte ich ihn sofort. „Josh hat schöne Beine – und die Pailletten würden seine Augen zum Strahlen bringen.“
„Lou, was tust du?“, fragte Josh besorgt an meinem Ohr. „Ich finde es vollkommen in Ordnung, hässlich im paillettenbesetzten Minirock auszusehen. Nachher will Finn, dass ich einen anziehe, um zu beweisen, dass er recht hat.“
Finn grinste breit und lehnte sich vor. „Du flüsterst nicht leise genug, Josh – und das ist eine brillante Idee.“
Ich konzentrierte mich hastig wieder auf das Geschehen vor mir, damit ich Joshs genervten Blick nicht mitbekam.
Der Wagen fuhr gerade wieder an, doch die Goldfunken waren noch nicht mit ihrer Performance fertig, also bremste der Traktorfahrer, der das golden-rote Funkenmobil zog, gezwungenermaßen wieder ab.
Ein Ruck ging durch den Wagen und aus den Augenwinkeln nahm ich eine Bewegung wahr. Unter normalen Umständen war das auf der überfüllten Severinstraße nichts Merkwürdiges. Doch diese bestimmte Bewegung fand unter dem Umzugswagen statt.
Stirnrunzelnd blinzelte ich und beugte mich nach vorn. Hatte ich mir das nur eingebildet? Die Umzugswagen waren alle relativ tief gelegt, aber ich hätte schwören können, dass ich einen Schatten unter dem Wagen gesehen hatte.
„Lou, du kannst unmöglich jetzt schon betrunken genug sein, um umzukippen“, meinte Josh und hielt mich am Arm fest, als ich in die Hocke sank und mit zusammengekniffenen Augen zwischen den Beinen und fliegenden Süßigkeiten hindurchsah.
„Bin ich nicht. Ich bin noch stocknüchtern“, meinte ich abwesend. „Aber Josh … liegt da jemand unterm Wagen?“
„Was?“ Seine Stimme war auf einmal alarmiert. „Da, unter der Karosserie“, sagte ich und nickte zum Umzugswagen. „Ich glaub, da liegt jemand.“ Es war so verdammt dunkel unter dem Gefährt, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich menschliche Umrisse ausmachen konnte. Oder zumindest Beine, die von einer der Achsen hingen.
Rispo befand sich mittlerweile auf meiner Höhe und sah ebenfalls unter den Wagen. „Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht“, sagte er kopfschüttelnd. „Aber es sieht eher nach einer Puppe aus. So oder so sollten sie jetzt nicht …“
Der Traktor fuhr erneut an und diesmal stoppten die Mitglieder der Goldfunken ihn nicht.
Mein Mund wurde trocken und besorgt sah ich, wie die Beine der Schattengestalt einige Sekunden lang mitgezogen wurden … bis die Gestalt vollends auf den Boden fiel und der Wagen über sie hinwegratterte.
Fluchend sprang Josh auf und drängte sich durch die Menge nach vorn. „Hey! Stopp! Haltet den Traktor an!“
Josh konnte unfassbar laut schreien. Ich war mir ziemlich sicher, dass er im letzten Leben eine Feuerwehrsirene gewesen war. Doch selbst er konnte keine enthusiastische Blaskapelle und hundert grölenden Besoffenen übertönen.
„Was ist los?“, fragte Emily verwirrt.
„Ist Josh Teil der Goldfunken?“, wollte Trudi neugierig wissen.
Ich beachtete sie beide nicht, sondern drückte mich durch die frisch gezogene Menschenschneise nach vorn. „Leute, haltet an!“, schrie ich jetzt auch.
Niemand achtete auf uns.
Der Wagen fuhr. Die Trompeter, die die erste Reihe der Musiker ausmachten, liefen munter weiter. Josh sprintete nach vorn zum Traktor. Ich eilte nach hinten, zog mir den Ritterhelm vom Kopf und wedelte damit über meinem Kopf hin und her. „Stopp!“, brüllte ich.
Doch das war nicht mehr nötig.
Einer der Trompeter hatte bereits angehalten. Den Blick starr und entsetzt auf den Boden vor ihm gerichtet.
Ich wandte den Kopf, sah ebenfalls auf den Asphalt …
„Fuck“, entfuhr es mir und ich schlug die Hand vor den Mund.
Das war keine Puppe.
Das war ein Mädchen im Goldfunken-Kostüm. Ein bleiches, starres Mädchen, dessen Stirn unterm Umzugswagen lag, der nun endlich zum Stillstand gekommen war. Ihre Lippen violett. Ihre hellblonden Haare zu einem wirren Heiligenschein um ihr Gesicht gefächert. Vertrocknetes Blut auf Stirn und Schläfen.
„Eieiei“, murmelte Trudi und stellte sich neben mich. „Das sind nicht die Art von Kamelle, die man vom Wagen geworfen haben will, oder?“
„Oh mein Gott“, hauchte der Trompeter und sank auf die Knie.
„Sie ist tot“, murmelte sein Nebenmann schockiert.
„Tot!“
Ein Raunen ging durch die Blaskapelle, die augenblicklich aufhörte zu spielen.
„Nein, nein, es ist bestimmt nur ein Kostüm!“, sagte ein Posaunist aus der zweiten Reihe, schritt nach vorn und hielt auf die Leiche zu. „Wir müssen nur …“ „Niemand fasst diesen Körper an!“, hielt ihn eine harte Stimme zurück und der Musiker zuckte erschrocken zusammen, als Rispos dunkler Blick ihn traf. Er hätte zugegebenermaßen noch autoritärer gewirkt, wenn kein Efeu in seinem Haar gesteckt hätte. Josh schien derselbe Gedanke zu kommen, denn er zog sich den Blumenkranz unwirsch vom Kopf.
Klasse. Karneval war vorbei und der lustige Josh durch den ernsten Kommissar ersetzt worden.
„Alle zurücktreten“, rief er laut und warf Trudi einen strengen Blick zu, die pflichtbewusst nach hinten trippelte. „Das hier ist ein Tatort.“
„Tatort?“ Das Wort hallte durch die Menge und das Gemurmel der Umherstehenden schwoll an.
Leute reckten ihre Hälse, drängten nach vorn und ignorierten Joshs Anweisung, während er fluchend sein Handy aus der Tasche zog und keine Sekunde später leise in den Hörer sprach. Ich nahm nur Worte wie Verstärkung und Tote und Severinstraße wahr. Mehr bekam ich nicht mit. Ich war zu beschäftigt damit, den Blick über die Leiche schweifen zu lassen.
Sie sah friedlich aus. Die Augen geschlossen. Die Finger gespreizt, den Kopf auf die eigene Schulter gelegt. Als würde sie sich nur kurz ausruhen. Doch sie täuschte mich nicht. Ihre Lider würden sich nicht mehr von allein öffnen.
Ein großer, zackiger Stein drängte meine Kehle hoch und ich presste die Hände auf mein schmerzendes Zwerchfell. Ich hatte in meinem Leben schon einige Tote gesehen. Ihr Anblick beeinflusste mich nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Ich musste bei dem Geruch einer frischen Leiche nicht mehr würgen. Musste den Blick nicht mehr sofort abwenden. Hyperventilierte beim Anblick von Blut längst nicht mehr. Doch das alles änderte nichts daran, dass jeder Tod etwas ganz Eigenes, Grausames an sich hatte.
Bei dem Mädchen vor mir schockierten mich weder das Blut, das sich in vertrockneten roten Rinnsalen über ihre Stirn und Schläfen zweigte, noch ihre dreckigen, abgebrochenen Fingernägel. Stattdessen war es der Anblick ihres aufgequollenen Gesichts, das im furchtbaren Kontrast zu ihrem schicken rot-goldenen Kostüm stand, der mich wie eine Faust in den Magen traf. Es war die Tatsache, dass sie kaum neunzehn sein konnte und ein Tattoo ihr Handgelenk zierte, das „Live Life to the …“ las, die die Tränen in meine Augen trieb. Ich schluckte den Kloß in meinem Hals hinunter und presste die Lippen zusammen, während ich mich tiefer vorbeugte, um die Schrift zu studieren. Wahrscheinlich endete der Satz mit „fullest“, doch das Wort wurde von einem aus blauem Stoff geknüpften Armband verdeckt, auf dem ein rotes Herz eingestickt war, das jemand mit einem unordentlichen Kreuz mit schwarzem Edding durchgestrichen hatte. Die Leiche roch noch nicht schlimm, fiel mir auf. Nicht schlimmer als der Gestank nach schalem Bier und Schweiß zumindest, der ohnehin in der Luft hing. Aber es sah auch nicht aus, als wäre die junge Frau erst vor wenigen Minuten ums Leben gekommen.
Stirnrunzelnd neigte ich den Kopf und blickte unter die Karosserie. Hatte das Mädchen auf der Achse des Umzugswagens gelegen? Wieso sollte man dort eine Leiche deponieren? Also, nicht, dass man irgendwo eine Leiche deponieren sollte, wenn es sich vermeiden ließ. Aber wenn man schon einen Körper loswerden musste, dann erschien mir dieser bestimmte Ort doch als äußerst unpraktisch
Ein grelles Blitzlicht blendete mich und erschrocken zuckte ich zurück.
„Keine Fotos!“, brüllte Josh zornig. „Liebe Güte, habt ein wenig Respekt vor der Toten! Und muss ich mich noch mal wiederholen: Niemand tritt zu nah an diese Leiche heran!“
„Was ist mit ihr?“, rief der Posaunist von vorhin und deutete auf die Person, die noch immer über die Leiche gebeugt dastand. Oh, das war ich.
„Lou!“, fuhr Josh mich ungehalten an. „Das kann nicht dein Ernst sein. Tritt von der Leiche weg.“
Hastig machte ich einen Schritt zurück. „Was?“, fragte ich unschuldig und hob beide Hände.
„Was ist denn hier los?“
Einige der Goldfunken waren um den Wagen herumgelaufen, um herauszufinden, warum er nicht weiterfuhr.
„Louisa?“ Leonie erschien hinter dem letzten Reifen und sah mich irritiert an. „Was …“ Sie stockte, denn ihr Blick fiel auf die Tote. „Oh mein Gott! Das ist Sina!“, hauchte sie entsetzt. „Sie war heute Morgen nicht am Treffpunkt, sie … Ist sie tot?“
Einige Mädchen fingen an zu kreischen, sobald das Wort an ihre Ohren drang. Andere Umherstehende liefen Mittelalter Gouda-gelb an und sanken kraftlos zu Boden und nicht wenige Schaulustige ließen ihre Bierdosen fallen, klammerten sich an dem Umzugswagen fest und kniffen die Augen zusammen. Ein, zwei übergaben sich auf der Stelle auf den Asphalt, sodass ihr Erbrochenes sich mit herumliegendem Konfetti und Gummibärchenpackungen vermischte.
„Großer Gott“, murmelte Josh, eine Hand an der Stirn, während plötzlich uniformierte Beamte aus der Menge strömten und die umherstehenden Gaffer zurückdrängten. „Ich hätte damit rechnen sollen, oder?“, fragte er kopfschüttelnd und presste die Lippen zusammen. „Dass dir selbst an Karneval eine Leiche vor die Füße fällt.“
„Na ja, ehrlich gesagt ist sie ja ihm vor die Füße gefallen.“ Ich deutete auf den Trompetenspieler, der mit noch immer kalkweißem Gesicht auf dem Boden saß, die Hände in seinen Haaren vergraben.
Josh seufzte schwer und schüttelte den Kopf. Vermutlich meinetwegen. Es war meistens meinetwegen. „Okay“, murmelte er gedehnt. „Ich muss die Goldfunken alle mit aufs Präsidium nehmen. Die meisten Leute vom Wagen auch.“ Er verzog das Gesicht. „Shit, das sind viel zu viele Menschen! Mein freier Tag ist vorbei – der Umzug auch.“ Er rieb sich mit Daumen und Mittelfinger über den Nasenrücken, bevor er erneut sein Handy ans Ohr hob. „Marvin, ich brauche Sie in einer Viertelstunde auf dem Präsidium“, blaffte er keine Sekunde später in den Hörer. „Ist mir egal, ob Sie gerade mit einer süßen Erdbeere flirten! Es ist gerade vor meinen Augen eine Leiche von einem Umzugswagen gefallen, das hat Vorrang! Ja … Ja. Bis gleich.“ Er legte auf und sprach dann mit einem Beamten, der nach weiteren Anweisungen fragte, während bereits die Straße abgesperrt wurde. Mein Blick wanderte derweil zu Leonie, die in den Armen eines anderen Goldfunkens lag und bitter weinte.
Mein Magen zog sich zusammen und mein Herz sank in die Hose. Es war so leicht, eine starre, fremde Tote anzusehen und zu vergessen, dass sie gelebt hatte. Dass sie Freunde gehabt hatte. Träume. Eine Familie.
Ich presste die Hände auf meine schmerzende Brust. Ich war vielleicht abgehärtet, was Leichen anging, die willkürlich auf meinem Weg lagen. Aber ich war frischkäseweich, wenn ein Mensch, den ich sehr mochte, einen Verlust erlitt. Wenn er trauerte. Und Leonie hatte die Tote offensichtlich gekannt.
Mit brennenden Augen atmete ich tief durch, bevor ich näher an Josh trat.
„Ähm … Soll ich mitkommen?“, fragte ich vorsichtig und vergrub die Hände in den Löchern meines Käsekostüms.
Josh schnaubte, seine Augenbrauen eine einzige, gerade Linie. „Aufs Präsidium, um Leute zu befragen? Nein! Du bist keine Polizistin.“
„Ich könnte mich als Polizistin verkleiden“, schlug ich vor.
„Louisa“, sagte Josh mit gesenkter Stimme und sah mich warnend an. „Du bist eine Blumenladeninhaberin, meine Fast-Verlobte und zurzeit ein Mittelalter-Gouda – aber du bist noch immer keine Angestellte der Kripo.“
„Aber …“
„Nein“, unterbrach er mich mit Nachdruck. „Der Fall ist nicht persönlich. Du hattest erst vor drei Wochen deine letzte Leiche, das hier ist meine.“
„Na ja … sie scheint eine Freundin von Leonie zu sein, Josh“, wisperte ich. „Das macht es irgendwie schon persönlich. Und du hast nie gesagt, dass ich nur einem Mörder im Monat nachstellen darf. Du meintest nur, dass ich dir sagen müsse, wenn ich offiziell an einer Mordermittlung teil–“
„Ein Mörder pro Monat ist ja wohl mehr als genug!“, unterbrach er mich ungläubig. „Das stand im Kleingedruckten. Und ich hab jetzt keine Zeit, mit dir darüber zu diskutieren. Da hinten liegt nämlich ein totes Funkenmariechen, falls du dich erinnerst. Du wirst dich in kein Verhörzimmer stehlen und du wirst Leonie nicht versprechen, dass du den Mörder findest, hast du mich verstanden?“