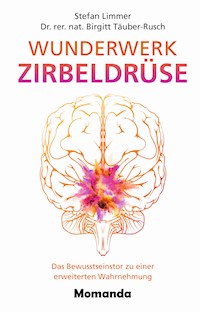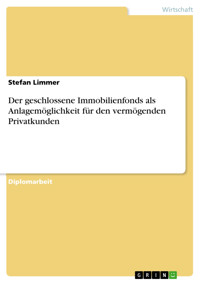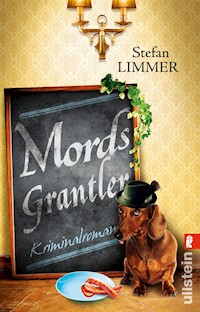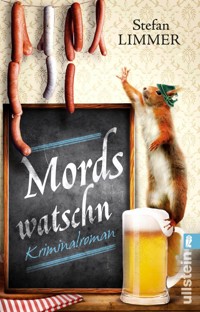
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was für ein Stress — und das am heiligen Sonntag! Erst wird Kommissar Dimpfelmoser im Wirtshaus bei seinen geliebten Bratwürstl gestört. Dann macht ihm seine Haushälterin Eva eine peinliche Szene. Und schließlich wird auch noch eine Leiche gefunden. Welcher Verrückte kommt auf die Idee, seinem Opfer das Blut aus den Adern zu saugen? Während der raubeinige Kommissar auf Hochtouren ermittelt, wird eine zweite Leiche gefunden — ausgerechnet auf dem Gelände des geplanten »Begegnungszentrums für spirituell Suchende«. In der erzkatholischen Kleinstadt im Bayerischen Wald rumort es, denn der Pfarrer macht mobil gegen das »teuflische Zentrum«. Dimpfelmoser setzt Himmel und Hölle in Bewegung, damit die Situation in seiner Heimatstadt nicht eskaliert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Kommissar Dimpfelmoser ist genervt. Erst wird er im Wirtshaus beim Frühschoppen gestört, weil ihm seine Haushälterin Eva eine Szene hinlegt, dass es zu einem Volksauflauf der Kirchgänger kommt. Dann muss er auch noch mit seinem ungeliebten Kollegen Reindl zum Haus des Landrats fahren, um dort den Hausherrn und sein »Gspusi« vor aufdringlichen Fotografen zu schützen. Und als ob das nicht schon genug wäre, wird auch noch eine Leiche gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um einen besonders heimtückischen Mord handelt: Jemand hat dem Opfer bei lebendigem Leib das Blut aus den Adern gesaugt.
Während der Kommissar und seine Kollegen auf Hochtouren ermitteln, wird eine zweite Leiche gefunden – wie schon der erste Tote auf dem Gelände des geplanten »Begegnungszentrums für spirituell Suchende«. Der Pfarrer, dem das »teuflische Zentrum« schon immer ein Dorn im Auge war, sieht seine Chance gekommen, die Dorfbewohner dagegen zu mobilisieren. Dimpfelmoser hat alle Hände voll zu tun, da er neben den Mordermittlungen auch noch möglichst unauffällig die Sache mit dem Landrat klären muss. Herrschaftszeiten, was für eine Aufregung!
Der Autor
Stefan Limmer ist verheiratet und hat vier Kinder. Er wohnt zwischen Regensburg und Cham, in der Gegend, in der auch der Kommissar Dimpfelmoser ermittelt. Hauptberuflich ist er als Heilpraktiker, Seminarleiter und Dozent tätig. Mordswatschn ist sein erster Kriminalroman.
Mordswatschn
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juli 2015
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: Getty Images/© Jill Chen (Würstchen);
getty images/© Steven Whitehead (Eichhörnchen);
© FinePice®, München
ISBN 978-3-8437-1107-4
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Wörth an der Donau
Wie es das ehemalige oberpfälzische Bauerndorf Mitte des letzten Jahrhunderts geschafft hat, zu Stadtrechten zu kommen, das ist wohl in ganz Bayern für niemanden mehr nachvollziehbar. Mit seinen 4500 Einwohnern – und da sind die 29 »Stadtteile« außerhalb der eigentlichen Stadt schon mitgerechnet – wirkt Wörth an der Donau auf mich immer noch wie ein Dorf.
Aber entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Mein Name ist Xaver Dimpfelmoser, meines Zeichens Kommissar des Polizeipräsidiums Regensburg, und seit längerem tätig in meiner Heimatstadt Wörth an der Donau.
Schön ist es schon bei uns. Über der Stadt thront weithin sichtbar das Wörther Schloss. Von meiner Polizeistation in der Ludwigsstraße aus bin ich gleich drüben beim Schorsch-Wirt, und in die Natur ist es auch nicht weit. So kann ich mir immer aussuchen, ob ich in meinen Pausen lieber ein oder zwei Halbe trinke oder mich an die Donau setze.
Bei uns kennt wirklich jeder jeden. Und weil das so ist, wissen auch immer gleich alle, was so in der Stadt und im Umland passiert. Aber das werden Sie auch bald selber merken. Ich wünsche Ihnen viel Spannung, Spaß und gute Unterhaltung mit den Enthüllungen aus meinem ereignisreichen Polizistenleben.
Ihr Xaver Dimpfelmoser
»So sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme.«
2. Mose 21, 23–25
Prolog
»Du wirst jetzt sterben, und ich werde dir dabei zusehen.«
Der Mann steht langsam auf und schaltet die Pumpe ein, die leise zu surren beginnt. Sofort läuft das Blut aus dem Schlauch in den bereitgestellten Eimer. Der Gefesselte verdreht die Augen und zuckt panisch, doch schnell erlahmen seine Reaktionen. Der Mann beobachtet das Schlauchende genau. Erst als kein Blut mehr herausfließt, stellt er die Pumpe wieder ab. Er schneidet die Fesseln durch, zieht die Kanüle aus dem Arm und rollt den Hemdsärmel wieder nach unten.
»Auge um Auge, Zahn um Zahn«, murmelt er und betrachtet den Toten.
Er weiß, dass er erst Ruhe findet, wenn sein Werk vollbracht ist.
Kapitel 1
Sonntag, 11.00 Uhr
Auf dem Weg zum Schorsch-Wirt begegnen mir nur wenige Menschen, was nicht besonders verwunderlich ist. Die Messe vom Pfarrer Eberdinger, die ich wegen kleiner Meinungsverschiedenheiten zwischen uns konsequent meide, ist noch nicht zu Ende, weshalb die Straßen der Stadt relativ leer sind. Außerdem regnet es in Strömen, was mir aber nix ausmacht. An einem Sonntagvormittag gibt es praktisch nichts, was mir meine gute Laune verderben kann. Ich habe zwar Rufbereitschaft, aber nachdem bei uns eh nie was passiert, nehme ich auch an solchen Tagen kein Diensthandy mit, wie es eigentlich Vorschrift ist. Das hat zumindest mein Vorgesetzter, der Hauptkommissar Huber, bei unserem letzten Dienstgespräch behauptet. Der muss es ja wissen, der alte Paragraphenreiter. Der versteht überhaupt keinen Spaß und schaut immer so, als würde gleich die Welt untergehen. Seit ihn seine Frau vor einem halben Jahr sitzen hat lassen wegen eines anderen, sind seine Mundwinkel noch weiter nach unten gewandert. Wer kann es der armen Frau schon verdenken. Kein Mensch hält es mit so einem aus, der zum Lachen in den Keller geht. Unser letztes Gespräch ist dementsprechend auch wieder ziemlich unerfreulich verlaufen. Ich wollte ihn halt etwas aufmuntern und habe ein paar Witze über seine Frau und ihren neuen Lover gerissen. Das fand er gar nicht lustig. Stattdessen hat er mir eine Abmahnung erteilt, weil sich so ein Depp beschwert hat, dem ich bei einer Verkehrskontrolle die Ohren langgezogen habe – natürlich nur ein bisschen, so dass er gerade noch auf den Zehenspitzen stehen konnte. Ich bin ja kein Unmensch. Aber wo kommen wir denn da hin, wenn jeder dahergelaufene Porschefahrer meint, für ihn gilt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann kommt er mir auch noch ganz blöd, von wegen er hat das Schild nicht gesehen. Ja wenn ich so schnell fahre, dann sehe ich auch keine Schilder mehr. Jedenfalls habe ich ihn nur ein bisschen ermahnt und ihm klargemacht, dass er eine Amtsperson vor sich hat. Dass dabei sein Sakko zerrissen ist, war nun wirklich keine Absicht von mir. Was muss er auch so rumzappeln, anstatt einfach stillzuhalten. Ich habe ihm ja auch angeboten, dass ich seine Jacke mit zur Oma nehme. Die kann ganz wunderbar nähen, aber das wollte er auch nicht, da kann man dann halt nichts machen. Jedenfalls hat er sich in Regensburg beim Polizeipräsidenten, der ein Spezi von ihm ist, beschwert. Und das fand der Huber wiederum gar nicht lustig, aber wie gesagt, der versteht eh keinen Spaß.
Beim Schorsch-Wirt ist um diese Zeit noch nicht viel los, nur die paar üblichen Gesichter hängen wie jeden Sonntagvormittag schon am Stammtisch und spielen Schafkopf, was das Zeug hält. Ich gehe zu meinem Stammplatz ins hinterste Eck. Da kann ich immer noch in Ruhe mein Bier trinken, wenn die Kirchgänger hernach einfallen und den vorderen Teil der Gaststube bevölkern.
»Servus, Dimpfelmoser«, begrüßt mich die Heidi, die seit ein paar Monaten an den Wochenenden als Bedienung beim Schorsch arbeitet.
Die ist ein echter Augenschmaus, großer Vorbau, ein wundervolles Lächeln, blonde Haare, die ihr immer so ins Gesicht fallen, dass sie sie mit einer Handbewegung wieder hinter die Ohren schieben muss. Und auch der Rest von der Heidi ist einwandfrei. Da wird einem ganz warm ums Herz – und nicht nur ums Herz.
»Servus, Heidi, du bist ja wieder fesch heute«, sag ich zu ihr und schaue dabei ganz ungeniert in ihren Dirndlausschnitt, so wie ich es jeden Sonntag mache, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet.
Sie lächelt mich an, und da wird mir gleich noch wärmer.
»Das Übliche, Dimpfelmoser?«
Ich kann gar nichts sagen und nicke nur, während ich schnell zu meinem Platz gehe und mich setze. Von hier aus kann ich der Heidi ganz in Ruhe zuschauen, wie sie wie ein Engel durch die Wirtsstube schwebt und beim Schorsch an der Theke mein Bier holt. Aus der Küche rieche ich den Duft der Bratwürste. Die Heidi kommt mit meinem Bier, und beim Abstellen ergattere ich noch einen tiefen Einblick. Dann bringt die Lisel aus der Küche auch schon die zwölf Würste und eine Schüssel mit Sauerkraut. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Genüsslich nehme ich einen tiefen Schluck, dann zerteile ich die erste Wurst und wälze sie im Bratenfett, das auf dem Teller schwimmt, so wie ich es am liebsten mag. Als ich die Gabel langsam zum Mund führe, schließe ich kurz die Augen, um mich ganz auf den Geschmack zu konzentrieren. Da fehlt mir nichts, aber auch rein gar nichts mehr zu meinem Glück. So ein Sonntag beim Schorsch-Wirt, das ist wie im Paradies, besonders seit die Heidi hier ist. Gerade will ich den ersten Bissen genießen, da haut mir doch einer von hinten auf die Schulter, dass ich vor Schreck die Gabel fallen lasse. Die landet im Fett auf meinem Teller, und das spritzt auch gleich auf mein von der Eva frisch gewaschenes, blaukariertes Lieblingshemd.
»Ja Herrschaftszeiten, du Depp du blöder«, schreie ich, während ich aufspringe und mich umdrehe, um dem Störenfried eine zu langen.
»Langsam, langsam, Dimpfelmoser«, ruft mein Kollege, der Harald Reindl, erschrocken und springt einen Schritt zurück, so dass mein Schlag ins Leere geht.
Er kennt mich halt schon und weiß, dass ich manchmal etwas überreagiere. Aber das ist ja wohl absolut gerechtfertigt. So schändlich von so einem Deppen aus dem Paradies gerissen zu werden, da ist eine angemessene Reaktion ja wohl das Mindeste. Also hole ich noch mal aus, aber der Reindl weicht zurück bis in das hinterste Eck des Gastraumes.
»Der Huber hat gerade angerufen und rumgebrüllt, wenn du dich nicht sofort bei ihm meldest, dann schickt er dich als Streifenpolizist nach München.«
Oha, das ist eine böse Drohung. München ist für mich so etwas wie die irdische Hölle, und das weiß der Huber, darum droht er mir auch immer wieder damit. Gott sei Dank verfüge ich ja über ein paar kleine Informationen, die ich ihm gegenüber bis jetzt noch nicht erwähnt habe. Heute ist wohl der richtige Zeitpunkt, um meine Beziehung mit ihm auf eine neue Basis zu stellen. Sofort verraucht meine Wut, und gemächlich setze ich mich wieder hin.
»Sag ihm einen schönen Gruß von mir, ich möchte mich mit ihm übers ›La Luna‹ unterhalten, dann gibt er Ruhe. Ich melde mich in einer halben Stunde bei ihm«, sag ich zum Reindl, der immer noch völlig angespannt in der Ecke steht, obwohl ich ihm doch gar nichts mehr tun will.
Aber er ist halt aus der Großstadt und kann die Reaktionen der Einheimischen hier immer noch nicht richtig einschätzen.
»Wenn du unbedingt nach München willst«, brummt er und trottet aus dem Wirtshaus.
Ich grinse in mich hinein und widme mich endlich ungestört meinen Bratwürsten. Das wäre ja noch schöner, wenn mir der Huber meinen Sonntag ruinieren würde. Nach der dritten Halben und einigen ausgiebigen Blicken auf die Heidi zahle ich und mache mich auf den Weg zu unserer Polizeistation. Die ist nur ein paar Schritte neben dem Schorsch-Wirt in der Ludwigsstraße untergebracht. Meine provisorische Außenstelle der Kripo, die nun schon seit zwei Jahren besteht, ist inzwischen zur geduldeten Dauereinrichtung geworden. Mir ist das ganz recht. Ich habe ja überhaupt keine Lust, wieder mit dem Huber in unsere alte Polizeiinspektion in der Regensburger Straße umzuziehen. Und der Huber sieht das wohl genauso. Der ist, glaube ich, heilfroh, dass er mich nicht mehr vor der Nase sitzen hat. Die Chemie stimmt halt einfach nicht zwischen uns. Und darum, vermute ich, sind unsere alten Räume nicht renoviert und unsere jetzige Station auch nie mehr aufgelöst worden. Seitdem sitzt der Huber in Regensburg im Präsidium und ich hier in meiner Polizeistation. Wahrscheinlich hat der Huber, der alte Schisser, einfach nur Angst, dass ich noch mal Jagd auf Ratten mache. Hätte er halt selber mal was unternommen, anstatt den Mistviechern einfach zuzuschauen, wie die sich wie die Karnickel vermehren und unsere Akten anfressen.
»Huber«, habe ich ihm immer wieder gesagt, »wir müssen was unternehmen. Einen Kammerjäger brauchen wir, der die Bestien vernichtet.«
Aber er hat immer nur gejammert, das wäre in seinem Etat nicht drin, und stattdessen hat er ein paar Lebendfallen aus dem Baumarkt besorgt und aufgestellt. Aber die Ratten sind ja nicht deppert. Warum hätten sie dem Huber seinen vergammelten Käse fressen sollen, wenn doch überall was viel Besseres rumliegt – wie eben meine Bratwurstsemmeln. Da hört dann der Spaß auf. Da war es doch die beste Entscheidung, sie einfach in flagranti abzuknallen, was ich dann – auch an einem Sonntag übrigens – getan habe. Außer mir und den zwei Kollegen von der Bereitschaft war ja eh niemand da. Dass ich bei meiner Rattensäuberungsmission die Hauptwasserleitung durchlöchert habe, ja mei, so was passiert halt mal im Einsatz, dafür kann ich ja wirklich nichts. Und dann macht der Huber einen Aufstand wegen den gefluteten Diensträumen, das war halt völlig übertrieben. Dabei war das doch alles ein Heidenspaß, nicht ganz billig für den Staat, das gebe ich zu. Da wäre der Kammerjäger günstiger gewesen, aber der Huber wollte ja nicht auf mich hören. Anstatt sich bei mir zu bedanken, dass ich der Plage ein Ende gesetzt habe, schickt der Arsch mich zum Psychologen, von wegen Gefahr für die Allgemeinheit und lauter so einen Schmarrn. Ich bin halt nur nicht feige und mache das, was ein Mann eben tun muss. Das gilt im Dienst und auch privat. Immer voller Einsatz, koste es, was es wolle. Der Psychologe, dieses bornierte, arrogante Bürscherl von der Universität, der überhaupt keine Ahnung hat vom richtigen Leben, der fand mein Verhalten dann auch bedenklich und hat gemeint, ich gehöre in psychologische Betreuung. Da habe ich dem Huber aber den Marsch geblasen. Der hat das dann doch eingesehen, und seitdem muss ich nur alle halbe Jahr zu dem Hirnverdreher. Da tue ich dann immer ganz normal, aber bis jetzt hat der immer noch nicht lockergelassen und will mich weiter sehen. Vielleicht ist er ja auch schwul und steht auf mich, warum sonst würde er so darauf beharren, dass ich immer wieder bei ihm antanze?
Jedenfalls ist unsere provisorische Polizeistation geblieben, und da kann ich tun und lassen, was ich will. Nur der Reindl nervt immer wieder. Der ist auch so dermaßen penetrant und ehrgeizig, und überhaupt leidet er an einem Wahn. Hinter jedem Furz, den jemand lässt, vermutet er immer gleich ein Verbrechen. Der hat immer noch nicht kapiert, dass bei uns die Uhren anders ticken. Anstatt den ganzen Tag einfach gemütlich mit unserem Dienstwagen durch die Gegend zu fahren, muss er sich immer wichtigmachen und steckt seine Nase in Angelegenheiten, die ihn nix angehen. Besonders beliebt hat er sich damit bisher nicht gemacht, obwohl ich ihn gewarnt habe. Aber was will man von einem echten Großstadtmenschen schon anderes erwarten.
Inzwischen hat es zu regnen aufgehört, und sogar die Sonne zeigt sich hinter den Wolken.
»Servus, Dimpfelmoser«, flötet es da hinter mir.
Ich drehe mich um, da steht doch tatsächlich die Eva. Mit ihr teile ich mir die Räume von ursprünglich zwei Wohnungen, die durch einen Mauerdurchbruch und eine Türe miteinander verbunden sind. Die Eva kümmert sich meistens um meinen Haushalt und kocht für mich, wenn sie nicht gerade wieder einmal eingeschnappt oder beleidigt ist, was leider an der Tagesordnung ist. Sie lächelt mich erwartungsvoll an. Bevor die mir eine Szene macht, schaue ich lieber, dass ich verschwinde.
»Du, Eva, ich hab gerade leider gar keine Zeit für dich, dringende Ermittlungen, die nicht warten können«, rufe ich ihr zu, während ich mich schleunigst davonmache.
Ich sehe noch, wie sie aufhört zu lächeln und ihr die hübschen Gesichtszüge entgleisen.
»Du Arschloch«, ruft sie mir nach, »du hast mir versprochen, dass wir heute was zusammen unternehmen, und jetzt weichst mir aus und lässt mich einfach hier stehen, oder was?«
Bevor sie ganz ausrastet, habe ich schon die rettende Türe meiner Polizeistation erreicht und verschwinde im Gang. Die Eva haut von draußen dagegen und rüttelt daran, aber ich denke gar nicht daran, ihr aufzumachen. Gott sei Dank ist die Türe auch in unserer provisorischen Polizeidienststelle gesichert und nur von innen zu öffnen. Ich lasse mich auf einen Besucherstuhl fallen und warte, dass die Eva endlich abzieht. Der Reindl sitzt am Schreibtisch hinter der schusssicheren Glasscheibe an der Eingangsschleuse und schüttelt missbilligend den Kopf.
»Dimpfelmoser, du bist so ein Trottel«, fängt er oberlehrerhaft an. »So eine Frau wie die Eva, die lässt man doch nicht einfach so stehen. Andere würden sich alle zehn Finger abschlecken, wenn die Eva sie beachten würde. Aber was die an dir findet, das ist mir echt ein Rätsel.«
»Reindl«, sage ich süffisant grinsend, »du hast keine Ahnung von den Frauen. Die stehen halt nicht auf so Weicheier wie dich, sondern auf so gestandene Mannsbilder wie mich. Da musst nicht immer um sie rumwinseln und so tun, als würdest gerne mit ihnen über ihren Weiberkram reden. Der echte Mann schweigt und genießt.«
Der Reindl schüttelt nur weiter den Kopf und brummt irgendwas vor sich hin, was ich aber nicht verstehe, weil sich die Eva inzwischen mit aller Kraft schreiend und tobend gegen die Türe wirft, dass sogar mein Schreibtisch wackelt. Leider kann ich jetzt auch nicht mit dem Huber telefonieren, bei dem Radau kann sich ja kein Mensch konzentrieren. Ich warte noch ein bisschen, aber die Eva ist inzwischen so in Rage, dass sie gar nicht daran denkt, aufzuhören. Also stehe ich auf und öffne die Türe. Draußen hat sich zu meiner Überraschung eine beachtliche Menschenmenge angesammelt. Anstatt gottesfürchtig nach Hause oder ins Wirtshaus zu gehen, wie sich das nach der Vormittagsmesse gehört, steht die halbe Kleinstadt da und schaut der Eva zu, wie sie brüllt und tobt und versucht, meine Türe einzuschlagen. Nun muss ich für Ruhe und Ordnung sorgen, das ist schließlich meine Aufgabe. Also schnappe ich mir die Eva, die sich sofort auf mich stürzen will, schmeiße sie mir über die Schultern und gehe quer über die Straße zu unserem Haus. Das ist noch so was, warum das mit der Eva nicht so einfach ist. Sie hat immer im Blick, ob ich da bin oder nicht, und das mag ich ja gar nicht, wenn ich mich beobachtet fühle.
»Geht’s nach Hause, hier gibt es gar nichts mehr zu sehen«, schreie ich noch dem Mob entgegen, der sich scheinbar prima auf Evas und meine Kosten amüsiert. Dann habe ich unsere Haustüre einigermaßen unversehrt erreicht, was gar nicht so einfach ist, weil sie auf mich einprügelt und mich gleichzeitig kratzt und beißt, so dass ich alle Hände voll zu tun habe, um nicht ernsthaft verletzt zu werden. Sie ist wirklich rasend vor Wut. Ich setze sie auf dem Küchentisch ab.
»Mei, Eva, wenn du so wütend bist, dann bist gleich noch mal so schön, als du eh schon bist«, sage ich zu ihr.
Sie hört auf mit ihrem Gezeter und schaut mich groß an.
»So, schön findest mich also schon noch«, sagt sie, und Tränen laufen ihr über ihr zorngerötetes Gesicht.
Nun kann ich mit weinenden Frauen schon gar nicht umgehen. Da fühle ich mich völlig hilflos. Also drücke ich sie einfach an mich, so fest ich kann. Da hört sie auf zu weinen und strahlt mich an.
»Hast dann wenigstens heute Abend Zeit für mich?«, fragt sie leise.
»Ja«, sage ich, damit sie Frieden gibt. »Du, Eva, ich muss jetzt wirklich arbeiten, der Huber ist fuchsteufelswild und will mich nach München versetzen, wenn ich nicht gleich anrufe.«
Da steht die Eva auf, als wenn nichts gewesen wäre, öffnet mir lächelnd die Türe und schiebt mich raus.
»Geh schon, das wäre ja wirklich schade, wenn du nicht mehr hier wärst«, flötet sie mir ins Ohr, und da stehe ich auch schon auf der Straße.
Die Frauen verstehe mal wer will, ich jedenfalls nicht. Der Mob der Schaulustigen hat sich inzwischen auch zerstreut, und so gehe ich zurück in mein Revier, um endlich das leidige Telefonat mit dem Huber zu führen. Der Reindl sitzt an seinem Schreibtisch und tut so, als wäre er beschäftigt, die beleidigte Leberwurst. Wie ein Weib ist er manchmal, der Reindl.
Ich lasse mich also in meinen neuen, rückenfreundlichen Bürostuhl fallen, den mir die Oma letztes Jahr zum Geburtstag gekauft hat. Seitdem habe ich tatsächlich viel weniger Rückenschmerzen. Jetzt kommen sie halt nur noch, wenn ich mal wieder eine Nacht im Wirtshaus versumpfe, aber das kommt ja nur sehr selten vor. Aber dann halt richtig, man gönnt sich ja sonst nichts.
Ich wähle die Nummer vom Huber, und bevor es überhaupt richtig klingeln kann an dem seinen Apparat, hebt er schon ab und fängt gleich ohne Begrüßung an zu reden.
»Ich brauche Sie dringend in einer etwas delikaten Ermittlung, Dimpfelmoser«, sagt er und erwähnt mit keinem Wort, dass ich erst jetzt anrufe.
»Ja, Huber, etwa so delikat wie Ihr Auftritt im ›La Luna‹?«, rutscht es mir dann auch gleich raus. »Sind Sie da eigentlich öfters?«
Der Huber verschluckt sich am Ende der Leitung und ringt hörbar nach Luft. Das geschieht ihm ganz recht, dem bornierten Deppen. Er hätte mich ja auch nicht so zusammenstauchen müssen wegen dem Affen von einem Porschefahrer. Er hätte die Angelegenheit ja auch ohne Abmahnung regeln können, ein gescheiter Anschiss hätte es auch getan. Aber der Huber muss sich ja an die Vorschriften halten, hat er gesagt. Da verstehe ich dann halt auch überhaupt keinen Spaß mehr, wenn der mir so daherkommt. Wegen dem habe ich schon wieder einen Eintrag in meiner Akte. Und weil das nicht der erste ist, ist das eben wirklich blöd. Da muss ich dann wieder mal zum Psychologen, und auf dem seinen Schmarrn habe ich ja überhaupt keine Lust. Drum ist der kleine Verschlucker vom Huber eh nur eine geringe Genugtuung.
Es entsteht eine Pause, er muss erst überlegen, wie er damit umgehen soll, dass ich von seinem Puffbesuch im ›La Luna‹ weiß. Ich erinnere mich noch genau, wie ich auf einer meiner nächtlichen Spazierfahrten zufällig den Huber gesehen hab, wie er auf Schleichwegen dorthin gefahren ist. Den seinen protzigen Mercedes erkennst sogar noch in der dunkelsten Nacht. Ich bin ihm natürlich unauffällig gefolgt, und da hab ich ihn gesehen, wie er mit bierernstem Blick, ohne auch nur seine Fresse zu einem einzigen kleinen Grinser zu verziehen, mit einer drallen Blondine aufs Zimmer abgezogen ist.
»Dimpfelmoser, ich muss mich halt auch informieren, was in meinem Bezirk so alles läuft, und da gehört eine Recherche vor Ort eben dazu. Ja glauben Sie denn, ich mach so was zum Spaß?«, schiebt er noch hinterher, der Heuchler, der elendige. »Ich verlasse mich auf Sie, Dimpfelmoser, dass das unter uns bleibt. Sie als mein bester Mann, da kann ich mich ja wohl zu einhundert Prozent drauf verlassen.«
Oha, jetzt bin ich also auf einmal sein bester Mann. Ich räuspere mich erst mal ganz ausgiebig und genieße es, wie zuwider ihm das ist.
»Huber, wenn Sie da mal was machen könnten, dass ich nicht wieder zum Psychologen muss …«, träller ich in die Leitung.
Zunächst ist es ganz still. Ich sehe ihn vor mir, wie er schwitzt und wie es in seinem Spatzenhirn rattert. »Dimpfelmoser, ich schau, was sich da machen lässt. Da können Sie sich ganz auf mich verlassen, dass ich alle meine Beziehungen spielen lasse, das verspreche ich Ihnen.«
Na also, geht doch. Warum nicht gleich so.
»Warum haben’S eigentlich angerufen?«, frage ich ihn dann so nebenbei.
Jetzt, wo alles geklärt ist zwischen uns, kann man ja wieder zum normalen Tagesgeschäft übergehen.
»Dimpfelmoser, wie gesagt, es ist etwas delikat, da brauche ich meinen besten Mann«, schleimt er.
»Reden’S halt nicht um den heißen Brei herum«, sag ich, damit er endlich zur Sache kommt.
»Also, es ist Folgendes – und dass Sie mir ja zurückhaltend und unauffällig vorgehen, Dimpfelmoser. Das ist wichtig, es handelt sich nämlich um unseren Landrat, da müssen’S wirklich diskret sein.«
Oha, daher weht also der Wind. Kaum geht es um einen der Politfuzzis, da springt der Huber auch schon, und es ist ihm völlig egal, ob er andere Leute beim Sonntagsessen stört. Aber so läuft das nun mal bei denen da oben. Einer leckt dem anderen den Arsch, bis er richtig reinkriechen kann. Das könnte ja mal für die eigene Karriere wichtig sein. Da bleibe ich doch lieber mir und meinen Prinzipien treu, bevor ich bei so einem Eiertanz mitmache.
»Also, der Landrat Hinterbirner hat mich vorhin angerufen. Er verbringt das Wochenende mit seiner Freundin draußen in seiner Jagdhütte.«
»Der ist doch verheiratet mit dieser Schauspielerin, der Maria Hinterbirner«, werfe ich vorsichtig ein, »was macht der dann da mit einer anderen?«
»Mensch, Dimpfelmoser, jetzt stellen Sie sich halt nicht so an. Der hat halt was laufen mit der. Eine wahre Augenweide übrigens, das kann ich Ihnen sagen. Sophia Distler heißt sie. Dem Landrat seine Frau ist ja immer unterwegs, da will er halt auch mal ein bisschen Spaß haben, das ist doch nicht verwerflich. Ein Mann hat schließlich so seine Bedürfnisse, das kennen Sie doch sicher auch, Dimpfelmoser.«
»Sodom und Gomorrha, und das bei uns auf dem Land«, werfe ich ein, aber der Huber geht gar nicht darauf ein.
»Also der Hinterbirner hat mich angerufen. Seine Jagdhütte liegt ja draußen im Wald an Ihrer Reviergrenze, da sind Sie also eh zuständig. Und da schleicht seit ein paar Stunden einer um die Hütte. Der Hinterbirner und die Frau Distler befürchten natürlich das Schlimmste. Stellen Sie sich vor, jemand hat etwas mitbekommen von der Beziehung von den beiden, und jetzt steht da draußen so ein Journalist und wartet nur darauf, sie in flagranti zu fotografieren.«
»Und deswegen machen’S am Sonntag so einen Aufstand?«, frage ich vorsichtig nach, aber der Huber lässt sich nicht beirren.
»Dimpfelmoser, stellen Sie sich halt nicht so an, es geht um den Landrat. Der hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Das gibt doch einen Riesenskandal, wenn das rauskommt. Die Frau Distler ist ja auch verheiratet, da muss man doch auch an die armen Familienangehörigen denken, Dimpfelmoser«, beschwört mich der Huber.
Jetzt ist mir aber der Ruf von denen da oben ja völlig wurscht. Dann müssen die halt besser aufpassen mit ihren Sauereien. Aber ich merke schon am Tonfall vom Huber, dass ich da rausfahren muss. Also halte ich mich zurück und denke mir meinen Teil.
»Also dann fahr’n mia da hernach hin und schau’n amal nach, wer sich da rumtreibt. Sind’S dann zufrieden, Huber?«, sage ich und lege auf, weil der schon wieder zu einer Predigt ansetzen will, wie wichtig das doch ist.
Für ihn ist es wichtig, da sammelt er wieder ein paar Schleimpunkte bei seinem Parteifreund, dem Landrat.
»Abmarsch, Reindl«, rufe ich zum Kollegen rüber.
Der schaut mich blöd an, und sein Mund klappt auf, aber es kommt nichts raus.
»Ja, was schaust denn so deppert, mia ham an Einsatz, und zwar einen geheimen. Das bleibt unter uns, sonst passiert was, und mach halt dein Maul wieder zu, Reindl. Deine fauligen Zähne kannst jemand anders zeigen.«
Der Reindl ist völlig perplex, als ob wir noch nie einen Einsatz gehabt hätten. Zugegeben, viele waren es nicht, seit er bei mir ist, aber bei uns ist eben die Welt noch in Ordnung. Inzwischen scheint die Nachricht von den Ohren bis zu seinem Spatzenhirn vorgedrungen zu sein, jedenfalls springt er ganz wichtig auf und rennt zum Dienstwagen. Den Großstädtern fehlt einfach das Gefühl für das richtige Tempo. Ich gehe gemächlich hinterher. Der Reindl startet schon hektisch den Wagen. Ich reiße die Fahrertür auf und ziehe ihn raus, wo kommen wir denn da hin. Ich spiele doch nicht den Beifahrer vom Reindl, da bestehe ich dann doch auf meinen Status als Dienststellenleiter. Grummelnd schleicht der um das Auto und lässt sich auf den Beifahrersitz sinken. Ich steige ein, und mit quietschenden Reifen lege ich einen Kavaliersstart auf unserer Hauptstraße hin, dass es nur so raucht und ein wahres Vergnügen ist. Den Polizeifunk schalte ich sicherheitshalber ab, nicht dass uns noch einer stört auf unserer Geheimmission. Schweigend sitzen wir nebeneinander. Ich nehme routiniert die kurvige Straße, die zum Wald führt, in dem der Landrat seine Lusthütte stehen hat. Der Reindl ist schon ganz bleich, ihm bekommt mein ausgefeilter Fahrstil immer noch nicht so richtig. Einmal hat er sogar aus dem Fenster gekotzt, aber er ist halt ein Warmduscher aus der Stadt. Bei Tempo einhundertfünfzig geht plötzlich neben mir ein Höllenspektakel los. Beinahe hätte ich das Lenkrad verrissen vor Schreck, aber was ein echter Profi auf der Straße ist, der hat so eine Situation gleich wieder im Griff. Also schlingert der Wagen nur knapp an der Leitplanke vorbei, dann bin ich schon wieder Herr der Lage. Der Reindl fingert hektisch in seiner Jackentasche rum und zieht das Diensthandy raus. Endlich hat er das Teil am Ohr und meldet sich ganz korrekt, wie es nun einmal seine Art ist.
»Kommissar Reindl, was kann ich für Sie tun?«, quillt es schleimig aus seinem Mund, aber weiter kommt er nicht, weil der Huber mit überschnappender Stimme am anderen Ende der Leitung so laut brüllt, als würde er gerade abgestochen werden.
»Gib her«, sage ich zum Reindl, der mir schockiert das Telefon reicht.
Ohne vom Gas zu gehen, lenke ich gekonnt mit einer Hand den Wagen weiter. Der Huber schreit die ganze Zeit irgendwas von einer Leiche, so viel kann ich gerade noch verstehen. Ich lasse ihn erst mal brüllen, bis er irgendwann einmal doch Luft holen muss.
»Sie haben eine Leiche gefunden, Huber?«, frage ich ihn.
Jetzt ist er still, ich hör ihn nur wild schnaufen. Vielleicht hat er ja den Lover von seiner Alten abgemurkst, denke ich mir. Scheinbar beruhigt er sich doch etwas, seine Atmung wird zumindest gleichmäßiger, auch wenn es sich immer noch anhört, als wäre ein Walross am anderen Ende der Leitung. Er schnauft noch ein paar Mal theatralisch, und dann kann man endlich vernünftig mit ihm reden.
»Ich doch nicht, Dimpfelmoser«, nuschelt er auf einmal geheimnisvoll ins Telefon.
Zuerst schreit er, dass mir das Trommelfell platzt, und dann versteh ich fast nix, weil er auf einmal so leise wird. Der spinnt doch, der Huber. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Ich muss ja schließlich auch noch den Wagen über die kurvige Straße lenken. So langsam hab ich die Faxen echt dick, und das alles am Sonntag.
»Dimpfelmoser, Sie müssen sofort umkehren. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Im Hungersacker liegt eine Leiche. Da müssen Sie sofort hin.«
Das gibt es jetzt aber echt nicht mehr! Der Tag ist ja langsam völlig für die Katz, wenn ich auch noch zum Hungersacker rausfahren soll.
»Und was ist mit dem Landrat?«, frage ich. »Ist der nicht mehr so wichtig? Mir san scho fast da, noch zwei Minuten. Und der Hungersacker ist ja genau in die entgegengesetzte Richtung, da brauchen mia mindestens eine Stunde hin. Können’S da nicht jemand anders schicken?«
»Dimpfelmoser, der Einsatzbefehl kommt direkt über die Notrufzentrale, das hilft alles nichts. Da muss auch der Landrat warten. Und jemand anders kann ich nicht schicken. Alle Kollegen sind doch auf der Großdemo in der Stadt, das wissen Sie doch, Dimpfelmoser.«
Als ob das mein Problem wäre. Zuerst schickt der Huber am Sonntag meine Männer zur Demo und lässt mich mit dem depperten Reindl ganz alleine, und dann soll ich die Suppe hier wieder auslöffeln. Ich sag dem Huber, dass wir gleich umkehren und hinfahren, dann lege ich auf und werfe das Höllenteil dem Reindl rüber.
»So, dann fahr’n mia weiter zum Landrat«, sage ich und gebe noch mehr Gas.
»Aber eine Leiche, Dimpfelmoser, du hast es doch gerade gehört, das hat Priorität«, belehrt mich der Reindl.
»Eine Leiche, die ist doch schon tot, was soll daran wichtiger sein?«, raunze ich ihn an, den ewigen Besserwisser. »Der Landrat lebt hoffentlich noch, und da fahr’n mia zuerst hin, nicht dass dem auch noch was passiert.«
Dem Reindl fällt zur Abwechslung mal nichts mehr ein. Er starrt bloß verbissen auf seine Schuhspitzen und tut auf beleidigt. Das ist mir ganz recht, dann hält er wenigstens mal seinen Mund. Plötzlich brüllt schon wieder die Motorsäge. So langsam nervt mich das echt. Der Reindl geht ran und kommt gar nicht zu Wort. Ich höre es bis zu mir rüber, es ist die Oma. Die habe ich in dem ganzen Sonntagsstress ja völlig vergessen. Sie kreischt ins Telefon, dass selbst das Geschrei vom Huber ein Dreck dagegen ist. Sogar mir wackeln die Ohren, obwohl doch der Reindl das Handy hat. Wahrscheinlich ist der inzwischen taub, aber das kommt davon. Was muss er das blöde Teil auch immer mit sich rumschleppen. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt, er soll es doch einfach in der Dienststelle lassen, aber er weiß es ja immer besser. »Gib her«, sag ich und nehme ihm wieder das Handy ab.
»Oma«, brülle ich, so dass es den Reindl noch mehr reißt und er sich die Ohren vor Schreck zuhält. »Halt einmal für einen Moment die Luft an und hör mir zu. Wir sind auf einem wichtigen Polizeieinsatz, Mord und Totschlag sag ich da nur, da kann ich momentan nicht zum Kaffee kommen, des musst schon verstehen. Ich bin halt auch am Sonntag im Dienst. Aber wenn du mir was aufhebst von deinem Apfelkuchen, dann erzähl ich dir später alles genau.«
Jetzt ist die Oma zufrieden, das weiß ich. Sie ist nämlich ganz narrisch auf Mord und Totschlag. Sie schaut sich ja jeden Krimi im Fernsehen an.
»Ja sag’s halt gleich, dass du auf Verbrecherjagd bist«, schnurrt sie ins Telefon. »Freilich heb ich dir was auf vom Kuchen, wenn du mir die Geschichte hernach erzählst.«
So, dann ist der Sonntag wenigstens noch nicht ganz versaut, wenn ich zumindest später noch einen Apfelkuchen von der Oma kriege. Die macht den besten Apfelkuchen im ganzen Landkreis, und das ist dann fast so schön wie das Bratwurstessen beim Schorsch-Wirt. Ich lege also zufrieden auf, und da sind wir auch schon gleich bei der Jagdhütte vom Landrat Hinterbirner. Ich schalte noch schnell das Blaulicht und das Martinshorn ein, damit der Landrat und sein Gspusi mitkriegen, dass sie jetzt in Sicherheit sind und sich nicht mehr fürchten brauchen. Dann gebe ich so richtig Gas, dass der Wagen filmreif vor die Eingangstüre schlittert und direkt davor zum Stehen kommt. Das macht Spaß, das sollte ich wieder öfter machen, so wie früher. Aber das hat mir der Huber ja auch verboten, die alte Spaßbremse.
»So, Reindl«, sag ich, »pass einmal auf, wie das ein echter Profi macht, damit du noch was lernst für deine weitere Laufbahn, gell.«
Der Reindl starrt mich nur wieder deppert an, aber das ist mir egal. Jetzt muss ich mich auf den Einsatz konzentrieren. Ich suche mit meinem professionellen Röntgenblick das Gelände ab. Kurz flackert etwas in meinen Gehirnwindungen auf, etwas, das nicht so sein soll, wie es ist, aber leider kriege ich das verdammte Bild im Kopf nicht näher zu fassen, es entfleucht mir wieder und verkriecht sich in einer dunklen Ecke. Aber das ist mir momentan auch wurscht, ich muss mich konzentrieren. Ich schaue also weiter. Mein Blick wandert zum Waldrand, und tatsächlich entdecke ich im Dickicht hinter den Büschen eine Gestalt. Ja sauber, da sitzt doch tatsächlich einer, und den stört es scheinbar nicht einmal, dass jetzt die Polizei hier ist! Glaubt der denn, er hat es mit Idioten zu tun? Für den Reindl mag das ja zutreffen, aber mich sollte das Bürscherl nicht unterschätzen. Ich bin ja nicht auf der Brennsupp’n dahergeschwommen. Ich warte noch einen Moment, während ich das Gelände weiter beobachte, dann ziehe ich blitzschnell meine Dienstwaffe, reiße die Türe auf und hechte mit der Pistole im Anschlag aus dem Wagen. Gekonnt robbe ich zu dem Holzstoß am Haus, während ich einen Warnschuss in Richtung Wald abgebe, um gleich einmal klarzustellen, wie hier der Hase läuft. Während ich hinter dem Holzstoß in Deckung gehe, um dem Paparazzo gar keine Möglichkeit zu geben, mich abzulichten, höre ich einen gurgelnden, unmenschlichen Laut aus der Richtung, in die ich geschossen habe. Das irritiert mich doch ein bisschen. Ich habe ja extra nach oben gezielt, damit ich niemanden verletze. Vielleicht hat sich der Sauhund ja auf einen Baum geflüchtet, dann hätten wir ein kleines Problem, denke ich mir. Vorsichtshalber schieße ich noch einmal, wobei ich ganz bewusst über die Bäume ziele. Während der Schuss im Wald verhallt, raschelt es in den Bäumen über mir, und eine riesige Eule segelt mit dem Kopf nach unten auf den Boden. Die hat wohl das Zeitliche gesegnet, da kann man nichts machen. Jetzt kommt auch noch der Reindl kreidebleich aus dem Auto gesprungen und lässt sich hinter den schützenden Holzstand sinken. Der Feind nutzt inzwischen den Moment der Verwirrung und flüchtet in den Wald. Ich überlege kurz, ob ich die Verfolgung aufnehmen soll, aber mein angeborener Polizisteninstinkt sagt mir, dass das keinen Sinn hat. Dann soll er halt abhauen, der Feigling. Kurz darauf höre ich, wie im Wald ein Wagen angelassen wird und sich mit aufheulendem Motor schnell entfernt. Hätte der Huber nicht alle Einsatzkräfte zur Demo geschickt, könnten wir einfach die Kollegen informieren, und die würden den Flüchtigen dann schon auf der Kreisstraße erwischen, aber so müssen wir ihn halt ziehen lassen. Ich gehe gemächlich zum Gebüsch und inspiziere den Platz, an dem der Eindringling gesessen hat. Am Boden verstreut liegen mindestens zwanzig Zigarillostummeln einer seltenen, mir aber nicht unbekannten Marke und eine angebissene Leberkässemmel. Ich sammle die Teile in eine Plastiktüte ein, ohne sie anzufassen. Man will ja schließlich keine Fingerabdrücke verwischen, obwohl mir eh schon klar ist, wer da als Spanner gesessen hat. Man kennt ja schließlich seine Pappenheimer. Und einen kettenrauchenden Leberkäsfresser, der so ein stinkendes Kraut raucht, da gibt es im Umkreis von hundert Kilometern nur einen, der in Frage kommt. Der läuft mir nicht davon, dem kann ich später auch noch den Arsch aufreißen. Also gehe ich zufrieden zurück zum Haus.
»Gefahr vorüber, Reindl«, rufe ich rüber zum Kollegen, der immer noch ganz kasig hinter dem Holzstoß sitzt.
Er hält halt einfach nichts aus. Im Haus ist alles still. Ich klopfe an die Tür, aber es rührt sich nichts.
»Jetzt macht’s halt auf, hier ist die Polizei«, schreie ich, »die Gefahr ist vorüber. Ihr könnt’s rauskommen.«
Wieder rührt sich nichts. Ich drücke die Klinke, aber die Türe ist verschlossen. Also ist Gefahr in Verzug. Nicht dass der Schmierenblattfuzzi dem Landrat und seinem Gspusi noch was angetan hat. Ich reiße also noch mal meine Dienstwaffe aus dem Halfter und ziele auf das Türschloss.
»Geht’s weg da drinnen, falls ihr hinter der Türe steht’s«, schreie ich, und dann schieße ich das Schloss in tausend Teile.
Der Einsatz ist wirklich pfundig, so viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Die Tür springt endlich nach dem vierten Schuss auf, und mit der Pistole im Anschlag betrete ich vorsichtig das Haus. Aus den Augenwinkeln sehe ich noch, wie sich der Reindl hinter dem Holzstoß übergibt, aber da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern. Vorsichtig schleiche ich durch das Haus, die Waffe immer im Anschlag. Man weiß ja nie, was einen so alles erwartet. Im Schlafzimmer finde ich die beiden dann. Eng aneinandergeklammert haben sie sich unter dem Bett verkrochen. So was ist also unser Landrat. Vögeln und fremdgehen, das kann er schon, aber kaum wird es einmal ein bisschen brenzlig, dann verkriecht er sich wie eine Maus in ihrem Loch, der saubere Herr. Aber so sind sie halt, die Politiker. Ein Riesenmaul in der Öffentlichkeit, aber keine Eier in der Hose, wenn es drauf ankommt.
Wie sie mich sehen, kriechen sie zitternd aus ihrem erbärmlichen Versteck. Ich stelle fest, dass der Huber noch untertrieben hat. Die Distler Sophia ist ja so was von rattenscharf, da bin ich sogar mitten im Einsatz kurz abgelenkt und glotze sie mit großen Augen an. Sie quittiert meine Fleischschau mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln. Dass der Landrat bei so einer schwach wird, das kann ich dann doch irgendwie verstehen, auch wenn ich es trotzdem völlig daneben finde, wie der so ungeniert seine Frau betrügt. Inzwischen kommt die Sophia mit einem Augenaufschlag und einem Gang auf mich zu, dass mir gleich ganz schwindlig wird. Sie fällt mir doch tatsächlich um den Hals und haucht mir einen Kuss auf die Wange, dass mir abwechselnd heiß und kalt wird.
»Danke, Herr Polizist, dass Sie uns so mutig gerettet haben«, flüstert sie mir ins Ohr.
Ich atme ihren unwiderstehlichen Duft ein, da unterbricht jäh ein Hüsteln die wunderbare Stimmung zwischen uns.
»Dimpfelmoser, selten habe ich mich so gefreut, Sie zu sehen«, sagt der Hinterbirner und tut so, als wäre er ganz Herr der Lage und nicht eben noch schlotternd vor Angst unter dem Bett gelegen.
»Haben Sie denn die beiden Eindringlinge verhaftet?«
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt.
»Ja wie kommen’S auf zwei, Herr Landrat?«, frage ich. »Da war nur einer. Haben’S zu viel getrunken, Hinterbirner?«
»Wir sind ja nicht hierhergekommen, um uns zu betrinken«, tut er gleich ganz entrüstet und zwinkert mir verschwörerisch zu. »Zwei, Dimpfelmoser, es waren hundertprozentig zwei Männer. Wir konnten sie ja genau sehen, wie sie vor dem Schlafzimmerfenster rumgeschlichen sind. Fragen Sie die Frau Distler, die kann Ihnen das bestätigen.«
»Herr Polizist, um neun Uhr in der Früh, da war ein großer Blonder am Fenster, ich hab sein Gesicht genau gesehen. Ich bin ja gänzlich unbekleidet davorgestanden«, haucht sie mir wieder ins Ohr. »Der ist aber sofort wieder im Wald verschwunden, als er gemerkt hat, dass wir ihn gesehen haben.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.