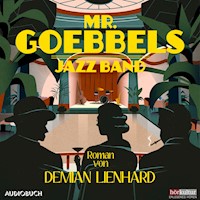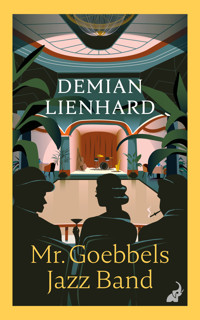
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die verbotenen Rhythmen des Dritten Reichs: Faszinierender Einblick in die verbotene Jazzszene im Berlin der Nazizeit. Nominiert für den Schweizer Buchpreis. Berlin, Frühjahr 1940. Auf Beschluss von Joseph Goebbels wird für den Auslandsradiosender Germany Calling eine Big Band gegründet, die als Mr. Goebbels Jazz Band internationale Bekanntheit erlangt. Die besten europäischen Musiker, darunter auch Ausländer, Juden und Homosexuelle, spielen im Dienst der NS-Propaganda wortwörtlich um ihr Überleben – ausgerechnet mit Jazz, der als »entartet« galt. Bis zu 6 Millionen britische Haushalte täglich lauschen den Swing-Stücken mit anti-alliierten Hetztexten und dem Star-Moderator William Joyce alias Lord Haw-Haw, der nach seinem Aufstieg in der British Fascist Union aus London nach Berlin geflohen war. Joyce soll den Erfolg »an der Front im Äther« literarisch dokumentieren lassen. Der dafür ausgewählte Schweizer Schriftsteller Fritz Mahler findet sich im Zuge seines Auftrags, einen Propagandaroman über die Band zu schreiben, in verruchten Berliner Clubs und illegalen Jazzkellern wieder, trinkt zu viel Cointreau, verzettelt sich in seinen Recherchen und muss nicht nur die Skepsis der Musiker überwinden, sondern auch seine gefährlichen Auftraggeber über das schleppende Vorankommen seines Unterfangens hinwegtäuschen. Demian Lienhard erzählt die ungeheuerliche (fast bis ins Detail wahre) Geschichte von Mr. Goebbels Jazz Band und des berüchtigten Radiosprechers William Joyce. In furiosem Tempo jagt Lienhard seinen Figuren von New York nach Galway, London, Manchester, Zürich, Danzig und Berlin nach und stellt den menschenverachtenden Zynismus des NS-Staats ebenso bloß wie die Perfidie der Nazi-Propaganda. Gezeigt wird das Scheitern künstlerischer Produktion im Dienste einer Ideologie, wobei auch die eigene Erzählung verschmitzt unterwandert wird, bis hin zum überraschenden Paukenschlag. »Die wahre Geschichte des Faschisten, der ins Nazideutschland flieht, dort Jazzsendungen moderiert, Musik, die verpönt, ja verboten ist, mutet absurd an. Demian Lienhard erzählt sie mit viel Witz und Ironie, mit Sinn für Details. Ein verrücktes Buch, das überrascht, bildet und die Wirkung und den Widersinn von Propaganda in feiner und präziser Sprache vorführt.«Susanne Wankell, WDR5 »Ein Roman, der faszinierende Einblicke in ein vergessenes Kapitel des ›Dritten Reichs‹ gewährt, lebendig und fesselnd bis zum furiosen Schlusstwist.«Buchjournal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berlin, Frühjahr 1940. Auf Beschluss von Joseph Goebbels wird für den Auslandsradiosender Germany Calling eine Big Band gegründet, die als Mr. Goebbels Jazz Band internationale Bekanntheit erlangt. Die besten europäischen Musiker, darunter auch Ausländer, Juden und Homosexuelle, spielen im Dienst der NS-Propaganda wortwörtlich um ihr Überleben – ausgerechnet mit Jazz, der als »entartet« galt. Bis zu 6 Millionen britische Haushalte täglich lauschen den Swing-Stücken mit anti-alliierten Hetztexten und dem Star-Moderator William Joyce alias Lord Haw-Haw, der nach seinem Aufstieg in der British Fascist Union aus London nach Berlin geflohen war. Joyce soll den Erfolg »an der Front im Äther« literarisch dokumentieren lassen. Der dafür ausgewählte Schweizer Schriftsteller Fritz Mahler findet sich im Zuge seines Auftrags, einen Propagandaroman über die Band zu schreiben, in verruchten Berliner Clubs und illegalen Jazzkellern wieder, trinkt zu viel Cointreau, verzettelt sich in seinen Recherchen und muss nicht nur die Skepsis der Musiker überwinden, sondern auch seine gefährlichen Auftraggeber über das schleppende Vorankommen seines Unterfangens hinwegtäuschen.
Demian Lienhard erzählt die ungeheuerliche (fast bis ins Detail wahre) Geschichte von Mr. Goebbels Jazz Band und des berüchtigten Radiosprechers William Joyce. In furiosem Tempo jagt Lienhard seinen Figuren von New York nach Galway, London, Manchester, Zürich, Danzig und Berlin nach und stellt den menschenverachtenden Zynismus des NS-Staats ebenso bloß wie die Perfidie der Nazi-Propaganda. Gezeigt wird das Scheitern künstlerischer Produktion im Dienste einer Ideologie, wobei auch die eigene Erzählung verschmitzt unterwandert wird, bis hin zum überraschenden Paukenschlag.
INHALT
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Schlussbemerkungen des Herausgebers Demian Lienhard
Nachwort von Staatsarchivar Dr. phil. Samuel Tribolet
Editorische Notiz
The one duty we owe to history is to rewrite it.
Oscar Wilde
ERSTER TEIL
Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.
Georg Büchner
Berlin, im Jahr 1940
Über dem Reich, über der Hauptstadt, über Berlin, da war an diesem Vormittag eine durch und durch deutsche Sonne am blankgeputzten Himmel zu sehen: Feist und prall und kurz vor Erreichen ihres Höhepunktes thronte sie über der Welt und übergoss alles mit ihrer schwefelgelben Herrlichkeit, dass es vor Verzückung kaum ein Aushalten war.
Der Tag nahm sich außerordentlich warm aus für diese Jahreszeit. Nur selten war da und dort ein laues Lüftchen zu verspüren, zumeist aber blieb es vollkommen windstill. Die riesigen Hakenkreuzfahnen, sehr zufrieden über ihre eigene Größe, hingen schlaff und träge an ihren Stangen.
Unter den Linden, auf der Leipziger und der Wilhelmstraße, den Neben-, Zubringer- und Seitenstraßen, sprich: im Regierungsviertel, ging alles seinen wohlgeordneten Gang. Schneidige Beamte schritten schnell von einem Büro ins nächste, adrett gekleidete Sekretärinnen huschten von einer Straßenseite zur anderen, schwarz schimmernde Dienstwagen und Taxis schoben sich rasch ins Reißen des Verkehrs.
Im dumpfen Vibrando dieser großstädtischen Geschäftigkeit war zunächst nur unmerklich, dann aber umso schärfer und stechender ein dreimotoriges Knattern und Sputzen auszumachen, und wer nun, vom Lärm aufgeschreckt, den Kopf hob, konnte dort einen in der Sonne glitzernden Aeroplan seine ebenmäßigen Bahnen ziehen sehen; seine Nase starr gen Tempelhof gerichtet, sank er wie auf einer unsichtbaren Rampe langsam aus dem Himmel herab.
Das war es, was die Menschen am Boden sahen, während umgekehrt, aus den rechteckigen Fensterchen, der Blick der Passagiere hinunter in die Straßenschluchten des monumentalen Zentrums stürzte. Man sah das Reichspräsidentenpalais, das Justizministerium, das Auswärtige Amt, alle waren sie an der Wilhelmstraße aufgereiht wie lauernde Seevögel auf einer hohen Klippe. Zwischen Wilhelmplatz und Mauerstraße schließlich erblickte man auch das schattenfarbene Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda, in dessen – nanu! – seltsam verrenktem Grundriss einer der empfindsameren Passagiere für kurze Zeit die fast bis zur Unlesbarkeit miteinander verwachsenen Buchstaben J und G zu erkennen meinte. Dies freilich blieb den Passanten am Boden verborgen; wer die Mauerstraße hinunterschlenderte, sah hier einen von steinernen Vögeln bewachten Bau mit riesigen Fenstern, Türen und Treppenstufen, der jeden Maßstab des Menschlichen vermissen ließ. Aber war nicht genau dies der Arbeit angemessen, die hier tagein, tagaus geleistet wurde?
In diesem Schalt- und Waltzentrum der öffentlichen Befindlichkeit, in dieser Fabrik des deutschen Willens hing am heutigen Vormittag eine gewisse Irritation in der Luft. Eine Störung hatte sich ins ministeriale Uhrwerk eingeschlichen, die präzis ineinandergreifenden Zahnräder der Abteilungen und Referate waren in eine leichte Unwucht geraten, denn ungewohnte Klänge krochen durch die Flure, nervöses Klarinettengenäsel kam die Treppen heruntergeschlängelt, lockere Melodien, denen man hier und dort einen Ton abgeknapst hatte, drangen stoßweise in so manches Büro, und immer wieder schoss ganz unvermittelt das überdrehte Tüdelü eines Saxophons durch eine offenstehende Tür.
Dagegen formierte sich alsbald Widerstand. Wie auf einen unsichtbaren Befehl kamen ein Herr Itzewerder, ein Herr Storchenburg und ein Herr von Ungern-Sternberg auf die Gänge gelaufen, und an den zahlreichen Köpfen, die nun überall aus den Türen gereckt wurden, konnte man leichthin erkennen, dass sie in ihrem Empfinden nicht alleine waren. Noch im selben Gang schloss sich ihnen ein Dutzend Männer und Frauen an, und in kürzester Zeit hatte sich ein lärmender Haufen zusammengerottet, der sich auf die Suche nach der Quelle des Übels begab.
Man folgte verschlungenen Fluren, stieg zahlreiche Treppenschächte empor und wieder hinunter, und auch wenn man hin und wieder in die Irre ging, wurde man von der beschwingten Melodie letztlich doch in einen abgelegenen Teil des Gebäudes gelockt, vor die doppelflüglige Tür eines Vorführungssaals. Hier nun gab es keinen Zweifel mehr: Hinter der Handbreit furnierten Holzes war es, wo eine Musik aufgespielt wurde, die sich ganz offenbar mit allen Wassern gewaschen hatte. Wobei, in den meisten Ohren – sicher bei den Herren Storchenburg und Ungern-Sternberg, bei Herrn Itzewerder wissen wir es nicht ganz so genau – nahmen sich diese Melodien natürlich schmutzig aus, denn da schwang, nun, afrikanischer Dschungel oder auch, jawohl, Palästina mit, und der Rhythmus war unerhört. Das alles aber verführte erstaunlicherweise zum Mitwippen, es schob sich einem unweigerlich die Kinnlade nach vorne, hinten, vorne, die Musik verlockte zum Tanzen, vielleicht war sie sogar ein kleines bisschen schmissig, fetzig und – ähm, aber vor allem natürlich heillos entartet.
Also, worauf wartete man denn noch? Los los, hinein in den Saal gestürmt, und beendet, was beendet gehört! Oder doch nicht? Nun, die Beamtenschar wollte den Klamauk schleunigst unterbunden sehen, sie zürnte und zuckte, bibberte und geiferte. Im gleichen Maße aber war man auch gehemmt, dieses Verlangen höchstselbst ins Werk zu setzen. In stachligen Buchstaben stand nämlich präzis jener Gedanke an der Tür angeschlagen, den sie alle unausgesprochen auf der Zunge trugen: Jegliche Störung ist zu unterlassen!
Ui. Was sollte das nun heißen, wie war das zu deuten, was war zu tun? Sollte man seinem inneren Drang nach Ordnung nachgeben und die Tür aufbrechen? Aber galt es nicht ebenso, diesem Befehl zu gehorchen, der hier unmissverständlich und in seiner ganzen Schärfe auf der Tür prangte? Man haderte und zürnte, man war hierhin und dorthin gerissen, es herrschte eine fingernägelknabbernde Anspannung. Nein, es war wirklich nicht erquicklich, in diesen Häuten zu stecken, die von oben bis unten angefüllt waren mit der Frage, ob man sich – sozusagen für ein höheres Ziel – einem Befehl widersetzen durfte, und man hätte ganz ungern mit diesen bedauernswerten Kreaturen tauschen wollen.
Just das (oder etwas sehr Ähnliches) aber geschah nun: Wie durch telepathische Gedankenübertragung fand sich die exakt gleiche Überlegung in die Köpfe des hinter dieser Tür versammelten Publikums verpflanzt, und auch wenn es unerträglich stickig war in dem eng bestuhlten Raum, so waren es bestimmt nicht nur die verbrauchte Luft und der wabernde Zigarettenrauch, welche feine Schweißperlen auf die Stirn der in dezenten Braun-, Grau- und Schwarztönen uniformierten Zuhörer trieben. Hier und dort wurde denn auch gehüstelt, immer wieder griff irgendwo ein Daumen und ein Zeigefinger nach dem Kragenspiegel, um der Kehle etwas Erleichterung zu verschaffen, und so manch ein Blick fand sich abermals auf die tadellos polierten Stiefelspitzen gesenkt. Der allgemeinen Nervosität zum Trotz versuchte man ruhig zu bleiben und hoffte inständig auf eine baldige Klärung der Frage, warum in aller Welt diese wahnwitzigen Musiker da vorne einen astreinen Swing von ihren Instrumenten rissen.
Noch aber hieß es warten: Die Anspannung des beamtischen Publikums nämlich schien mitnichten auf die Bühne übergegriffen zu haben, wo mit einer Mischung aus südländischer Nongschalengs (wie der Berliner zu sagen pflegt) und hauptstädtischer Schnoddrigkeit vier, fünf, sechs schwarz befrackte Musikanten zugange waren und überhaupt nicht ans Aufhören dachten. Im Gegenteil: Da zwirbelte ein Saxophonist mit runder Brille seine Melodiechen eifrig zwischen die Trompetenstöße, während an Klavier und Schlagzeug zwei Männer mit glänzendem Haar und ebensolchem Gespür für musikalische Feinheiten der eingängigen Melodie ihren Rhythmus unterjubelten. Es war ein Hin und Her, eine musische Mänadenjagd, die von diesem Sextett vollzogen wurde, ein Wippen und Hüpfen, ein schrilles Kreischen, das erst nach langen Minuten in ein hörbares Verebben mündete, dem ganz zum Ende noch einmal ein furioses Schlagzeugsolo entgegengeschleudert wurde, padabadabam, Kipploren beim Kieslassen, hohle Zisternenwagen rasselten übers nächtliche Weichenfeld, die Trommel eines Revolvers entlud sich. Dann war Schluss, aus, vorbei, und eine schwere Stille fiel von der Decke herab.
Tja. Was sollte man davon denken, und vor allem: Wie sollte man sich dazu verhalten? Das hörte sich ja alles recht professionell an, Talent war unbestreitbar vorhanden, aber das konnte nun leider nicht verhindern, dass sich einem jeden die stechende Frage stellte, was mit diesem Affentheater eigentlich bezweckt werden sollte. Es war halb zwölf, nicht wenige hatten seit neun Uhr nichts mehr zwischen den Kiefern gehabt, man saß seit nunmehr einer vollen Stunde in diesem schlecht belüfteten Saal und wurde seither ohne Unterlass mit Buschmusik traktiert. Da durfte man doch nach einer Erklärung verlangen, oder etwa nicht?
Doch doch, ganz richtig. Aber noch wurde man von dieser Marter nicht erlöst. Dem Intendanten des Auslandsrundfunks Dr. Adolf Raskin, seines Zeichens Meister der Zersetzungspropaganda, hätte man zwar durchaus eine schlüssige Antwort zugetraut (auch wenn man gespannt sein durfte, welch kühne Verrenkungen hierzu notwendig sein würden), doch fand sich gerade dieser noch immer in ein angeregtes Flüstergespräch mit seinem Nachbarn vertieft, und man wusste es schlechterdings nicht zu deuten. Angesichts der sekündlich wachsenden Verwirrung heftete sich die Aufmerksamkeit des Publikums fast schon dankbar an einen neuen Widerspruch, der sich nun, sozusagen in Handlung übersetzt, vor ihren Augen zu materialisieren begann: Auf die Bühne schwang sich ein kleiner, kräftiger, vielleicht auch ein wenig grobschlächtiger Mann, den man im Ministerium als jenen Iren, Amerikaner, Briten (oder was auch immer er sein mochte) kannte, der seit geraumer Zeit im gegen England gerichteten Propagandaradio eine ziemlich starke Falle machte. Dieser Mann, der sich aus irgendeinem Grund Wilhelm Froehlich nannte, stellte sich schelmisch grinsend zwischen die Musikanten, die inzwischen ganz vorne auf der Bühne Aufstellung genommen hatten, um sich vor dem Publikum zu verneigen. Zwischen dem feinfühligen Sextett, das jedes Fingerklöpfeln und jedes Hüsteln im Raum sogleich aufgriff, um ihm wie aus gutgeölten Gelenkpfannen nachzuwippen, nahm sich besagter Froehlich, dem jedes Taktgefühl abging, wie ein Fremdkörper aus. Keine Frage: Jeder ästhetisch veranlagte Mensch im Saal war unmittelbar versucht, diesen Mann aus dem Bild zu schieben, und geradezu körperlich musste sich einem die Frage aufdrängen, ob der hier denn irgendwie dazugehöre.
Natürlich tat er das. Wie genau, das wurde den Entscheidungsträgern nun von Doktor Raskin erklärt, der aufgesprungen war, sich der Menge zugekehrt und seine blecherne Stimme erhoben hatte, deren Metall ihm sichtliches Behagen bereitete. Der Saxophonist Lutz Templin, der mit den deutlich sichtbaren Insignien des mittleren Alters (tief ins Haupthaar vorgedrungene Geheimratsecken, fesche Brille) allgemeine Sympathien beim vornehmlich älteren Publikum weckte, der Sänger Karl Schwedler (im Grunde ebenfalls ein flotter Kerl, aber aufgrund seiner undurchsichtigen Verflechtungen mit Ribbentrops Ministerium durchaus auch etwas zwielichtig) und eben der Radiosprecher Wilhelm Froehlich waren Anfang Jahr mit einer ausgefuchsten Idee auf den Plan getreten. Binnen Wochen hatten sie ein Programm namens Charlie’s Political Cabaret zur Sendereife gebracht, und mit diesen musikalisch untermalten Kabarettstückchen und satirischen Sketches hatten sie in England die allererstaunlichsten Erfolge feiern können. So weit, so gut, sagte Raskin, aber man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, im Gegenteil: Jetzt heiße es, Größeres ins Auge zu fassen, die Zeiten des Improvisierens und Kleckerns seien vorbei. Ein hauseigenes Orchester, sozusagen eine musikalische Schattenarmee, müsse her, die in der Lage sei, die Briten Tag und Nacht mit dem allerfeinsten Propagandajazz zu bombardieren.
Vielerorts Zustimmung, hier und da auch erstaunte Gesichter, aber vornehmlich Zuversicht. Auf dem rechten Flügel des Saals jedoch blieb man argwöhnisch, einigen wollte die Sache nicht ganz – nun – koscher erscheinen, es gab halblaut geäußerte Meinungsverschiedenheiten, bis schließlich einer das Wort ergriff und – ganz recht, nur zu! – den entscheidenden Gedanken äußerte: Ob man wirklich, tatsächlich, allen Ernstes, Jazz nach England senden wolle? Ob Deutschland (und England sowieso!) nicht vielleicht besser damit bedient sei, wenn man Händel, Beethoven und Mozart über den Kanal schicke? Angesichts dieser musikalischen Übermacht müsse der Brite doch unweigerlich die Waffen strecken.
Nun, das war ein redlicher Einfall, und als solcher fand er im Publikum lippenschürzende Zustimmung; Raskin aber winkte ab, seine Rechte vollzog einen seitwärts gerichteten deutschen Gruß, er wischte die Argumente von seinem imaginären Schreibtisch. Papperlapapp, Pustekuchen, Kokolores, Quatsch mit Soße. Die Engländer mochten vielleicht ihr Brudervolk sein, aber es war eben der alkoholkranke, raufsüchtige, verzogene und verweichlichte Bruder, der keine Kultur als die der Gosse kannte. Klassische Musik für England sei deshalb sozusagen Perlen vor die Säue, während umgekehrt Jazz geradezu für Schweine gemacht sei, sagte Raskin und wischte sich den Schweiß von der Denkerstirn, die ihm bis weit hinter die Ohren reichte. Nachdem er gehörigen Applaus für diese Pointe eingeheimst hatte, fuhr er fort, die Jazzmusik nach Spielweise, Rhythmuseinsatz, Tonqualität und Instrumentenkombination etc. etc. fein säuberlich auseinanderzunehmen, um schließlich jeden dieser Punkte in Hinsicht auf seine Wirkung, die er auf die angelsächsische Seele haben müsse, zu untersuchen. Wir haben diese komplizierten Ausführungen leider bis heute nicht zur Gänze begriffen, weshalb wir uns außerstande finden, sie hier angemessen wiederzugeben. Nur so viel: Lutz Templin rollte währenddessen ziemlich oft mit den Augen, wie er es immer tat, wenn ihm jemand vorrechnete, wie seine Musik zu funktionieren habe.
Nun waren aber die Zuhörer keine Jazzconnaisseurs (zumindest nicht offiziell), und deshalb war Templins künstlerischer Dünkel natürlich vollkommen fehl am Platze. Beamte trafen Entscheidungen, und deshalb wollten sie Fakten hören. Kollege Raskin lieferte sie ihnen, und zwar nicht zu knapp. Bald schon war in den Gesichtern eine abgemilderte Form der Skepsis zu erkennen (also kritisches Interesse), und schließlich, als es um den praktischen Nutzen ging, verfingen die Worte des Intendanten voll und ganz. Markig waren sie vielleicht schon, aber eben gerade deshalb auch umso verständlicher: Das hier ist Krieg, der Feind ist der Brite, und wenn der sich mit Jazzmusik am leichtesten in die Falle locken lasse, dann sei diese eben schlicht und ergreifend die beste Waffe.
Damit wollte Raskin eigentlich enden, aber weil sich auf dem rechten Flügel aufs Neue eine Hand hob, entschied er sich, den abermals auflodernden Widerstand mit einem kleinen Tricklein aus der rhetorischen Zauberkiste gewissermaßen im Keime zu ersticken. Was die Herren denn von den Erfolgen der U-Bootflotte hielten, fragte er zur störrischen Rechten hin gerichtet, und nachdem die zu erwartenden Antworten (Kolossal! Phänomenal! Erste Sahne!) von überallher auf ihn eingeprasselt waren, ließ er die Katze aus dem Sack: Sehr richtig, aber die feine englische Art (zwinkerzwinker) sei der U-Bootkrieg nun einmal nicht. Wenn sie ihn fragten, sei er sogar ziemlich hinterlistig, aber man müsse ja einen Krieg gewinnen, keinen Schönheitspreis.
Das saß. Der Hinterste und Letzte im Saal war überzeugt. Diese Stimmung musste man ausnutzen, es galt, Nägel mit Köpfen zu machen. Raskin erbat sich die Unterstützung des Ministeriums, um ein ständiges Jazzorchester auf die Beine stellen zu können, und nachdem diese von allen Stellen und Abteilungen zugesichert und das Publikum mit einer gewissen Erleichterung in die Mittagspause verduftet war, wandte er sich mit dem Auftrag an Templin, ein solches zusammenzustellen; Schlagzeug, Bass, Klavier und Gitarre, zwei, drei Saxophone, Klarinetten, Posaunen und Trompeten, alles in allem also fünfzehn, sechzehn Mann und ein paar zusätzlich für die Reserve; kurz, das volle Programm.
Einverstanden, sagte dieser, indem er mit dem Zeigefinger die verrutschte Brille wieder an ihren rechten Platz schob.
Er habe gar nichts anderes erwartet, sagte Raskin mit einem schelmischen Lächeln und äußerte dann, indem er Froehlich, der etwas abseits stand, mit der einen Hand heranwinkte und mit dem Zeigefinger der anderen auf ihn deutete, einen neuen (und gewiss richtigen) Gedanken: Jetzt müsse man eigentlich nur noch einen Schriftsteller anheuern, der mit wohlgewogener Neutralität über diese Sache schreibe, denn was man nicht dokumentiere, habe bekanntlich nie stattgefunden.
Wer denn dieser Schriftsteller sein solle, gab sich Froehlich neugierig, und ging damit geradewegs ins weit aufgespannte Netz.
Das sei eine ausgezeichnete Frage, erwiderte Raskin, und deshalb gebe er ihm höchstpersönlich den Auftrag, einen geeigneten Mann auszusuchen.
Froehlich, der, ohne es zu wollen, eine Schnute zog, hob gerade an, seinen Unwillen zu bekunden, als er sich vom Doktor flugs in die Schranken gewiesen fand.
Na na, immerhin werde dieser Roman auch von ihm handeln. Jeder andere würde sich nach einem solchen Mitspracherecht die Finger lecken.
Froehlichs Begeisterung indes hielt sich in engen Grenzen (oder wenn er eine solche verspürt haben sollte, gelang es ihm zumindest vortrefflich, diese zu verbergen). Warum er denn in diesem Roman vorkommen solle.
Raskin rollte mit den Augen. Er war von lauter Idioten umgeben, dieses Ministerium war das reinste Irrenhaus.
Na, weil er doch die Songtexte schreibe. Die Lyrics.
Er habe gedacht, das sei nicht bekannt, sagte Froehlich.
Der Allgemeinheit nicht, dem Ministerium schon.
Froehlich presste die Lippen aufeinander, kniff die Augen zusammen. Es arbeitete in seiner Stirn.
Ob der Doktor sich jemanden wie, zum Beispiel, Thomas Mann vorstelle?
Raskin starrte den Iren mit großen Augen an, um dann, nach einer Sekunde, loszuprusten. Er lachte laut, schallend und gellend, lief puterrot an, japste nach Luft.
Sie sind witzig, Froehlich, ich mag Ihren britischen Humor, brüllte er, und dann, nach einer Pause: Auch wenn ich die Briten verabscheue.
Wie wär’s mit Bronnen?
Zu jüdisch.
Benn?
Schwierig.
Jünger?
Der sei am Oberrhein stationiert.
Den könne man doch herholen.
Ungern.
Tja. Damit waren Froehlichs Kenntnisse der zeitgenössischen Literatur erschöpft. Er zuckte mit den Schultern.
Das mache nichts, sagte Raskin, man werde ihm schon dabei helfen. Wichtig sei jetzt, und damit wandte er sich wieder an Templin, dass man möglichst rasch die Gründung des Orchesters angehe.
Berlin, im Jahr 1940
Während man im Ministerium noch damit beschäftigt war, sich gegenseitig zu dieser Verwegenheit zu beglückwünschen, machte sich Lutz Templin bereits daran, die richtigen Leute für sein Orchester zusammenzusuchen. Es war indes leicht abzusehen, dass das recht rasch vonstattengehen würde, denn mit ihm hatte man ohne Frage den richtigen Mann ausgewählt: In Sachen Unterhaltungsmusik machte dem Düsseldorfer so schnell keiner was vor, er kannte Hinz und Kunz, Krethi und Plethi und im Zweifel auch Pontius und Pilatus. Dann war Templin aber vor allem auch einer, der es einfach nicht ertrug, wenn eine Arbeit unerledigt umherlag. Der Mann war ganz Eifer, ganz Tatendrang, und wer einmal in seine lebhaften Augen hinter den runden Gläsern blickte, konnte das leichthin erkennen. Wie flinke Fischchen in einem Aquarium flitzten dort immerfort seine winzigen Pupillen umher, und oft flog ein fiebriges Funkeln darüber, wenn ihn ein Einfall überkam. Überhaupt legte Templin in allem, was er tat, ein nervöses Zuviel an den Tag: Er erhob sich nicht, er sprang auf; er ging nicht, er rannte; er trank sein Bier nicht, er stürzte es hinunter; es wollte manchmal den Anschein machen, als wäre bei Templins Geburt das Metronom seines Lebens versehentlich zu schnell eingestellt worden. Nirgends auch nur eine Spur von Selbstbeherrschung, sagte Froehlich einmal, als er nach der zweiten oder dritten Flasche Schnaps zur Wahrheit aufgelegt war.
Wer nun aber dachte, Lutz Templin hätte sich in den Berliner Westen aufgemacht, um in verrauchten Spelunken und Hinterzimmern einen Musiker nach dem anderen von der Bühne zu schälen, geht freilich in die Irre. Nicht, dass die fraglichen Personen nicht genau dort zu finden gewesen wären (und auch nicht, dass Templin, dessen ständig wechselnder Wohnsitz von den berüchtigten Bars selten mehr als ein paar hundert Meter entfernt lag, selbiges nicht gewusst hätte), aber wir schreiben das Jahr 1940, und das Zauberwort heißt Fernsprechapparat. Und wer wäre Templin gewesen, wenn ihm nicht schon von Anfang an klar gewesen wäre, welche Jazzmusiker als die besten in Berlin, in Deutschland, in Europa, zu gelten hatten und wo – oder unter welcher Nummer – sie zu finden waren? Eben.
Er griff also zum Hörer, legte den Zeigefinger auf die Wählscheibe und rief – zrrr zrrr zrrr rassel rassel – einen nach dem anderen an.
Drei Nachmittage lang hatte er so an der Strippe gehangen (die einen Musiker traten am Abend auf und schliefen am Morgen aus, die anderen hatten Proben am Morgen und besuchten abends die Auftritte der einen), seine Stimme war nur noch ein heiseres Krächzen, und ohne dass er es wollte, fuhr sein inneres Ich fort, in einer Endlosschleife die Vertragsbedingungen herunterzuleiern: Streng geheim, Proben von neun bis zwölf im Haus des Rundfunks, streng geheim, soundsoviel Reichsmark pro Auftritt, streng geheim, Stillschweigen gegenüber allen und jedem, ja, auch gegenüber deiner Frau, deinem Kompagnon, und gegenüber jedem anderen.
Der Ablauf der Probe war denkbar einfach. Lutz Templin und Karl Schwedler, der als Sänger (und nicht zuletzt als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in Sachen Rundfunkangelegenheiten) ohnehin schon gesetzt und als ehemaliger Konzertagent mit Amerikaerfahrung mit solchen Castings und Rehearsels aufs Engste vertraut war, ließen die Kandidaten einzeln vorspielen, und zwar nach Instrumenten getrennt. Erst die Trompeten (erste, zweite, dritte) und Posaunen (erste, zweite, dritte), dann die Saxophone und Klarinetten, darauf die Rhythmusgruppe (Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug), zuletzt das Zugemüse (Ziehharmonika).
Die Sache verlief zunächst ganz ordentlich. Mit fortschreitender Zeit und zunehmender Ungeduld der im Vorführungssaal Wartenden jedoch ließ es sich nicht verhindern, dass von hinten und ungefragt immer wieder einzelne Instrumente in die Stimme desjenigen einfielen, der gerade spielte, um ihn ein Stück Wegs zu begleiten. Templin, der seine Pappenheimer nicht nur genau so kannte, sondern im Grunde selbst einer war, versuchte gar nicht erst, es ihnen zu verbieten. Das Vorspielen hatte immer mehr den Anstrich eines improvisierten Jazzkonzerts.
Als die Probe nach drei recht beschwingten Stunden für beendet erklärt wurde, geschah dies nur unter Protest der Anwesenden; einige hatten sich eben erst warmgespielt, und gerade die Musiker der Rhythmusgruppe um Fritz Brocksieper (Schlagzeug), Meg Tevelian (Gitarre) und Paul Henkel (Bass), die man erst ganz am Schluss angehört hatte, wollten sich so leicht nicht von der Bühne scheuchen lassen. Kurz: Die Jungs waren mit Eifer bei einer Sache, die sie noch gar nicht recht begriffen hatten.
Immerhin zeitigte Templins Einschreiten eine recht erfreuliche Nachricht: Glücklicherweise hätten es ziemlich viele geschafft. Als er die Liste herunterlas, wurde es zum ersten Mal seit drei Stunden mucksmäuschenstill:
Erste Trompete: Rimis van den Broek
Zweite Trompete: Charly Tabor und/oder Fernando Díaz
Dritte Trompete: Helmut Friedrich und/oder Fritz Petz
Posaunen: Willy Berking, Henk Bosch, Ferri Juza
Tenorsaxophon oder Klarinette: Mario Balbo
Tenorsaxophon: Bob van Venetië und/oder Eugen Henkel
Altsaxophon oder Klarinette: Benny de Weille
Klarinette oder Altsaxophon: Teddy Kleindin
Klavier: Franz Mück
Gitarre: Meguerditsch Tevelian
Bass: Cesare Cavaion und/oder Paul Henkel
Schlagzeug: Fritz Brocksieper
Ziehharmonika: Walter Musonius
Ja, das waren in der Tat ziemlich viele, und wer sich wie Fritz Brocksieper genau umgesehen und aufmerksam mitgezählt hatte, musste leichterdings einsehen, dass auf dieser Liste schlicht ein jeder stand, den Templin ins Haus des Rundfunks eingeladen hatte.
Die Chose ist von Anfang an klar gewesen, der Schlingel hat sich mit diesem abgekarteten Spiel ein privates Wunschkonzert gegönnt, dachte Brocksieper jetzt, und kam damit, ohne es zu wissen, der Wahrheit erstaunlich nahe. Als er seinen Verdacht mit erhobenem Mahnfinger äußerte, überhörte ihn Templin, der für Tonalitäten solcher Art vollkommen taube Ohren hatte, geflissentlich. Noch Fragen, warf er stattdessen in die Runde.
Allerdings, ergriff Brocksieper erneut das Wort. Er sei bekanntlich Jude.
Templin schaute ihn fragend an, und Brocksieper schleuderte ihm einen eindringlichen Blick entgegen.
Seines Wissens lediglich ein halber, sagte Templin unbeeindruckt.
Das mache eigentlich keinen Unterschied, erwiderte Brocksieper, und das war richtig und dann auch wieder falsch.
Stimmt, sagte Templin, hier mache sowieso nichts einen Unterschied. Im Orchester gehe es nicht darum, wer er sei, sondern was er leiste.
Das höre er seit langem zum ersten Mal, sagte Brocksieper ungläubig, aber inzwischen hatte sich Tevelian zu Wort gemeldet, und der staatenlose Armenier gab genau das zu bedenken: dass er Armenier und staatenlos sei.
Umso besser, antwortete Templin, Armenien liege in der Sowjetunion, und die Sowjets seien ja mit Deutschland verbündet.
Er besitze die sowjetische Staatsbürgerschaft eben gerade nicht, sagte Tevelian, der nicht wusste, wie er staatenlos anders erklären sollte.
Templin zögerte eine wenig. Nun, sagte er dann und klopfte ihm beschwichtigend auf die Schulter, das sei ja letzten Endes nicht so schlimm. Irgendwann würden die Sowjets sicher auch ihre Feinde sein.
Berlin, in den Jahren 1940 und 1941
Eigentlich hatte sich Froehlich vorgenommen, die Suche nach einem geeigneten Schriftsteller möglichst rasch hinter sich zu bringen, um nicht ständig daran denken zu müssen. Doch dann wurde er – wie sämtliche Briten – vom Krieg überrascht. Wo man nur hinsah, erlitt das Empire empfindliche Niederlagen: Arras und Dünkirchen, Südnorwegen und Narvik, die Versenkung der Glorious. Die alliierten Linien brachen so schnell zusammen, dass man mit dem Augenreiben gar nicht mehr hinterherkam. Wenn das so weiterging, würde England spätestens zum Ende des Jahres fallen.
Natürlich galt es, diese Neuigkeiten im Radio breitzutreten, man musste den Schwung des Schlachtfelds mitnehmen und per Kurz- und Mittelwelle ins feindliche Hinterland tragen. Die besiegten und nach Britannien heimkehrenden Truppen sollten dort auf eine noch viel niedergeschlagenere Zivilbevölkerung treffen.
Froehlich hatte in diesen Tagen und Wochen also alle Hände voll zu tun; ständig war er auf Sendung, und wenn nicht, besorgte er neue Informationen von der Front, schrieb Berichte und Ansagen oder dachte sich kleine Schwänke aus, die Churchill und sein Kabinett ins rechte Licht rückten. Viel Zeit zum Nachdenken blieb also nicht, aber manchmal, in einer stillen Minute, auf dem Weg in seine Wohnung am Charlottenburger Amtsgerichtsplatz zum Beispiel, fragte er sich, ob er zu Unrecht so lange an die Größe des Empire geglaubt hatte, ob er fälschlicherweise von dessen Unbezwingbarkeit überzeugt gewesen war. Nun, es machte ganz den Anschein. Mehr noch: Es gab eigentlich nichts, was darauf hindeutete, dass es den Deutschen nicht gelingen sollte, Weihnachten in London zu feiern.
Als ehemaliges Führungsmitglied der British Fascist Union, als Gründer der National Socialist League, kurz: als lupenreiner Nationalist musste er sich an den Gedanken einer Niederlage Großbritanniens erst gewöhnen. Immerhin: Die täglich hereintröpfelnden Schreckensmeldungen, die er jedes Mal mit einer Mischung aus blankem Entsetzen und heller Schadenfreude aufnahm, halfen ihm dabei. Was würde geschehen, fragte er sich immer häufiger, wenn der Krieg Ende Jahr vorbei wäre? Nun, das Jazzorchester und überhaupt der ganze Propagandasender Germany Calling würden selbstverständlich hinfällig werden; er bräuchte keinen Schriftsteller mehr anzuheuern, er könnte diesen störenden Gedanken getrost beiseitelegen. Sicher, er würde auch seine Anstellung in Berlin verlieren, aber es bestand überhaupt gar kein Zweifel daran, dass das im Tausch gegen einen aussichtsreichen Posten im besiegten Nachkriegsengland geschehen würde. Letztlich würde er also doch noch an der Regierung beteiligt werden, derweil Margaret nicht mehr zu arbeiten bräuchte und einfach das tun könnte, was sie verdiente: seine Frau sein. Wundervoll.
Nun, so weit fortgeschritten war der Krieg aber noch nicht. Es zogen weitere Monate ins Land, es wurde Juli, es wurde August, es wurde September, es wurde Oktober, es wurde November. Es kehrte etwas Ruhe ein bei den Auslandssendern, und eigentlich wäre nun Zeit gewesen, um sich auf die Suche nach einem Autor zu machen. Froehlich aber legte in dieser Sache einen auffälligen Schlendrian an den Tag, der erstaunlich genau mit seiner Hoffnung in Einklang stand, dass sich diese Schnapsidee mit der Zeit im Sand verlaufen würde; er jedenfalls würde nichts dafür tun, um auf ihre Umsetzung zu pochen.
Wie sich später herausstellen sollte, hatten Froehlichs Wünsche und Hoffnungen nicht allzu fern von der Wirklichkeit gelegen. Die Suche nach einem geeigneten Schriftsteller hatte auch anderswo im Ministerium bloß auf niedrigem Feuer geköchelt. Es hatte während des stürmischen Sommers beileibe andere Dringlichkeiten zu bewältigen gegeben, und dann war es auch gar nicht so einfach gewesen, einen passenden Mann zu finden. Plötzlich aber, im Dezember, war von irgendwoher ein Anruf ins Ministerium vorgedrungen, und auch wenn dieser wegen der Festtage keine unmittelbaren Folgen gezeitigt hatte, war er doch nicht gänzlich in Vergessenheit geraten. Im neuen Jahr hatte er einen neuen Anruf ausgelöst, der wiederum jemand anderen zum Hörer hatte greifen lassen, worauf abermals ein paar Fernsprecher in verschiedenen Berliner Büros geschrillt hatten. Kurz: Die genauen Umstände waren äußerst nebulös, aber mit einem Mal kam von irgendwoher ein Name ins Spiel, von woanders fand ein Manuskript auf den richtigen Schreibtisch, und dann ging alles zwar nicht schnell, doch aber in gelenkten Bahnen, so dass man einige Zeit später dem Verleger einen Wink gab, er solle diesen seinen Dichter ganz dringend anrufen und ihm eine Zusage machen, den Rest besorge man dann schon selbst.
Den Rest?, wollte der Verleger wissen, aber im Ministerium war man zu Diskussionen dieser Art nicht aufgelegt. Er solle jetzt einfach anrufen.
Gut, sagte dieser, und versuchte es.
Zürich, im Jahr 1941
In seiner Zürcher Mansardenwohnung lag bis weit in die Nachmittagsstunden dieses Spätwinterfreitags der angehende Schriftsteller Fritz Mahler zu Bett, als er sich gegen halb drei durch das nervenzerfetzende Geprassel seines schwarzen Bakelittelephons jählings aus seinen Selbstzweifeln gerissen fand.
Mahler war kein eigentlicher Langschläfer; dass er zu solch unstatthafter Zeit das Bett noch immer nicht verlassen hatte, war vielmehr der tief in ihm wurzelnden Überzeugung geschuldet, sich als Schriftsteller einige Marotten angedeihen lassen zu müssen, die von der Gesellschaft gleichermaßen verabscheut wie als solche anerkannt wurden. Wenn er also bereits die ersten beiden Anrufe dieses Tages versäumt hatte, dann lag das keineswegs daran, dass er das ohrenbetäubende Geklingel im Schlaf nicht gehört oder dieses gar in seine Träume verwoben hätte; vielmehr war ihm daran gelegen, bei nichts und niemandem den Eindruck zu erwecken, er sei in den Vormittagsstunden wach und also auf irgendeine bürgerliche Art und Weise produktiv.
Wie so oft in diesen Tagen war sich Mahler bereits seit den frühesten Morgenstunden in selbsterniedrigenden Gedanken ergangen, deren Verlauf sich im Wesentlichen darin erschöpfte, ihren Urheber auf immer wieder neue Weise als erfolglosen Nichtsnutz und erbärmlichen Schreiberling zu bezichtigen; wie immer in solch schweren Stunden suchte er Zuflucht im Ausspruch Epiktets, dass nur, wer nichts ist, noch die Möglichkeit habe, alles zu werden; doch war auch dieser Trost bloß von kurzer Dauer.
Also gleich in doppelter Hinsicht hätte ihm dieser Anruf, der nun geradezu mit Nachdruck in seine Wohnung hineindrängte, Erleichterung verschaffen können; nicht nur hätte er Mahler von dessen geistigen Selbstzerfleischung abgelenkt, sondern ihm auch gleich die Gründe für ebendiese genommen und seinem bis dahin eher ereignislosen Leben eine entscheidende Wendung zu geben vermocht, hätte er ihn nur entgegengenommen. Doch genau dazu sah sich Mahler partout außerstande.
Dabei hatte er erst vor wenigen Monaten und für teures Geld, das ihm streng genommen noch gar nicht gehörte, eine Telephonleitung hinauf in seine Wohnung verlegen lassen, und zwar in freudiger Erwartung wichtiger Anrufe, die sein Durchbruch als Schriftsteller, der zweifellos unmittelbar bevorstand, mit sich bringen würde. Doch dann musste er feststellen, dass er jedes Mal, wenn ihn das Klingeln aufschrecken ließ, von einer geradezu körperlichen Furcht ergriffen war, die sich ihm als unerträgliche Engnis in der Kehle spürbar machte; bald schon hegte er eine Abscheu gegenüber dem heimtückisch auf seinem gleichfalls schwarzen Beistelltisch glänzenden Apparat, und die Vorstellung, mit einer Person zu sprechen, deren Gesicht er nicht zu sehen bekam, trieb ihm jedes Mal den Schweiß auf die Stirn, sobald sich diese bedrohliche Kulisse an den Rändern seines Bewusstseins aufzubauen begann.
Mahler erfuhr deshalb erst am Montagmittag, als er sich endlich durchgerungen hatte, den nunmehr sechsten Anruf entgegenzunehmen, von einem bereits leicht missmutigen Verleger, dass dieser gewillt war, sein Manuskript zu drucken und schnellstmöglich auf den Markt zu bringen.
Berlin, im Jahr 1941
Acht Tage später war ein Durchschlag ebendieses Manuskripts in die Charlottenburger Kastanienallee 29 gelangt, und zwar auf derart verschlungenen Wegen, dass sie sich nicht mehr zufriedenstellend nachvollziehen lassen. Seither lag es, in bräunliches Packpapier gewickelt und mit dem Vermerk Streng geheim! versehen, auf einem Beistelltisch im Wohnzimmer und wartete darauf, endlich gelesen zu werden.
An einem Freitagmorgen im Winter 1941 nun erscholl hier das nervöse, markerschütternde Klingeling eines Weckers, das durch Wände und Tür des Schlafzimmers herüberdrang; Wilhelm Froehlich, dem dieses Zeichen eigentlich galt, wurde nur langsam aus seinem tiefen Schlaf geschüttelt, und es war an seiner Frau Margaret, welche die andere Hälfte des doppelschläfigen Bettes einnahm, dem kreischenden Schrillen ein Ende zu bereiten. Froehlich erhob sich nur mühsam, schlurfte zur Tür und taumelte ins Wohnzimmer hinüber, und als er hier mit einem Ziehen an der Lampenschnur Sofa, Minibar und Beistelltisch der Dunkelheit entriss, erblickte er mit einem Mal das Mahlersche Manuskript, das heimtückisch zu ihm herüberschielte. Seither brachte er seine Gedanken nicht mehr von ihm los.
Jetzt, im Badezimmer, dünkte ihn dies besonders schmerzlich. Die Viertelstunde vor dem Spiegel, während der er mit sorgfältigen Bewegungen Rasierschaum auf seine Wangen auftrug, galt ihm als die kostbarste des Tages, denn nun sah er, wenn auch nur für ein paar Minuten, sein Gesicht wieder so weiß, unversehrt und makellos, wie es einst, vor siebzehn Jahren, gewesen war.
Froehlich genoss es, den Gedanken nachzuhängen, die sich vor dem Rasieren einstellten; er sah sich in jene Zeit in London zurückversetzt, als er noch keine Narbe trug und William Joyce hieß, und es fielen ihm seine Dienstzeit bei der Armee und auch die ersten Jahre des Studiums ein; und doch hatte dieses Nachsinnen, dieses Sich-zurückversetzt-Finden in die Vergangenheit, die jetzt ein halbes Leben zurücklag, auch immer Schmerzen im Gefolge. Spätestens in jenem Moment nämlich, in dem er zum Rasiermesser griff und zusammen mit den Bartstoppeln auch den Schaum aus seinem Gesicht schabte, drängte sich ihm unweigerlich die Narbe in den Blick, und plötzlich stand ihm alles vor Augen, alles: das schauerliche Zucken, das seinen Körper durchfuhr, als ihm die Klinge durch die Wange glitt; der Eisengeruch des Blutes, der sich ihm für immer in der Nase festsetzte; die Beschwerden beim Kauen, die nach dem heimtückischen Angriff noch wochenlang währten.
Immer wieder hatte er diesen Schmerz zu vergessen, auszulöschen, aus seinem Innersten zu meißeln versucht, doch war er mitnichten verblasst, hatte lediglich seinen Sitz verändert, war von der Wange in die Kehle gesunken und hatte sich tief in der Brust festgesetzt, tiefer, als ein Rasiermesser je zu schneiden vermochte. Lange hatte ihn der traurige Anblick seines grinsenden Gesichts erröten lassen, wodurch das Narbengewebe, das weiß und gleich einer Milchhaut von feinsten, kaum merklichen Fältchen durchzogen sich über die Wunde gelegt hatte, nur umso deutlicher von seiner Umgebung abstach. Am schlimmsten aber empfand er die Scham, die ihn überkam, wenn er daran dachte, dass ihm diese Verletzung nicht einfach zugestoßen war. Nein, er hatte eben auch zugelassen, dass man ihm eine solche zufügte, und besonders quälte ihn der Gedanke, dass der Täter, nach allem, was man wusste, ein jüdischer Bolschewist gewesen war. Jahrelang hatten Scham und düstere Rachegefühle in seinem Inneren um die Vorherrschaft gerungen, und erst nach und nach hatten sich letztere durchgesetzt, wohingegen sich die Scham allmählich zu Stolz gewandelt hatte, den er schließlich zu spüren begann, wenn ihn die Leute auf der Straße anstarrten; die Schramme, wie er sie inzwischen nannte, galt ihm nun als Beweis seiner Widerstandskraft.
Solchen Überlegungen gab sich Froehlich für gewöhnlich hin, wenn er im Badezimmer stand und sich rasierte. Heute aber beherrschte das Manuskript seine Sinne, und er fühlte sich unter dem Türspalt und durch das Schlüsselloch hindurch von ihm beobachtet, beschattet und sogar unverhohlen angeglotzt.
In den letzten Tagen hatte er mehrere Versuche unternommen, sich aus der Verantwortung zu stehlen; er habe viel zu viel zu tun, sei unendlich beschäftigt, und dann sei er ja auch Radiokommentator und gar kein Literaturkritiker. Doch sein Vorgesetzter, der Halbschotte Dietze, mit welchem ihn neben der keltischen Abkunft vor allem der tiefe Hass auf den jeweils anderen verband, hatte darüber nur achselzuckend geschwiegen und mit einem Fingerzeig nach oben angedeutet, dass die Anweisung von ebendort komme.
Gleichviel; Froehlich dachte nicht daran, dieses Manuskript zu lesen. Das heißt, im Grunde dachte er fortwährend daran, aber er wollte nicht! Ratlos schaute er in den Spiegel, doch auch von dort kam keine Rettung. Erneut seufzte er, um dann zu tun, was er immer in solchen (wie auch in vielen anderen) Situationen tat: Er ging zur Minibar, langte nach einer der Flaschen und goss sich einen gesunden Schluck in ein bauchiges Glas, das präzis zu diesem Zweck bereitstand. Der Schnaps übte zwar eine erhebende Wirkung auf ihn aus, doch das mehrte bloß seine Lust, einen weiteren zu trinken, während seine Abscheu vor dem Manuskript sich kein bisschen verminderte. Unter fadenscheinigen Vorwänden, die er sich selbst nicht so recht abnahm, zögerte er die Sache immer und immer wieder hinaus, und erst als Margaret hoffnungslos verspätet ins Badezimmer hastete und ihn fragte, ob er ihr in der Zwischenzeit Frühstück machen könne, gab es kein Zurück mehr.
Ganz ausgeschlossen, er habe soeben mit einer ganz wichtigen Arbeit angefangen, log er ganz unverfroren, und weil Margaret dann den Kopf durch die Badtür steckte, um nachzusehen, was das denn für eine Arbeit sei, sah er keinen anderen Ausweg, als seinen Blick tatsächlich auf den missliebigen Papierstoß zu senken.
Berlin, im Jahr 1941
Es war tiefste Nacht, als ihn ein lautes Knacken an der Tür (oder war es vor dem Fenster?) aufschrecken ließ. Zum ersten Mal seit Stunden sah Froehlich von den hektographierten Seiten auf, doch bereits ein paar Sekunden später ließ er seinen Blick wieder auf seinen Schoß niedersinken, und sofort hefteten sich seine Gedanken erneut an jene Bilder, die Mahlers Text auf dem Grund seines Inneren eingepflanzt hatte. In schneller Folge ließ er die eng bedruckten Seiten über seinen Daumen gleiten, während sein Gesicht einen Zug tiefster Anerkennung annahm. Was hatte er da nur gelesen! Gewiss, ein bisschen gekünstelt mutete es hier und da an, was dieser Mahler schrieb, ein wenig antiquiert mochte die Sprache ab und an erscheinen, so manche seiner Wendungen war in den glitzernden Raureif eines – leider! – längst verflossenen Zeitalters gehüllt. Doch der Text war von einem schmerzlich-schauderhaften Geist durchflossen, der gelegentlich, wo es frohgemut zu und her ging, einem heiteren, flotten Ton wich; anderswo wiederum, wenn das nackte Grauen beschrieben wurde, berichtete der Erzähler mit jenem Jüngerschen Gleichmut, der dem Schrecklichen eine ganz besondere Wucht verleiht. Ja, auf Effekte verstand sich dieser Mahler, das musste man ihm lassen, doch genauso bewundernswert waren eben seine Fähigkeiten, Heikles im gebotenen Maß zu verharmlosen und die nötige Augenwischerei zu betreiben. Ein Teufelskerl.
Gerne hätte er sich jemandem mitgeteilt, auf Englisch, jemandem, der seine Begeisterung verstand. Seufzend erhob er sich vom Sofa, ging nach dem Schlafzimmer, schob die Tür zum Badezimmer auf, trat auf einen Blick in die Küche, sah sogar im Treppenhaus nach; alles, um bestätigt zu sehen, was er ohnehin schon wusste: Margaret war noch immer nicht zurück.
Berlin, im Jahr 1941