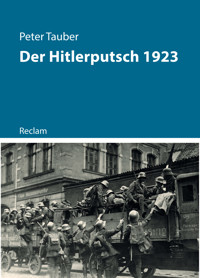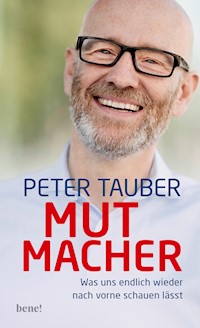
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Den Mutigen gehört die Welt«, besagt ein altes Sprichwort. Wie ist das mit dem Mut heute? Brauchen wir in unserer Gesellschaft mehr davon? Und wie finden wir ihn? Der ehemalige Spitzenpolitiker Peter Tauber schreibt über die Relevanz von Mut und das Bekennen zu einer Gesellschaft, in der Miteinander mehr zählt als Ellenbogen. Ein Buch für alle, die sich angesichts der Krisen und des Schlechten in der Welt ermutigen lassen wollen. Peter Tauber stellt fest: Wer den Fernseher anschaltet, im Internet surft oder in die Zeitung schaut, dem begegnet statt dem Mut viel häufiger die Wut. Obwohl wir wissen, dass Wut selten zu etwas Gutem führt. Wut zerstört. Mut hingegen, so heißt es, Mut wird belohnt. Auch in der Bibel ist der Mut ein Dauerthema. Und auch, wenn sie medial eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen: »Es gibt sie überall in unserem Land. Menschen, die nicht bloß wütend sind, was alles nicht funktioniert oder ihnen gegen den Strich geht, sondern die etwas tun, damit die Welt besser wird«, sagt Tauber und ergänzt: »Und ich bin mir sicher Sie kennen selbst ganz viele.« In seinem neuen Buch erzählt der ehemalige Bundestagsabgeordnete die inspirierenden Geschichten von Mutmacherinnen und Mutmachern. Von Menschen, die er allesamt persönlich kennt: Da ist seine an Multiple Sklerose erkrankte Schwester Steffi Tauber, Danny Beuerbach, der Kinder fürs Lesen begeistert, Mechthild Heil, die sich im flutgeplagten Ahrtal engagiert – und Christoph Lübcke, der sich nach dem Mord an seinem Vater noch stärker gegen Rechtsextremismus positioniert. Es geht Tauber um ein mutiges Bekennen zu einer Gesellschaft, in der Miteinander mehr zählt als Ellenbogen, Rücksicht ankommt und aufeinander achten wichtiger ist als »me, myself and I first«. »Weil ich das Gefühl habe, dass wir in den Medien und der Öffentlichkeit den Lauten, den Wütenden, den Schreihälsen viel zu viel Aufmerksamkeit widmen, ist hier mal nur Platz für die Mutigen, ohne die am Ende nichts in unserem Land gut werden würde.« Peter Tauber
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Tauber
Mutmacher
Was uns endlich wieder nach vorne schauen lässt
Knaur eBooks
Über dieses Buch
»Mutmacherinnen und Mutmacher sind der eigentliche Reichtum unseres Landes. Geben wir ihnen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, lassen wir uns begeistern und anstecken von ihrem Mut.«
Peter Tauber
Um die Welt positiv zu verändern, braucht es Mut. Doch an vielen Stellen in unserer Gesellschaft und in den Medien begegnet uns stattdessen viel häufiger zerstörende Wut. Der ehemalige Spitzenpolitiker Peter Tauber erzählt deshalb hoffnungsvolle Geschichten von zwölf Mutmacherinnen und Mutmachern: Da ist etwa seine an Multiple Sklerose erkrankte Schwester Steffi Tauber, Danny Beuerbach, der Kinder fürs Lesen begeistert, Mechthild Heil, die sich im flutgeplagten Ahrtal engagiert – und Christoph Lübcke, der sich nach dem Mord an seinem Vater noch stärker gegen Rechtsextremismus positioniert.
Ein zuversichtliches Plädoyer für eine mutigere Gesellschaft.
Inhaltsübersicht
Motto
Den Mutigen gehört die Welt!
ZWÖLF MUTMACHERINNEN UND MUTMACHER
1 Den Feinden der Demokratie mutig entgegentreten
2 Das Leben geht weiter, auch wenn’s humpelt
3 Bärenherz
4 Mutig »flügelflatterschlagen«
5 Warum die Welt eine mutige Kirche braucht
6 Wenn Mut aus Fremden Freunde macht
7 Ungerechtigkeiten auf den Zahn fühlen
8 Sich den Dämonen stellen
9 Wenn eine Umarmung Mut macht
10 Dem inneren Feind entgegentreten
11 Kleiner Mann ganz groß
12 Vom Mut, anders zu leben
Nur Mut!
»Zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes,
dem das Leben gehört, und das ist der Mut.«
Theodor Fontane
Den Mutigen gehört die Welt!
Immer wieder höre ich: »Das war ja ganz schön mutig von Ihnen, aus der Politik auszusteigen.« Oder: »Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, noch mal neu anzufangen.« Als ich vor einigen Jahren schwer krank war und dann meine Geschichte dazu aufgeschrieben habe, sagte mir jemand: »Ihren Mut, mit der Krankheit und Schwäche offen umzugehen, bewundere ich.«
Ich fand mich aber gar nicht mutig. Für mich war mein Schritt logisch, konsequent, vielleicht auch notwendig. Schließlich hatte ich nach langer Zeit für mich erkannt: »Du musst kein Held sein.« Das bedeutet nicht, dass es sich nicht lohnt, sich anzustrengen, sich etwas zuzumuten, mutig zu sein, anzupacken, über sich hinauszuwachsen. Es bedeutet, achtsam zu sein. Mit sich selbst und anderen. Dazu gehört Mut.
Als ich damals mitten in der Nacht den Notarzt rief, war mir klar: Es ging nicht mehr. Und es fiel mir total schwer, mir das einzugestehen. Das Eingeständnis war für mich tatsächlich zunächst schlimmer, als krank zu sein. Festzustellen: Ich war nicht so stark, wie ich gedacht hatte. Ich habe meine Schwächen ignoriert. Das war nicht klug.
Aber dann galt es, nach vorne zu schauen und auf mich selbst zu achten.
Ohne die vielen Mutmacher, Helferinnen und Helfer und all die medizinischen Spezialisten hätte ich meine Erkrankung nicht überstanden: ohne die Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Familie, Kolleginnen und Kollegen, aber auch wildfremde Menschen, die mir Genesungswünsche geschickt haben. Es waren die Begegnungen im Krankenhaus und in der Reha, die mir Kraft gaben – und Mut, Zuversicht und Hoffnung. Als ich meine Geschichte aufgeschrieben hatte, stellte ich fest, dass sie wiederum anderen Menschen Mut machen kann. Es tat gar nicht weh, so viel von mir selbst preiszugeben – im Gegenteil. Es war befreiend, sich einzugestehen und anderen gegenüber ehrlich zu bekunden: Ich kann nicht mehr. Ich muss etwas ändern. Aber ich will das auch, und das Neue wird gut.
Mut kann man teilen. Die vielen positiven Reaktionen auf mein erstes Buch zeigen das. Die Ärztin, der Pfarrer, der Soldat, die mir geschrieben haben, wie es ihnen erging, warum ihnen meine Geschichte Mut gemacht hat und wie sie nun selbst mutig nach vorne schauen, das inspiriert und bewegt.
Ich habe inzwischen verstanden, dass vieles, was man ganz selbstverständlich tut, von anderen als mutig wahrgenommen wird. Woran liegt das? Ich glaube, es ist so: Wenn man von einer Sache wirklich überzeugt ist, wenn man an etwas glaubt, dann fällt einem der Schritt dorthin leicht. Mutig zu sein, ist kein Selbstzweck. Es kommt darauf an, Mut auch für andere aufzubringen. Vielleicht hat deswegen auch die Mutprobe keinen guten Ruf. Den Mut auf die Probe stellen, ohne dass dies einem konkreten Ziel dient, nur um ihn unter Beweis zu stellen, das ist eine ziemlich dumme und sinnlose Sache.
Wie ist das mit dem Mut heute? Brauchen wir in unserer Gesellschaft mehr davon? Und wie finden wir ihn? Wer den Fernseher anschaltet, im Internet surft oder in die Zeitung schaut, dem begegnet statt Mut viel häufiger die Wut – manchmal sogar eine unbändige oder tragischerweise ohnmächtige Art und Weise. Wut ist überall präsent. In den Medien, ganz besonders in den dann gar nicht sozialen Netzwerken und bisweilen sogar im Umgang miteinander. Wenn wir uns diese Entwicklungen anschauen, kann einen selbst manchmal schon der Mut verlassen.
Menschen sind beispielsweise wütend, dass die Energie- und Lebensmittelpreise so stark steigen und die Politik aus ihrer Sicht zu wenig dagegen tut. Andere sind zornig, dass ihnen etwas Bestimmtes verwehrt wird, von dem sie glauben, dass es ihnen zusteht. Und wieder andere sind wütend auf alle und jeden – weil sie sich ganz grundsätzlich ungerecht behandelt und benachteiligt fühlen. Dabei wissen wir doch, dass Wut selten zu etwas Gutem führt. Statt selbst aktiv zu werden und ins Handeln zu kommen, zeigen wir mit dem Finger auf andere und schieben diesen die Schuld an der ganzen Misere in die Schuhe.
Klimawandel, Artensterben, korrupte Politiker, dekadente Eliten, eine Kirche, die zu oft die Frohe Botschaft nicht mehr verkündet und stattdessen durch Skandale ihrer Oberen auf sich aufmerksam macht; astronomische Gehälter für Fußballer; Kinder, die ohne Schulbrot in der Schule sitzen und denen der Magen knurrt, Rücksichtslosigkeit. Neue Nazis, die inzwischen nicht nur in sozialen Netzwerken laut sind, Armut, Krieg und Hunger in der Welt. Soll ich weitermachen, oder spüren Sie schon die Wut in sich aufsteigen angesichts solcher Ungerechtigkeiten und Probleme?
Wut tut oft kurzzeitig gut. Aber sie ist keine Lösung. Und es besteht auch kein Anlass, wütend zu sein. Ja, manchmal gebiert Wut Mut. Aber auf Dauer beeindrucken mich Menschen, die sich nicht wütend, sondern klaren Kopfes und Verstandes für eine bessere Welt einsetzen. Menschen, die handeln. Vielleicht manchmal mit der erfrischenden Naivität, mit der Martin Luther sogar angesichts des morgigen Weltuntergangs noch heute sein Apfelbäumchen pflanzen würde, aber sie sind nicht bereit, das, was sie stört, einfach hinzunehmen. Sie tun etwas. Ganz schön mutig.
Es braucht Mut, um das Blatt zu wenden und aus den Schatten herauszutreten. Mut wird belohnt, heißt es. Mut vor Königsthronen und Machthabern wird oft eingefordert.
Wir reden über Zivilcourage, wir stellen uns unseren Dämonen. Wir überwinden unsere Ängste. Wir sagen, was wir denken. Wir übernehmen Verantwortung. Ganz schön mutig eben. Komisch ist nur, dass unser Land voll von solch mutigen Menschen ist, dass jeder von uns solche Menschen kennt, sie aber in den Medien, in der Öffentlichkeit nicht den gebührenden Raum finden.
In der Bibel ist der Mut ein Dauerthema. Und Gott traut uns etwas zu. Er will uns ermutigen.
Deswegen ist das »Fürchte dich nicht!« auch eine wiederkehrende Botschaft an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift. Natürlich kennt das Alte Testament auch einen zürnenden Gott, aber Wut ist seine Sache nicht. Das Buch Sirach warnt: »Eifer und Zorn verkürzen das Leben, und Sorge macht alt vor der Zeit.« Wut kann nicht nur anderen Schaden zufügen. Wut zerstört uns selbst.
Warum wir »mutiger bekennen« und auch »fröhlicher glauben« sollten, davon handelt dieses Buch. Es geht um ein mutiges Bekennen zu einer Gesellschaft, in der Miteinander mehr zählt als Ellenbogen, in der Rücksicht ankommt und aufeinander achten wichtiger ist als »me, myself and I first«.
Was tun also, damit wir auch zukünftig in einer Gesellschaft leben können, in der Freiheit die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben ist? Eine Freiheit, die uns ermutigt zur Verantwortung; im Sinne der Freiheit eines Christenmenschen. Volker Busch hat uns in seinem wunderbaren Buch Kopf frei! daran erinnert, dass die Frage »Wie werden wir in zehn Jahren leben?« falsch gestellt ist. Wir müssen uns viel eher fragen: »Wie wollen wir in zehn Jahren leben? Und was müssen wir dafür tun?«
Mutige Menschen haben zu allen Zeiten die Welt verändert: diejenigen, die Zivilcourage bewiesen, Ängste überwunden und innere und äußere Dämonen bezwungen haben. Diejenigen, die gesagt haben, was sie denken, egal, welche Konsequenzen das für sie hatte. Doch Mut ist eben kein Selbstzweck – im Gegensatz zur Wut, die sich oft genug verselbstständigt wie der Hass. Bei manchem wütenden und hasserfüllten Zeitgenossen hat man den Eindruck, er kann selbst nicht mehr genau sagen, was ihn eigentlich so wütend macht.
Der Mut hingegen will und soll uns zu etwas befähigen. Wir erkennen immer wieder: Mut allein führt zu nichts. Es geht um mehr. Der Mut braucht die Tugend. Die christlichen Tugenden sind die Quelle der Kraft, aus der heraus der Mut sich schöpft. Wir benutzen das Wort Tugend inzwischen nicht mehr so oft. Vielleicht wirkt es zu altmodisch. Aber die Werte, die damit verbunden sind, die kennen wir alle, die fordern wir teilweise auch immer wieder ein: Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit – aber auch Glaube, Hoffnung und Liebe. Neben den christlichen Tugenden gibt es ritterliche Tugenden. Na gut, Ritter gibt es in der Nachbarschaft eher selten. Aber bürgerliche Tugenden gibt es noch, und als Bürgerinnen und Bürger dieser Republik sehen wir uns ja hoffentlich alle dazu aufgerufen, einander zu achten und für Gerechtigkeit einzutreten. Die Tugenden und der Mut sollen uns helfen, besser zu werden und die Welt besser zu machen. Dann mal los.
In diesem Buch soll es um Frauen und Männer gehen, die Mut machen; um Menschen, die für andere oder für sich selbst mutig waren und etwas erreicht haben. Die Vorbilder sind – auch wenn sie sich selbst oft nicht so sehen. Es sind Menschen, deren Mut oft gar nicht laut daherkommt, sondern still und leise. So ist das ja bei vielen Mutigen in unserer Gesellschaft. Und weil ich das Gefühl habe, dass wir in den Medien und der Öffentlichkeit den Lauten, den Wütenden, den Schreihälsen viel zu viel Aufmerksamkeit widmen, ist in diesem Buch Raum für die Mutigen, ohne die am Ende nichts in unserem Land gut würde.
In den letzten Jahren bin ich ganz vielen Menschen begegnet, die solche Mutmacher sind. Und ich bin mir sicher, Sie kennen selbst auch viele solcher Menschen. Unser Land braucht dringend mehr von ihnen. Wenn man die Nachrichten schaut oder die Zeitung liest, dann denkt man: Alles geht den Bach runter. Dabei stimmt das gar nicht. Auch weil es in unserem Land so viele begeisternde Menschen gibt, die nicht nur mutig sind, sondern anderen Mut machen. Ihre Geschichten inspirieren und verbreiten Hoffnung.
Meine Schwester Steffi Tauber leidet seit über zehn Jahren an Multiple Sklerose. Wie sie mit dieser Krankheit umgeht, das finde ich bemerkenswert – nicht nur, weil ich ihr Bruder bin. Dennis Hasselmann hat eine Depression. Krank zu sein, vor allem, wenn das Leiden kein körperliches ist, das akzeptiert unsere Gesellschaft immer noch nicht richtig. Dennis kann davon ein Lied singen. Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Fürsorge, Mitgefühl – all das braucht unsere Gesellschaft dringend, wenn sie solidarisch und menschlich bleiben oder wieder werden soll.
Auch bei Bernhard Drescher und Michelle N. ist es eine Erkrankung, die ihr Leben prägt. Hätten sie sich nicht entschieden, unserem Land als Soldat und Soldatin zu dienen, dann wäre ihnen das, was ihnen widerfahren ist, erspart geblieben. Bernhard Drescher war im Kosovo im Einsatz. Dort hat er so schlimme Dinge gesehen, dass seine Seele krank wurde. Er hatte eine PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung. Seit seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr setzt er sich für diejenigen ein, die wie er aus dem Auslandseinsatz zurückgekommen sind, aber nicht mehr in ihr vorheriges Leben zurückfinden. Michelle N. ist während eines Auslandseinsatzes von einem Transporter überfahren worden. Nach über zehn Operationen kämpft sie sich nicht nur zurück in den Alltag, sondern auch wieder in den Dienst. Sie will weiter das tun, was sie liebt: Soldatin sein. Und demnächst geht es wieder in den Auslandseinsatz. Sage noch einmal jemand, unsere Soldatinnen und Soldaten seien nicht mehr mutig.
Frank Dieter und Danny Beuerbach sind ein bisschen verrückt – im besten Sinne. Gerade das macht sie liebenswert. Frank Dieter arbeitet bei der Deutschen Bahn. Und er läuft Marathon. Bis zu zwölfmal pro Jahr. Sie haben richtig gelesen. Und damit nicht genug. Für jeden gelaufenen Kilometer sammelt er Spenden für einen guten Zweck. Damit inspiriert er andere. Danny Beuerbach ist Friseur. Seine eigenen Haare stehen wild vom Kopf ab. Ihm stehen die Haare zu Berge, wenn er mitbekommt, dass Kinder mutlos leben. Und er wünscht sich mehr Fantasie für unsere Welt. Wenn Kinder zu ihm kommen und ihm etwas vorlesen, dann schneidet er ihnen kostenlos die Haare. Umsonst ist das nicht. Im Gegenteil: Es ist beeindruckend, wie das Selbstbewusstsein dieser Kinder in den zehn Minuten auf dem Friseurstuhl wächst. So kann man Kindern Mut schenken.
Jörg Niesner und Nikodemus Schnabel haben sich einem Mann verschrieben: Jesus Christus. Nikodemus Schnabel ist Pater im Heiligen Land. In der Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg ist er zu Hause. Dort habe ich ihn auch kennengelernt. Sein Sendungsbewusstsein gründet sich in der Erwartung Jesu an seine Jünger: die Frohe Botschaft zu verkündigen. Pater Nikodemus hat etwas zu sagen. Das ist nicht immer bequem, aber immer deutlich und mitten aus dem Leben. Es wirkt so befreiend und erfrischend, dass man seiner katholischen Kirche wünscht, dass es dort mehr Menschen wie ihn gäbe, die mutig die Frohe Botschaft verkünden.
Jörg Niesner ist evangelischer Pfarrer im hessischen Laubach. Der Ort ist das, was man auf den ersten Blick für eine heile Welt halten mag. Doch in Wahrheit gibt es auch dort alles, was das Leben an Schwierigkeiten und Problemen bereithält. Jörg Niesner treibt das an, etwas dafür zu tun, dass sich die Situation für viele verbessert. In seiner Gemeinde vor Ort kümmert er sich um fast 3000 Seelen, von denen ihm über 400 auch in den sozialen Netzwerken folgen. Darüber hinaus erreicht er über Social-Media-Kanäle viele Tausend Menschen. Mit ihnen diskutiert er über Fragen, die jenseits der Kirchenmauern bewegen. Teils ganz persönliche, teils theologische Fragen. Dabei hält er mit seiner Meinung nicht zurück, zeigt Mut, auch unbequeme Wahrheiten zu sagen. Neulich stand eine Frau aus Süddeutschland vor seiner Tür und wollte ihn nicht nur kennenlernen, sondern auch bei ihm in die Kirche eintreten.
Wie Pater Nikodemus kämpft auch Pfarrer Jörg (wie einst der gleichnamige Junker, der auf der Wartburg Unterschlupf fand) für eine mutige Kirche. Denn unser Land braucht auch bei einer geringer werdenden Zahl an Christen eine starke, stimmgewaltige Kirche und mutige Christen. Davon sind beide überzeugt.
Mechthild Heil ist Bundestagsabgeordnete. Sie vertritt in Berlin einen der schönsten Landstriche unseres Landes. Eine Gegend, die von einer Verheerung heimgesucht worden ist wie keine zweite in den letzten Jahren. Ihre Heimat ist das Ahrtal. Was sie dort während der Flutkatastrophe erlebt hat, und welcher Mut ihr begegnet ist, das teilt sie mit ihnen.
Auch Aylin Selçuk hat eine Mutgeschichte zu erzählen, in der es nicht nur um sie selbst geht. Als sogenanntes Gastarbeiterkind ist sie ihren Weg gegangen – gegen alle Widerstände, Vorurteile und auch gegen Anfeindungen. Inzwischen engagiert sie sich nicht nur politisch, sondern führt auch erfolgreich eine Zahnarztpraxis. Als Jugendliche hat sie die »DeuKische Generation« gegründet, einen Verein, in dem sich türkeistämmige Jugendliche für Gleichaltrige einsetzen und auch öffentlich ihre Interessen vertreten. Es geht dabei um Integration auf Augenhöhe. Aylin Selçuk will nicht nur reden, sondern machen. Sie steht für den Anspruch junger Deutscher mit Einwanderungsgeschichte, mitzuentscheiden, was aus unserem Land wird.
Christoph Lübcke teilt die Werte einer offenen Gesellschaft, in der jeder, der sich anstrengt, alles werden kann. Er findet, dass wir im besten Deutschland leben, das es je gab – mit dem Grundgesetz als Fundament. Sein Vater, Walter Lübcke, ist für diese Überzeugung von einem Nazi ermordet worden. Trotzdem verzagt Christoph Lübke nicht und will den Mut seines Vaters weitertragen. Er ist Stadtverordnetenvorsteher in seiner Heimatstadt Wolfhagen, und er will den Mördern seines Vaters und ihren Sympathisanten, den neuen Nazis, nicht die Genugtuung gönnen, vor ihnen zurückzuweichen. Außerdem ist er sich sicher: Einzuknicken wäre nicht im Sinne seines Vaters. Walter Lübcke hatte ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Und er war, wie man es den Nordhessen nachsagt, gutherzig und auch ein Dickkopf. Vielleicht kann Christoph auch deswegen nicht anders: Er will anderen Mut machen, für unsere Republik einzutreten.
Das verbindet junge Menschen wie ihn und Aylin Selçuk mit Männern wie Jules August Schröder, der den Krieg noch erlebt hat und sich aufgrund seiner eigenen Geschichte heute für Menschen engagiert, die nach Flucht und Vertreibung in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. Er macht den Flüchtlingen Mut. Und auch den Einheimischen macht er Mut, dass das Zusammenleben gelingen kann. Damit ist er ein Vorbild.
Egal, ob es um eine offene Gesellschaft, den Kampf gegen Rechtsextremismus und für unsere Demokratie, um mehr Achtsamkeit und Mitmenschlichkeit, ein anderes Bewusstsein für Menschen mit Einschränkungen, um die Zukunft der Kirche oder auch einfach nur um Respekt füreinander geht: Es braucht mehr Mut. Viele Menschen in unserer Gesellschaft können das Schlechtreden, das ständige Schimpfen, die Wut, den Hass und die negativen Schlagzeilen nicht mehr ertragen. Sie wünschen sich, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen.
Wir sind ein tolles Land mit so vielen beeindruckenden Menschen! Davon bin ich fest überzeugt. In den letzten Jahren habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt und erlebt. Es war gar nicht so leicht zu entscheiden, wessen Geschichte ich hier erzähle. Und ich bin mir sicher, Sie kennen auch viele beeindruckende Frauen und Männer, Junge und Alte. Sie sind der eigentliche Reichtum unseres Landes. Geben wir ihnen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, lassen wir uns begeistern und anstecken von ihrem Mut. Den Mutigen gehört die Welt!
Peter Tauber
ZWÖLFMUTMACHERINNENUND MUTMACHER
1 Den Feinden der Demokratie mutig entgegentreten
Christoph Lübcke
Wolfhagen in Nordhessen, da ist der Wind etwas rauer, die Menschen aber oft umso herzlicher – wenn man sie näher kennengelernt hat. Die Gegend westlich von Kassel ist die Heimat der Familie Lübcke. Christoph Lübcke lebt hier mit seiner Familie, seiner Frau und den drei Kindern. Das jüngste ist erst vor relativ kurzer Zeit auf die Welt gekommen. Und gerade hat Christoph viel beruflich zu tun, denn die Windkraftanlagen, an denen das familieneigene Unternehmen beteiligt ist, sollen erneuert werden. »Repowering« nennt man das. Christoph ist darüber hinaus in der Kommunalpolitik aktiv. Er ist Stadtverordnetenvorsteher in seiner Heimatstadt Wolfhagen. So etwas wie der Parlamentspräsident – nur auf der örtlichen Ebene. Und außerdem ist er der Sohn von Walter Lübcke, dem von Nazis ermordeten Regierungspräsidenten Nordhessens.
Oft beginnen Geschichten über Christoph mit dem Hinweis auf seinen Vater. Und die Geschichte seines Vaters ist ausführlich erzählt. Christophs Geschichte hingegen nicht. Natürlich kann man sie nicht erzählen, ohne auch über Walter Lübcke zu schreiben.
Bei allem Schmerz, aller Trauer und all den Emotionen, die schwer zu beschreiben und zu fassen sind, hat man nicht das Gefühl, dass das Schicksal des Vaters Christoph erdrückt. Auf eine eigentümliche Art und Weise trägt der Vater ihn. Christoph fühlt sich dem Vater und seinem Erbe verpflichtet, aber diese Verpflichtung lebt er auf seine Weise. Im Inneren trägt er Kämpfe aus. Doch nach außen wirkt er ruhig. Er strahlt etwas aus, das Mut macht und Zuversicht vermittelt. Das beeindruckt mich jedes Mal, wenn wir uns begegnen. Deswegen bin ich der Meinung, dass es sich lohnt, Christoph kennenzulernen, auf den sein Vater sicher sehr stolz war und es heute noch mehr wäre.
Das Erinnern ist Christoph wichtig, auch wenn es manchmal schmerzt. Warum er sich nach dem Mord an seinem Vater weiter politisch für seine Heimatstadt engagiert und für eine lebendige Demokratie wirbt, das hat er einmal in einem Interview mit folgendem Gleichnis beschrieben: »In den Niederlanden brechen alle hundert Jahre viele Deiche. Die Generation, die die Flut erlebt hat, weiß, wie wichtig es ist, die Deiche zu schützen. Sie baut oft neue, macht Pläne zur Instandsetzung, kümmert sich. Die Kinder wissen das noch aus Erzählungen. Sie schauen ab und an, ob der Deich noch fest und intakt ist, und erfüllen so ihre Pflicht. Aber manchmal wird das schon lästig. Es gibt so viele andere Probleme, um die man sich kümmern muss. Für die Enkel sind die Schrecken einer Sturmflut weit weg, sie kennen das nur aus den Geschichtsbüchern. Und dann droht die Gefahr, dass die Deiche erneut brechen. So ähnlich ist das auch mit der Demokratie. Wir sind jetzt in der dritten Generation, die den Schrecken des Krieges nicht kennt und nicht weiß, wie es ist, in einer Diktatur ohne Freiheit zu leben. Der demokratische Bürger kümmert sich zu wenig um den Deich, zu wenig um die Demokratie. Der Mord an meinem Vater und die immer größere Zahl an rechtsextremen Straftaten zeigen das.«
Die Ermordung seines Vaters hat Christophs Leben und das der gesamten Familie auf den Kopf gestellt. Er hat viel von seinem Vater und ist doch in vielem seiner Mutter sehr ähnlich. Das Wertefundament der Familie, das merkt man in fast jedem Satz, den er sagt, will er unbedingt erhalten. Gerade in einer schnelllebigen Zeit ist es für ihn bedeutsam, seine Wurzeln zu kennen.
Die Familie ist ihm enorm wichtig – von den Großeltern über die Eltern bis hin zu ihm selbst und den eigenen Kindern. Haltung und Werte werden vorgelebt, weitergegeben. Man hält zusammen. Das Leben der Familie ist davon geprägt. Im Namen der erwähnten Firma sind deshalb auch die Namen der Großeltern mit aufgenommen: Braun, Lübcke und Grimmelbein – BLG. Die Großeltern und Eltern haben Christoph und seinem Bruder beigebracht, Verantwortung zu übernehmen und sich füreinander einzusetzen, so wie sich Walter Lübcke immer für die Familie eingesetzt hat.
Walter Lübcke. Groß gewachsen, eine laute Stimme und ein volles Lachen. Klare Haltung, bodenständig, im besten Sinne des Wortes konservativ. So haben ihn die Menschen, die ihn kannten, erlebt. Mich verband mit ihm eine Freundschaft, auch wenn wir uns nicht oft gesehen haben. Wenn wir uns begegnet sind, dann war es umso herzlicher. Und da wir am gleichen Tag Geburtstag haben, gab es dann natürlich einen Geburtstagsanruf. Oft begann der mit dem scherzhaften Satz: »Hast du etwa meinen Geburtstag vergessen?« Und da war es dann wieder, sein volles Lachen.
Walter Lübcke war pragmatisch und fähig, Kompromisse zu machen. Er wollte das Gute bewahren und ging doch mit der Zeit. So kannten ihn die Menschen in Nordhessen. Erst war er Landtagsabgeordneter und dann Regierungspräsident. Er liebte seine Familie, und die Familie liebte ihn. Die Familie als Burg, als Rückzugsort war ihm wichtig. Und heimatverbunden war er auf eine besondere Art und Weise. Den Menschen zugewandt, wollte er das Beste für Nordhessen.
Christoph ist ihm in mancherlei Hinsicht ähnlich und doch eine ganz eigene Persönlichkeit. Sicher war es das, was der Vater für seine Kinder wollte: ihnen etwas mitgeben; aber den eigenen Weg, den sollten sie dann schon selbst gehen.
Der Mord liegt nun schon einige Zeit zurück. Was macht so eine Tat mit der Familie? Kann es wieder so etwas wie Normalität geben? Alltag? Eins ist sicher: Es kann nicht mehr so werden wie vorher. Das anzunehmen ist wahrscheinlich das schwierigste. Und es braucht Mut, einen neuen Alltag, eine neue Normalität aufzubauen und sich darauf einzulassen.
Die Erinnerung an den Vater wird so schnell nicht verblassen. Alle zwei Jahre wird nun ein Walter-Lübcke-Demokratie-Preis durch das Land Hessen verliehen. Christophs Mutter ist Mitglied im Kuratorium. Der Preis hat die Form eines Sterns – angelehnt an das berühmte Buch Der kleine Prinz, in dem es heißt: »Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache.« Das beschreibt Walter Lübcke ziemlich genau, denn er war ein lebensbejahender, fröhlicher Mensch, und er war gläubig. Der Stern ruht auf einem Sockel aus Waldecker Holz aus Nordhessen. Auch diese Symbolik ist gut gewählt für den heimatverbundenen Menschen Walter Lübcke. Der Preis soll an Menschen verliehen werden, die sich für das demokratische Miteinander und gegenseitigen Respekt einsetzen.
Darüber hinaus gibt es weitere Initiativen und Ideen, um die Erinnerung an Walter Lübcke wachzuhalten. Die Gründung einer Stiftung ist im Gespräch. Und in seiner Heimatstadt trägt nun die weiterführende Schule seinen Namen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich dafür eingesetzt. Ein Plakat mit den Worten »Demokratische Werte sind unsterblich« hing als Solidaritätserklärung nach dem Mord lange an der Schule. Es ist die Schule, in die früher auch Christoph und sein Bruder Jan-Hendrik gegangen sind.
Und in Kassel, dem Sitz des Regierungspräsidiums, trägt eine Brücke seinen Namen. In Lohfelden, Niestetal, Langen und Rosbach vor der Höhe sind Plätze nach Walter Lübcke benannt worden. Man merkt, dass sein Schicksal die Menschen an vielen Orten beschäftigt. Der Name bleibt dadurch in aller Munde. Und damit verbunden ein Appell für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Nach der Sprachlosigkeit, die unmittelbar nach der Tat herrschte, sind solche Appelle heute auch nötig.
Ich habe mich damals geärgert über das dröhnende Schweigen. Natürlich gilt in einem Rechtsstaat die Unschuldsvermutung, natürlich gab es direkt nach dem Mord keine Beweise. Doch nicht nur mein Gefühl war untrüglich: Da ist jemand ermordet worden, weil er Demokratie und Rechtsstaat verteidigt hat und für Werte wie Menschenwürde und Nächstenliebe eingetreten ist.
Wahrscheinlich ging es vielen Menschen so wie mir: Als die Meldung vom Tod Walter Lübckes durch die Nachrichten ging, war mein erster Gedanke: Das war Mord. Doch man hatte fast das Gefühl, dass nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Ein Mord von rechts an einem Repräsentanten des demokratischen Staates – das hatte es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Erklärt das die Sprachlosigkeit unmittelbar nach der Tat? Ich weiß es nicht. Und ich fand das Schweigen beschämend.
Der Tat war eine unglaubliche Hetze gegen Walter Lübcke vorausgegangen, durch Rechtspopulisten und Neonazis, die im Netz gemeinsame Sache machten. Auch die AfD und ihre Politiker mischten kräftig mit. Sie alle machten sich mitschuldig.
Lübcke hatte als Regierungspräsident während der Flüchtlingskrise 2015 für eine vernünftige Unterbringung und Aufnahme der Flüchtlinge zu sorgen. Er vertrat dabei unmissverständlich die Werte und Normen unseres Rechtsstaates, die gerade dann durchgesetzt und hochgehalten werden müssen, wenn es schwierig ist. Dafür wurde er ermordet, nachdem der Hass im Netz sich immer weiter hochgeschaukelt hatte.
Die Familie merkt jetzt, wie viel Kraft die letzten zwei Jahre gekostet haben. Die öffentliche Aufmerksamkeit, Polizeischutz, dann der Prozess. Christoph fühlte sich in dieser Zeit wie in einem Tunnel, erzählte er mir. Denn die Arbeit, die Familie – all das musste ja weitergehen. Ihm ist das in der letzten Zeit erst so richtig klar geworden. Wenn er jetzt anfängt, viele Dinge, die liegen bleiben mussten, zu sortieren, dann sortiert er sich dabei auch ein bisschen selbst.
Dabei halten die Lübckes zusammen, wie sie es seit jeher tun. Alle genießen das familiäre Leben und treffen sich gerne zu feierlichen Anlässen. Dann ist das Haus natürlich voller Menschen, aber vor allem voll familiärer Wärme. Früher war das normal, heute ist es etwas Besonderes. Christophs Anliegen, das zu bewahren, was die Vorfahren geschaffen haben, es in die Zukunft zu tragen, hat jetzt eine weitere Bedeutung erfahren. Zu dem, was bewahrenswert ist, gehören nun noch stärker die Demokratie, der Rechtsstaat und die Freiheit. Für die Deutschen sind diese Werte seit über 70 Jahren selbstverständlich. Seine Familie hat erlebt, was passiert, wenn diese Werte angegriffen und zerstört werden.
Die Großeltern von Christoph hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, den die Familie immer noch fortführt. Das, was geschaffen wurde, soll bewahrt werden. Christoph erinnert sich daran, dass sein Großvater jeden Holzbalken aufgehoben hat, weil dieser vielleicht noch zu gebrauchen war. Er hat das miterlebt und gelernt, den Wert von Dingen zu schätzen. Auch sein Vater ist in einfachen Verhältnissen groß geworden. Mit seinen drei Brüdern teilte er sich ein Zimmer im elterlichen Haus, bis er 16 Jahre alt war. Die Familie ruft sich das immer wieder ins Gedächtnis, und Christoph will die gelebten Werte an seine Kinder weitergeben. Er weiß, dass es nicht so leicht ist, das zu vermitteln, ohne dass es als alte Geschichte abgetan wird.