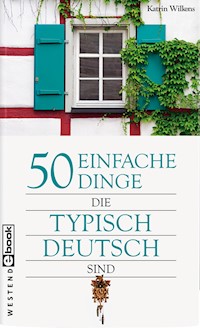13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer noch bekommen Frauen nur die Hälfte der Rente, immer noch gibt es den gender-pay-gap und immer noch konkurrieren Mütter darum, wer die besten Dinkelkekse bäckt. Der gelungene und passgenaue Wiedereinstieg in den Beruf gerät für junge Frauen zur größten Herausforderung ihres eh schon dichten Lebens zwischen 35 und 50. Katrin Wilkens hat 1000 Frauen geholfen, den passenden Job zu finden: die erlösende Vision – oder schlicht das Machbare, das funktioniert. Katrin Wilkens führt in diesem Buch die Ursachen für die Schwierigkeiten an und erklärt den Kreativitätsansatz, mit dem sie arbeitet, so dass irgendwann der Dinkelkeks-Battle nicht mehr die Altersarmut zur Folge hat. Ein wütender Aufschrei, der jungen Frauen Mut macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ebook Edition
Katrin Wilkens
Mutter schafft!
Es ist nicht das Kind, das nervt, es ist der Job, der fehlt
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-737-5
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Jasmin Zitter, ZitterCraft, Mannheim
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Warum mache ich das bloß?
Es ist diese Scheißsache mit dem Genügen.
Genau 24 Stunden, bevor ich dieses Buch zu schreiben beginne, sitze ich mit netten Nachbarn beim Grillabend. Sieben Erwachsene, acht Kinder, zwei Hunde. Rama-Idyll. Mir geht der Arsch auf Grundeis. Morgen werde ich für vier Wochen meine Familie verlassen, um mich einzuigeln. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich weiß nicht, ob irgendjemanden interessiert, was ich schreibe, ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit meine Tochter vor Mutterheimweh wimmert.
»Was würde euch an einem Buch über beruflichen Wiedereinstieg bei Frauen gar nicht interessieren?«, frage ich, in der falschen Hoffnung, schnell noch die kapitalsten Autorenfehler zu erfragen, zu vermeiden. Zu genügen. Die Frauen der Runde antworten prompt.
Line, Elternsprecherin, freiberuflich, vegetarisch, Typ Netzwerkerin, die man nachts um drei anrufen könnte, um die eigenen Kinder vorbeizubringen, sagt: »Wenn ich lesen würde, dass ich zu wenig arbeite.«
Katharina, sozial, politisch, tolerant und unaufdringlich edel: »Wenn ich mich in den Beispielen nicht wiederfinden würde.«
Die Männer trinken Bier und schnappen sich den politisch korrekten Grillkäse. »Reichst du mir mal den Salat, bitte?«
»Hey, sagt mal, was euch an dem Buch überhaupt nicht interessieren würde?!« Ausrufe-Rhetorik. Die, die man als Mutter tausendmal am Tag einsetzt: »Räum bitte den Tisch mit ab! Einer muss noch mit dem Hund raus! Geh verdammt noch mal ohne Socken ins Bett!« Wenn man diesen Tonfall einmal hat, switcht man bisweilen zu schnell – Riesenfehler am Freitagabend: Die Männer wollen chillen, nicht denken.
»Weißt du, Katrin, was mich an deinem Buch interessiert?«, setzt schließlich Seth, Typ Prenzlauer-Berg-Kreativer, von Beruf Neurosenbändiger und Budgetverwalter. Seth ist ein Amalgam aus Kreativität und Pragmatismus. Wenn einer was zur Machbarkeit von Ideen sagen kann, dann er. Er nimmt noch ein Stück Grillkäse. »Nichts. Mich interessiert an dem Buch nichts.«
Mirko ergänzt: »Mich würde abturnen, wenn du vom Feminismus redest und das Ganze zu streng aufschreibst. Mach es mehr locker, verstehste?«
Und so sieht die Bestandsaufnahme aus: Wenn man über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schreibt, dann muss man ein veganes Schwein grillen: Man darf auf keinen Fall feministisch schreiben, das wirkt dann so baschamikaesk, aliceschwarzerhaft, lauriepennymäßig. Es soll witzig sein, obwohl eigentlich in der Tatsache, dass Frauen immer noch nur halb so viel Rente bekommen wie Männer, nicht viel Witz steckt, jedenfalls nicht für uns Frauen. Es soll fundiert sein, mit viel wissenschaftlichem Bezug, sonst sind es nur Behauptungen, aber es darf nicht zu fußnotenlastig sein, sonst ist es Hirnfick. Es muss Zahlen bringen, sonst kann man darüber nicht diskutieren, es darf aber nicht zahlenlastig sein, sonst will niemand darüber diskutieren. Es soll viele Beispiele bringen, sonst ist es zu trocken, aber es dürfen keine Einzelfälle sein, sonst sind das nur Ausnahmen. Es soll eine Debatte anstoßen, aber es darf nicht aggressiv formuliert sein. Es muss journalistisch und wissenschaftlich zugleich sein, obwohl das kaum geht. Facebook-kompatibel und Hardcover, schnell- und langlebig. Unterhaltung und Politik. Ein Anliegen, das niemanden verprellt, aber etwas bewirkt. Es muss direkt in der Ansprache sein, sonst ist es zu verkopft, aber es darf nicht vulgär formuliert sein, denn das verschreckt oder biedert an. Es muss aus der Position einer glücklichen, zufriedenen Autorin geschrieben sein, denn Larmoyanz will keiner kaufen, es muss aber auch biografisch anrührend formuliert sein, denn ohne Ich-bin-eine-von-euch-Empathie wirkt es arrogant, will das niemand lesen. Es muss für Frauen geschrieben sein, bloß nicht verbittert, sondern eher so lustig, wie Barbara Schöneberger es schreiben würde, also humorvolle Selbstgeißelung, und es muss für Männer geschrieben sein, denn schließlich ist das doch kein reines Frauenthema, sondern betrifft die ganze Familie. Es muss also mit den Männern flirten und mit den Frauen solidarisch sein. Es muss wahrhaftig sein und geschmeidig. Es muss auf die Kinder Rücksicht nehmen, denn die sind schließlich das Wichtigste, oder auf die Frauen, auf die Männer, auf Gott und die Welt und den Fisch und die Gräte. Es muss ein hundertprozentig perfektes Buch für weibliches Nichtgenügen werden.
Die Gartentür geht auf, und Familie Wiedemann schaut vorbei, im Gepäck Vollkornpizzaschnecken und ein verwöhntes Kind. Die Mutter tuppert aus, und der Vater setzt sich mit einem tiefen Seufzer neben mich. Ich kenne ihn, er spielt mit seinem Siebenjährigen immer Fußball, übernachtet im selbstgebauten Baumhaus und ist ein Vorzeigepapa. Bekäme er für seine Vaterschaft Fleißkärtchen – er hätte die Sammlung komplett. Dazu ist er noch ein Hobbysammler: Er spielt Cello, Skat und Schultheater, er liest, kocht, malt und singt. Ginge ein obdachloses Hobby an ihm vorbei, er läse es auf und nähme es mit. Ich konnte früher über meinen Vater nur »Patience legen und kegeln« sagen, wenn man mich fragte, was er gern tat. Dass er feste Verabredungen jede Woche gehabt hätte – das war damals nicht üblich.
»Warum schreibst du denn das Buch?«, fragt der Hobby-Hobbyist, wirklich freundlich, ohne Häme und interessiert, zumindest strategisch interessiert. Er weiß, dass seine Frau auf die Nachbarschaftshilfe angewiesen ist, da will er es sich nicht grundlos verscherzen. »Weil ich es ungerecht finde, dass Frauen immer noch weniger Geld verdienen als Männer«, setze ich an. Bei meinem Mann löst das den sofortigen Ich-geh-mal-eine-rauchen-Reflex aus. Er weiß, dass es jetzt länger dauert, und er weiß vor allem, dass es noch länger dauert, wenn man mir widerspricht.
»Aber es ist doch ganz logisch, dass Männer mehr Geld verdienen müssen.« Ehrliche Ratlosigkeit im Gesicht meines Gegenübers: »Männer müssen doch auch die ganze Familie ernähren.« Den letzten Satz hört mein Mann und setzt sich schnell wieder hin. Jetzt wird es gleich krachen, und er ist nicht schuld. Er wartet auf Ein Kessel Buntes und die Replik seiner Frau.
Ich bin noch beim Sortieren. Ist das die Post-Harald-Schmidt-Ironie, das Gegenteil dessen zu behaupten, was politisch korrekt ist und dabei subversiv lachen? Sprenge ich die Freitagabendstimmung, wenn ich jetzt inhaltlich werde? Fliegen wir aus dem netten Grillzirkel, werden meine Kinder nicht mehr zum Übernachten eingeladen, wird mein Mann still bemitleidet, nur weil ich relevant werde? 100 Prozent perfekte Fragen für weibliches Nichtgenügen.
»Findest du es gerecht, dass wir Frauen nur die Hälfte der Rente bekommen, die ihr Männer bekommt?« Die Antwort kommt prompt und jovial-gönnerhaft. »Du kennst dich ja nicht so mit Statistik aus wie ich, Frauen werden ja auch viel älter als Männer, da ist es doch logisch, dass sie von der Altersarmut mehr betroffen sind.«1
Neun Erwachsene hören dieses Argument – neun Abiturienten, Akademiker, zum Teil Promovierte. Und schlagartig weiß ich, warum ich dieses Buch schreiben muss. Es liegt nicht an der kruden Anno-dunnemals-Argumentation des Cellisten. Es gibt auch Leute, die die Vernunftehe befürworten, und mitunter sind es ganz und gar reizende Zeitgenossen.
Es geht um die neun Erwachsenen, vier Männer, fünf Frauen, davon vier Mütter. Alle hatten mit dem beruflichen Wiedereinstieg nach der Babypause zu kämpfen. Alle wollten es besser machen als damals ihre Mütter, zumindest anders – obwohl ich gestehen muss, dass meine Mutter schon eine ziemlich geniale Mischung aus Beruf und Mutterschaft hingelegt hat: Sie war Architektin und hatte ihr »Studio« einfach in unser Haus integriert.
Die Elternsprecherin, die ihre Mutter aus lauter Selbstständigkeit kaum zu Gesicht bekam und heute für ihre Kinder auch einfach nur mal zwei Stunden Mutter sein will.
Die Politischgeprägte, die ihren Mann entlastet, soweit es geht, damit er auch eine Beziehung zu seinen Kindern aufbauen kann.
Die Tuppermutter mit ihrem Einzelkind, die es anders als ihre strenge Mutter machen will und deshalb ihr Kind lobt und unterstützt und »sieht« – und dabei gar nicht mehr bemerkt, dass sie sich selbst immer mehr auflöst, bis sie irgendwann nur noch Kindeswunsch ist.
Und ich, die ich meiner Tochter und meinen zwei Söhnen auch ein immaterielles Erbe mitgeben will: dass Arbeit Identität bedeutet, Sinn, Antidepressivum, Struktur, Spaß, Gemeinschaft, Geld, ja, auch Geld, Lernen, Abwechslung, Leidenschaft und Vernunft.
Wir alle wollen Familie und Beruf bestmöglich vereinen, denn darin sind wir uns einig: Der Sinn unserer Tage besteht nicht im Thermomixen, auch nicht im Detoxen oder im Twittern. Denn Frauen sind emanzipiert, wir Mütter sind es leider (noch) nicht immer.
»Findest du nicht, dass die wirklichen Verlierer die Kinder sind?«, unterbricht mich der Vorzeigepapa mit den hundert Hobbys, wahrscheinlich tritt er nächste Woche in einen Debattierklub ein.
»Nein, es ist längst wissenschaftlich erwiesen, dass sich Kinder, um die sich ausschließlich die Mutter gekümmert hat, nicht anders entwickeln als diejenigen, um die sich andere Personen gekümmert haben.2 Es ist längst erwiesen, dass sich heute berufstätige Mütter mit ihren Kindern so lange beschäftigen wie nichtberufstätige Mütter in den siebziger Jahren. Es ist längst erwiesen, dass sich zwei berufstätige Elternteile sogar vorteilhaft auf die Entwicklung von Mädchen auswirken.«3
»Noch Grillkäse?«
Ja, ich weiß, die Stimmung kippt. Aber mich ärgert diese Argumentation ungemein, die keine ist, aber von allen so hingenommen wird. Warum sagt niemand, dass sich Väter am glücklichsten fühlen, wenn sie 50 Stunden pro Woche arbeiten? Warum sagt niemand, dass es sie nachweislich unzufrieden macht, wenn sie sich um die Kinder kümmern?4 Warum lobt man Väter, wenn sie mit ihren Kindern angeln gehen, aber nicht die Mütter, wenn sie Pfannkuchenrezepte ausprobieren? Warum darf man auf diese Missstände nicht hinweisen, ohne dass es mit einem Sympathieverlust einhergehen muss? Das finde ich in #MeToo-Zeiten den viel stärker zu geißelnden Sexismus und nicht die Frage, ob in Hollywood, weitab von unserer Lebensrealität, die Frauen solidarisch schwarze Kleidung zur Oscarverleihung tragen.
Der Mann sieht mich lange an. Ich habe, wenn ich mich anstrenge, Mitleid. Er begibt sich in ein Feld, das er nicht beackern kann – vielleicht aus Gründen der sportiven Kräfterangelei oder aus der kulturellen Verpflichtung heraus, für Unterhaltung sorgen zu müssen. Ich habe aber auch Mitleid mit mir: weil meine Argumente nicht zählen, weil ich überhaupt, um diese Diskussion gewinnen zu können, lässig, ironisch, selbstmarternd smalltalken müsste, was ich nicht kann.
»Sag mal, mag dein Mann dich überhaupt noch so?«
Am nächsten Tag bringt mich meine Tochter zur Bahn. »Mama, warum musst du das Buch schreiben?«, fragt sie. »Weil Grillkäse eigentlich eklig ist«, antworte ich, »weil ich etwas sagen will, von dem ich glaube, dass es wichtig ist. Weil du genügst, so wie du bist. Und weil Papa mich immer noch mag.«
Das böse F-Wort
Feminismus, Gender-Mainstreaming, Pussy-Hut-Träger. Es ist egal, wie man das Kind nennt. Wenn man sich mit der Identität von Frauen beschäftigen will, kommt man nicht umhin, sich auch mit Feminismus zu beschäftigen – obwohl kaum ein Begriff einen derartigen Hautgout1 aufweist wie Feminismus. Hautgout-Worte nennt man in der Psychologie auch Trigger, weil sie neben ihrer eigentlichen Bedeutung noch weitere Assoziationen transportieren. »Feminismus«, das assoziieren viele fast automatisiert mit »lila Latzhose«, »lesbisch« und »männerhassend«.2
»Frauenrechteliebend« denkt niemand, und dabei war genau dies immer das größte Ziel der Feministinnen. Vor 150 Jahren wurde erstmals begonnen, für weibliche Rechte einzutreten. Erst ging es um Teilhabe am Wissen, dann um das Wahlrecht, schließlich um das Recht auf Abtreibung. Und heute kämpft der Feminismus hauptsächlich gegen Sexismus. Rentengleichheit, Gender-Gap und Wiedereinstiegschancen sind hingegen höchstens Randthemen. Überhaupt: Rente, auch so ein Trigger-Begriff. Da könnte man auch gleich Kukident sagen oder präfinal.
Es ist aber so ein bisschen wie mit der These des Kommunikationspsychologen Paul Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren. Oder um mit der Mode zu sprechen: Man kann sich nicht kleiden, ohne nicht etwas über sich auszusagen. Man kann keine Kunst betreiben, ohne sich dabei miteinzubringen. Man kann keine Kinder erziehen, ohne die eigene Kindheit im Blick zu haben, selbst wenn man komplementär erziehen würde. Und als Frau kann man sich nicht freimachen vom Feminismus. Selbst wenn ich mich abgrenze, definiere ich mich über die Abgrenzung zur Feministin. Unsere Werte haben so viel mehr mit soziologischen als individuellen Parametern zu tun, dass wir eigentlich fremdgesteuerte Wesen sind. Wir wollen es zum Glück nur nicht so wahrhaben.
Von der Befreiung der Frau
Der Feminismus hat sich, grob gesagt, in drei Epochen entwickelt. Diese Entwicklung ein wenig zu kennen, hilft zu verstehen, was bislang erreicht wurde – und was noch zu tun ist.
»Die Perspektivlosigkeit der unverheirateten Frauen des Bürgertums war einer der Hauptgründe für die Entstehung der bürgerlichen Frauenbewegung«, schreibt Herrad Schenk in ihrem Werk Frauen. Ein historisches Lesebuch. Und so begann die erste Welle des Feminismus Ende des 19. Jahrhunderts – erstmals wurde systematisch für die Grundrechte der Gleichberechtigung gestritten: das Recht auf Bildung (und damit auf einen qualifizierten Beruf) sowie das Wahlrecht (damit durften Frauen erstmals eine politische Meinung haben und auch vertreten). 1893 gab es erstmals Gymnasialkurse für Frauen, 1909 durften sie erstmals studieren und ab 1919 deutschlandweit wählen.
Die Frauen in der Weimarer Republik waren ungewöhnlich denkfreudig, frivol und mitunter auch wenig zimperlich.3 Wichtige Vertreterinnen waren beispielsweise Erika Mann, Journalistin und Tochter von Thomas Mann, Elly Beinhorn, eine Pilotin, oder Margarete von Wrangell, die erste Professorin an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim. All diesen Frauen wohnte ein Pioniergeist inne, eine Tatkraft, ein wütender Hunger nach Freiheit außerhalb der eigenen Familie. Warum ich das aufschreibe? Weil bei jedem erfolgreichen Manager mindestens fünf angefangene Biografien auf dem Nachttisch liegen. Weil Männer über Beispiele posen. Und weil es uns Frauen guttut, sie in diesem Punkt zu kopieren – Vorbilder bilden.
Wer nachvollziehen will, was ich mit denkfreudig und frivol meine, dem sei die Biografie der Künstlerfrau Alma Mahler-Werfel empfohlen. Sie war das, was man heute Künstler-Groupie nennen würde. Sie scharte so viele Künstler und Maler um sich,4 dass es ihr in ihren Erinnerungen nicht schwerfiel, schnell zu diesem und jenem Kunstwerk eine ich-starke Meinung rauszuhauen. Alma Mahler-Werfel war Künstlermuse und Kritikerin in einem, und ganz sicher kann man eines posthum über diese Frau behaupten: Eine Meinung hatte sie. Und damit war sie solitär in ihrer Generation, denn der erste Grundsatz über Frauen lautete: Man solle sie sehen, aber nicht hören. Eine Meinung war also nichts anderes als Befreiung. Und jede laut geäußerte Meinung war ein erkämpfter Schritt dahin, dass heute Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und Heidi Klum mit 47 Jahren im Bikini posiert. Je nachdem, was einem wichtiger ist.
Warum schreibe ich so viel über Künstlerinnen? Kunst hatte in Europa damals eine andere Funktion, als sie heute hat. Sie war weniger Dekoration (und Inszenierung) als vielmehr Politik und Sichtbarmachung einer kulturellen Identität. Selbst ein olles Stillleben konnte politisch aufgeladen werden. Heute übernehmen die Medien diese Funktion, deshalb wird Kunst immer mehr zu einem unpolitischen oder kapitalistischen Akt. Früher war Kunst oft die einzige Quelle aktiver zeitgenössischer Kultur – und deshalb muss man eigentlich nicht über Künstler schreiben, sondern über Zeitzeugen.
Noch stärker war Martha Vogeler. Sie wurde von dem damals sehr berühmten und gut betuchten Jugendstilkünstler Heinrich Vogeler entdeckt: Er sah das 14-jährige Mädchen und verliebte sich in sie. Martha heiratete den Künstler und wurde so etwas wie eine Doppelmuse: Vogeler machte sie zu einem Teil seiner Kunst, zu einem integralen Bestandteil seines Werks. Er malte sie, und sie lebten zusammen in dem als Gesamtkunstwerk inszenierten Haushalt Barkenhoff in Worpswede – ein wichtiger Treffpunkt norddeutscher Künstler: Paula Modersohn-Becker, Rainer-Maria Rilke, Gerhardt Hauptmann, Thomas Mann waren häufige Gäste. Eigentlich hätte Martha froh sein können, dass ihr Mann sie aus der prekären Enge befreite – ihr Vater starb früh, die Mutter musste mit land- und hauswirtschaftlicher Arbeit die Kinder allein ernähren. Aber sie emanzipierte sich ein zweites Mal in ihrem Leben und wurde selbst Künstlerin. Als ihr Mann in eine fulminante Schaffenskrise geriet und infolgedessen sich im Ersten Weltkrieg freiwillig an die Front meldete, schuf sie künstlerisch und handwerklich ihr eigenes Profil. Sie zog mit ihren drei Kindern aus dem Barkenhoff aus, legte Wert darauf, dass alle drei Töchter gebildet und berufstauglich erzogen wurden, und rettete zur Freude vieler Kunsthistoriker wichtige Werke ihres Mannes, die er selbst zerstören wollte. Sie war aktives Mitglied der NSDAP und wurde 1942 von der Partei wegen »nicht nationalsozialistischen Verhaltens« ausgeschlossen. Ihre doppelte Verpuppung beeindruckt mich: Sicherlich wuchs Martha Vogeler in engen Verhältnissen auf, eng im geistigen und materiellen Sinn, und trotzdem entschied sie sich an zwei entscheidenden Weggabelungen in ihrem Leben für die (riskante) Freiheit.
Abhängig war diese Frau zeitlebens nicht, obwohl sie viel weniger Möglichkeiten hatte als wir heute. Warum haben wir trotzdem so viel Angst, uns beruflich zu emanzipieren? Warum suchen wir »Ersatzprojekte« für unser Leben (Kinder, soziale Medien, Ernährung), anstatt einfach loszulegen? Ich versuche, mir vorzustellen, wie Martha Vogeler auf uns moderne Frauen reagiert hätte. Gewiss wäre sie keine gewesen, die viel geredet, gefühlt, verwörtert hätte. Sie wäre wahrscheinlich so ein »tiefes, stilles Wasser« gewesen, das man von Weitem bewundern könnte, die aber ihr eigenes Ding machte. Und Kinder hatte sie darüber hinaus auch. Eine Ikone des Feminismus aber würde sie sicher nie sein wollen. Im Gegenteil: Nur aus ihrer Beiläufigkeit, das Leben »so zu nehmen, wie’s kommt«, kann man Nektar für sein eigenes Leben saugen.
Vielleicht bedingen sich solche Biografien und der frühe Feminismus trotzdem gegenseitig. Weil starke Frauen Rechte einforderten, hatten sie Erfolg, und dieser Erfolg beflügelte sie weiter und ließ sie das Fundament erkämpfen, auf dem wir heute selbstverständlich stehen: Wir lernen in Schulen und Universitäten dasselbe wie Jungs, haben einen Beruf und ein fortschrittliches Scheidungsrecht.
Das Nazi-Regime war dann ab den dreißiger Jahren ein einziger barbarischer Rückschritt, auch für die Frauenfrage. Frauen galten als »Fruchtschoß« des Dritten Reichs, die lediglich von der Natur dazu auserkoren waren, dem Führer frische Soldaten zu schenken. »Das Wort Frauenemanzipation ist nur ein vom jüdischen Intellekt erfundenes Wort«, wetterte Hitler, »die deutsche Frau brauchte sich in den wirklich guten Zeiten des deutschen Lebens nie zu emanzipieren.« Und Heinrich Himmler gab die Gebärroute vor: »In einem richtig gebauten Staat ist das Weib, das nicht geboren hat, unehrenhaft.« Mütterlichkeit wurde zu einer heiligen Aufgabe: Indem die Frau gebiert, sollte sie der deutschen Rasse Unsterblichkeit schenken. Oder Kanonenfutter für den Krieg produzieren? Auf alle Fälle machte der Zweite Weltkrieg die Frauen auf eine ekelhafte Weise emanzipiert, wie es heute in unserer Rundum-Wohlfühlwelt zwischen Grillkäse und Dinkelkeksen kaum vorstellbar scheint. Wir leben seit Jahrzehnten in einer historisch sehr langen Periode des Friedens, zum Glück. Aber manches entwickelt sich zugleich unfreiwillig rückständig.
Es gibt Denkansätze, die legen dar, dass die lange Periode ohne Krieg in Europa Grund für eine derzeitige »Verbiedermeierung der Geschlechter« ist, dass man zum Beispiel in den zwanziger Jahren viel engagierter in Frauenrechtsfragen war, als es heute interessieren würde. Der Krieg ruft Kräfte hervor, von denen man sich in Friedenszeiten nicht vorstellen kann, dass man sie hat, so traurig, wie das ist. Der Essayist Wolf Lotter schreibt dazu:5 »So einflussreich etwa in den USA und Großbritannien die ›Suffragettenbewegung‹ auch in der Presse und in politischen Zirkeln war, für die Gleichberechtigung waren die beiden Weltkriege von 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 wohl entscheidender. Frauen dominierten in der Kriegswirtschaft die Produktion, und sie ersetzten Männer auch im Büro – vor dem Ersten Weltkrieg kaum vorstellbar. Nach 1945 war das schwer rückgängig zu machen.« Und doch kriegte Mann es hin.
In Deutschland wurde der Wiederaufbau gestartet, ein Unterfangen, das ohne emanzipierte, zupackende Frauen nicht möglich gewesen wäre. Und trotzdem schwappte ab den sechziger Jahren eine Refeminisierung zu uns, die von der amerikanischen Psychologin und Soziologin Betty Friedan6 »das Problem ohne Namen« genannt wurde: »Es war eine seltsame Erregtheit, ein Gefühl der Unzufriedenheit, eine Sehnsucht, worunter die Frauen in den Vereinigten Staaten um die Mitte des 20. Jahrhunderts litten. Jede der in den Vororten lebenden Ehefrauen kämpfte für sich allein dagegen an. Wenn sie Betten machte, einkaufen ging, Stoff für neue Schonbezüge ausmaß, mit den Kindern Erdnußbutterbrote aß oder sie mit dem Auto zu ihren Pfadfindergruppen brachte, wenn sie nachts im Bett lag – immer scheute sie sich, die leise Frage zu stellen: ›Ist das alles?‹« Friedan beschreibt die Ödnis der amerikanischen Vorstadt und unterschlägt dabei, dass die ein oder andere amerikanische Vorstadtfrau vielleicht mit dem Angebot ihres Lebens ganz zufrieden war: Kinder, Eigenheim und Diätvorschläge.
Für Betty Friedan haben alle Frauen ein und dasselbe Problem, das Problem ohne Namen: »Das Problem ist, daß ich immer die Mammi der Kinder oder die Frau des Pfarrers bin und niemals ich selbst.« Ja, es gibt Frauen, die in der Familienarbeit aufgehen. Und sie sind nicht einen Deut weniger wert als Frauen, die Arbeit und Familie unter einen Hut bekommen wollen! Das Einzige, was sie weniger sind: rentenversichert. Abgesichert, für den Fall, dass dem Mann etwas zustößt.
Meine Patentante hat jahrzehntelang nicht gearbeitet. Falsch, das ist unpräzise formuliert: Sie hat nicht pekuniär gearbeitet: ein Haus, vier Kinder, gefühlt siebzig Ehrenämter, aktives Gemeindemitglied, Chorsängerin und für jeden kranken Nachbarn da. Gäbe es ein Ehrenamt für flüchtige Feuerwanzen, hätte sie es auch noch übernommen. Die Frau, nach der wir unsere Tochter benannt haben, ist jetzt im Alter gut versorgt: Immer noch vergeht kein Tag, an dem nicht irgendjemand vor ihrer Tür steht und meine Tante, inzwischen verwitwet »auf ein Schnäpsle« abholt. Und für das Finanzielle hatte mein Patenonkel gesorgt: Er hatte seine Frau akribisch für die Zeit nach seinem Tod abgesichert, sodass sie weiterhin das machen konnte, was sie zeitlebens am besten konnte – Menschen eine Gastfreundin sein.
In den Nachkriegsjahren war die Rolle der Frau betonhart zementiert: »Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, daß sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen läßt«, hieß es in einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 1966. »Wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.« Kurz: Frauen wurden zum Sex per Gesetz gezwungen und sollten dazu bitteschön auch noch rallig lächeln.
Hier setzt die zweite Welle der Frauenbewegung ab den sechziger Jahren an. Sie definierte sich hauptsächlich über den Grad der sexuellen Selbstbestimmung der Frau. Die Antibabypille wurde erfunden, die Abtreibung unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert.7 Alice Schwarzer schrieb über »den kleinen Unterschied« und Hannah Arendt vom »tätigen Leben.«8 Beiden Autorinnen war ein Beruf Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, nicht im ökonomischen Sinn, sondern viel eher im philosophischen.
Was diese Ära besonders effizient machte, war die hungrige Wut der Frauen, mit der sie auf die Straßen gingen. Es gab kein Google, Facebook, Pinterest oder Handy, und trotzdem war die Publikationskompetenz dieser Frauen überragend. Frauenkreise, autonome Zirkel, Studentenparteien – die Frauen der zweiten Welle waren Netzwerkerinnen, wie sie im Buche stehen. Wenn es etwas gab, was sie noch besser konnten als Provokation und Politik, dann war es PR. Und sie waren erfolgreich! Drei neue Grundrechte erstritten die Frauen dieser Generation:
▪ Eherecht: Ein neues Eherecht trat 1977 in Kraft. Von da an waren Frauen nicht mehr verpflichtet, den Haushalt zu führen. Es war nur noch erwünscht.
▪ Scheidungsrecht: Gleichzeitig wurde das Scheidungsrecht erneuert. Das Schuldprinzip wurde abgeschafft, fortan galt das Zerrüttungsprinzip. Das war ein Meilenstein in der Selbstbestimmung der Frau.
▪ Gleichbehandlung: 1980 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz regelte. Was sich heute nahezu wie aus dem Biedermeier liest, ist in Wirklichkeit gerade mal fünfzig Jahre her – anderthalb Generationen!
Die Generation unserer Mütter und Großmütter kämpfte um das elementare Recht, im öffentlichen Raum gleichberechtigt zu sein. Dieser Kampf erforderte viel Langmut, die abschätzigen Bemerkungen der Männer zu ignorieren. So erscheint es nachvollziehbar, dass sich viele Frauen aus dieser Generation der heutigen Mütterblog-Latte-macchiato-Kultur nicht anschließen mögen. Meine Mutter sagte mal zu mir: »Ich habe da ja nie mitgemacht, aber manchmal denke ich: Wir haben euch einen Weg bereitet, den ihr heute selbstverständlich belustwandelt, mit irgendwelchen selbstbemalten Glückssteinchen von Etsy. Das ist zwar wahnsinnig dekorativ, aber verkennt manchmal, wie schwer es für uns war, über diesen Weg überhaupt erst einmal eine Planierraupe zu jagen.«
Die dritte Welle setzt in den neunziger Jahren an und ist nicht »Revolution, sondern Evolution, nicht Erneuerung, sondern Weiterentwicklung«, wie es in der Autowerbesprache heißen würde,9 wenn man ein Modell als brandneu verkaufen muss und dafür keinen besseren Marketingclaim hat. Der Feminismus verkapitalisiert. Viel hat hierzu die Popkultur beigetragen: Androgyn wurde hip und der metrosexuelle Mann ebenso. Zunehmend erlebten es auch die Männer als diskriminierend, wenn sie von den Themen Kindererziehung, Haushalt und Familie ausgeschlossen werden. Es gibt kaum noch einen Kita-Elternabend, wo nicht auch Väter, gern in Doppelsetzung, hingehen. Während mein Vater früher abschätzig zu einem männlichen Elternsprecher sagte: »Wenn der dazu Zeit hat …«, so ist es heute eher ein Distinktionsmerkmal, eine Männlichkeitsveredelung, wenn man im Schultheater die männliche Hauptrolle spielt und wochenlang den Text übt.
Heute, in der Trump-Zeit, tragen Frauen absurd pink gestrickte Wollmützen, um damit die vierte Welle des Feminismus einzuläuten. Feministinnen wie Laurie Penny setzen Antikapitalismus und Feminismus gleich und versuchen, ein neues Gesellschaftsbild zu etablieren. Es ist ein vulgäres, brutales und aggressives Frauenbild – nichts erinnert an die niedlichen Mütterblogs oder die vielen selbstgestrickten Megaschals auf Etsy.
Penny schreibt in ihrer Streitschrift Unsagbare Dinge über die moderne Frau: »Abgefuckte weiße Mädchen. Die Buchauslagen und Zeitschriftenständer in den Städten quellen über von Geschichten über abgefuckte weiße Mädchen, schöne kaputte Püppchen, die mit der Freiheit und den Chancen, die sie geerbt haben, nicht zurechtkommen, die armen Dinger. Wir fetischisieren diese Mädchen, fotografieren sie, retuschieren ihren geblähten Bauch und ihre spitzen Knochen. […] Das Scheitern ist zu einem Modeaccessoire geworden, einem Luxus. Dem Leben nicht gewachsen zu sein, ist cool. Das Koksen, das Saufen, die Essstörung, die hauchdünne transzendente Schönheit einer jungen Frau […]: Das ist mittlerweile fester Bestandteil des neoliberalen Weiblichkeitsmythos.«10 Damit wird Penny zu einer der wichtigsten Ikonen des jungen Feminismus. Ihr literarischer und kultureller Wert besteht in ihrem unbarmherzigen Umgang mit Worten, der es erst ermöglicht, in einen Diskurs einzusteigen. Anders als die Feministinnen der siebziger Jahre liest sich Penny klar und deutlich wie ein Brigitte-Dossier und ist gleichzeitig so bissig und scharfzüngig wie die Titanic. Ohne Penny wäre die Feministinnenzunft ärmer und flacher und humorfreier.
Ihr gegenüber stehen Feministinnen wie die Philosophin Svenja Flaßpöhler, die mit einer neuen Weiblichkeit vor allem auch mehr Eigenverantwortung der Frau fordert. In einem Interview mit dem Spiegel11 prangert sie die »Vergeltungslogik« der Frauen in der #MeToo-Debatte an: »#MeToo ist zunächst nur ein Schlagwort, und es ist bei Lichte betrachtet völlig unklar, was damit genau gemeint ist. Es wird der diffuse Eindruck erweckt, dass Frauen von einer strukturellen, männlichen Macht unterdrückt werden. Aber was heißt das eigentlich? Vor dem Gesetz sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Im täglichen Miteinander gibt es gewiss weiterhin eine Ungleichheit, aber für das Miteinander sind zunächst mal die Individuen selbst zuständig.«
Schuld an diesem »Ist-mein-Mann-doch-selbst-schuld-wenn-ich-friere-warum-kauft-er-mir-keine-Handschuhe«-Feminismus sei der dekonstruktive Feminismus, wie ihn Judith Butler in ihrem Buch Das Unbehagen der Geschlechter beschreibt. Die Einteilung in »männlich« und »weiblich« sei demnach nur ein Instrument männlicher Herrschaft, die eine biologische Tatsache instrumentalisiere.
Schön und gut, dass man aus der Doppelgeschlechtigkeit den Mann extrahiere, findet Svenja Flaßpöhler – aber wo bleibt da die Frau? Wer hat zugelassen, dass sie herausgetrennt wird? Wer unternimmt nichts dagegen, dass es dafür keine Kompensation gäbe? Flaßpöhler hält sich strikt an Luthers Leitsatz: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Sie will nicht, dass Männer einsehen, sich für Frauen zu ändern. Sie will, dass Frauen einsehen, dass es lohnt, den Kampf mit Männern aufzunehmen. Ob nun jede bereit ist und auch das Potenzial zu kämpfen mitbringt, muss man vorsichtig hinterfragen – auch ohne die Frauen mit dieser Nachfrage unselbstständig zu machen.
Politik wird heute mehr zu einem Selbstinszenierungsmerkmal und verliert zugleich den Charakter des Allgemeinwesens. Wenn ich mich politisch äußere, dann lasse ich mich auch zu großen Teilen über mich selbst aus. Politik war noch nie so sehr wie heute auch ein narzisstischer Akt.
Mit dieser »ästhetisierten Politik« verdienen Feminismusikonen auch ihr Geld: Penny zum Beispiel ist ein Konsumprodukt, deren Marktwert maßgeblich davon abhängt, wie viel Follower sie hat, wie viele Twitter-Nachrichten pro Tag sie rausschießt und zu wie vielen Podiumsdiskussionen sie eingeladen wird, weil sie eine provokative These im Gepäck hat. Dass sie sich nur um schwarze, benachteiligte, alleinerziehende Frauen kümmert, ist geradezu rührend verlogen. Sie kümmert sich auch um sich, und das sehr geschäftstüchtig. Nun ist Kommerz zunächst nichts, wofür man eine erfolgreiche Zeitkritikerin tadeln sollte. Schwierig beziehungsweise kariös wird ihre Argumentation nur, wenn sie behauptet, dass Feminismus immer auch Antikapitalismus bedeuten müsse. Dann darf sie den Kampf, den sie gegen den Kapitalismus führt, nicht ausgerechnet mit den Mitteln des Kapitalismus führen. Und soziale Medien, die Hauptverbreitung ihrer Thesen, sind ein Amalgam aus Narzissmus, Kapitalismus und (medialer) Gewalt. Auch eine Bloggerin hat Macht.
Synthese aus Job, Familie und Identität
Wenn wir uns also um uns kümmern wollen, dann müssen wir zuerst einordnen: Wie viel Feminismus bin ich? Denn mit dem Feminismus ist es heute in etwa so wie mit den Lebensmittelunverträglichkeiten: Jede sucht sich das Ernährungsprinzip aus, das ihrer Identität am ehesten entspricht, und mit genau diesem Prinzip inszeniert sie sich. Vegan? Zu doktrinär. Glutenunverträglich? Zu freudlos, ich esse ja gern Kuchen. Vegetarisch? Geht, aber ab und zu den von meinem Mann geangelten Fisch, der muss schon sein. Also Flexitarier. Was bei der Ernährung leicht einzuordnen ist, ist beim Feminismus schwammig. Deswegen personalisiere ich nachher die politischen Gewichtungen, einfach um ein bisschen zu spielen. Aber vielleicht muss ich vorher noch kurz erzählen, was eigentlich mein Beruf ist und wie ich zu dem komme, wofür ich heute, ja, brenne:
2010 hatte ich mein drittes Kind geboren und lebte als freiberufliche Journalistin mit meinem Mann in Hamburg. Das Schreiben wurde zunehmend schwieriger: weil ich nicht mehr spontan reisen konnte, weil mir die für den Journalismus nötige Flexibilität fehlte, wenn ich mich nicht auf Spargelrezepte und Horoskopschreiben spezialisieren wollte. Genau in diesem Moment kam meine Kollegin Miriam mit ihrer Familie aus Shanghai zurück, sie hatte drei Jahre als Expat-Gattin auf dem Buckel. Ich weiß noch, wie wir betrübt im Kinderzimmer meiner Söhne saßen, sie mit Augenringen, ich mit Babykotze auf den Schultern, und dass wir irgendwie nur diesen Tag rumbringen mussten, bis endlich alle fünf Kinder im Bett lagen und der nächste langweilige Tag beginnen konnte. Und genauso, wie man den Kindern immer predigt: »Langweile dich ruhig, dann entstehen daraus gute Ideen«, fingen wir auf einmal an zu sortieren: Was können wir Journalisten eigentlich gut?
Wir Journalisten können gut schreiben. Wir können den Kern einer Geschichte erfassen und, wenn der schon auserzählt ist, dann drehen wir diese Geschichte noch eine Schraubendrehung weiter. Wir haben einen Sinn für die Notwendigkeit von Unterhaltung. Wir können uns selbst organisieren, weil wir das als Freiberufler jeden Tag müssen. Wir haben eher eine Ahnung als andere, wenn uns sozial erwünschte Phrasen erzählt werden – Menschenkenntnis will ich das noch nicht nennen, obwohl es in die Richtung geht. Und vor allem haben wir die Chuzpe, schamlos weiterzufragen. Und noch weiter, wenn wir es nicht verstanden haben. Oder nicht glauben wollen. Oder einfach neugierig sind.
2011 haben Miriam und ich unsere Job-Profiling-Agentur i.do gegründet. Zielgruppe: Augenringe und Babykotze auf der Suche nach einem neuen Job. Eine aufregende Arbeit! Von tausend Frauen kam nicht eine, bei der ich nach einer Stunde dachte: »Och, so was Ähnliches hatten wir schon mal, da nehmen wir dann einfach dies und das.« Von tausend Frauen hatten wir nicht eine, die mich gelangweilt hatte.12 Und vor allem: Von tausend Frauen hatten wir nicht eine, die es allgemeingültig richtig