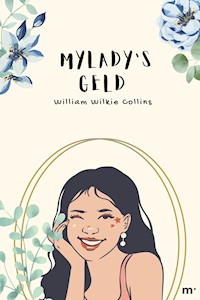
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. William Wilkie Collins war ein britischer Schriftsteller und Verfasser der ersten Mystery Thriller. Das ebook 'Myladys Geld' gehört zu seinen bekanntesten Werken. #wenigeristmehrbuch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Myladys Geld
William Wilkie Collins
Vorwort.
Die Geschichte wurde ursprünglich in der Weihnachtsausgabe der Illustrated London News von 1877 veröffentlicht. Die zwingende Notwendigkeit, verbunden mit der Frage des Platzes, ließ den freundlichen und rücksichtsvollen Behörden des Amtes keine andere Wahl, als »My Lady’s Money« in einer Schrift zu drucken, die für Leser, die bereits ein reifes Alter erreicht hatten, ein ernsthaftes Hindernis darstellte (trotz der Brillen). Ich habe nun die Ehre, die Aufmerksamkeit dieser Damen und Herren auf die ausgeprägte Rücksicht auf ihre Bequemlichkeit zu lenken, die die Drucker der Geschichte in ihrer jetzigen Form an den Tag legen. Noch ein Wort zur rein literarischen Seite der Frage: Ich wage zu hoffen, dass die Charakterstudien in diesem kleinen Werk treu der Natur entnommen sind - und dass alle Hundefreunde in dem mit Feder und Tinte gezeichneten Porträt von »Tommie« etwas entdecken werden, das auch auf ihre Hunde zutrifft.
W. C.
London: Oktober 1878.
Personen
Frauen
Lady Lydiard
Witwe von Lord Lydiard
Isabel Miller
ihre Adoptivtochter
Miss Pink
aus South Morden
Die ehrenwerte Mrs. Drumblade
die Schwester des ehrenwerten A. Hardyman
Männer
Der Hon. Alfred Hardyman
vom Gestüt
Herr Felix Sweetsir
Neffe von Lady Lydiard
Robert Moody
Lady Lydiard’s Steward
Mr. Troy
Lady Lydiards Anwalt
Old Sharon
Erster Teil.Das Verschwinden.
Kapitel I.
Die alte Lady Lydiard saß nachdenklich am Kamin und hatte drei geöffnete Briefe auf ihrem Schoß liegen.
Die Zeit hatte das Papier verfärbt und die Tinte bräunlich gefärbt. Die Briefe waren alle an dieselbe Person adressiert: »An ihre Ehren. Lord Lydiard« und waren alle auf dieselbe Weise unterzeichnet: »Dein liebevoller Cousin James Tollmidge«. Nach diesen Beispielen seiner Korrespondenz zu urteilen, muß Herr Tollmidge ein großes Verdienst als Briefschreiber besessen haben — das Verdienst der Kürze. Er wird die Geduld von niemandem überstrapazieren, wenn es ihm erlaubt wird, sich Gehör zu verschaffen. Man möge ihm daher gestatten, auf seine eigene, hochtrabende Weise für sich selbst zu sprechen.
Erster Brief:
»Meine Erklärung soll, wie Ihre Lordschaft es verlangt, kurz und bündig sein. Ich verdiente sehr gut als Porträtmaler auf dem Lande, und ich hatte eine Frau und Kinder, an die ich denken musste. Unter diesen Umständen hätte ich, wenn es mir überlassen gewesen wäre, selbst zu entscheiden, sicherlich gewartet, bis ich ein wenig Geld gespart hatte, bevor ich mich an die erheblichen Kosten für ein Haus und ein Atelier im Londoner Westend wagte. Ihre Lordschaft, das kann ich mit Bestimmtheit sagen, hat mich ermutigt, das Experiment zu wagen, ohne zu warten. Und hier bin ich nun, unbekannt und arbeitslos, ein hilfloser Künstler, der sich in London verirrt hat — mit einer kranken Frau und hungrigen Kindern, und der Bankrott steht mir ins Gesicht geschrieben. Auf wessen Schultern ruht diese furchtbare Verantwortung? Auf denen Eurer Lordschaft!«
Zweiter Brief:
»Nach einer Woche Verspätung beehren Sie mich, Mylord, mit einer knappen Antwort. Ich kann auf meiner Seite ebenso knapp sein. Ich leugne entrüstet, dass ich oder meine Frau sich jemals angemaßt haben, den Namen Eurer Lordschaft ohne Eure Erlaubnis als Empfehlungsschreiben für Sitzungen zu verwenden. Irgendein Feind hat uns verleumdet. Ich beanspruche als mein Recht, den Namen dieses Feindes zu erfahren.«
Dritter (und letzter) Brief:
»Eine weitere Woche ist vergangen — und kein einziges Wort der Antwort hat mich von Eurer Lordschaft erreicht. Das macht wenig aus. Ich habe die Zeit genutzt, um Nachforschungen anzustellen, und ich habe endlich den feindlichen Einfluss entdeckt, der Euch von mir entfremdet hat. Ich hatte anscheinend das Pech, Lady Lydiard zu beleidigen (wie, kann ich mir nicht vorstellen); und der allmächtige Einfluss dieser edlen Dame wird nun gegen den kämpfenden Künstler eingesetzt, der mit Ihnen durch die heiligen Bande der Verwandtschaft verbunden ist. Sei es drum. Ich kann mir den Weg nach oben erkämpfen, mein Herr, wie es andere Männer vor mir getan haben. Es mag der Tag kommen, an dem die Schar der Kutschen, die vor der Tür des eleganten Porträtmalers warten, auch das Gefährt Ihrer Ladyschaft einschließen und mir den verspäteten Ausdruck des Bedauerns Ihrer Ladyschaft bringen wird. Ich verweise Sie, Mylord Lydiard, auf diesen Tag!«
Nachdem Lady Lydiard zum zweiten Mal Mr. Tollmidges gewaltige, sie selbst betreffende Behauptungen gelesen hatte, fanden ihre Überlegungen ein abruptes Ende. Sie erhob sich, nahm die Briefe in beide Hände, um sie zu zerreißen, zögerte und warf sie zurück in die Schrankschublade, in der sie sie entdeckt hatte, zwischen andere Papiere, die seit Lord Lydiards Tod nicht mehr geordnet worden waren.
»Dieser Idiot«, sagte ihre Ladyschaft und dachte an Mr. Tollmidge, »ich habe zu Lebzeiten meines Mannes nie etwas von ihm gehört; ich wusste nicht einmal, dass er wirklich mit Lord Lydiard verwandt war, bis ich seine Briefe fand. Was soll ich jetzt tun?«
Während sie sich diese Frage stellte, blickte sie auf eine aufgeschlagene Zeitung, die auf den Tisch geworfen worden war und den Tod »des vollendeten Künstlers Mr. Tollmidge, der, wie man sagt, mit dem verstorbenen bekannten Kenner Lord Lydiard verwandt war« ankündigte. Im nächsten Satz beklagte der Verfasser der Todesanzeige die mittellose Lage von Mrs. Tollmidge und ihren Kindern, die »hilflos auf die Gnade der Welt angewiesen sind«. Lady Lydiard stand am Tisch und blickte auf diese Zeilen und sah nur zu deutlich die Richtung, in die sie zeigten — die Richtung ihres Scheckbuchs.
Sie wandte sich dem Kamin zu und läutete die Glocke. »Ich kann in dieser Angelegenheit nichts tun«, dachte sie bei sich, »bis ich weiß, ob auf den Bericht über Mrs. Tollmidge und ihre Familie Verlass ist. Ist Moody schon zurück?« fragte sie, als der Diener an der Tür erschien. »Moody« (sonst der Verwalter ihrer Ladyschaft) war nicht zurückgekommen. Lady Lydiard verwarf das Thema der Witwe des Künstlers, bis der Verwalter zurückkam, und widmete sich einer Frage von häuslichem Interesse, die ihr näher am Herzen lag. Ihr Lieblingshund war schon seit einiger Zeit kränklich, und an diesem Morgen hatte sie keine Nachricht von ihm erhalten. Sie öffnete eine Tür in der Nähe des Kamins, die durch einen kleinen Korridor mit seltenen Drucken zu ihrem eigenen Boudoir führte. »Isabel!«, rief sie, »wie geht es Tommie?«
Eine frische junge Stimme antwortete hinter dem Vorhang, der das andere Ende des Korridors verschloss: »Nicht besser, Mylady.«
Ein leises Knurren folgte der frischen jungen Stimme und fügte (in der Sprache eines Hundes) hinzu: »Viel schlechter, Mylady — viel schlechter!«
Lady Lydiard schloss die Tür mit einem mitfühlenden Seufzer für Tommie wieder und ging langsam in ihrem geräumigen Salon hin und her, um auf die Rückkehr des Stewards zu warten.
Lord Lydiards Witwe war klein und dick und, was das Alter anbelangt, gefährlich nahe an ihrem sechzigsten Geburtstag. Aber man kann sagen, ohne ein Kompliment zu machen, dass sie mindestens zehn Jahre jünger aussah als ihr Alter. Ihr Teint war von jener zartrosa Färbung, die man manchmal bei alten Frauen mit gut erhaltener Konstitution findet. Ihre Augen (die ebenso gut erhalten waren) hatten die harte hellblaue Farbe, die sich gut trägt und nicht auswäscht, wenn sie durch Tränen geprüft wird. Hinzu kamen ihre kurze Nase, ihre prallen Wangen, die den Falten trotzten, und ihr weißes Haar, das in steife kleine Locken gekleidet war. Wenn eine Puppe alt werden könnte, wäre Lady Lydiard mit sechzig Jahren das lebende Abbild dieser Puppe gewesen, die das Leben mit Leichtigkeit in das schönste aller Gräber hinabsteigen ließ, auf einen Friedhof, auf dem das ganze Jahr über Myrten und Rosen wuchsen.
Bei all diesen persönlichen Vorzügen ihrer Ladyschaft muss eine unparteiische Geschichtsschreibung auf der Liste ihrer Mängel einen völligen Mangel an Takt und Geschmack in ihrer Kleidung anerkennen. Die seit Lord Lydiards Tod verstrichene Zeit hatte ihr die Freiheit gelassen, sich zu kleiden, wie es ihr gefiel. Sie kleidete ihre kleine, plumpe Figur in Farben, die für eine Frau ihres Alters viel zu grell waren. Ihre Kleider, die von der Farbwahl her schlecht gewählt waren, waren vielleicht nicht schlecht gemacht, aber sicherlich schlecht getragen. Sowohl moralisch als auch körperlich muss man von Lady Lydiard sagen, dass ihr Äußeres ihre schlechteste Seite war. Zu den Anomalien ihrer Kleidung gesellten sich die Anomalien ihres Charakters. Es gab Momente, in denen sie so fühlte und sprach, wie es sich für eine Dame von Rang gehörte, und es gab andere Momente, in denen sie so fühlte und sprach, wie es sich für eine Köchin in der Küche gehört hätte. Unter diesen oberflächlichen Ungereimtheiten wartete das große Herz, das im Grunde wahre und großzügige Wesen der Frau nur auf eine ausreichende Gelegenheit, sich zu zeigen. Im trivialen Verkehr der Gesellschaft war sie von allen Seiten dem Spott ausgesetzt. Aber wenn eine ernste Notlage das Metall, aus dem sie wirklich gemacht war, auf die Probe stellte, standen die Leute, die am lautesten über sie lachten, fassungslos da und fragten sich, was aus der vertrauten Begleiterin ihres täglichen Lebens geworden war.
Der Spaziergang ihrer Ladyschaft hatte nur eine kleine Weile gedauert, als ein schwarz gekleideter Mann geräuschlos an der großen Tür erschien, die sich zum Treppenhaus hin öffnete. Lady Lydiard bedeutete ihm ungeduldig, den Raum zu betreten.
»Ich habe Sie schon seit einiger Zeit erwartet, Moody«, sagte sie. »Sie sehen müde aus. Nehmen Sie einen Stuhl.«
Der Mann in Schwarz verbeugte sich respektvoll und nahm Platz.
Kapitel II.
Robert Moody war zu diesem Zeitpunkt fast vierzig Jahre alt. Er war eine schüchterne, ruhige, dunkle Person mit einem blassen, glatt rasierten Gesicht, das von großen, tiefliegenden schwarzen Augen angenehm belebt wurde. Sein Mund war vielleicht sein bestes Merkmal; er hatte feste, wohlgeformte Lippen, die sich bei seltenen Gelegenheiten zu einem besonders gewinnenden Lächeln verzogen. Das ganze Erscheinungsbild des Mannes, trotz seiner gewohnten Zurückhaltung, ließ ihn als äußerst vertrauenswürdig erscheinen. Seine Stellung im Haushalt von Lady Lydiard war keineswegs von der niederen Sorte. Er war ihr Haushofmeister, Sekretär und Verwalter — er verteilte ihre Almosen, schrieb ihre Geschäftsbriefe, bezahlte ihre Rechnungen, stellte ihre Dienerschaft ein, füllte ihren Weinkeller, war befugt, Bücher aus ihrer Bibliothek auszuleihen, und bekam seine Mahlzeiten in seinem eigenen Zimmer serviert. Aufgrund seiner Abstammung hatte er Anspruch auf diese besonderen Gunstbezeugungen; er war von Geburt an in den Rang eines Gentleman erhoben worden. Sein Vater war in einer Zeit der Wirtschaftspanik als Bankier auf dem Lande gescheitert, hatte eine gute Dividende gezahlt und war im Ausland im Exil als Mann mit gebrochenem Herzen gestorben. Robert hatte versucht, seinen Platz in der Welt zu behaupten, aber das schlechte Schicksal hielt ihn zurück. Unverdientes Unheil verfolgte ihn von einer Anstellung zur anderen, bis er den Kampf aufgab, dem Stolz vergangener Tage ein letztes Mal Lebewohl sagte und die ihm rücksichtsvoll und feinfühlig angebotene Stelle in Lady Lydiards Haus annahm. Er hatte keine nahen Verwandten mehr, und er hatte nie viele Freunde gefunden. In den Zeiten, in denen er beschäftigt war, führte er ein einsames Leben in seinem kleinen Zimmer. Die Frauen im Bedienstetensaal wunderten sich insgeheim, dass er in Anbetracht seiner persönlichen Vorzüge und der Möglichkeiten, die sich ihm sicherlich boten, nie das Glück eines verheirateten Mannes versucht hatte. Robert Moody gab keine Erklärungen zu diesem Thema ab. Auf seine eigene traurige und ruhige Art und Weise fuhr er fort, sein eigenes trauriges und ruhiges Leben zu führen. Die Frauen, die alle, von der hübschen Haushälterin abwärts, nicht den geringsten Eindruck auf ihn machten, trösteten sich mit prophetischen Visionen über seine künftigen Beziehungen zum Geschlecht und sagten rachsüchtig voraus, dass »seine Zeit kommen würde.«
»Nun«, sagte Lady Lydiard, »und was haben Sie getan?«
»Ihre Ladyschaft schien sich Sorgen um den Hund zu machen«, antwortete Moody in dem ihm eigenen leisen Ton. »Ich bin zuerst zum Tierarzt gegangen. Er war aufs Land gerufen worden, und . . .«
Lady Lydiard winkte das Ende des Satzes mit ihrer Hand ab. »Vergessen Sie den Chirurgen. Wir müssen jemand anderen finden. Wohin sind Sie dann gegangen?«
»Zum Anwalt Ihrer Ladyschaft. Mr. Troy wollte, dass ich ihm sage, dass er die Ehre haben wird, auf Sie zu warten . . .«
»Vergiss den Anwalt, Moody. Ich möchte etwas über die Witwe des Malers erfahren. Stimmt es, dass Mrs. Tollmidge und ihre Familie in hilfloser Armut leben?«
»Das stimmt nicht ganz, Mylady. Ich habe den Pfarrer der Gemeinde gesehen, der sich für den Fall interessiert . . .«
Lady Lydiard unterbrach ihren Verwalter zum dritten Mal. »Haben Sie meinen Namen erwähnt?«, fragte sie schroff.
»Gewiss nicht, Mylady. Ich habe meine Anweisungen befolgt und Sie als eine wohlwollende Person beschrieben, die nach Fällen echter Not sucht. Es stimmt, dass Mr. Tollmidge gestorben ist und seiner Familie nichts hinterlassen hat. Aber die Witwe hat selbst ein kleines Einkommen von siebzig Pfund.«
»Reicht das zum Leben, Moody?«, fragte ihre Ladyschaft.
»In diesem Fall reicht es für die Witwe und ihre Tochter«, antwortete Moody. »Die Schwierigkeit besteht darin, die wenigen verbliebenen Schulden zu bezahlen und die beiden Söhne ins Leben zu führen. Es wird berichtet, dass es sich um solide Jungs handelt, und die Familie ist in der Nachbarschaft sehr geachtet. Der Geistliche schlägt vor, für den Anfang ein paar einflussreiche Namen zu finden und eine Subskription zu starten.«
»Keine Subskription!«, protestierte Lady Lydiard. »Mr. Tollmidge war Lord Lydiards Cousin, und Mrs. Tollmidge ist mit seiner Lordschaft durch Heirat verwandt. Es wäre eine Schande für das Andenken meines Mannes, wenn die Bettelkiste für seine Verwandten herumgeschickt würde, ganz gleich, wie weit entfernt sie auch sein mögen. Cousins!«, rief ihre Ladyschaft aus, indem sie plötzlich von den hohen Höhen der Gefühle in die Niederungen hinabstieg. »Ich hasse schon ihren Namen! Ein Mensch, der mir nahe genug ist, um mein Verwandter zu sein, und weit genug von mir entfernt, um mein Geliebter zu sein, ist eine doppelzüngige Sorte Mensch, die ich nicht leiden kann. Kommen wir zurück zu der Witwe und ihren Söhnen. Wie viel wollen sie?«
»Eine Subskription von fünfhundert Pfund, Mylady, würde für alles sorgen — wenn sie nur gesammelt werden könnte.«
»Es soll gesammelt werden, Moody! Ich werde die Subskription aus meinem eigenen Geldbeutel bezahlen.« Nachdem sie sich mit diesen edlen Worten durchgesetzt hatte, verdarb sie die Wirkung ihres eigenen Ausbruchs von Großzügigkeit, indem sie in ihrem nächsten Satz zu der schmutzigen Sichtweise des Themas überging. »Fünfhundert Pfund sind allerdings ein gutes Stück Geld, nicht wahr, Moody?«
»Das ist es in der Tat, Mylady.« So reich und großzügig er seine Herrin auch kannte, ihr Vorschlag, die gesamte Summe zu zahlen, überraschte den Steward. Lady Lydiards schnelle Auffassungsgabe erkannte sofort, was in seinem Kopf vorging.
»Sie verstehen meine Position in dieser Angelegenheit nicht ganz«, sagte sie. »Als ich in der Zeitung die Nachricht von Mr. Tollmidges Tod las, suchte ich in den Papieren seiner Lordschaft, um zu sehen, ob sie wirklich verwandt waren. Ich entdeckte einige Briefe von Mr. Tollmidge, die mir zeigten, dass er und Lord Lydiard Cousins waren. Einer dieser Briefe enthält einige sehr schmerzliche Behauptungen, die mein Verhalten in höchstem Maße unrichtig und ungerecht erscheinen lassen; Lügen, kurz gesagt«, platzte ihre Ladyschaft heraus und verlor wie üblich ihre Würde. »Lügen, Moody, für die Mr. Tollmidge verdientermaßen ausgepeitscht werden sollte. Ich hätte es selbst getan, wenn seine Lordschaft es mir damals gesagt hätte. Aber das macht nichts, es ist sinnlos, jetzt darüber nachzudenken«, fuhr sie fort, indem sie sich wieder zu der Ausdrucksweise erhob, die einer Dame von Rang gebührt. »Dieser unglückliche Mann hat mir ein großes Unrecht angetan; meine Motive könnten ernsthaft missverstanden werden, wenn ich persönlich mit seiner Familie in Kontakt trete. Wenn ich ihnen anonym in ihrer gegenwärtigen Not helfe, erspare ich ihnen die Bloßstellung durch eine öffentliche Subskription, und ich tue das, was seine Lordschaft meiner Meinung nach selbst getan hätte, wenn er noch gelebt hätte. Mein Schreibset liegt auf dem anderen Tisch. Bringen Sie es her, Moody, und lassen Sie mich das Böse mit dem Guten vergelten, solange ich noch in der Stimmung dazu bin!«
Moody gehorchte schweigend. Lady Lydiard stellte einen Scheck aus.
»Gehen Sie damit zur Bank und bringen Sie einen Fünfhundert-Pfund-Schein zurück«, sagte sie. »Ich lege ihn dem Pfarrer bei, als von ›einem unbekannten Freund‹ kommend. Und beeilen Sie sich damit. Ich bin nur ein fehlbarer Sterblicher, Moody. Lassen Sie mir nicht genug Zeit, um mit fünfhundert Pfund geizig zu sein.«
Moody ging mit dem Scheck hinaus. Die Beschaffung des Geldes ließ nicht lange auf sich warten; das Bankhaus befand sich ganz in der Nähe, in der St. James’s Street. Allein gelassen, beschloss Lady Lydiard, ihren Geist mit einem anonymen Brief an den Geistlichen in großzügiger Weise zu beschäftigen. Sie hatte gerade ein Blatt Notizpapier von ihrem Schreibtisch genommen, als ein Diener an der Tür erschien und einen Besucher ankündigte.
»Mr. Felix Sweetsir!«
Kapitel III.
»Mein Neffe!« rief Lady Lydiard in einem Tonfall aus, der Erstaunen, aber sicher nicht auch Freude ausdrückte. »Wie viele Jahre ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben?«, fragte sie in ihrer schroffen, direkten Art, als Mr. Felix Sweetsir an ihren Schreibtisch trat.
Der Besucher war kein Mensch, der sich leicht entmutigen ließ. Er nahm die Hand von Lady Lydiard und küsste sie mit leichter Anmut. In seinem Verhalten lag ein Hauch von Ironie, der durch einen spielerischen Anflug von Zärtlichkeit angenehm gemildert wurde.
»Jahre, meine liebe Tante?«, sagte er. »Sieh in dein Glas und du wirst sehen, dass die Zeit seit unserer letzten Begegnung stehen geblieben ist. Wie wundervoll du dich trägst! Wann werden wir das Erscheinen deiner ersten Falte feiern? Ich bin zu alt; ich werde es nicht mehr erleben.«
Er nahm uneingeladen einen Sessel, setzte sich dicht neben seine Tante und ließ seinen Blick mit satirischer Bewunderung über ihr schlecht gewähltes Kleid gleiten. »Wie perfekt gelungen!«, sagte er mit seiner wohlerzogenen Frechheit. »Was für eine keusche Farbenpracht!«
»Was wollen Du?«, fragte ihre Ladyschaft, nicht im Geringsten durch das Kompliment erweicht.
»Ich möchte meiner lieben Tante meine Aufwartung machen«, antwortete Felix, der sich von dem ungnädigen Empfang nicht beeindrucken ließ und es sich in einem geräumigen Sessel bequem machte.
Es ist sicher nicht nötig, ein Porträt von Felix Sweetsir mit der Feder zu zeichnen — er ist in der Gesellschaft zu bekannt. Der kleine, geschmeidige Mann mit den leuchtenden, unruhigen Augen und dem langen, eisengrauen Haar, das ihm in Locken bis auf die Schultern fällt, mit seinem leichten Schritt und seiner herzlichen Art, mit seinem ungewissen Alter, seinen zahllosen Errungenschaften und seiner grenzenlosen Beliebtheit — ist er nicht überall bekannt und überall willkommen? Wie dankbar nimmt er die herzliche Wertschätzung einer bewundernden Welt entgegen, wie reichlich zahlt er sie zurück! Jeder Mann, den er kennt, ist »ein charmanter Kerl«. Jede Frau, die er sieht, ist »süß und hübsch«. Was für Picknicks gibt er im Sommer an den Ufern der Themse! Was für ein wohlverdientes kleines Einkommen er am Whist-Table erzielt! Was für ein unschätzbarer Schauspieler ist er bei privaten Theatervorstellungen aller Art (einschließlich Hochzeiten)! Haben Sie nie den Roman von Sweetsir gelesen, den er in den Pausen des heilenden Schweißes in einem deutschen Bad verfasst hat? Dann wissen Sie nicht, was brillante Belletristik wirklich ist. Er hat nie ein zweites Werk geschrieben; er macht alles und macht es nur einmal. Ein Lied — die Verzweiflung der professionellen Komponisten. Ein Bild — nur um zu zeigen, wie leicht ein Gentleman eine Kunst aufnehmen und wieder fallen lassen kann. Ein wirklich vielgestaltiger Mann, mit allen Annehmlichkeiten und allen Fertigkeiten, die ständig an den Enden seiner Finger funkeln. Wenn diese armen Seiten nichts anderes erreicht haben, so haben sie den Menschen, die nicht in der Gesellschaft sind, einen Dienst erwiesen, indem sie sie Sweetsir vorstellten. In seiner liebenswürdigen Gesellschaft erhellt sich die Erzählung, und der Autor und der Leser verstehen sich dank Sweetsir endlich, da sie den Widerschein des Glanzes wahrnehmen.
»Nun«, sagte Lady Lydiard, »jetzt, wo Du hier bist, was hast Du zu Deiner Verteidigung zu sagen? Du warst natürlich im Ausland! Wo?«
»Hauptsächlich in Paris, meine liebe Tante. Der einzige Ort, der sich zum Leben eignet — aus dem ausgezeichneten Grund, dass die Franzosen die einzigen Menschen sind, die wissen, wie man das Beste aus dem Leben macht. Man hat Verwandte und Freunde in England und ab und zu kehrt man nach London zurück . . .«
»Wenn man sein ganzes Geld in Paris ausgegeben hat«, warf ihre Ladyschaft ein. »Das wolltest du doch sagen, nicht wahr?«
Felix nahm die Unterbrechung mit seinem herrlichen guten Humor hin.
»Was bist du doch für ein fröhliches Geschöpf!« rief er aus. »Was gäbe ich nicht für Deine gute Laune! Ja — in Paris gibt man Geld aus, wie Du sagst. Die Klubs, die Börse, die Pferderennbahn: man versucht sein Glück hier, dort und überall; und man verliert und gewinnt, gewinnt und verliert — und man hat keinen einzigen langweiligen Tag zu beklagen.« Er hielt inne, sein Lächeln erlosch, er sah Lady Lydiard fragend an. »Was für eine wunderbare Existenz muss Deine sein«, fuhr er fort. »Die ewige Frage bei Ihren bedürftigen Mitmenschen, ›Woher soll ich Geld bekommen?‹, ist Dir nie über die Lippen gekommen. Eine beneidenswerte Frau!« Wieder hielt er inne — diesmal überrascht und verwirrt. »Was ist denn los, meine liebe Tante? Du scheinst unter einem gewissen Unbehagen zu leiden.«
»Ich leide unter deiner Unterhaltung«, antwortete ihre Ladyschaft scharf. »Geld ist im Moment ein wunder Punkt für mich«, fuhr sie fort, den Blick auf ihren Neffen gerichtet, um die Wirkung ihrer Worte zu beobachten. »Ich habe heute Morgen mit einem Federstrich fünfhundert Pfund ausgegeben. Und erst vor einer Woche habe ich der Versuchung nachgegeben und meine Bildergalerie vergrößert. Während sie diese Worte sagte, blickte sie auf einen Torbogen am anderen Ende des Raumes, der durch Vorhänge aus violettem Samt verschlossen war. »Ich zittere wirklich, wenn ich daran denke, was mich dieses eine Bild gekostet hat, bevor ich es mein Eigen nennen konnte. Eine Landschaft von Hobbema; und die Nationalgalerie hat gegen mich geboten. Macht nichts!«, schloss sie und tröstete sich, wie immer, mit Überlegungen, die unter ihrer Würde waren. »Hobbema wird bei meinem Tod für einen höheren Preis verkaufen, als ich für ihn geboten habe — das ist ein Trost!« Sie blickte wieder zu Felix; ein Lächeln von schelmischer Genugtuung begann sich in ihrem Gesicht zu zeigen. »Stimmt etwas mit deiner Uhrkette nicht?«, fragte sie.
Felix, der abwesend mit seiner Uhrkette spielte, schreckte auf, als ob seine Tante ihn plötzlich geweckt hätte. Während Lady Lydiard gesprochen hatte, war seine Lebhaftigkeit allmählich abgeklungen und hatte ihn so ernst und so alt aussehen lassen, dass sein engster Freund ihn kaum wiedererkannt hätte. Aufgeschreckt durch die plötzliche Frage, die ihm gestellt worden war, schien er in seinen Gedanken auf der Suche nach der erstbesten Entschuldigung für sein Schweigen zu sein.
»Ich habe mich gefragt«, begann er, »warum ich etwas vermisse, wenn ich mich in diesem schönen Zimmer umsehe; etwas Vertrautes, wissen Sie, das ich hier zu finden glaubte.«
»Tommie?», schlug Lady Lydiard vor, die ihren Neffen immer noch so bösartig wie immer beobachtete.
»Das ist es!«, rief Felix, ergriff seine Ausrede und sammelte seine Lebensgeister. »Warum höre ich Tommie nicht hinter mir knurren, warum spüre ich nicht Tommies Zähne in meiner Hose?«
Das Lächeln verschwand aus Lady Lydiards Gesicht; der Ton, in dem ihr Neffe über ihren Hund sprach, war äußerst respektlos. Sie zeigte ihm deutlich, dass sie es missbilligte. Felix fuhr dennoch fort, undurchdringlich für Vorwürfe der leisen Art. »Lieber kleiner Tommie! So herrlich dick; und so ein höllisches Temperament! Ich weiß nicht, ob ich ihn hassen oder lieben soll. Wo ist er?«
»Krank im Bett«, antwortete ihre Ladyschaft mit einer Ernsthaftigkeit, die sogar Felix selbst erschreckte. »Ich möchte mit dir über Tommie sprechen. Du kennst doch alle. Kennst Du einen guten Hundearzt? Die Person, die ich bisher angestellt habe, befriedigt mich überhaupt nicht.«
»Ein Fachmann?«, erkundigte sich Felix.
»Ja.«
»Alles Humbug, meine liebe Tante. Je schlimmer es dem Hund geht, desto größer wird die Rechnung, verstehst du nicht? Ich habe den richtigen Mann für dich — einen Gentleman. Er weiß mehr über Pferde und Hunde als alle Tierärzte zusammen. Wir haben uns gestern auf dem Schiff getroffen, als wir den Kanal überquerten. Du kennst ihn natürlich mit Namen? Lord Rotherfields jüngster Sohn, Alfred Hardyman.«
»Der Besitzer des Gestüts? Der Mann, der die berühmten Rennpferde gezüchtet hat?«, rief Lady Lydiard. »Mein lieber Felix, wie kann ich mir anmaßen, eine so große Persönlichkeit wegen meines Hundes zu behelligen?«
Felix brach in sein geniales Lachen aus. »Bescheidenheit war noch nie so fehl am Platz«, erwiderte er. »Hardyman brennt darauf, Eurer Ladyschaft vorgestellt zu werden. Er hat, wie alle anderen, von den prächtigen Dekorationen dieses Hauses gehört und sehnt sich danach, sie zu sehen. Seine Gemächer sind ganz in der Nähe, in der Pall Mall. Wenn er zu Hause ist, werden wir ihn in fünf Minuten hier haben. Vielleicht sollte ich lieber erst den Hund sehen?«
Lady Lydiard schüttelte den Kopf. »Isabel sagt, es sei besser, ihn nicht zu stören«, antwortete sie. »Isabel versteht ihn besser als jeder andere.«
Felix hob seine lebhaften Augenbrauen mit einer Mischung aus Neugierde und Überraschung. »Wer ist Isabel?«
Lady Lydiard ärgerte sich über sich selbst, weil sie Isabels Namen in Gegenwart ihres Neffen so unbedacht erwähnt hatte. Felix war nicht die Art von Person, die sie in häuslichen Angelegenheiten in ihr Vertrauen ziehen wollte. »Isabel ist ein Neuzugang in meinem Haushalt, seit du das letzte Mal hier warst«, antwortete sie kurz.
»Jung und hübsch?«, erkundigte sich Felix. »Ah! Du siehst ernst aus und antwortest nicht. Jung und hübsch, offensichtlich. Was darf ich zuerst sehen, den Zuwachs in deinem Haushalt oder den Zuwachs in deiner Bildergalerie? Du schaust dir die Bildergalerie an — ich bin wieder dran.« Er erhob sich, um sich dem Torbogen zu nähern, und blieb bei seinem ersten Schritt stehen. »Ein süßes Mädchen ist eine furchtbare Verantwortung, Tante«, fuhr er mit einer ironischen Ernsthaftigkeit fort. »Weißt du, es würde mich nicht wundern, wenn Isabel dich auf lange Sicht mehr kosten würde als Hobbema. Wer ist da an der Tür?«
Die Person an der Tür war Robert Moody, der von der Bank zurückkam. Mr. Felix Sweetsir, der kurzsichtig ist, musste sein Augenglas in Position bringen, bevor er den Premierminister von Lady Lydiards Haushalt erkennen konnte.
»Ha! Unser ehrenwerter Moody. Wie gut er sich trägt! Kein einziges graues Haar auf seinem Kopf — und sieh dir meins an! Welches Färbemittel benutzt du, Moody? Wenn er mein offenes Gemüt hätte, würde er es sagen. So wie es ist, sieht er unsagbare Dinge und schweigt. Ah! Wenn ich nur meine Zunge hätte halten können — als ich im diplomatischen Dienst war, wissen Sie — was für eine Position ich jetzt hätte einnehmen können! Lass dich von mir nicht unterbrechen, Moody, wenn du Lady Lydiard etwas zu sagen hast.«
Nachdem Moody die lebhafte Begrüßung von Mr. Sweetsir mit einer förmlichen Verbeugung und einem ernsten Blick der Verwunderung quittiert hatte, der den Humor dieses temperamentvollen Herrn respektvoll zurückwies, wandte er sich seiner Herrin zu.
»Haben Sie den Geldschein?«, fragte ihre Ladyschaft.
Moody legte den Geldschein auf den Tisch.
»Bin ich im Weg?«, erkundigte sich Felix.
»Nein«, sagte seine Tante. »Ich habe einen Brief zu schreiben, der mich nicht länger als ein paar Minuten in Anspruch nehmen wird. Du kannst hier bleiben oder dir das Hobbema ansehen, wie du willst.«
Felix unternahm einen zweiten Versuch, die Gemäldegalerie zu erreichen. Wenige Schritte vor dem Eingang angekommen, blieb er erneut stehen, angezogen von einem offenen Kabinett italienischer Handwerkskunst, gefüllt mit seltenem alten Porzellan. Da Mr. Sweetsir ein kultivierter Amateur war, hielt er inne, um dem Inhalt des Schranks seine Bewunderung zu zollen. »Charmant! charmant!«, sagte er zu sich selbst, wobei er den Kopf anerkennend ein wenig zur Seite neigte. Lady Lydiard und Moody ließen ihn in ungestörtem Genuss des Porzellans zurück und fuhren mit dem Geschäft der Banknote fort.
»Sollen wir die Nummer des Scheins mitnehmen, für den Fall eines Unfalls?«, fragte ihre Ladyschaft.
Moody holte einen Zettel aus seiner Westentasche. »Ich habe die Nummer in der Bank notiert, Mylady.«
»Nun gut. Behalten Sie sie. Während ich meinen Brief schreibe, könnten Sie den Umschlag weiterleiten. Wie lautet der Name des Geistlichen?«
Moody nannte den Namen und richtete den Umschlag aus. Felix, der zufällig einen Blick auf Lady Lydiard und den Steward warf, während beide mit dem Schreiben beschäftigt waren, kehrte plötzlich an den Tisch zurück, als sei er von einer neuen Idee ergriffen worden.
»Gibt es einen dritten Stift?«, fragte er. »Warum sollte ich nicht sofort eine Zeile an Hardyman schreiben, Tante? Je eher du seine Meinung über Tommie erfährst, desto besser — meinst du nicht auch?«
Lady Lydiard deutete lächelnd auf das Tablett mit der Feder. Rücksicht auf ihren Hund zu nehmen, hieß, sich unwiderstehlich auf den Weg zu ihrer Gunst zu machen. Felix machte sich an die Arbeit, in einer großen, krakeligen Handschrift, mit viel Tinte und einer lauten Feder. »Wir sind wie Angestellte in einem Büro«, bemerkte er in seiner fröhlichen Art. »Alle haben die Nase am Papier und schreiben, als ob wir davon leben würden! Hier, Moody, lass einen der Diener dies sofort zu Mr. Hardyman bringen.«
Der Bote wurde losgeschickt. Robert kehrte zurück und wartete in der Nähe seiner Herrin, mit dem angewiesenen Umschlag in der Hand. Felix schlenderte zum dritten Mal langsam in Richtung der Gemäldegalerie zurück. In einem weiteren Augenblick beendete Lady Lydiard ihren Brief und faltete den Geldschein darin zusammen. Sie hatte Moody gerade den gerichteten Umschlag abgenommen und den Brief hineingelegt, als ein Schrei aus dem inneren Zimmer, in dem Isabel den kranken Hund pflegte, alle aufschreckte. »Mylady! Mylady!«, rief das Mädchen verwirrt, »Tommie hat einen Anfall? Tommie liegt im Sterben!«
Lady Lydiard ließ den unverschlossenen Umschlag auf den Tisch fallen und rannte — ja, klein wie sie war und dick wie sie war, rannte — in das innere Zimmer. Die beiden Männer, die zusammen zurückblieben, sahen sich an.
»Moody«, sagte Felix in seiner träge-zynischen Art, »glaubst du, wenn du oder ich einen Anfall hätten, dass ihre Ladyschaft rennen würde? Ach! Das sind die Dinge, die den Glauben an die menschliche Natur erschüttern. Ich fühle mich höllisch schäbig. Diese verfluchte Kanalpassage — ich zittere im Innersten, wenn ich daran denke. Besorgen Sie mir etwas, Moody.«
»Was soll ich Ihnen schicken, Sir?« fragte Moody kühl.
»Etwas trockenen Curaçoa und einen Keks. Und lassen Sie es mir in die Pinakothek bringen. Verflucht sei der Hund! Ich gehe und schaue mir Hobbema an.«
Diesmal gelang es ihm, den Torbogen zu erreichen, und er verschwand hinter den Vorhängen der Gemäldegalerie.
Kapitel IV.
Allein im Salon zurückgelassen, betrachtete Moody den unverschlossenen Umschlag auf dem Tisch.
Könnte er sich in Anbetracht des Wertes der Sendung berechtigt fühlen, den Kleber zu befeuchten und den Umschlag sicherheitshalber zu verschließen? Nach reiflicher Überlegung entschied Moody, dass es nicht gerechtfertigt war, sich an dem Brief zu schaffen zu machen. Wenn er darüber nachdachte, konnte es sein, dass ihre Ladyschaft noch Änderungen vorzunehmen oder dem Geschriebenen ein Postskriptum hinzuzufügen hatte. Abgesehen von diesen Überlegungen, war es vernünftig, sich so zu verhalten, als sei das Haus von Lady Lydiard ein Hotel, das ständig für das Eindringen von Fremden offen war? Gegenstände im Gesamtwert von zweimal fünfhundert Pfund lagen auf den Tischen und in den unverschlossenen Schränken um ihn herum verstreut. Moody zog sich ohne weiteres Zögern zurück, um das leichte Stärkungsmittel zu bestellen, das Mr. Sweetsir ihm verordnet hatte.





























