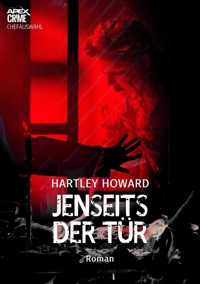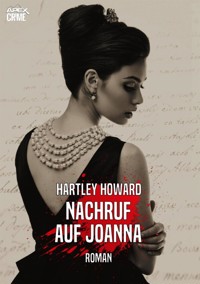
5,99 €
Mehr erfahren.
Der anonyme Brief lautete: Was geschah eigentlich wirklich in jener Juni-Nacht vor dreiundzwanzig Jahren, als Joanna starb? Und was geschieht, wenn ich es der Polizei verrate?
Es war der erste von vielen Briefen. Eine Erpresser-Kampagne mit Haken und Ösen.
Als sich der New Yorker Privatdetektiv Glenn Bowman einschaltete, geschah ein Mord...
Der Roman Nachruf auf Joanna des britischen Bestseller-Autors Hartley Howard (* 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) erschien erstmals im Jahr 1972; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HARTLEY HOWARD
Nachruf auf Joanna
Roman
Apex Crime, Band 66
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
NACHRUF AUF JOANNA
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Das Buch
Der anonyme Brief lautete: Was geschah eigentlich wirklich in jener Juni-Nacht vor dreiundzwanzig Jahren, als Joanna starb? Und was geschieht, wenn ich es der Polizei verrate?
Es war der erste von vielen Briefen. Eine Erpresser-Kampagne mit Haken und Ösen.
Als sich der New Yorker Privatdetektiv Glenn Bowman einschaltete, geschah ein Mord...
Der Roman Nachruf auf Joanna des britischen Bestseller-Autors Hartley Howard (* 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) erschien erstmals im Jahr 1972; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
NACHRUF AUF JOANNA
Erstes Kapitel
Ein schöner Frühlingstag war vorbei, und die Luft fühlte sich noch lange nach Sonnenuntergang warm an - warm, staubig und mit Abgasen angereichert. Bei Büroschluss war mir mehr nach Trinken als nach Essen zumute.
Ich schloss also meine drei mal vier Quadratmeter große Bude ab und ging zu Dobbie’s Parlour am westlichen Broadway. Das war zwar kein sehr vornehmer Laden, aber dafür gab es immer schön gekühltes Bier.
Die meisten Hocker an der Bar waren leer. Wie üblich saß ein recht gemischter Haufen hier herum: ein Straßenmädchen mit harten Augen, ein schon älterer Herumtreiber mit Schaum an seinem Schnurrbart, ein kupfernasiger Schnapsbruder, der mit sich selbst redete, dazu zwei Blaujacken, die den Eindruck machten, als hätten sie schon voll geladen.
Und natürlich der Mann mit dem traurigen Gesicht, der hinter der Bar Gläser polierte.
Und Garry Calhoun.
Da er mit dem Rücken zum Eingang saß, erkannte ich ihn nicht sofort und wäre weitergegangen, wenn er mich nicht beim Ärmel gepackt hätte.
»Ist das nicht komisch, dass ich Sie hier treffe?«, fragte er.
»Wieso komisch?«
»Ich hab’ erst gestern an Sie gedacht.«
»Na und, jetzt haben wir heute.«
Er legte sein Affengesicht in Falten. Dann zeigte er mir lachend zwei Reihen Zähne.
Er fragte: »Irre ich mich, oder wollen Sie mich abwimmeln?«
»Sie irren sich nicht.«
»Warum tun Sie eigentlich immer so, als hätte ich die Pest?«
»Für mich sind Sie eine Pest, und jetzt lassen Sie meinen Ärmel los.«
Er nahm seine Hand weg. »Wissen Sie was?«, fragte er. »Ich mag Sie auch nicht besonders. Und wenn ich Sie näher kennen würde, wären Sie mir wahrscheinlich widerlich.«
»Fein«, sagte ich, »wenn wir uns wieder begegnen, tun Sie einfach so, als kennen Sie mich nicht. Das ist besser für uns beide.«
Ich ging weiter und suchte mir einen Platz am oberen Ende der Bartheke mit leeren Hockern auf beiden Seiten. Der traurige Barmixer brachte mir ein eisgekühltes Bier. Dann polierte er wieder Gläser.
Nach ungefähr einer halben Minute setzte sich Calhoun zu mir. Er kletterte einfach auf den nächsten Hocker und sah mich liebenswürdig an, aber ich tat, als sei er nicht vorhanden.
Aber dadurch ließ er sich nicht abweisen. »Hören Sie«, sagte er, »das ist doch alles Unsinn. Alle wissen, dass ich ein verträglicher Mensch bin.«
»Nur gut, dass diese Leute alle nicht wissen, was Sie sonst noch sind.«
»Wir haben alle unsere Fehler.« Mit einem Achselzucken tat er eine zehnjährige Gaunerkarriere ab. »Sollte ich Sie beleidigt haben, tut’s mir leid.«
»Sie haben mich nicht beleidigt. Sparen Sie sich die Entschuldigungen. Hauen Sie einfach ab und fallen Sie in irgendein Kanalloch.«
»Das ist nicht nett von Ihnen. Kann ich Sie einladen?«
»Ich hab’ schon etwas.«
»Zu einem anständigen Drink, nicht zu einer Dose Bier.«
»Um diese Tageszeit schmeckt mir Bier am besten.«
Calhoun machte eine Bewegung, als seien ihm ein paar Härchen in den Kragen gerutscht. »Schon wieder«, brummte er. »Aber bleiben wir wenigstens zivilisiert, wenn wir schon nicht Freunde sein können. Wir sind doch sozusagen Kollegen.«
»Nicht ganz. Sie tun doch einfach alles, um sich auf krumme Touren ein paar Dollar zu verdienen.«
»Man muss sich ja schließlich durchschlagen.«
»Meinungssache. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben.«
Wieder zuckte er die Achseln. »Sie lassen sich also nicht einladen?«
»Habe ich Ihnen nicht schon gesagt, dass ich bereits bedient bin?«
»Ja, ich weiß. Aber können Sie nicht das Vergangene ruhen lassen? Sagen Sie doch, was Sie wollen. Ich bestelle es Ihnen.«
Die Absicht war unverkennbar. »Ich hab’ so das Gefühl, dass Sie heute bereit sind, für meine Gesellschaft jeden Preis zu zahlen.«
»Kann stimmen«, brummte er.
»Zu Geld gekommen?«
»Es geht.«
»Also laufen die Geschäfte.«
»In letzter Zeit nicht so gut.«
»Aber Ihr neu erworbener Wohlstand scheint Ihnen keinen Spaß zu machen?«
»Beklage ich mich denn?«
»Sie sollten einmal Ihr Gesicht sehen.«
Er verzog sein Affengesicht zu einem unechten Lächeln. Dann sagte er, um ehrlich zu sein: »Ich hab’ Angst.«
Wenn Garry Calhoun ganz von allein ehrlich war, log er immer. Das gehörte dazu.
»Warum ausgerechnet ich?«, fragte ich.
»Weil ich’s mir mal von der Seele reden muss.«
»Und warum sprechen Sie nicht mit einem Geistlichen, wenn Ihr Gewissen Sie plagt - falls Sie eins haben?«
»So ist das doch nicht.« Er zuckte wieder ungemütlich mit den Schultern. »Ich habe nur einfach Angst.«
Damit machte er keinen Eindruck auf mich. Ich kannte sein Vorstrafenregister nur zu gut. Aber die Angst schien echt zu sein. Ich fragte: »Weshalb haben Sie kalte Füße bekommen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie trinken zu viel.«
»Nein, ich bin stocknüchtern.« Er zeigte mir sein halbleeres Schnapsglas. »Mein erstes heute.«
»Und Sie wissen trotzdem nicht, warum Sie Angst haben?«
»Warum, weiß ich schon.«
Wenn ich jetzt vernünftig gewesen wäre, hätte ich ihn bei seinem Schnaps und Krokodilstränen sitzen lassen. Aber ich brachte es einfach nicht übers Herz.
Ob Calhoun es nun wusste oder nicht - ich wäre jede Wette eingegangen, dass er mich jetzt nicht anschwindelte.
»Okay«, sagte ich, »meinetwegen. Sparen Sie sich den Drink und erzählen Sie mir Ihre traurige Geschichte.«
»Danke«, murmelte er.
Er trank einen kleinen Schluck, überlegte und fuhr genauso leise fort: »Ich werde verfolgt.«
»Von wem?«
»Weiß ich nicht. Sonst könnte ich etwas dagegen unternehmen.«
»Sie irren sich bestimmt nicht?«
»Bei so was nicht.« Er nahm wieder einen Schluck.
»Es könnte Einbildung sein.«
»Also Verfolgungswahn?«, fragte er gereizt. »Wollen Sie mir einreden, dass ich Gespenster sehe, bis ich in der Klapsmühle lande?«
»Das wäre nicht übel. Es könnte Ihnen manche Gaunerei ersparen.«
In seinem Affengesicht zuckte es. »Wirklich, das ist kein Witz. Ich hab’ schon die ganze Zeit das Gefühl, dass einer hinter mir her ist. Ich spüre seine Augen hinter meinem Rücken.«
»Und Sie haben ihn nie gesehen?«
»Nie. Wenn ich mich umdrehe, ist er weg.«
»Schlimm«, brummte ich.
»Ist das alles?«
»Was haben Sie denn erwartet, ich bin auch kein Psychiater.«
Er trank sein Glas leer, stellte es wieder hin und sah mich an. Und dann griff er in die Hosentasche, die ausgebeult war wie von einem Bruchband. Als er seine Hand hervorzog, hielt sie ein dickes Bündel Banknoten. Der Barmixer mit den traurigen Augen sah es ebenfalls. Seine Miene erhellte sich, und er hörte mit dem Gläserpolieren auf.
»Was möchten die Herren?«, fragte er.
»Einen Schnaps für mich und einen doppelten Whisky für meinen Freund«, bestellte Calhoun.
»Für mich nicht«, sagte ich.
»Aber Sie mögen doch Whisky, Sie trinken ihn ja dauernd!«
»Nicht mehr.«
»Seit wann?«
»Ich hab’ doch schon gesagt, dass ich mir mein Bier selbst kaufe.«
»Ein Wink mit dem Zaunpfahl«, sagte er. »Okay ich hab’s kapiert.«
Er zupfte einen Fünfdollarschein aus dem Bündel und packte die anderen Scheine wieder weg. Während er das Geld dem Barmixer zuschob, sagte er: »Ich hoffe, Ihnen ist es egal, mit wem Sie trinken. Kaufen Sie sich etwas.«
»Ich muss an meine Magengeschwüre denken«, sagte der Mann, ohne einen Blick von Calhouns Hosentaschen zu nehmen. »Trotzdem vielen Dank. Das Trinkgeld nehme ich gern.«
Das kam Calhoun sehr komisch vor. Er zeigte wieder seine Zähne. »Ich muss also doch wohl die Pest haben.«
Er wurde wieder ernst, als er ein volles Glas vor sich stehen hatte. Er warf rasch einen Blick über die Schulter, als der Schnapsbruder mit der Kupfernase ging und die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ.
Die beiden Matrosen begannen gutmütig zu streiten und lachten laut. Ich merkte, dass mich das Mädchen in dem Spiegel hinter der Bar beobachtete, und überlegte, ob sie wohl Calhouns Barschaft gesehen hatte. In solchen Lokalen zeigt man nicht gern viel Geld.
Während ich noch darüber nachdachte, sagte Calhoun: »Niemand hat Anlass, mir einen Schatten anzuhängen. Ich führe ein ruhiges Leben und bin gegenüber meinen Klienten fair. Wen sollte schon interessieren, was ich mache?«
»Vielleicht sind Sie jemandem lästig geworden?«
»Müsste ich das nicht wissen?«
»Nicht unbedingt. Sie haben mehr Feinde, als ein Straßenköter Flöhe hat. Es muss wohl an Ihrer Vergangenheit liegen.«
Er hielt sich an seinem Glas fest und betrachtete mein Spiegelbild. Dann brummte er. »Ich glaub’s nicht. Diesmal ist es anders.«
»Inwiefern?«
»Wenn mich jemand durch die Mangel ziehen wollte, hätte er genug Gelegenheit gehabt. Aber ich hab’ nur einfach das Gefühl, dass ich beobachtet werde.«
»Jetzt auch?«
Er legte die Stirn in Falten. »Sie tun immer noch so, als hätte ich Ameisen im Kopf.«
»Ganz und gar nicht«, sagte ich. »Sie sind vielleicht ein Gauner, aber verrückt sind Sie nicht. Ich verstehe nur nicht, warum Sie mir das alles erzählen.«
Seine Äuglein blitzten mich an, als erhoffe er sich eine Banane von mir. »Ich dachte, Sie könnten mir einen kleinen Rat geben.«
»Sie würden ihn doch nicht befolgen.«
»Hören Sie doch endlich mit dem Quatsch auf. Sehen Sie denn nicht, dass ich in der Patsche sitze?«
»Das musste früher oder später passieren.«
»So geht’s nicht. Ich brauche Hilfe.«
»Kostenlos?«
»Nein. Ich bezahle jeden Preis.«
»Seien Sie nicht so freigebig mit Ihrem Geld. Ein solcher Rat kann teuer werden.«
Die Falten in seinem Gesicht wurden tiefer. Er fragte: »Sie werden doch nicht jemanden ausnützen, der so in der Klemme sitzt?«
»Normalerweise nicht«, entgegnete ich. »In Ihrem Fall mache ich eine Ausnahme.«
Er war schon im Begriff, mir ein unfeines Wort an den Kopf zu werfen, ließ es aber bleiben und fragte widerwillig: »Okay, wie teuer?«
»Ich überlasse es Ihnen, wieviel Ihr Fell wert ist.«
»Ich hab’ Ihnen doch schon erzählt, dass es sich um etwas anderes dreht. Mich stört ganz einfach, dass mich dauernd einer beobachtet.«
»Na schön: Wieviel ist Ihnen Ihr Seelenfriede wert?«
Er führte mit beiden Händen das Schnapsglas an die Lippen und trank einen kleinen Schluck. Während er nachdachte, sah er mich durchdringend an. Dann ging die Tür auf, und ein alter Mann kam auf zwei Stöcken hereingehumpelt. Er hatte ein Gipsbein.
Calhoun hörte es erst, als die Tür wieder ins Schloss fiel. Er fuhr erschrocken herum und schüttete sich den Schnaps über die Jacke.
»Reißen Sie sich zusammen«, sagte ich. »Es ist nur ein armer Kerl mit vier Beinen.«
Der alte Mann humpelte zur Bar hinüber und zog sich unbeholfen auf einen Hocker hinauf. Calhoun beobachtete den Eingang, bis er die Fassung wiedererlangt hatte.
Nach einer Weile sagte er: »Wenn ich nicht Acht gebe, fürchte ich mich noch vor meinem eigenen Schatten. Was soll ich machen?«
»Verreisen«, riet ich ihm.
»Und die besten Chancen seit Jahren sausen lassen. Wie oft finden Sie einen Kunden, der bar bezahlt und nicht über die Spesen meckert.«
»Wofür?«
»Reine Routine. Kinderkram.« Das klang mir zu beiläufig.
»Solche Arbeit macht sich selten bezahlt«, sagte ich vorsichtig.
»Stimmt. Aber hin und wieder trifft man auf eine Goldmine. Schade, dass alles vorbei sein soll.« .
»Ich wette, Sie haben es Ihren Klienten noch nicht erzählt. Sie werden die Kuh melken, bis sie trocken steht.«
»Nein, an diesem Fall habe ich genug verdient«, erklärte Calhoun großmütig. »Ich mag niemandem unter falschen Voraussetzungen Geld aus der Nase ziehen.«
»Was Sie nicht sagen!«
»Wie Sie wollen. Was Sie denken, ist mir egal. Ich brauche Ihren Rat.«
»Sie wissen doch schon, was Sie machen müssen, um den Schatten loszuwerden.«
»Würde ich Sie dann fragen?«
»Diesen Rat kriegen Sie umsonst«, sagte ich. »Gehen Sie zur Polizei. Jeder ordentliche, arbeitsame Bürger hat Anspruch auf den Schutz des Gesetzes.«
Calhoun zeigte mir seine Zähne, während er sich mit der linken Hand an der rechten Kinnseite kratzte. »Etwas Gescheiteres fällt Ihnen nicht ein?«, fragte er. »Ich hätte zumindest erwartet...«
Den Rest des Satzes verschluckte er, weil uns der Barmixer störte. Er sah uns aus seinen melancholischen Augen an und fragte: »Heißt einer der Herren zufällig Calhoun? Er wird am Telefon verlangt.«
»Das bin ich«, sagte Calhoun und stellte sein Glas hin. »Aber ich hab’ doch niemandem gesagt, dass ich hier bin. Sie haben den Namen richtig verstanden?«
»Natürlich.«
»Verdammt komisch. Wer sollte denn wissen, dass ich hier bin?«
»Vielleicht hat jemand eine Wünschelrute.«
»Das Telefon steht da drüben«, sagte der Barmixer. »Neben der Toilette. Oder soll ich lieber sagen, ich hab’ keinen Calhoun gefunden?«
»Nein, ich nehm’s schon an.« Calhoun warf mir einen verzweifelten Blick zu.
Er glitt vom Barhocker und verschwand durch eine Tür am anderen Ende der Bar. Wenn ich einfach ausgetrunken hätte und irgendwohin essen gegangen wäre, sähe vieles anders aus. Aber so etwas merke ich immer erst, wenn es schon zu spät ist. Ich bestellte mir noch ein Bier und überlegte ein paar Minuten, wie ich den Abend totschlagen sollte. Pokerabend war heute nicht, und ich hatte keine Lust, eine der Nummern in meinem kleinen Adressbuch anzurufen. Eigentlich hatte ich zu überhaupt nichts Lust.
Der nächste Gedanke war: Das Bier bei Dobbie schmeckte zwar gut und kühl, aber die Gesellschaft hier gefiel mir nicht. Besonders Garry Calhoun. Ich hatte ihn seit längerer Zeit nicht mehr gesehen und auch nicht vermisst. Wie mochte er wohl zu Geld gekommen sein?
Eins stand fest: Es konnte nur anderer Leute Geld sein. So war es immer bei Calhoun. Er war eben ein Gauner, der immer noch mit knapper Mühe diesseits der Legalität operierte.
Der Barmixer fing meinen nachdenklichen Blick auf und kam näher. »Da muss jemand Mr. Calhoun seine ganze Lebensgeschichte erzählen«, sagte er.
»Oder umgekehrt.«
»Seltsam, wenn man’s recht überlegt.«
»Was ist seltsam?«
»Dass er hier angerufen wird. Er ist zum ersten Mal hier und hat doch gesagt, dass niemand davon weiß.«
»Biergespräche sind meistens belanglos. Man redet einfach so daher.
»Vielleicht hatten Sie vorhin recht«, sagte ich.
»Womit?«
»Mit der Wünschelrute.«
Der Barmixer sah mich an, als sei er mit offenen Augen eingeschlafen. Dann brummte er: »Das sollte doch nur ein Witz sein.«
»Sie sollten einmal eine Komödie schreiben.«
»Jetzt wollen Sie mich verspotten.« Er sah mich traurig an und fuhr fort: »Ist Ihnen aufgefallen, wie er zusammenzuckte, als die Tür aufging?«
»Er verträgt keine Zugluft«, sagte ich. »Ich übrigens auch nicht. Machen Sie lieber den Mund zu.«
Das war vielleicht ein bisschen grob. Der Mann meinte es ja nicht böse. Aber ich hatte einen elenden Tag hinter mir, und nun verdarben er und Calhoun mir mein Glas Bier. Sein Pech, dass er ungünstig stand und es für beide ausbaden musste.
Er sah mich weiter traurig an und sagte mit ruhiger Stimme: »Sie brauchen es nicht an mir auszulassen, wenn Sie sich über einen anderen ärgern.«
Inzwischen war mir schon klargeworden, dass ich meine eigene Gesellschaft selbst nicht den ganzen Abend ertragen konnte. Wenn ich allein essen ging, bekam ich sicher Verdauungsstörungen. Die nächsten fünf Stunden waren eine verdammt lange Zeit, wenn ich versuchte, vor mir davonzulaufen.
Also dachte ich doch wieder an ein paar Nummern in meinem kleinen Telefonbuch. Was ein Abendessen zu zweit kostete, hatte ich noch in der Tasche.
Vielleicht zog ich eine Niete, vielleicht auch nicht. Aber fragen kostete ja nicht viel.
Der Barmixer betrachtete mich wie ein melancholisches Schaf. Ich sagte: »Sie haben recht. Ich hab’ meine Klappe zu weit aufgemacht. Sollen wir es vergessen?«
»Von mir aus schon.« Er versuchte es mit einem Lächeln, aber es stand ihm nicht. Was Kunden sagen, geht zu einem Ohr rein und zum anderen immer wieder raus. »Sie können mich ja zu einem Bier einladen.«
Fast hätte ich ihn gefragt, was seine Magengeschwüre zu einem kalten Bier sagten, aber es waren ja schließlich seine Schmerzen. Also gab ich ihm eine hübsche neue Dollarnote und sagte ihm, er solle das Wechselgeld behalten.
»Passen Sie auf mein Bier auf, bis ich wieder da bin.«
»Wo gehen Sie hin - falls Mr. Calhoun fragt?«
»Ich werde ihn vor Ihnen sehen. Ich muss mal telefonieren.«
Von der Bar aus gelangte man auf einen Flur mit Steinfußboden und imitierten Kacheln an den Wänden. Zwei schwache Glühbirnen hingen an der Decke. Am Ende stand auf einer Tür: Toilette. In einer Nische daneben sah ich das Telefon.
Garry Calhoun ließ sich nicht blicken. Durch das Glasfenster der Telefonzelle sah ich nur, dass darin das Licht noch brannte. Offensichtlich war er schon gegangen.
Nach dem Telefongespräch musste er es sehr eilig gehabt haben. Nicht einmal seinen Schnaps hatte er ausgetrunken. Falls er nicht für kleine Jungen war...
Die Toilette war auch leer. Ich trat wieder auf den Flur heraus und sagte mir, dass es schließlich seine Sache sei, wenn er einmal eilig weg wolle.
Es sah fast danach aus, als hätte ihm ein guter Freund geraten, aus Gesundheitsgründen möglichst schnell aus Dobbie’s Parlour zu verschwinden. Was kümmerte es mich, auf welche Geschäfte Calhoun sich eingelassen hatte und warum. Sollte er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Das ging mich alles nichts an. Er war groß genug, um für sich selbst zu sorgen. Ich musste telefonieren. Wenn ich noch länger wartete, konnte es mir passieren, dass ich den Abend doch noch allein verbrachte.
Aber dann fielen mir ein paar Kleinigkeiten auf. Erstens hatte Calhoun nach dem Gespräch den Hörer nicht eingehängt. Ich sah ihn an seiner Schnur baumeln. Zweitens...
Ich riss die Tür auf und sah genug. Er war auf die Seite gekippt, die Knie gebeugt, das Rückgrat gebogen, das Kinn auf der Brust. Der Hut war ihm beim Hinfallen schief über ein Auge gerutscht. Das andere Auge stand weit offen und starr.
Als ich mich über ihn beugte, sah ich zwischen Hals und rechter Schulter einen Messergriff hervorragen.
Er musste sehr viel Blut verloren haben. Der Geruch drehte mir den Magen um. In der winzigen Telefonzelle roch es wie auf einem Schlachthof.
Ich stand lange Zeit da und kämpfte gegen die Übelkeit an. Garry Calhoun war gerade nicht mein bester Freund, aber das spielte jetzt keine Rolle. Dann riss ich mich zusammen, beugte mich über ihn und hielt das Ohr an den herabbaumelnden Hörer. Aber ich hörte nichts.
Also war die Verbindung noch nicht unterbrochen. Der Teilnehmer am anderen Ende hatte aufgelegt, aber nicht Calhoun. Dazu hatte er keine Zeit mehr gefunden.
Ein paar andere Dingen gingen mir durch den Kopf: Er hatte mit dem Rücken zur Tür gestanden, als jemand aufmachte und ihm das Messer in die Schulter stieß. Höchstwahrscheinlich hatte er seinen Mörder nicht einmal gesehen.
War das eine Täuschung, oder bewegte er sich wirklich? Bei einem Mann wie Garry Calhoun konnte man das nie genau wissen. Dass er den Toten spielte, bewies noch nichts.
Ich berührte ganz vorsichtig sein offenes Auge mit der Fingerspitze. Kein Reflex. Vorsichtshalber tastete ich noch nach dem Puls an der Halsschlagader. Aber diesmal versuchte Garry Calhoun niemanden zu täuschen.
Zweites Kapitel
Jemand fotografierte die Telefonzelle, den Flur und das leblose Bündel, das einmal ein Winkeldetektiv namens Calhoun gewesen war. Ein anderer suchte an dem Messergriff und dem Türrand nach Fingerabdrücken.
Ein dritter Beamter war weggeschickt worden, um bei der Telefongesellschaft zu versuchen, den Anrufer zu ermitteln. Unterdessen wurden die Kunden in Dobbie’s Parlour vernommen.
Die Mordkommission arbeitete ruhig und gewissenhaft. Für sie war das alles nichts Neues. Jedes Jahr passieren in New York dreihundertfünfundsechzig Morde, und die Erfahrung merkte man den Leuten an.
Ich sah ihnen zu, wie sie kamen und gingen und hin und wieder ein paar leise Worte wechselten.