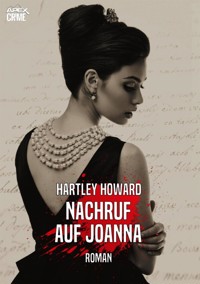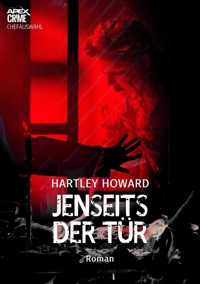5,99 €
Mehr erfahren.
Die alte Miss Hemingway hat mehr Geld, als gut für sie ist - und jemand will sie offenbar um diese Bürde erleichtern. Glenn Bowman, der Privatdetektiv aus New York, soll es verhindern. Und dennoch folgt ein Mordanschlag dem nächsten...
»Temporeich, spannend, mit Vergnügen zu lesen«, urteilte der London Observer über die Krimis von Hartley Howard.
Der Roman Schlaf für die Verdammten des britischen Schriftstellers Hartley Howard (eigentlich Leopold Horace Ognall - * 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) erschien erstmals im Jahr 1955; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1977.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
HARTLEY HOWARD
Schlaf für die Verdammten
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
SCHLAF FÜR DIE VERDAMMTEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Die alte Miss Hemingway hat mehr Geld, als gut für sie ist - und jemand will sie offenbar um diese Bürde erleichtern. Glenn Bowman, der Privatdetektiv aus New York, soll es verhindern. Und dennoch folgt ein Mordanschlag dem nächsten...
»Temporeich, spannend, mit Vergnügen zu lesen«, urteilte der London Observer über die Krimis von Hartley Howard.
Der Roman Schlaf für die Verdammten des britischen Schriftstellers Hartley Howard (eigentlich Leopold Horace Ognall - * 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) erschien erstmals im Jahr 1955; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1977.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
SCHLAF FÜR DIE VERDAMMTEN
Erstes Kapitel
Wuchtig und solide stand das alte graue Haus auf der Anhöhe über der Bucht. Es hatte leuchtend weiße Fensterrahmen, eine weißlackierte, doppelflüglige Haustür und eine geflieste, steinerne Veranda, die so sauber war wie ein frisch geschrubbter Esstisch. Ich blieb stehen und schaute mich um. Hinter einer niedrigen Mauer fiel das Gelände steil ab bis zur Straße am Ufer - eine Straße, die in die Felsen des Hügels gehauen werden musste, als man dieses Haus erbaute, aus Stein und Schweiß und der Vision, ein Heim zu gründen hoch über der Mündung des Delaware. Menschen hatten Stein für Stein herbeigeschleppt, in jener längst vergangenen Zeit, damit der Sohn von Richard Thomas Hemingway und seine Kinder und Kindeskinder ein angemessenes Dach über dem Kopf hatten. Und Menschen hatten miterlebt, wie das Haus hundertfünfzig Jahre lang den Stürmen des Atlantiks trotzte.
Aber an dem Tag, als ich dort oben stand und die flachen Wellen betrachtete, die unten gegen die Felsen klatschten, war der Himmel eine blassblaue Kuppel ohne ein einziges Wölkchen, war die Sonne heiß, und das Haus der Hemingways schlummerte in der Hitze wie ein alter Mann, der von der Vergangenheit träumt.
Rechts von der Tür gab es einen blankpolierten Klingelzug. Als ich ihn losließ, ertönte irgendwo in den Tiefen des Hauses eine Glocke.
Danach war es wieder sehr still - still und friedlich; man hörte nichts als das entfernte Plätschern der Wellen und das Brummen eines Motors auf der Straße tief unten. New York, die Stadt, in der ich lebte, schien in eine andere Welt zu gehören. Ich fragte mich, warum Miss Lavinia Hemingway einen Privatdetektiv aus dieser hundertsechzig Kilometer entfernten Großstadt hierher zitiert haben mochte.
Ich wartete eine Weile, dann hörte ich weit entfernt das Klappern von Sohlen und Absätzen auf Parkett, hörte, wie eine Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Die Schritte kamen näher.
Als ich zurücktrat, öffnete sich die eine Hälfte der Haustür. Und ich blickte in eine weite, rechtwinklige Halle mit Türen auf beiden Seiten und einer breiten, weißen Treppe, die sich in elegantem Bogen nach oben schwang. Riesige, hohe Fenster ließen sanftes Licht durch gefärbte Scheiben eindringen.
Mit der Sonne im Rücken konnte ich die Frau recht gut betrachten, die zu mir emporblickte und mich fragend anschaute.
Sie war nicht so alt, wie ihr Gesichtsausdruck und ihre Haltung hätten vermuten lassen, aber ich nahm an, sie hatte die Vierzig schon hinter sich. Ihre Figur war durchschnittlich, und ihr Mund sah so aus, als hätte sie vergessen, wie man damit lächelt. Sie erinnerte mich an Bette Davis, wenn sie sich reserviert-freundlich gab.
Ich sagte: »Guten Tag. Mein Name ist Bowman. Miss Hemingway hat mir geschrieben und mich gebeten, sie zu besuchen.«
Anstelle einer Antwort kroch der Blick aus zwei schwarzen Pupillen Zentimeter um Zentimeter an mir empor, bis er mein Gesicht erreichte. Erst dann sagte die Frau mit einer hölzernen Stimme: »Woher soll ich wissen, ob das stimmt?«
»Weil ich es Ihnen sage«, erwiderte ich. »Aber wenn Sie glauben, dass ich hergekommen bin, um das Familiensilber zu klauen, können Sie sich ja bei ihr erkundigen.«
Sie befeuchtete ihre bleichen Lippen mit der Zungenspitze und richtete den Kopf gerade. Dann murmelte sie mit gedämpfter Stimme: »Ja, das könnte ich tun.«
»Fein«, erklärte ich. »Dann warte ich inzwischen hier. Aber lassen Sie mich nicht allzu lange warten. Sonst bekomme ich noch einen Hitzschlag.«
Sie versteckte die Hände hinter ihrem Rücken und zog eine Schnute. »Vielleicht... Vielleicht könnten Sie mir den Brief zeigen. Ich will Ihnen ja nicht zu nahetreten, aber ich selbst gebe alle Korrespondenz von Miss Hemingway zur Post und erinnere mich nicht, dass ein Schreiben an Sie darunter gewesen wäre... Sie wissen schon, heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein mit Fremden.«
»Sicher, ich verstehe«, erklärte ich. »Sie meinen also, ich lasse Sie einen Brief lesen, den Miss Hemingway ohne Ihr Wissen an mich geschrieben hat. Nun, mir persönlich ist es egal, aber ich könnte mir denken - ich will Ihnen ja nicht zu nahetreten es wäre Miss Hemingway gar nicht recht... Vielleicht lassen Sie sich lieber von ihr selbst sagen, was sie mir geschrieben hat.«
Sie schien nicht sehr glücklich zu sein über meine Bemerkung. Nachdem sie eine Weile so tat, als denke sie über meinen Vorschlag nach, erklärte sie mit ausdrucksloser Stimme: »Ich habe den Eindruck, Sie versuchen, so unhöflich wie möglich zu sein.«
»Und wenn Sie noch eine Weile so weitermachen, wird es nicht beim Versuch bleiben«, erwiderte ich. »Glauben Sie, dass wir auf diese Weise jemals auf einen grünen Zweig kommen?«
Wir schauten einander ohne Zurückhaltung feindselig an. Und ich begann mir ein paar Gedanken über das Haus Hemingway zu machen, die meine Neugier anstachelten, die Besitzerin kennenzulernen. Ich ahnte, dass keine noch so hochnäsige Angestellte mit dem Bedürfnis, in den Angelegenheiten anderer herumzuschnüffeln, mich daran hindern würde.
Mittlerweile begab sich die Frau an der Tür auf den Rückzug. Mit kleinlauter Stimme sagte sie: »Ihr Name war doch Bowman, nicht wahr?«
»Das habe ich Ihnen gleich zu Anfang gesagt«, erklärte ich. »Glenn Bowman, um genau zu sein. Und nun sagen Sie mir, wie Sie heißen.«
Sie zog die Mundwinkel ein wenig nach oben, und auf ihrem Gesicht zeigte sich ein Schimmer von Wärme. Fast scheu erklärte sie: »Ich bin Rachel... Wenn Sie bitte hereinkommen und warten wollen, ich werde Sie bei Miss Hemingway melden... Sie hätte mir aber auch sagen können, dass sie Besuch erwartet...« Ehe ihre Worte in der Halle verklangen, war sie einen Schritt von der Tür zurückgetreten. Ich hatte das Gefühl, dass sie plötzlich versuchte, nett zu sein, aber nicht wusste, wie man das macht. Und ich hatte obendrein das Gefühl, dass sie zu den einsamen Menschen gehörte, die sich eine harte Schale zugelegt haben, damit niemand erkennt, wie weich sie im Inneren sind. Dennoch... Ich habe mich in Bezug auf Frauen nicht selten geirrt.
Als Rachel, ohne sich noch einmal umzusehen, nach oben gegangen war, stand ich auf einer Insel aus dicken, indischen Teppichen und blickte nach draußen auf die von Licht und Schatten gemusterte Veranda. Dann, es muss wohl ein paar Minuten gedauert haben, hörte ich Rachel hinter mir. Sie stand am Fuß der Treppe, die Hände gefaltet, das Gesicht so verschlossen wie in dem Augenblick, als sie die Haustür geöffnet hatte. Was auch zwischen ihr und der Dame des Hauses vorgegangen sein mochte - sie verbarg es vor mir. Sie sagte: »Miss Hemingway erwartet Sie. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.« Ohne zu warten, ohne sich zu vergewissern, ob ich ihr tatsächlich folgte, drehte sie sich um und ging mit leisen Schritten nach oben.
Wir kamen auf einen Treppenabsatz, der so breit war wie eine Straße an der East Side. Und nach links und rechts erstreckte sich ein Korridor mit vielen weißlackierten Türen. Der Teppich war so dick, dass man darin die Schuhe verlieren konnte. Von beiden Seiten warfen Buntglasfenster unwirkliches Licht auf den Boden.
Aber wir blieben nicht stehen. Die Treppe wand sich weiter nach oben, und Rachel und ich folgten ihr. Rachel sprach kein Wort, und ich hielt mich an ihr Beispiel.
Der Korridor im zweiten Stock war schmaler. Und das Licht drang durch normale Fenster. Doch die Teppiche waren so dick wie unten.
Sie wandte sich nach rechts. Wir kamen an zwei Türen vorbei, hinter denen sich nichts rührte. Ehe wir die dritte erreichten, wandte sich Rachel um und schaute mich an. Sie atmete schwer und musste ein paarmal schlucken, als hätte sie der Weg hier herauf, den sie nun schon zum zweiten Mal machte, überanstrengt. Es dauerte eine Weile, dann sagte sie in kaltem, etwas gequältem Ton: »Miss Hemingway ist eine alte Dame, Mr. Bowman, und sie ist seit längerer Zeit gebrechlich. Alle, die sie kennen, behandeln sie sehr rücksichtsvoll.« Sie atmete tief ein und presste die schmalen Lippen zusammen. »Wir schätzen sie sehr, Mr. Bowman. Ich weiß nicht, weshalb Sie hier sind, aber ich empfehle Ihnen, das zu beherzigen. Solange Sie das tun, sind Sie hier willkommen.«
»Ich werde es beherzigen«, sagte ich. Warum Rachel es für notwendig hielt, mir zu drohen, sollte ich erst später erfahren. Aber eine Drohung war es auf jeden Fall, das sah man schon an dem kalten Funkeln ihrer Augen. Ich fragte mich, wie man in diesem Hause wohl mit jemandem verfahren mochte, der nicht willkommen war.
Sie nickte kurz, trat dann zur Seite und deutete auf die dritte Tür. »Sie können allein hineingehen.« Dann schritt sie über den Korridor zurück und verschwand gleich danach. Ich hörte eine Stufe knirschen, als Rachel nach unten ging.
Ich klopfte zweimal mit dem Knöchel des Mittelfingers, und es kam mir so laut vor, als hätte ich die Tür mit einem Vorschlaghammer bearbeitet. Dann rieb ich meine Handflächen an den Hosentaschen, weil sie feucht geworden waren vom Schweiß. Ich fragte mich, ob der Knoten meiner Krawatte richtig saß. Ich fragte mich, ob ich für einen Privatdetektiv anständig genug aussah. Und ich fragte mich, ob Miss Lavinia über den bösen Blick verfügte, wie wir das als Kinder von meiner Urgroßtante behaupteten.
Aber ich brauchte mich nicht allzu lange zu fragen. Sehr schwach, sehr dünn, sehr weit weg, sagte eine leise Stimme: »Kommen Sie doch rein.« Es klang wie eine kleine Glocke mit einem Sprung, der schon vor langer Zeit gekittet wurde.
Ich rieb mir noch einmal die Hände trocken, drehte den Türknopf und trat ein.
Zweites Kapitel
Es zeigte sich, dass Rachel mit der Beschreibung ihrer Herrin nicht übertrieben hatte. Miss Lavinia Hemingway war alt und gebrechlich. Sehr alt. Ja, ich glaube, sie war das älteste, verschrumpeltste Wesen, das mir je entgegengelächelt hat.
Sie saß im Rollstuhl in einem verglasten Erker, und der helle Sonnenschein, der ihre Gestalt umstrahlte, erinnerte an die Scheinwerfer auf einer Bühne. Sie hatte milchweißes Haar, eine faltige Elfenbeinhaut und einen kleinen Mund mit farblosen Lippen. Ihr Kopf war gesenkt, als sei er zu schwer für die mageren Schultern, die sie ein wenig hochzog, als sei ihr kalt. Aber sie fror ganz bestimmt nicht, denn sie hatte sich in einen weichen, dicken Schal gehüllt, der an ihrem Hals von einer großen, goldenen Brosche mit einem eiergroßen Amethyst festgehalten wurde. Und von der Taille nach unten war sie überdies so fest in eine Decke gewickelt wie ein Baby in Windeln.
Als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte und ein paar Schritte auf sie zugegangen war, erhob sie eine zitternde Hand aus ihrem Schoß und deutete auf den Hocker neben ihrem Rollstuhl. Und mit ihrer kleinen, aber klaren Stimme sagte sie: »Guten Tag, Mr. Bowman... Kommen Sie her und setzen Sie sich, damit wir beide gleich groß sind. Es war mir seit jeher unangenehm, wenn ein großer Mann vor mir stand und auf mich herunterschaute.« Wieder lächelte sie und verschränkte die Hände, kuschelte sich tiefer in das Nest aus weichen Kissen. »Hatten Sie eine angenehme Reise?«
»Ja, danke«, sagte ich. »Sehr angenehm.«
»Möchten Sie etwas essen oder trinken?«
»Ich habe im Zug gegessen und«, - ich rückte den Hocker vor sie, damit mir die Sonne nicht in die Augen schien, »...ich möchte jetzt lieber nichts trinken. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür.«
Sie nickte ein paarmal geistesabwesend, als befänden sich ihre Gedanken ganz woanders. Dann kletterten ihre Finger am Rand des Schals nach oben, bis sie die Brosche an ihrem Hals erreichten. Einen Augenblick lang streichelte sie den großen Stein, als wollte sie sich seiner versichern. Ihre Hand war noch an der Brosche, als sie sagte: »Sie sind genauso, wie ich Sie mir vorgestellt habe. Ich bin froh, dass ich Sie gebeten habe, bei mir vorbeizuschauen.«
»Das Äußere sagt wenig über den Charakter, Miss Hemingway«, entgegnete ich. »Und von New York hierher ist ein weiter Weg. Bevor Sie mir sagen, weshalb Sie mich hergebeten haben, sollte ich Ihnen...«
»...ein paar Papiere zeigen, damit ich sehe, dass Sie ehrlich, nüchtern, verlässlich und fleißig sind?« Sie schüttelte den Kopf und lachte leise. »Oh, nein, junger Mann. Das können wir uns sparen. Wenn eine Frau erst einmal mein biblisches Alter erreicht hat, macht sie keine Fehler mehr.«
»Das hat mir gegenüber bisher noch keine Frau behauptet, ganz gleich, wie alt sie war.«
»Vermutlich nicht. Aber die Frauen, die Sie meinen, waren sicher nicht so alt wie ich... Ich frage mich, warum ihr Junggesellen so gern zynische Bemerkungen macht.« Es war eine Feststellung.
»Woher wissen Sie denn, dass ich Junggeselle bin?«, fragte ich. Diese alte Lady bestand vielleicht nur mehr aus zwei blassblauen Augen und einer leisen, klaren Stimme, aber ihr entging anscheinend nur wenig.
Wieder lachte sie. »Ich war immer der Meinung, dass wir Frauen die besseren Detektive sind... Sie tragen braune Socken, die nicht zu Ihrem Anzug passen, und den untersten Knopf an Ihrem Sakko hat bestimmt keine Frau angenäht.« Ihr schlaues Gesicht Zeigte, dass sie sich über meine Miene amüsierte, während ihre Stimme hinzufügte: »Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich ein bisschen Sherlock Holmes spiele und Sie zum Doktor Watson degradiere. Sie schauen so verblüfft drein.«
»Ich habe es nicht anders verdient«, sagte ich. »Sie haben ganz recht, Miss Hemingway, ich bin nicht verheiratet.«
»Sehen Sie, und das war der Fehler der Frauen, denen Sie begegnet sind. Aber ich will mich nicht in Ihre Privatangelegenheiten mischen. Es ist sehr ungezogen von mir. Ich nütze mein Alter zu sehr aus... Haben Sie schon mal von einer Anwaltskanzlei Blundell & Hardisty gehört?«
»Eine bekannte und angesehene Firma in New York«, sagte ich. »Vor langer Zeit habe ich einmal von einem ihrer Klienten einen Auftrag erhalten.«
»Ja, das haben sie mir berichtet. Sehen Sie, Mr. Bowman, ich habe nämlich nie im Leben den Fehler gemacht, zu denken, ich könnte keine Fehler machen. Als ich Ihren Namen auf gut Glück aus dem Telefonbuch ausgesucht hatte, habe ich mich bei meinen Anwälten über Sie erkundigt. Und Sie werden sich freuen zu hören, dass man mir eine sehr gute Auskunft über Sie erteilt hat.«
»Ich freue mich wirklich«, erwiderte ich. »Aber ich frage mich, weshalb Rachel der Meinung war, sie müsse Sie vor mir schützen.«
Ihr Blick begegnete dem meinen. Sie schaute mich fragend an und schürzte dann die Lippen. »Hat sie sich - merkwürdig verhalten?«
»So könnte man es bezeichnen. Sie sagte mir, dass Sie gebrechlich seien und dass ich Sie gefälligst schonend behandeln solle, sonst könne ich mich auf etwas gefasst machen... Dies war jedenfalls die Konsequenz, die sie angedeutet hat.«
»Das kam wohl daher, dass Sie nicht sagen wollten, weshalb Sie hier sind, was?«
»Ich glaube, ja. Zuerst hat sie mir gar nicht glauben wollen, dass Sie mich hierhergebeten haben. Sie gibt angeblich Ihre Post auf, konnte sich aber an keinen Brief erinnern, der an mich adressiert war... Aha, jetzt wird mir klar, weshalb Ihr Brief den Poststempel von New York trug.«
Miss Hemingway gab ein leises, befriedigt glucksendes Geräusch von sich und berührte wieder den großen Amethyst an ihrem Hals. »Ich hielt mich deshalb für besonders schlau. Ich habe den Brief an Sie zusammen mit ein paar erklärenden Worten an Blundell & Hardisty abgeschickt und meine Anwälte gebeten, ihn für mich aufzugeben. Auf diese Weise...« Ihr Gesicht wurde plötzlich energisch und streng, und die Bürde des Alters schien von ihr gewichen zu sein. »Auf diese Weise habe ich eventuelle Spekulationen eines Neugierigen verhindert, bis ich die Möglichkeit bekam, mit Ihnen zu sprechen.«
Der sonnendurchflutete Raum, von dem aus man hinausblickte auf Tausende von Kilometern sonnenüberfluteten Ozeans, wurde schlagartig dunkel und schattig. Ich stand auf, ging zur Tür und schaute hinaus auf den leeren Korridor. Dann kam ich zurück und setzte mich wieder dicht vor die alte Dame. »Hat dieser - Neugierige einen Namen?«
»Wenn ich ihn wüsste«, erklärte Miss Hemingway, »dann hätte ich Sie nicht hierherbemühen müssen.«
Jetzt hatte sich die Härte auch auf ihre Stimme ausgedehnt. Und ihre Hände zitterten nicht mehr. Als ich schwieg, richtete sie sich steif auf und atmete tief ein. »Damit Sie keinen falschen Eindruck gewinnen, junger Mann: Ich benötige keine Wachhunde - seien es nun vierbeinige oder zweibeinige. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen, soweit das notwendig sein sollte. Und Sie brauchen mich dabei nicht so skeptisch anzusehen.«
Sie starrte auf einen Punkt hinter mir, als höre sie auf etwas, was ich nicht hören konnte; dann zog sie die Unterlippe ein und nahm mich in Augenschein, als sei ich das Muster auf der Tapete.
Schließlich erklärte sie: »Ganz gleich, wie alt ein Mensch sein mag, Mr. Bowman, der Gedanke, sterben zu müssen, ist ihm nie willkommen. Ich weiß...«, sie lächelte ein wenig schwach, »ich sollte mich schon seit vielen Jahren darauf gefasst machen. Früher oder später wird es aus sein.« Das Lächeln wurde traurig, und sie war wieder die kleine, verschrumpelte Greisin in einem viel zu großen Rollstuhl. »Ich nehme an, dass ich mein Ende nicht mehr allzu lange werde aufschieben können.«
»Wollten Sie mir vorhin andeuten«, fragte ich behutsam, »dass jemand es dennoch nicht erwarten kann?«
»Ja«, erwiderte sie. »Genau das. Jemand kann es offenbar nicht erwarten.«
Sie sagte es ohne Angst. Und weder Zorn noch Bitterkeit zeigte sich in ihrem Blick. Sie wusste es, und sie akzeptierte das Unvermeidliche.
Wenn ich ihr erklärte, dass man in ihrem Alter nicht selten Halluzinationen erliegt, würde sie mich wegschicken. Und sich einen anderen Privatdetektiv besorgen, wieder aus dem Telefonbuch. Privatdetektive gingen dreizehn auf ein Dutzend, mich eingeschlossen. Aber reiche alte Ladys wuchsen nicht auf den Brombeerbüschen. Und ein Mann muss schließlich von etwas leben.
Außerdem... Diese Miss Lavinia Hemingway war eine nette alte Dame. Ich brauchte kein ärztliches Gutachten um zu wissen, dass ihre Zeit nach Monaten und Wochen, nicht mehr nach Jahren gezählt wurde. Wenn sie also dem Ende ihres Lebens noch ein wenig Aufregung und Spannung verschaffen wollte, warum sollte ich ihr den Spaß verderben? Ich würde dabei vielleicht keine allzu heroische Rolle spielen, aber das wurde vermutlich durch ein ordentliches Honorar reichlich ausgeglichen.
Außerdem kostete es mich gar nichts, noch ein wenig zuzuhören. Der nächste Zug nach New York ging erst in ein paar Stunden. Wenn ich es eilig hatte, konnte ich von Atlantic City aus fliegen und das Ticket mit den hundert Dollar verrechnen, die sie mir geschickt hatte.
Als ich an diesem Punkt meiner Überlegungen angelangt war, fand ich es an der Zeit, wieder etwas zu sagen. Also fragte ich: »Warum sollte jemand die Absicht haben, Sie zu töten?«
Ihr Mund wurde schmal, und um ihre Augen vertieften sich die kleinen Fältchen zu Falten wie Rinnsale um einen vertrocknenden Teich. Dann sagte sie: »Haben Sie schon mal das Wort Geld gehört, Mr. Bowman?«
»Klar«, erwiderte ich. »Ein gutes Motiv unter vielen. Je mehr man davon hat, desto stärker ist das Motiv - für den Mörder.«
»Das war immer meine Ansicht.« Sehr ruhig und gelassen fügte sie hinzu: »Und ich besitze eine Menge Geld. Jemand scheint zu denken, dass ich es schon ein wenig zu lange besitze.«
»Angenommen, Sie haben recht... Es dürfte kaum schwierig sein, denjenigen ausfindig zu machen. Wie viele Erben können nach Ihrem Tod Ansprüche geltend machen?«
»Drei... Oder auch vier.« Zum ersten Mal vermied sie es, mir in die Augen zu schauen. Als sie es dann doch tat, erblickte ich in den ihren deutliches Unbehagen und wohl auch ein unterdrücktes Schuldgefühl.
»Können Sie das denn nicht mit Bestimmtheit sagen? Sind ihre Namen nicht in Ihrem Testament aufgeführt?«
»N-nein... Wissen Sie, ich habe nach dem Tod meines Vaters nur die Hälfte seines Vermögens geerbt. Die andere Hälfte gehört mir nicht, obgleich ich es zu meinen Lebzeiten verwalten darf.«
»Und wem gehört es?«
»Das klingt jetzt vermutlich lächerlich, ich weiß...« Sie bewegte sich ruhelos hin und her. »Es ist schon so lange her, und die Anwälte hätten bestimmt ihre Spur gefunden, vor allem, wenn Kinder dagewesen wären... Dennoch glaube ich noch immer...«
»Lassen Sie mich ein bisschen überlegen«, schlug ich vor. »Sie haben mir bereits hundert Dollar bezahlt für die Reisespesen. Also kann ich versuchen mich in Ihre angeblich so lächerliche Geschichte hineinzudenken. Von wessen Kindern sprechen Sie?«
»Ich hatte eine Schwester«, sagte Miss Hemingway in völlig verändertem Ton. Es klang, als spreche sie aus großer Entfernung zu mir. »Sie war vier Jahre jünger... Ich war die Älteste. Nach Connie kamen noch Richard und Edric. An Richard erinnere ich mich kaum. Er starb mit zehn Jahren an Diphtherie. Meine Mutter hat es nicht lange überlebt. Ihr letztes Kind, der kleine Edric, war eine sehr schwere Geburt gewesen, und meine Mutter war keine sehr widerstandsfähige Frau. Es hieß, der Schock über Richards Tod sei zu viel gewesen für sie... Aber der das sagte, wusste nicht, was Connie und ich wussten.« Sie seufzte und schwieg dann, als hätten ihre Erinnerungen sie in eine andere Zeit versetzt.
»Was wussten Connie und Sie?«, fragte ich.
Sie schaute mich mit düsterem Blick an und seufzte wieder. »Mein Vater hat meine Mutter umgebracht. Er warf ihr vor, Richard könnte noch leben, wenn sie ihn nicht zugunsten von Edric vernachlässigt hätte. Und eines Abends, kurz vor ihrem Ende, hörten ihn Connie und ich etwas sagen, was Connie ihm nie verzeihen konnte. Sie war ein heftiges Mädchen - darin war sie meinem Vater ähnlich.«
In die Stille des Raumes drangen das Klatschen der Wellen und die Schreie der Möwen. Das Zimmer war warm wie die Luft, die durch das geöffnete Fenster hereinströmte, aber der Blick aus Miss Hemingways Augen funkelte so kalt wie der Amethyst an ihrem Hals.
Ihre Finger tasteten wieder danach, während sie düster fortfuhr: »Ich habe mich oft gefragt, wie sich die Dinge wohl entwickelt hätten, wenn Vater in jener Nacht nicht so laut gebrüllt hätte, dass Connie und ich ihn hören mussten. Ich weiß noch genau, wie entsetzt wir beide waren. Connie war damals erst vierzehn, aber sie zwang mich, hinaufzugehen mit ihr... Ich hatte eine panische Angst, Vater könnte uns beide überraschen... Und dann hörten wir, wie Mutter ihm gestand, dass Edric nicht sein Sohn war.«
Ich fand, es war ein bisschen spät, das alles auszugraben, noch dazu vor einem Fremden - ganz gleich, ob ihr alter Herr recht gehabt hatte oder nicht. Und ich verstand vor allem nicht, was das mit dem Mordversuch an einer alten Dame zu tun hatte, die ohnehin bald dahingehen würde, so dass es kaum noch nötig war, ihr den entscheidenden Stoß zu versetzen.
Ich fragte: »Und - hat Ihr Vater Sie überrascht, wie Sie und Ihre Schwester an der Tür lauschten?«
Wieder zog sie die Oberlippe ein und schüttelte dann den Kopf. »Er hätte es nie erfahren, wenn Connie es ihm nicht vorgeworfen hätte - an dem Tag, als er sie aus dem Haus jagte.«
»Warum hat er das getan?«
»Er hatte erfahren, dass ein junger Mann hinter seinem Rücken mit Connie herumpoussierte - so jedenfalls drückte er sich aus. Er fand, dass der Junge aus einer Familie stammte, die nicht zu der unsrigen passte, und erklärte, er selbst würde die jungen Männer aussuchen, die für seine Tochter in Frage kämen. Außerdem könne er es nicht ertragen, dass ein junges, dummes Ding von siebzehn Jahren die Moral in seinem Hause untergrabe. Die beiden hatten einen fürchterlichen Streit. Connie schleuderte ihm ihren ganzen Hass entgegen, und er schlug sie ins Gesicht. Daraufhin schrie sie, er gehöre ausgepeitscht für das, was er ihrer Mutter angetan habe, ehe sie starb. Und sie schwor ihm, dass sie sich ihr Leben nicht von ihm würde zerstören lassen, so, wie er Mutters Leben zerstört habe. Ich habe sie nie so hasserfüllt gesehen wie damals, als sie aus seinem Zimmer kam. Wenn sie eine Pistole besessen hätte, hätte sie ihn zweifellos erschossen. Sie verschwand noch am selben Abend, und keiner von uns hat jemals noch etwas von ihr gehört.«
Irgendwo im Haus schlug eine Tür zu. Ich wartete, dachte nach und ließ bewusst die Zeit verstreichen. Es vergingen fünf Minuten, vielleicht auch zehn. Ich war nicht ungeduldig. Sie musste zurückreisen in eine Zeit, die an die sechzig Jahre in der Vergangenheit lag. So etwas kostet in ihrem Alter große Mühe. Mit brüchiger Stimme sagte sie schließlich: »Vater bereute das natürlich, aber da war es zu spät. Seine Reue wurde immer stärker, wurde schließlich zu einer Art von Besessenheit. Er sprach mit keinem ein Wort darüber, und ich erfuhr es erst, als ich seine Bücher übernahm und sah, welch gewaltige Summen er dafür ausgegeben hatte, Connie wiederzufinden. Er hatte die Hoffnung niemals aufgegeben, sie würde eines Tages zurückkommen. In seinem Testament hat er ihr die Hälfte seines Vermögens vermacht.«
Ohne ihr den Kopf zuzuwenden, sagte ich: »Und als er starb?«
»Ich übernahm sein unausgesprochenes Vermächtnis und suchte weiter nach meiner Schwester. Auch ich habe ein Vermögen dafür ausgegeben... Es gibt kein Land dieser Erde... Aber ich war es meinem Vater und meiner Schwester schuldig... Ich hätte Connie an jenem Abend nicht gehen lassen dürfen. Vielleicht war ich auf sie eifersüchtig. Sie war immer die Hübschere von uns beiden gewesen... Ich war ja noch so jung... Und jetzt bin ich so alt.« Ihre Stimme wurde plötzlich wieder stark, und die Worte klangen bitter. »Jetzt bin ich vierundachtzig, und man will nicht einmal mehr mein Geld dafür nehmen. Alle sagen, dass Connie schon seit langem tot sein muss.«
»Und was war mit dem unwillkommenen Liebhaber? Gibt es von dem auch keine Spur?«
»Sie ist nicht zusammen mit ihm weggegangen«, sagte Miss Hemingway. »Auch er hat sie seit damals nie wiedergesehen. Von dem Augenblick, als sie dieses Haus verließ, gibt es keine Spur mehr von ihr.«
»Das ist keineswegs eine lächerliche Geschichte«, sagte ich. »Und ich wollte, ich könnte Ihnen helfen.« Ich ging zurück zum Hocker und setzte mich. »Ich weiß nicht, wie. Welche Chance hätte ich, Ihre Schwester ausfindig zu machen, nach all den anderen, die Sie damit beauftragt haben?«
»Deshalb habe ich Sie auch gar nicht kommen lassen«, sagte sie. »Das wissen Sie ganz genau.« Ihr eingefallener Mund wirkte jetzt mürrisch, und in ihren Augen zeigte sich zorniges Funkeln. »Warum sagen Sie nicht, was Sie denken? Sie glauben, ich bin nicht mehr ganz bei Trost, nicht wahr?«
»Wenn es erst so weit kommt, dass ich mir anmaße, den Geisteszustand meiner Mitmenschen zu beurteilen, kann ich meinen Job gleich an den Nagel hängen«, erwiderte ich. »Ich begreife nur eines nicht: warum jemand Sie deshalb töten will.«
»Das können Sie auch gar nicht verstehen. Sie wissen ja nicht, wie sehr Connie meinen Vater hasste; Sie ahnen nicht, wie sehr sie mich verachtete. Sie wissen ja noch gar nichts von der ganzen Sache.« Miss Hemingway atmete schwer, und an ihrem Hals pochte eine Ader.
»Aber alle, die Sie in dieser Sache engagiert haben«, fuhr ich fort, »sind davon überzeugt, dass Ihre Schwester tot sein muss. Also kommt es nicht mehr darauf an, welche Gefühle sie gegenüber Ihrem Vater oder Ihnen hegte. Das müssen Sie doch einfach zur Kenntnis nehmen.«
»Und wenn sie Kinder hatte? Wenn eines von ihnen herausgefunden hat, dass ihm ein großes Erbe bevorsteht?«
»Dann brauchte es sich nur zu melden und seine Identität glaubhaft nachweisen. Es brauchte keinen Mord zu begehen, um an das Geld heranzukommen.«
Sie war sehr still geworden. Mit ruhiger, fast flüsternder Stimme sagte sie nach einer längeren Pause: »Doch - wenn es das ganze Vermögen haben will. Mit einer Million kann man viel mehr anfangen als mit fünfhunderttausend - oder nicht?«
Unsere Blicke begegneten sich kurz, dann wandte sie sich wieder ab. Sie tastete nach ihrer Brosche, als würde sie durch die Berührung mit dem kalten Stein Sicherheit gewinnen. »Ich schlafe nachts nicht mehr sehr tief«, sagte sie dann. »Vielleicht, weil ich oft auch tagsüber ein Stündchen ruhe. Und vor ein paar Wochen lag ich wach im Bett, als ein Mann in mein Schlafzimmer kam.«
»Was haben Sie gemacht?«
»Ich schaltete das Licht an meinem Nachttisch an, und er rannte hinaus.« Insgeheim schien sie sich zu amüsieren. »Ich nehme an, er glaubte, dass ich schlafe, aber ich hatte ihm wohl einen ziemlichen Schrecken eingejagt.«
»Und was geschah danach?«
»Ich läutete nach Rachel.«
»Hat sie den Eindringling auch gesehen, oder Spuren von ihm entdeckt?«