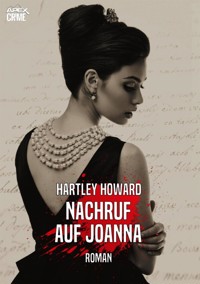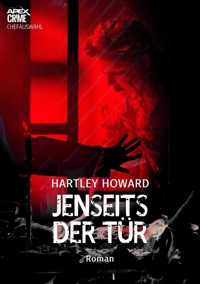5,99 €
Mehr erfahren.
Es beginnt mit dem Mord an Ben Riley, einem stadtbekannten Säufer. Ben stieß durch Zufall auf ein Geheimnis im Wert von einer Million Dollar plus einer Kugel - für Ben Riley!
Doch der Mörder begeht einen Fehler: Er erschießt den Trunkenbold ausgerechnet in der Wohnung des New Yorker Privatdetektivs Glenn Bowman...
»Temporeich, spannend, mit Vergnügen zu lesen«, urteilte der London Observer über die Krimis von Hartley Howard.
Der Roman Sicher wie das Grab des britischen Schriftstellers Hartley Howard (eigentlich Leopold Horace Ognall - * 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) erschien erstmals im Jahr 1971; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HARTLEY HOWARD
Sicher wie das Grab
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
SICHER WIE DAS GRAB
Die Hauptpersonen dieses Romans
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Das Buch
Es beginnt mit dem Mord an Ben Riley, einem stadtbekannten Säufer. Ben stieß durch Zufall auf ein Geheimnis im Wert von einer Million Dollar plus einer Kugel - für Ben Riley!
Doch der Mörder begeht einen Fehler: Er erschießt den Trunkenbold ausgerechnet in der Wohnung des New Yorker Privatdetektivs Glenn Bowman...
»Temporeich, spannend, mit Vergnügen zu lesen«, urteilte der London Observer über die Krimis von Hartley Howard.
Der Roman Sicher wie das Grab des britischen Schriftstellers Hartley Howard (eigentlich Leopold Horace Ognall - * 20. Juni 1908 in Montreal, Québec; † Großbritannien) erschien erstmals im Jahr 1971; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
SICHER WIE DAS GRAB
Die Hauptpersonen dieses Romans
Glen Bowman – Privatdetektiv.
Joe Pietruszka – Besitzer eines Delikatessengeschäfts.
Tony – sein Sohn.
Ben Riley – Fotograph.
Jason – Portier.
Captain Robert Almond – Polizeibeamter.
Victor Almond – sein Bruder.
Conrad Nelson – Vizepräsident der Trans-American Trustee Bank.
Sue Lynwood – junge Frau.
Raymond Wayne – Rechtsanwalt.
Lloyd Malone – Geschäftsmann.
Gus Somerville – Lastwagenfahrer.
Lieutenant Frank Terrel – Kriminalbeamter.
Lieutenant Young – Kriminalbeamter.
Sergeant Vic Goslin – Kriminalbeamter.
Erstes Kapitel
Schon seit dem frühen Morgen roch es nach Neuschnee. Der beißende Wind fühlte sich an, als käme er geradewegs vom Nordpol. Abends um halb zwölf sank das Quecksilber auf den tiefsten Stand seit dem Winteranfang. Ich stieg die Treppen hinauf und freute mich nach einem langen, harten Tag auf mein warmes Bett.
Wenn ich nicht so zerstreut gewesen wäre, hätte ich das Licht in meiner Wohnung bemerkt, noch bevor ich die Tür aufschloss. Es fiel mir erst auf, als ich die Tür aufstieß – und noch etwas: Ich hatte Besuch.
Es war ein rundlicher kleiner Mann mit fleckigen Apfelbäckchen, schütterem, in der Mitte gescheiteltem Haar und traurigen braunen Augen. Ich stieß die Tür mit dem Fuß zu. Wir sahen einander an, und keiner sagte ein Wort.
Ich war sprachlos. Um diese Zeit rechnete ich nicht damit, in meiner bescheidenen Zweizimmerwohnung einen rundlichen kleinen Mann anzutreffen. Ich hatte auch niemanden eingeladen.
Ich kannte den Menschen überhaupt nicht. Aber da saß er nun und sah mich von unten her so flehentlich an, als hätte er Angst, ich könnte ihm böse sein.
Unter anderen Umständen wäre ich das vielleicht auch gewesen, aber so hätte es mir auch nichts genützt. Der rundliche kleine Mann war nämlich tot.
Er hatte ein kleines Loch in der Hemdbrust, ungefähr einen Zoll links vom Brustknochen. Es war die Einschussöffnung einer Kugel von mittlerem Kaliber, die sein Leben, aber nicht viel Blut gekostet hatte.
Es schien, dass er rückwärtsging, als ihn die Kugel traf. Er stolperte wohl weiter, bis die Beine unter ihm nachgaben und er, mit dem Rücken ans Fußende meines Bettes gelehnt, sitzen blieb.
Seine traurigen braunen Augen sahen mich immer noch an, als ich mich bückte und zwei Finger an seine Halsschlagader legte. Es war nur eine Bestätigung dessen, was ich bereits wusste.
Nun spielten ein paar Minuten auch keine Rolle mehr. Der rundliche kleine Mann hatte noch eine ganze Ewigkeit Zeit.
Ich sah ihn mir genau an, ohne ihn noch einmal zu berühren. Er war rasch, aber gründlich durchsucht worden. Das Futter der Hosentaschen hing heraus, die inneren Jackentaschen und eine Manteltasche waren aufgerissen.
Auf dem Fußboden neben ihm lag eine offene Brieftasche. Ich rührte sie natürlich nicht an, sah aber, dass sie ziemlich viel Geld enthielt.
Damit war eine Frage beantwortet. Die zweite Antwort bekam ich von einem Kissen in meinem Sessel. Es hatte vorn ein geschwärztes Loch, wo die Pulverladung an der Einschussöffnung das Material verbrannt hatte.
Das war natürlich viel weniger, als die Polizei gleich von mir würde wissen wollen. Mit einem sehr ungemütlichen Gefühl rief ich das zuständige Revier an.
Lieutenant Frank Terrel hatte ein knochiges Gesicht, tiefliegende Augen und die Hautfarbe eines Magenkranken. Er war ein Mann mit einer ruhigen Stimme, die aber so scharf werden konnte wie eine Rasierklinge.
Und er war ungeheuer hartnäckig. Er ließ einfach nicht locker. Nach einer halben Stunde kam ich mir vor wie ein gehetzter Hase.
Inzwischen hatten sie alles nach Fingerabdrücken abgesucht und die Umrisse des rundlichen kleinen Mannes auf dem Teppich und am Fußende meines Bettes mit Kreide nachgezogen. Die Blitzlichtaufnahmen und die übrigen Routinearbeiten waren erledigt. Das Morddezernat arbeitet eben Tag und Nacht mit derselben geräuschlosen Geschwindigkeit.
Als unbeteiligter Zuschauer hätte ich die Geschicklichkeit dieser Männer bestimmt bewundert. Aber leider steckte ich mittendrin, und Terrel machte mir deutlich, dass er mir keine Chance geben würde.
Zwei gefühllose Roboter trugen den kleinen Mann auf einer Bahre hinaus, von Kopf bis Fuß mit einer schmutzigen Decke zugedeckt. Dann entfernten sich die Leute von der Spurensicherung.
Zurück blieben Terrel, ein gewisser Sergeant Vic Goslin und ich.
Goslin hatte breite Schultern, mächtige Pranken und ein unangenehmes Gesicht. Seine Augen wurden ganz besonders böse, wenn sie mich ansahen – und sie sahen mich fast immer an. Nur für den Fall, dass ich auf dumme Gedanken kommen sollte, lehnte er mit seinem vollen Gewicht an der Tür und massierte mit der linken Hand seine rechte Faust.
Als die letzten Schritte draußen auf der Treppe verklangen, sagte Terrel: »Fassen wir noch einmal zusammen: Zu dieser Wohnung gibt es zwei Schlüssel. Den einen haben Sie, den anderen hat der Hausmeister – stimmt’s?«
»Soviel ich weiß, ja.«
»War die Tür verschlossen, als Sie heimkamen?«
»Ja.«
»Das heißt also, dass der Mörder Ihres Besuchers entweder Ihren Schlüssel oder den des Hausmeisters besessen haben muss.«
»Meinen hatte er nicht«, sagte ich. »Der steckte die ganze Zeit in meiner Tasche.«
»Damit wollen Sie praktisch sagen, dass nur der Hausmeister Ihren Freund hereingelassen haben kann.«
»Davon habe ich kein Wort gesagt. Erstens war ich nicht hier und weiß daher nicht, wer meine Tür aufgeschlossen hat. Zweitens war der Tote kein Freund von mir.«
Lieutenant Terrel lächelte mich mit geschlossenen Lippen dünn an. Er sagte: »Wenn jemand umgebracht wird, bedeutet das für mich immer, dass er mit irgendjemandem nicht befreundet war. Aber weshalb sollte dieser Mann herkommen, wenn Sie ihn noch nie gesehen haben?«
»Diese Frage haben Sie mir schon ein halbes dutzendmal gestellt.«
»Und ich werde sie Ihnen immer wieder stellen, bis Ihnen die Antwort einfällt.«
»Sie hätten sich viel Mühe sparen können, wenn Sie gleich beim ersten Mal richtig hingehört hätten. Die Antwort bleibt dieselbe: Ich weiß es nicht.«
Sergeant Goslin schob sich den Hut in den Nacken und richtete sich zu seiner vollen, imposanten Größe auf. »Wenn Sie mich fragen, Lieutenant – der Kerl hat eine mächtige Klappe.«
Terrel nickte. Er sagte: »Schon möglich, Vic, aber seien wir nicht voreilig. Vielleicht braucht Bowman nur noch eine kleine Aufmunterung, bis er uns die wahre Geschichte erzählt. Wir haben ja die ganze Nacht Zeit.«
»Sie vielleicht schon«, sagte ich, »aber ich nicht. Ich habe Ihnen bereits die ganze wahre Geschichte erzählt. Wenn Sie alles noch einmal durchgehen wollen – einverstanden. Aber nur einmal.«
Terrel fragte in nachdenklichem Ton: »Interessiert es Sie denn gar nicht, was der kleine Mann Ihnen erzählen wollte, bevor ihn jemand für immer zum Schweigen gebracht hat?«
»Nein, ich will jetzt nichts weiter als endlich schlafen gehen.«
»Sind Sie gegenüber Ihren Klienten immer so gleichgültig?«
»Er war nicht mein Klient. Auf die Gefahr hin, dass ich Sie langweile, muss ich wiederholen: Ich habe ihn noch nie gesehen.«
»Na und? Kümmert es Sie gar nicht, dass er noch leben könnte, wenn er nicht hergekommen wäre?«
»Das ist eine neue Perspektive«, sagte ich. »Wie kommen Sie darauf, dass man ihm den Mund verschließen wollte?«
»Mir fällt kein anderes Motiv ein.« Terrel deutete auf die Habseligkeiten des Toten, die auf meiner Bettdecke ausgebreitet lagen. »Mehr hatte er nicht in seinen Taschen: Brieftasche, Schlüssel, Kleingeld, Kamm, Nagelschere, Notizbuch. Die achtundsechzig Dollar in seiner Brieftasche beweisen, dass Geld kaum das Tatmotiv gewesen sein dürfte, meinen Sie nicht auch?«
»Für mich heißt das nur, dass sein Mörder hinter etwas her war. was mehr wert sein musste als achtundsechzig Dollar.«
»Irgendwelche Anregungen?«
»Nun, es muss wohl so klein gewesen sein, dass man es in einer Tasche verschwinden lassen konnte. Wenn es sich um einen größeren Gegenstand handelte, hätten die Leute, die ihn filzten, nicht das Futter aufzureißen brauchen.«
Der Lieutenant machte große Augen und schob die Unterlippe vor. »Gut überlegt. Dieser Gegenstand – gleichgültig, worum es sich handelte – dürfte der Anlass für seinen Besuch gewesen sein. Er wollte mit Ihnen darüber reden.«
»Das war von vornherein klar. Man sah es ja an den herausgerissenen Taschen. Sparen Sie sich also Ihr Lob.«
Goslin begann zu knurren, aber Terrel brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Dann sagte er: »Ich habe nicht erklärt, dass ich bereit bin, das zu schlucken. Vielleicht hat man seine Taschen herausgestülpt und das Futter zerrissen, um uns auf eine falsche Fährte zu locken.«
»Und was haben Sie davon? Bis jetzt nichts als einen Mann mit einem Loch in der Brust, ein paar Habseligkeiten und eine Brieftasche mit achtundsechzig Dollar.«
»Stimmt nicht ganz«, widersprach Terrel. »Das Notizbuch habe ich noch nicht erwähnt.«
Er nahm es von meinem Bett und blätterte die ersten Seiten durch. »Keine Eintragungen am ersten Januar, am zweiten, dritten oder vierten«, murmelte er. »Nur eine Notiz für den heutigen Tag, den fünften Januar. Von da ab bis zum Jahresende ist der Kalender leer, ich habe nachgesehen.«
»Und jetzt soll ich Sie wohl fragen, was in dem Notizbuch für Donnerstag, den fünften Januar eingetragen steht. Wenn ich Ihnen die Frage nicht stelle, mache ich mich verdächtig.«
»Alles an dieser Sache wirkt verdächtig«, sagte Terrel. »Besonders verdächtig erscheint mir, dass als einziges in diesem Notizbuch ausgerechnet Ihr Name und Ihre Adresse eingetragen sind, und zwar unter dem heutigen Datum.«
Das klang zwar nicht sehr logisch, aber noch unlogischer wäre es gewesen, wenn der kleine Mann versehentlich in meine Wohnung geraten wäre.
Ich sagte: »Sie tun ganz so, als hätte ich ein Geständnis unterschrieben. Wenn’s kein Schlafwandler war, dann ist er hergekommen, um mit mir zu sprechen, das steht fest. Warum sollte er also nicht meinen Namen und meine Anschrift haben?«
»Dann muss er Sie doch gekannt haben?«
»Nein, nicht unbedingt. Meine Adresse kann sich jeder aus dem Telefonbuch besorgen. Dieser Herr Sowieso hat unter Privatdetektive nachgesehen und sich meinen Namen herausgeschrieben, das ist alles.«
»Hätte er da nicht angerufen und sich mit Ihnen verabredet?«
»Meistens wird das so gemacht. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen.«
»Und ausgerechnet eine dieser Ausnahmen finden wir tot in Ihrem Schlafzimmer«, sagte Terrel. »Warum hat er Sie nicht in Ihrem Büro aufgesucht?«
»Das weiß ich genauso wenig wie Sie.«
»Ich würde sagen, dass es sich um einen privaten Besuch handelte und nicht um einen geschäftlichen. Er hat in seinem Kalender Ihre Geschäftsadresse gar nicht vermerkt. Stimmt’s?«
»Keine Ahnung.«
»Warum nicht?«
»Weil ich noch nicht gesehen habe, was in dem Notizbuch steht.«
»Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass die einzige Eintragung diese Anschrift hier war.«
»Warum fragen Sie mich also, wenn Sie es selbst gesehen haben?«
Lieutenant Terrel schnaufte schwer. »Ich hab’ den Eindruck, dass Sie mich an der Nase herumführen wollen. Hätte der Hausmeister einen Fremden in die Wohnung gelassen, der Sie hier besuchen wollte?«
»Das ist unwahrscheinlich.«
»Wenn er aber wusste, dass der Besucher ein Freund von Ihnen war?«
»Jason kennt meine Freunde doch gar nicht.«
Goslin brummte vor sich hin: »Was soll das eigentlich? – Außer seiner Mutter wird er nie einen Freund gehabt haben – falls er überhaupt eine Mutter hat.«
Terrel wollte Zeit gewinnen und fragte: »Sie erwähnen da einen gewissen Jason – ist das der Hausmeister?«
»Ja.«
»Wohnt er hier?«
»Nein, er macht für gewöhnlich um neun Uhr Feierabend.«
»Wissen Sie seine Anschrift?«
»Irgendwo in der Gegend der Elizabeth Street.«
»Genauer wissen Sie’s nicht?«
»Nein.«
»Und wenn er nun einmal dringend gebraucht wird? Wenn ein Wasserrohr bricht oder die Hauptsicherung durchgeht?«
»Unten in der Portiersloge hängt eine Karte mit seiner Telefonnummer und Adresse.«
»Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«, fragte Terrel finster.
»Weil ich keinen Ärger haben will und nur Fragen beantworte, die an mich gestellt werden.«
Wieder lächelte er mich dünn an. »Wissen Sie was?«, meinte er, »Sie haben sich selbst bemogelt. Sie stecken schon bis zum Hals im Ärger.«
Er sah Goslin an und fügte hinzu: »Gehen Sie hinunter, Vic, und rufen Sie diesen Jason an. Sagen Sie ihm, er soll schnell eine Hose anziehen und herkommen.«
»Klar, ich sag’s ihm«, knurrte Sergeant Goslin.
Ich hörte seine schweren Schritte draußen auf dem Flur. Als sie am oberen Ende der Treppe angelangt waren, versuchte es Terrel auf plump-vertrauliche Weise: »Jetzt sind wir allein und können Tacheles miteinander reden. Ich nehm’s Ihnen gar nicht übel, wenn Sie schweigen, solange ein Dritter zuhört.«
»Das freut mich aber«, sagte ich.
»Gut. Wer ist er also?«
»Wer?«
»Der kleine Mann, dem das Lebenslicht ausgeblasen wurde.«
»Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich es nicht weiß.«
Lieutenant Terrel lehnte sich zurück und maß mich von Kopf bis Fuß. »Sie behaupten also immer noch, Sie hätten ihn niemals gesehen?«
»Niemals«, bestätigte ich. »Aber Sie glauben es mir ja doch nicht.«
»Da haben Sie verdammt recht.« Sein Gesicht bestand nur noch aus Haut und Knochen. Die stechenden Augen durchbohrten mich. »Ein Fremder kommt in Ihre Wohnung, macht es sich bequem und wird hier abgemurkst – das soll ich Ihnen abkaufen?«
»Nein.«
»Wie bitte?«
»Ich meine, es ist mir ganz egal, ob Sie’s glauben oder nicht.«
Terrel verzog keine Miene. Er fragte: »Um welche Zeit sind Sie heute nach Hause gekommen?«
»Auch das habe ich Ihnen schon gesagt, als der ganze Zirkus begann: ungefähr um halb zwölf.«
»Interessiert es Sie, was unser Arzt über die Todeszeit meint?«
»Ich würde Ihnen zumindest zuhören«, sagte ich.
»Es bleibt Ihnen auch gar nichts anderes übrig. Es war nur eine Höflichkeitsfloskel.«
»Ich würde an Ihrer Stelle vorsichtiger sein.«
Er atmete ganz langsam durch. Dann sagte er: »Sie sind einer von den Klugscheißern, bei denen ich immer Magenschmerzen kriege. Zu dumm, um einzusehen, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann.«
»Wir alle haben unsere Fehler«, entgegnete ich. »Sie müssten wissen, dass ich unschuldig bin, bis man mir eine Schuld nachgewiesen hat. Genauso möchte ich auch behandelt werden.«
»Okay«, sagte Terrel. »Sie sind also unschuldig. Und was hat das mit mir zu tun?«
»Ich könnte es Ihnen sagen – aber ich möchte ebenfalls höflich bleiben.«
»Immer noch der alte Komiker.« Er schüttelte seufzend den Kopf. »Aber einer von uns beiden muss jetzt vernünftig werden. Also: Der Gerichtsarzt meint, Ihr kleiner Freund wäre zum Zeitpunkt der Untersuchung schon drei bis vier Stunden tot gewesen.«
»Die Untersuchung fand um Mitternacht statt.«
»Richtig, das bedeutet, dass er zwischenacht und neun gestorben ist.« Im selben Atemzug fügte er hinzu: »Wo waren Sie um diese Zeit?«
»Ich habe beim Pokern verloren.«
»Von wann bis wann?«
»Von kurz vor acht bis wenige Minuten nach elf.«
»Können Sie das beweisen?«
»Wenn’s sein muss.«
»Es muss sein.«
»Dann fragen Sie die vier Burschen, die mich ausgenommen haben.«
»Wer war dabei?«
»Einer war ein früherer Staatsanwalt – ein gewisser Webster.«
»Hm – kennen Sie ihn näher?«
»Wir haben gemeinsam studiert.«
»Sie bewegen sich in guter Gesellschaft.«
»Jedenfalls bis vor einer Stunde«, sagte ich.
Er schüttelte wieder den Kopf und schnalzte ärgerlich mit der Zunge. »Wo fand dieses Spiel statt?«
»Bei Webster. Wollen Sie seine Adresse haben?«
»Nein, die kann ich selbst feststellen. Und während dieser drei Stunden haben Sie den Pokertisch nicht ein einziges Mal verlassen?«
»Nein.«
»Nicht einmal zum...«
»Nicht einmal zum...«, antwortete ich.
Lieutenant Terrel nickte und starrte versonnen durch mich hindurch, als wäre ich aus Glas. Als er mich lange genug ignoriert hatte, fragte ich: »Haben Sie denn bei meinem ungebetenen Besucher nichts gefunden, wonach man ihn identifizieren könnte?«
Er kehrte in die Gegenwart zurück. »Nein, aber es dürfte nicht schwierig sein, ihn zu identifizieren. Irgendwo in den Bars müsste ihn jemand kennen.«
»In den Bars? Warum?«
»Weil unser Doktor sagt, er habe die Gesichtsfarbe eines Säufers und stinke nach Schnaps. Haben Sie das nicht gerochen?« Wieder veränderte sich nichts an Terrels Tonfall, aber ich fiel auf seinen Trick nicht herein.
»Ich kam nicht nahe genug heran«, antwortete ich. »Aber jetzt, wo Sie’s erwähnen, fällt es mir auch ein: Er sah wirklich aus wie jemand, der gern trinkt.«
»Dann werde ich gleich noch etwas anderes erwähnen: Wäre es nicht möglich, dass Ihnen dieses Schnapsfass auf zwei Beinen in irgendeiner Kneipe begegnet ist?«
»Er mag mich vielleicht gesehen haben, aber ich ihn nicht.«
»Vielleicht haben Sie’s nur vergessen.«
»Bei den Mengen, die ich trinke, vergesse ich niemals Menschen, die ich kennenlerne. Sie stellen mir dauernd dieselben Fragen und kriegen dieselben Antworten darauf. Ich habe ihn heute Abend zum ersten Mal...«
»Okay«, unterbrach mich Terrel, »schon gut. Das hatten wir bereits. Ich suche nur nach einem Grund, warum der Hausmeister ihn hier eingelassen hat.«
»Wenn Jason ihn tatsächlich hereingelassen hat, dann müssen Sie ihn schon selbst fragen.«
»Ja, wahrscheinlich. Sobald er hier ist. Übrigens...«, er sah auf die Uhr, »Goslin braucht verdammt lange für dieses Telefongespräch. Ob er aufgehalten wurde?«
»Vielleicht war die Leitung besetzt.«
»Jetzt, mitten in der Nacht?«
Auf dem Flur waren Schritte zu hören. Als sie näherkamen, sagte ich: »Sprich vom Teufel, und er ist nicht weit.«
Goslin trat ein. »Entschuldigung, Lieutenant, Sie müssen glauben...«
»Überlassen Sie das mir. Haben Sie den Hausmeister erreicht?«
»Nein, er ist noch nicht zu Hause. Seine Frau meint, er wäre sicher auf einen Schluck und ein Spiel Billard hier in eine Kneipe gegangen. Das macht er wohl öfter.«
»Dann hat er also die Gewohnheit, sich die halben Nächte herumzutreiben?« Terrel sah mich an. »Sagten Sie nicht, er mache etwa um neun Uhr Feierabend?«
»Ja, um diese Zeit geht er für gewöhnlich.«
»Jetzt ist es schon lange nach Mitternacht. Wer drei Stunden lang Billard spielt, kann es nicht besonders eilig haben, zu seinem lieben Frauchen nach Hause zu kommen.«
Sergeant Goslin berichtigte: »Sie machte gar nicht den Eindruck eines lieben Frauchens. Ich an seiner Stelle würde überhaupt nicht nach Hause gehen. Ich sollte am Telefon warten, während sie in der Nähe in einem Spielsalon nachsehen ging. Scheint seine Stammkneipe zu sein.«
»Aber nicht um diese Zeit«, sagte Terrel.
»Offenbar nicht. Während ich auf ihren Rückruf wartete, habe ich mich umgesehen. Aber wenn’s einen Hauptschlüssel gibt, muss er ihn bei sich haben.«
Jetzt sahen mich beide an. Ich erklärte: »Jason nimmt ihn nicht mit nach Hause. Der Hauptschlüssel liegt immer in einer Schublade für den Fall, dass jemand seinen eigenen Schlüssel verliert.«
Lieutenant Terrel fragte: »Soll das heißen, dass jeder jede Wohnung betreten kann, wenn der Besitzer nicht zu Hause ist?«
»Klar, aber hier wohnen nur anständige Leute.«
Er räusperte sich bezeichnend. Dann wandte er sich an Goslin. »Die Frau konnte Ihnen keine andere Kneipe nennen, in der er sich vielleicht aufhält?«
»In seiner Stammkneipe hat ihn heute noch niemand gesehen. Einer seiner Freunde meinte, er wollte heute Abend vorbeikommen.«
Terrel fixierte seine Zehen und schnippte ein paarmal mit den
Fingern, als könnte er auf diese Weise das Nachdenken fördern. Dann murmelte er: »Ein Mann erschossen, der andere vermisst.« Ohne den Kopf zu heben, sah er mich von unten her lange und durchdringend an. »Das könnte ein Zufall sein. Oder aber auch nicht.«
»Wenn Sie damit andeuten wollen, dass vielleicht Jason diesen Schnapsbruder erschossen hat, dann schlagen Sie sich das aus dem Kopf«, sagte ich. »Ich kenne den Hausmeister schon lange genug; er ist ein friedlicher Mensch und weiß nicht einmal, aus welchem Ende eine Zweiunddreißiger schießt.«
Terrel hob ganz langsam den Kopf. Dann stellte er bedächtig fest: »Das ist aber interessant. Wie kommen Sie auf eine Zweiunddreißiger?«
»Ich habe Augen im Kopf.«
»Hm. Besitzen Sie auch eine Waffe?«
»Natürlich, sogar einen Waffenschein dazu.«
»Darf ich mal sehen?«
»Aber gern.«
Ich öffnete den Kleiderschrank und holte den Schuhkarton heraus, in dem ich immer meine Smith & Wesson zusammen mit einem Reservemagazin aufbewahrte. Als ich den Deckel hob, beugte sich Terrel schnuppernd darüber.
»Wann haben Sie die Waffe zuletzt benutzt?«, fragte er.
»Das ist schon sehr lange her. Ich führe ein recht ruhiges Leben.«
»Das dürfte sich ab sofort ändern«, meinte Terrel. »Schließen Sie Ihren Kleiderschrank nie ab?«
»Nein. Ich sagte doch bereits, dass ich nur ehrbare Nachbarn habe.«
»Ja, richtig, das sagten Sie. Trotzdem würde ich Sie bitten, sich einmal umzusehen, ob hier etwas fehlt.«
»Da brauche ich gar nicht nachzusehen. Für einen Dieb gibt’s hier nichts zu holen. Es sei denn, ein paar gebrauchte Kleidungsstücke.«
»Überhaupt nichts von Wert?«
»Wenn Sie hier irgendetwas Wertvolles finden, teile ich es sofort mit Ihnen«, sagte ich.
Der Lieutenant enthielt sich jeden Kommentars, als ich die 38er hinter meinen Hosenbund schob. Er wartete, bis ich den Schuhkarton wieder weggestellt hatte. Dann sagte er: »Diese ganze Geschichte regt mich allmählich auf. Man stellt Fragen und kriegt darauf die falschen Antworten oder gar keine. Wenn wir wenigstens wüssten, wie dieser kleine Schnapsbruder hier hereingekommen ist.«
Goslin sagte: »Vielleicht hat dieser Jason aufgeschlossen, ihn eingelassen und dann mit ihm gestritten. Er hat ihn erledigt und sich auf die Socken gemacht.«
»Damit ist gar nichts geklärt«, stellte Terrel fest. »Erstens: Warum ausgerechnet hier in dieser Wohnung? Und zweitens: Worüber haben sie gestritten? Drittens: Wie hat das Ganze überhaupt angefangen?«
Goslins Stiernacken färbte sich dunkler. »Das weiß ich nicht, Lieutenant. Es war nur so ein Gedanke.«
»Schön, noch mehr solche Gedanken?«
»Nun, es wäre vielleicht nicht übel, eine Personenbeschreibung von diesem Jason durchzugeben, damit er zum Verhör aufgegriffen wird. Er muss doch sagen können, ob er den Kleinen reingelassen hat oder nicht. Wenn nicht...«
Wieder sahen mich Terrel und Goslin durchdringend an. Ich sagte: »Fangen wir nicht noch einmal von vorn an. Ich würde Ihnen nicht raten, Jason einzulochen. Wenn er nur zu einer Sauf tour unterwegs ist und von der ganzen Geschichte nichts weiß, dürfen Sie sich beim Polizeipräsidenten eine Zigarre abholen.«
Terrel sah mich aus seinen tiefliegenden Augen an. Dann schien er zu einem Entschluss zu gelangen.
»Ich denke, wir fangen am besten mit dem Hauptschlüssel an«, sagte er. »Sehen wir einmal nach, ob wir ihn nicht finden.«
Goslin öffnete die Tür. Terrel nickte mir zu und fragte: »Wollen Sie mitkommen?«
Ich sagte: »Um halb eins gehe ich lieber schlafen.«
»Sie könnten uns zeigen, wo der Schlüssel liegt.«
»Dann ist das also keine Einladung, sondern ein Befehl?«
»Betrachten Sie es, wie Sie wollen, nur kommen Sie mit.«
Ich tat, als müsste ich überlegen. Dann sagte ich: »Na schön, die Bewegung wird mir guttun.«
Wir gingen den Flur entlang und die Treppe hinunter. Am hinteren Ende der Halle war alles still. Nur unsere Schritte klangen durchs Haus.
In Jasons winzigem Verschlag brannte Licht. Die Tür stand halb offen. Rechts auf dem schmalen Tisch fanden wir die Reste von Jasons Abendessen: Krümel, ein halbes Butterbrot, eine fast volle Tasse Kaffee. Zwei der Tischschubladen waren nicht ganz zugeschoben.
An der gegenüberliegenden Wand stand ein einfacher Holzschrank. Daneben hing eine Karte mit Jasons Privatadresse und Telefonnummer. In einer Ecke stand auf einem Brett ein Elektrokocher. Unter dem Tisch waren Kartons, ein Eimer, eine Teppichrolle und ein Werkzeugkasten gestapelt.
Für uns drei wurde es in dem Verschlag reichlich eng. Goslin lehnte sich an den Holzschrank, Terrel betrachtete das halbe Butterbrot und die Tasse Kaffee, ich lehnte mich zwischen dem Eckregal und einem alten Mantel, der an einem Haken hing, an die Wand.
Terrel legte die Hand an die Tasse und sagte: »Er ist kalt. Der Hausmeister muss schon ziemlich lange weg sein. Da er das Sandwich nicht aufgegessen und den Kaffee kaum angerührt hat, würde ich sagen, dass er es sehr eilig hatte. Was ist da in dem Holzschrank?«
Ich antwortete: »Leuchtröhren, Glühbirnen, ein paar Sicherungen, Desinfektionsmittel, Bohnerwachs.«
»Und in den Kartons da unter dem Tisch?«
»Keine Ahnung. Die stehen da schon ewig herum und verstauben.«
Er bückte sich nach den Kartons, hob den Deckel des Werkzeugkastens an und ließ ihn wieder fallen. Dann fragte er: »Wo sagten Sie, wird der Hauptschlüssel aufbewahrt?«
»Dort drüben in der einen Schublade, die nicht ganz geschlossen ist.«
Goslin sagte: »Ich habe schon nachgesehen.«
»Aber nicht in der Tabakschachtel ganz hinten in der Ecke«, erwiderte ich.
Terrel fand die Blechdose, aber nicht den Schlüssel. Nachdem er auch die übrigen Schubladen kontrolliert hatte, warf er mir einen Blick über die Schulter zu. »Aus irgendwelchen Gründen hatte es dieser Jason also doch nicht so eilig, denn sonst hätte er wohl nicht den Schlüssel mitgenommen.«
»Aber immerhin hat er seinen Mantel hängenlassen«, meinte ich.
Ich trat beiseite. Terrel fragte: »Der gehört ihm?«
»Ja, seit Beginn der kalten Jahreszeit hat er ihn jeden Tag angehabt.«
»Woher wollen Sie wissen, ob er nicht zwei Mäntel besitzt?«
»Das weiß ich nicht, aber wenn er einen anderen angezogen hat, warum sollte er dann die Handschuhe hiergelassen haben? Die stecken da in der Tasche.«
Ich klappte den Mantel auseinander, bis man das Futter sah.
Auch Terrel erblickte die Fransen des Wollschals, der in einem Ärmelloch steckte.
»Verdammt komisch«, murmelte Terrel vor sich hin.
»Vielleicht habe ich doch recht gehabt, Lieutenant«, sagte Gos- lin. »Er hat den Gartenzwerg oben erschossen, ist die Treppe ’runtergerannt und geflüchtet, ohne seinen Mantel und die anderen Sachen zu holen. Aber ohne Mantel wird er an einem so kalten Abend verdammt auffallen.«
»Wenn es so war«, warf ich ein.
Terrel fragte: »Wo soll er denn sonst stecken? Glauben Sie vielleicht, er ist noch irgendwo im Haus?«
»Nein, ich habe Ihnen doch von Anfang an gesagt, dass Jason kein Mörder ist. Selbst wenn ihn jemand noch so sehr gereizt hätte, er wüsste nicht einmal mit einem Revolver umzugehen. Er hat Angst vor Waffen.«
»Woher wissen Sie das so genau?«
»Weil ich ihn kenne. Er ist ein Angsthase.«
»Na schön, er hat’s also nicht getan. Aber wenn er Hals über Kopf davonrennt, muss er doch den Mörder kennen.«
»Da wird sich seine Versicherung gar nicht freuen«, sagte ich. »Er muss rennen und rennen.«
In Terrels Augen bemerkte ich wieder diesen versonnenen Blick. Der Lieutenant starrte mich eine ganze Weile an, ohne mich wahrzunehmen. Dann betrachtete er den Holzschrank.
Der Schlüssel steckte. Terrel öffnete die Tür, warf einen Blick hinein und murmelte: »Glühbirnen – Desinfektionsmittel – Bohnerwachs. Ihre Angaben stimmen.«
»Was haben Sie denn erwartet?«, fragte ich.
»Eigentlich nichts weiter. Aber ich hoffte irgendetwas zu finden, was Aufschluss darüber gibt, wo dieser Jason hingelaufen ist.«
»Ich dachte, Sie wären meiner Meinung«, sagte Goslin. »Wenn er nicht hierher zurückkommt, Lieutenant...«
»Dann werde ich sehr enttäuscht sein«, ergänzte Terrel.
Er stieß mit dem Fuß leicht an die Kartons unter dem Tisch, warf einen Blick in den Eimer und ging in die Hocke, um sich die Teppichrolle genauer anzusehen. Dabei warf er mir über die Schulter einen Blick zu und bemerkte: »Sie sind nicht der einzige, der eigentlich schon im Bett liegen müsste.«
Ich verstand. Vielleicht hatte ich es von Anfang an gewusst. Plötzlich drehte sich alles vor meinen Augen.
Während ich gegen das Gefühl der Übelkeit ankämpfte, sagte Terrel: »Ich hätte früher daran denken müssen. Jason hat sein Sandwich und den Kaffee stehenlassen. Sein Mantel hängt hier, die Handschuhe, der Schal...«
»Weil er alles nicht mehr brauchte«, ergänzte ich.
Goslin und Terrel schoben die Kartons, den Eimer und den Werkzeugkasten beiseite. Dann zerrten sie die Teppichrolle hervor.
Sie war nicht sehr lang. Mit einiger Mühe ließ sie sich in dem engen Raum ausrollen.
Dann sah ich Jasons totes graues Gesicht, das struppige graue Haar und die Stahlbrille. Sein Kopf lag auf dem Kissen, das er sich sonst auf seinem Stuhl immer hinter den Rücken geschoben hatte.
Das Fehlen dieses Kissens hätte mir eigentlich sofort auffallen müssen, als ich die enge Portiersloge betrat. Aber nun konnte ich mir denken, wozu es benutzt worden war, bevor man den Kopf dieses bescheidenen, freundlichen Mannes darauf bettete, der gestorben war, weil er zu viel wusste.
Zweites Kapitel
Ich brauchte nicht zu warten, bis der Gerichtsarzt und die Beamten der Mordkommission noch einmal aufkreuzten. Sie hatten in der engen Kammer auch ohne mich schon kaum Platz genug. Ich war doch nichts weiter als ein unnützer Zuschauer.
Kurz nach eins war ich wieder oben in meiner Wohnung. Ich fühlte mich hundemüde und zerschlagen, aber an Schlaf war natürlich nicht zu denken. Als ich mich aufs Bett warf und die Augen schloss, sah ich immer noch Jasons graues Gesicht vor mir, die Haarsträhne, die ihm in die Stirn fiel.
Am meisten beschäftigte mich die runde Stahlbrille. Dass ein Toter, der doch nicht mehr sehen kann, eine Brille trägt, das kam mir sehr seltsam vor.