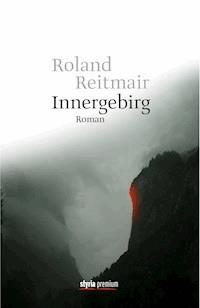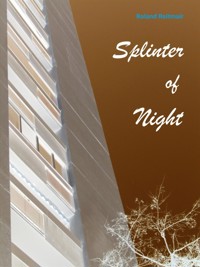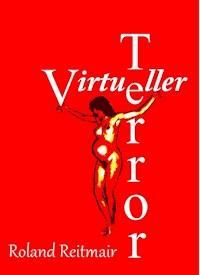Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nachspiel" erzählt die außergewöhnliche Geschichte einer Familie aus dem oberösterreichischen Mühlviertel, die aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen ist, Anfang der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts nach Bad Gastein auszuwandern. "Nachspiel" beschäftigt sich mit Zivilcourage, Widerstand gegen das Dritte Reich, sowie notwendigen Kompromissen, um zu überleben – und beleuchtet dabei die Mechanismen des Faschismus und deren Auswirkungen auf die nächste und übernächste Generation. Als Vorlage zu diesem Roman dienten mir die Erzählungen des Michael Reisinger und seiner Schwester Frieda – zwei Namen, die wie die Namen aller anderen handelnden Personen im Buch, frei erfunden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Reitmair
Nachspiel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Impressum neobooks
I
Zweige eines nahen Baumes schlugen ratternd an das große Glasfenster des Krankenhauses. Der Wind peitschte heftige Regenschauer gegen die Fassade.
Unter dem kleinen Dach vor dem Haupteingang stellte ein Mann den Kragen seines Mantels hoch und drehte den Sturmböen den Rücken zu.
Schwere Tropfen prasselten auf die Straße.
Gottfried saß mit versteinerter Miene in einem großen, dunklen Lehnstuhl im Wartebereich der Intensivstation. Die Uhr zeigte halb neun, doch draußen herrschte bleigraues Dämmerlicht. Er war kurz eingeschlafen und gerade erst wieder mit tauben Händen und einem von der Lehne schmerzenden Schulterblatt erwacht. Schon die zweite Nacht hatte er jetzt in seinem unbequemen Sessel verbracht. Er schüttelte die kribbelnde Hand, ballte sie zu einer Faust und streckte sie wieder. Bewegte die blutleeren Finger.
Gottfried fühlte sich müde und fertig, ohnmächtig, irgendwie sogar mitschuldig. Der Adolf. Was war ihm da nur eingefallen? Geht mit der Waffe auf den Bürgermeister los. Er kannte ihn doch gar nicht. Adolf war kein schlechter Mensch ... – Woher kam dieser blinde Hass?
Das dumme Versprechen vom Bürgermeister Edtauer vor der Wohnungsübernahme, dass auf die angrenzenden Felder nur mehr kleine Einfamilienhäuser gebaut würden ... ein sogenannter „Bauabschluss“ ...
Und dann war eben alles wieder einmal anders. Eine alltägliche Geschichte: Ein Bürgermeister, der nicht Wort hielt. Ein ganz normales Politikum. Ein Wahlversprechen von vielen. Eines mehr, das gebrochen wurde. Sicher, schäbig hatte er sich schon benommen, der Bürgermeister. Ein echter Politiker eben, aber das ...
„Sehen Sie wie gut, dass der Friedhof erweitert wird, sonst wäre kein einziges Grab frei für den Herrn Reisinger“, hatte der Depp von Messdiener gesagt, als er ihm im Gemeindeamt zufällig über den Weg gelaufen war. Hoffentlich brauchte die Friedhofsverwaltung jetzt nicht auch noch eines für den Bürgermeister ...
Elendige Wohnungsgeschichte. Gottfried stemmte die Beine gegen einen der hässlichen weißen Plastiktische. Und der Adolf war ja nicht einmal betroffen davon. Woher also kam sein Hass?
Er schüttelte unwillkürlich den Kopf. Der Zustand des Bürgermeisters war unverändert kritisch. Die Ärzte gaben sich zuversichtlich, weil die Kugel ohne Komplikationen hatte entfernt werden können. Aber nach wie vor wurde er in künstlichem Tiefschlaf gehalten. Seit drei Tagen.
Wenn er es sich recht überlegte, wusste Gottfried gar nicht genau, worauf er hier wartete. Er wollte einfach nur nicht heimgehen. Es stimmte natürlich, was die Tochter des Bürgermeisters gesagt hatte: „Und wenn Sie hier bis zum Jüngsten Tag sitzen, davon wird mein Vater weder schneller gesund, noch Ihr Cousin wieder lebendig ...“
Ja. Der Gustl würde nicht mehr lebendig davon, der Gustl.
Noch während dieser verfluchten „Anhörung“ mit dem Bürgermeister vor einer Woche hatte Gustls Gesicht eine ungesunde Röte überzogen. Nur wenige Stunden später war er friedlich eingeschlafen. Herzinfarkt. Mit zweiundvierzig Jahren.
Erst am nächsten Tag wurde er gefunden. Da war natürlich alles längst zu spät. Da konnte der Arzt nur mehr den Tod feststellen.
Gleich mit dem nächsten Zug ist Gottfried zum Onkel Michael gefahren, um ihm persönlich zu sagen, dass sein Sohn nicht mehr lebt. Der Gustl war Michaels einziges Kind, und immerhin war der Onkel ja nicht mehr der Jüngste.
„Gottfried!“, hatte er noch erfreut gesagt, doch im nächsten Moment gemerkt, dass was nicht stimmte. „Ist ... ist was mit dem Gustl?“
Gottfrieds Hand ruhte schwer auf Michls Schulter. „Ja ... Michl“, nickte er, „Der Gustl ... er ist ... tot.“
Onkel Michael zitterte. Kniff die Augen zusammen. Suchte Halt am Türrahmen und schwieg eine endlose Minute lang. Dann holte er tief Atem. „Komm rein.“ Er setzte sich verloren an den Tisch in der Küche, ließ Gottfried berichten.
Tränen liefen über sein faltiges Gesicht. Mit unsicherer Stimme fragte er, wann die Beerdigung wäre und ob er denn die paar Tage bei ihm in der Wohnung bleiben könnte.
Später erzählte er stockend und mit gebrochener Stimme, dass der August von Geburt an einen Herzfehler gehabt hatte. Die Ärzte hätten schon viel früher mit seinem Tod gerechnet. Er selber habe halt immer gehofft, er würde vor dem Gustl „dran“ sein, so wie es der Natur entspreche. Aber man muss das Leben akzeptieren wie es ist ...
„Wie der Gustl ein Kind war, und einfach nicht zu bändigen, haben wir, die Martha und ich, uns immer solche Sorgen wegen seinem Herz gemacht ... Der Martha ist das jetzt wenigstens erspart geblieben. Weißt
du, Gottfried“, sagte der Onkel weiter, „es gibt vielleicht nichts Schlimmeres als sein eigenes Kind zu beerdigen. Besonders, wenn es das einzige Kind ist ...“
*
Onkel Michl hatte sich kaum verändert. Vor ungefähr zwanzig Jahren hatte Gottfried ihn zuletzt gesehen. Auch damals war der Anlass ein Todesfall. Aber der Großvater war wenigstens schon dreiundachtzig.
Onkel Michael war immer freundlich, erkundigte sich, wie der Gottfried über dies oder jenes denke. Er hatte nie gefragt: „Was machst du jetzt eigentlich?“ – Wer was „machte“, wer was arbeitete, das wusste die ganze Familie immer ziemlich genau.
Die Frage wurde ihm vor zwanzig Jahren deswegen so oft gestellt, weil Gottfried damals nach einigen Alkoholexzessen die Arbeit bei der Rotax in Gunskirchen verloren hatte. Weil er dann von der Sozialhilfe lebte und in der Notschlafstelle wohnte.
Onkel Michael war der einzige in der Familie, der sich nicht sonderlich daran stieß. Zumindest ließ er sich nie etwas anmerken. Wenn sich irgendwer in seiner Gegenwart über Gottfried „das Maul zerriss“, sagte der
Michl nur, dass jeder für sein Leben selbst verantwortlich sei. Andere sollten nicht kritisieren, sondern es selbst besser machen … Der Gottfried ist ein gescheiter Bursch, nur weil er jetzt gerade einmal Probleme hat ... der schafft das schon.“ Vielleicht war es gerade dieses Vertrauen des Onkels, das ihm half, wieder auf die Beine zu kommen und mit der Sauferei aufzuhören. Und natürlich hat ihm der Gustl viel geholfen ...
Gustl war nicht nur irgendein Cousin, er war Gottfried lange der einzige Freund. Er holte ihn aus der Versenkung. Gustl arbeitete damals noch als Betreuer in der Notschlafstelle. Als er Gottfried dort das erste Mal sah, war er einigermaßen überrascht. „Was machst denn du da?“, staunte er ihn ungläubig an. Er war wahrscheinlich der einzige der Verwandten, der noch nichts von der „Karriere des schwarzen Schafs“ gehört hatte. Mit Gustl hatte er sich früher, bei den obligaten Familienfeiern schon immer gut verstanden. Er war ja auch kein Kostverächter in Sachen Wein.
Im November dann ist der Großvater gestorben. Noch im selben Jahr, schaffte Gottfried den Entzug. Seit diesem 17. Dezember rührte er nie wieder Alkohol an.
Etwa ein halbes Jahr später vermittelte ihm Gustl den Job bei der Voest.
II
Der Pfarrer wenigstens hatte noch versucht zu vermitteln. Nahm sich Zeit für die Anhörung mit den Anrainern beim Bürgermeister.
„Immer wieder einmal mit einem Kompromiss guten Willen demonstrieren“, hatte er gefordert, „vielleicht gibt es ja auch noch andere Lösungen.“
Der Edtauer lachte daraufhin aber nur sein dämlich süffisantes Lächeln und bat, es sollten doch alle am Boden bleiben und der Realität ins Auge sehen.
Fakt sei, dass Thalheim neue Wohnungen brauche. Das sei – wie er betonte – im Bauausschuss der Gemeinde so diskutiert und beschlossen worden. Hier biete sich eine Möglichkeit, bei der alle betroffenen Parteien zufrieden wären. Und die Anrainer hätten seit Jahren Bescheid gewusst, dass ihre Wohnbauten keinen Bauabschluss darstellen – sprich: dass die Nachbarflächen noch verbaut werden würden.
Gustls Augen blitzten zornig. „Ich verstehe nicht, warum man das Bauamt ausgerechnet mit Ausschuss besetzt hat!“
Da hatte plötzlich der Bürgermeister einen ungesund roten Kopf.
„Fairerweise sollte man sagen, dass bei der entscheidenden Gemeinderatssitzung zur Umwidmung der Flächen alle Fraktionen dafür gestimmt haben. Und nicht nur für die Umwidmung, sondern auch für die Bebauung und für den geplanten Wohnkomplex, welcher durch die Firma Novum des Herrn Zellinger realisiert werden sollte…“
Ursprünglich hätte gleich neben dem Friedhof eine neue Siedlung entstehen sollen – ein vergleichbarer Wohnkomplex“, führte er weiter aus, „Doch damit konnten Sie, Herr Pfarrer, sich nicht so richtig anfreunden. Die Kirche überlegte bereits seit langem wegen einer Friedhofserweiterung den Ankauf dieser Grundstücke in die Wege zu leiten. Nun war ihr die Gemeinde mit der neuen Flächenwidmung zuvor gekommen.
Also versuchten Sie durch einen Grundstückstausch gegen gleichwertige Felder am Ortsrand die Interessen der Kirche zu wahren ...“
Der Pfarrer nickte zwar, aber irgendwie beschlich einen das Gefühl, dass er sich vom Bürgermeister ausgebootet vorkam.
Seitens der Gemeinde hatte es zu den Anfragen der Kirche natürlich keine Einwände gegeben, solange der geplante Wohnbau realisiert würde. Er hatte sich also mit dem Abt von Stift Kremsmünster, dem Besitzer
besagter Felder, in Verbindung gesetzt und den Grundtausch organisiert – und nicht nur das: Weil die Zeiten nicht rosig waren und das Stift rote Zahlen schrieb, wurden auch gleich noch für weitere angrenzende Flächen, die zum Besitz des Stifts gehörten, Verkaufsoptionen herausgehandelt.
Die Herren waren sich einig. Der Rest war Formsache.
Dass dabei die Anrainer weder informiert noch befragt worden waren, davon hatte der Pfarrer allerdings nichts gewusst.
*
Gustl hatte als erster herausgefunden, was lief. „Da ist was faul“, ließ er Gottfried wissen, „angeblich wollen die da weitere Wohnblöcke hin bauen, anstatt Einfamilienhäuser ...“
Aus der Gemeinde hieß es auf seine Anfrage lapidar: Jeder Anrainer hätte ein entsprechendes Informationsschreiben erhalten. Und nachdem kein Anrainer protestiert und sich dagegen ausgesprochen hatte, würde nun eben gebaut.
Gustl fragte herum. Kein einziger Anrainer konnte sich an irgendein Gemeindeschreiben erinnern. „Hat wahrscheinlich die Post schlecht gearbeitet“, vermutete die Sekretärin in der Gemeinde.
Doch Rückscheinbriefe gehen nicht verloren. Diese Briefe waren erst gar nicht ausgeschickt worden.
Der Bürgermeister war bekannt dafür, dass er sich oft „großzügig“ über Amtswege hinwegsetzte, um unnötige Probleme zu vermeiden. Und er war vor allem aber auch dafür bekannt, dass er in Vorwahlzeiten allen möglichen Leuten alle möglichen Versprechungen machte – und mit seinem „Wort und Handschlag“ besiegelte.
Drei Jahre zuvor, gleich nach Fertigstellung des ersten Wohnkomplexes – eine Bezeichnung, die Gottfried besonders passend fand – hatte ihnen der Bürgermeister sein Wort gegeben, auf dem angrenzenden Grundstück würden höchstens noch sechs Einfamilienhäuser gebaut: „Sie können sich hier getrost eine Wohnung kaufen – ich verspreche Ihnen, dass die schöne Aussicht erhalten bleibt. Diese sechs Einfamilienhäuser werden der Bauabschluss – das heißt: keine weitere Verbauung der angrenzenden Felder.“
Da haben die meisten Wohnungsinteressenten, genau wie Gustl und Gottfried, beruhigt den Kaufvertrag unterschrieben.
Jetzt sah die Geschichte plötzlich ganz anders aus. Genaues wusste man anfangs ja nicht, fix allerdings war, dass Novum schon den Zuschlag für vier oder fünf Wohnblöcke habe – zu debattieren gäbe es da nichts mehr. Die Einfamilienhäuser-Siedlung war damit vom Tisch.
Einige Anrainer machten sich auf zum Bürgermeister. Der Herr war natürlich vielbeschäftigt und nicht gleich immer für jedermann zu sprechen. Völlig gestresst und mit den Vorwürfen konfrontiert, fiel er aus allen Wolken: „So etwas hab ich nie versprochen, könnte ich ja gar nicht ...“
„Doch“, sagte Gustl, „hast du!“
„Ich habe nie, ich betone, nie gesagt, dass dort Einfamilienhäuser gebaut würden. Im Flächenwidmungsplan waren zu der Zeit Einfamilienhäuser vorgesehen, davon werde ich wahrscheinlich gesprochen haben ...“
Er blickte auf die Uhr, „Und ich muss mich entschuldigen, leider hab ich noch einen wichtigen Termin beim Herrn Landeshauptmann.“
Gustl aber ließ nicht locker und folgte ihm in Richtung Auto.
„Du bist mir so ein Bürgermeister! Nicht vorbereitet bist, Ausred’ fällt dir auch keine ein und jetzt scheißt dich an und musst plötzlich zum Landeshauptmann.“
„Sparen Sie sich Ihre Unflätigkeiten, auf dem Niveau rede ich sowieso nicht mit Ihnen. Und ich wollte Sie nicht vertrösten. Im Gegenteil, ich hab mir extra die wenigen Minuten zwischen der Bauausschusssitzung und dem Termin beim Landeshauptmann für Sie freigenommen, um einen ersten Eindruck von Ihrem Anliegen zu bekommen.“
Jetzt sagte er plötzlich wieder „Sie“, damals im Bierzelt, vor der Wahl, hatte er ihm freundschaftlich das „Du“ angetragen.
„Ja dann sag uns eben noch schnell, dass das passt mit deinem Versprechen damals – dass du uns diese Wolkenkratzer nicht vors Küchenfenster hinstellen lässt“, sagte Gustl, „dann sind wir schon zufrieden, gehen und lassen dich in Ruh‘.“
„Das war erstens kein Versprechen und zweitens meinte ich damals nicht...“
„Du hast noch nie auch nur irgendwas so gemeint, wie du es gesagt hast, du hast nur ein Glück: nämlich kein Unternehmer zu sein, sondern Politiker. Als Unternehmer würdest du längst vor Gericht stehen. Leider sind zu viele Leute egoistische Ichmenschen. Die kaufst du mit deinen zweifelhaften Zusagen. Damit du nicht abgewählt wirst.“
Aber das war das letzte Mal, dass Gustl wegen irgendwas auf die Barrikaden stieg. Mit der Hand hielt er sich die Brust, während er mit einem bleichen, verkrampften Gesicht dahinwetterte.
Die Umstehenden lachten über seine theatralische Art und der Bürgermeister hatte plötzlich Oberwasser.
„Schau‘n Sie August, die Wohnungen sollten immerhin an sozial Bedürftige vergeben werden. Da konnte die Gemeinde nicht dagegen entscheiden. Es gibt so viele Menschen, die – wie ihr Cousin vor drei Jahren – unbedingt eine Wohnung brauchen. Sie wissen ja, ohne Wohnung keine Arbeit und umgekehrt. Hier sollen nun vom Land geförderte Wohnungen entstehen, die sich speziell eben auch Kleinverdiener leisten können. Wir von der Gemeinde werden die meisten Zuteilungen durchführen, damit sichergestellt wird, dass auch wirklich nur die Bedürftigen zum Zug kommen...“
Gustl ärgerte sich: “Weißt du was Bürgermeister, du lügst sobald du den Mund aufmachst. Und wennst es noch so schön daherredest, mich wirst du nicht einwickeln. Ich kenn‘ dich, da geht‘s um viel Geld, um das von deinem sauberen Freund Zellinger, aber auch um dein Geld. – Ich hab einen guten Tipp für dich“, spottete er, „Du solltest nach Italien gehen, Palermo, dort hast mit deiner Art sicher die besten Voraussetzungen für die Finanzverwaltung.“
„Jetzt beruhigen Sie sich doch August, ich hab doch damals lediglich gesagt, dass derzeit im Flächenwidmungsplan eine Einfamilienhausverbauung vorgesehen ist und zu der Zeit war das so. Jeder Mensch weiß doch, dass sich so ein Flächenwidmungsplan jederzeit per Gemeindebeschluss ändern kann.“
„Falscher Hund, falscher – aber wir hören uns noch! Pfiat di Bürgermeister“
„Ja pfiat di“
Ärgerlich stieg der Edtauer in seinen Mercedes und fuhr los. Gustl stand noch kurz unschlüssig vor dem Gemeindeamt, fluchte lautstark und schlurfte dann davon.
III
Die Marktgemeinde Thalheim bestand grob gesehen aus zwei Teilen – nördlich der ältere und historisch gewachsene Ortsteil an der Traun bis hinauf zum Schloss und der Kirche am höchsten Punkt, sowie der südliche Ortsteil dahinter am Kirchplateau und den angrenzenden Parzellen, wo sich erst seit kurzem die reichen Bürger der nahen Stadt Wels zwischen einzelnen alten Bauernhöfen ihre Villen bauen ließen.
Das Gemeindeamt befand sich im nördlichen und älteren Teil. Doch auch dieser gewachsene Ortsteil hatte eigentlich keinen Charakter. Erhaltenswerte „alte Bausubstanz“, Bürgerhäuser oder dergleichen gab es nicht. Der ganze Ort war ein bebautes Durcheinander ohne wirkliches Zentrum. Wo früher ausgedehnte Auen und Felder gewesen waren, wurde nun rigoros „umgewidmet“. Dort ein Einkaufszentrum, drüben das Dienstleistungszentrum, hier eine „Uferarkade“ zur Firmenansiedlung, und das Industriegebiet am Thalbach.
Nicht nur die Namen der Bauprojekte, sondern die ganze dahinterstehende Bebauungspolitik trieb seltsame Blüten. Wucherte wie bösartige Krebszellen. Gustl nahm den Gehweg durch den kleinen Wald oberhalb der Gemeindestraße hinauf zum Plateau. Über einige Steinstufen, die zur Umfriedung führten, erreichte man unweit der Kirche das wie eine Kapelle gestaltete Kriegerdenkmal. Meistens lagen dort Kränze. Kerzen brannten. Die Heimkehrer kümmerten sich rührend um die Gedenkstätten für ihre gefallenen Helden.
Gustl dachte an seinen Vater. Der war ein kommunistischer Widerstandskämpfer in diesem unseligen Krieg gewesen – außerdem hatte er überlebt. So gesehen schien er also sicher kein Held zu sein.
Der Vater. Mit seinen grauen, strähnigen Haaren. Als Mensch mochten ihn eigentlich alle, obwohl er mit seiner Einstellung überall aneckte.
Die eigenen Parteifreunde hatten es ihm verübelt, dass er bei einer Versammlung einmal sagte, Kommunismus und Christentum wäre nicht so verschieden, vor allem kein Gegensatz. Jeder wahre Christ wäre ihm lieber als die sogenannten Linken, die erst wieder nur den eigenen Vorteil im Auge hätten.
„Apparatschiks, die nichts Besseres im Sinn haben, als die neue Gesellschaft tot zu rüsten, um die andere Seite zu beeindrucken ...“
Die vom Vater in Schutz genommenen Christen hielten ihm dafür vor, dass er, wenn er auf Nächstenliebe vertrauen würde, ja wohl keine Revolution dazu brauche und keine Diktatur seines Proletariats. Dann könnte er doch auf die Kraft seines Glaubens bauen ... Aber den Glauben an einen lenkenden, denkend Gott hatte Gustls Vater spätestens in diesem Krieg verloren.
Ein paar Unverbesserliche wiederum – ewig Gestrige, mit denen er gelegentlich Karten spielte – schätzten ihn zwar, weil er nicht nachtragend war und darauf verzichtete „die alten Sachen wieder aufzuwärmen“, die sagten aber, dass er eben nur das andere Extrem gewählt hätte.