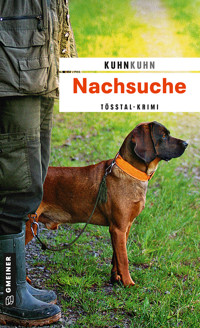
Nachsuche E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Polizist Noldi Oberholzer
- Sprache: Deutsch
Ein Hund und ein Jäger machen an einem Novembermorgen im idyllischen Tösstal eine grausame Entdeckung. Und schon hat Noldi, der Dorfpolizist, eine nackte weibliche Leiche am Hals, nach der kein Hahn zu krähen scheint. Weder jung noch attraktiv, kein Opfer eines Sexualverbrechens, ist sie auch uninteressant für die Presse. Doch kaum hat Noldi die Identität der Toten ermittelt, ist er umringt von Verdächtigen, die alle kein rechtes Alibi haben. Und die mit Alibi sind erst recht verdächtig …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kuhn Kuhn
Nachsuche
Noldi Oberholzers erster Fall
Zum Buch
Unerwartet Ein Hund und ein Jäger machen an einem Novembermorgen im Wald einen unerwarteten Fund: eine nackte, weibliche Leiche. Der Fall wird Noldi, den Polizisten Arnold Oberholzer, für Wochen in Atem halten, obwohl er findet, dieser Fall sei eine Nummer zu groß für ihn. Die Frau starb an einer Überdosis Insulin, und wäre sie nicht nackt im Wald gefunden worden, hätte ihr Tod als Selbstmord oder Unfall durchgehen können. Kaum hat Noldi jedoch die Identität der Toten ermittelt, sieht er sich plötzlich umringt von einem Kreis Verdächtiger, die alle kein rechtes Alibi haben. Diejenigen mit Alibi sind erst recht verdächtig, besonders der Garagenbesitzer mit seiner wunderschönen Frau, die nicht das ist, was sie zu sein scheint. Der Polizist muss sich auf die Nachsuche begeben, damit nicht ein Unschuldiger als Täter gilt und der Täter ungestraft bleibt.
Roswitha Kuhn studierte Germanistik und Slawistik in Graz sowie in Zagreb. Neben ihrer Tätigkeit als Bibliothekarin in Graz, Wien und am Tibet-Institut Rikon ist sie schriftstellerisch tätig. Gemeinsam mit ihrem Mann lebte sie bis zu seinem Tod 2016 in Rikon und Zürich. Jacques Kuhn absolvierte ein Ingenieurstudium in Zürich sowie den USA, führte mit seinem Bruder Henri bis zu dessen Tod und danach 15 Jahre allein das Familienunternehmen Kuhn Rikon AG. 1968 gründeten die Brüder auf Wunsch des XIV. Dalai Lama das Tibet-Institut in Rikon, das einzige tibetisch-buddhistische Kloster im Westen. Nach einer späten Heirat wagten sich KuhnKuhn in die Gefilde der Kriminalliteratur.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Emilia007 – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4172-1
Personen
Berti Walter, die Leiche, 43
Noldi (Arnold) Oberholzer, Kantonspolizist, 53
Meret, seine Frau, 49
Vreni, Tochter, 24, nennt sich Verena
Richard, Schwiegersohn, 27
Mark, deren erstes Kind, 2 Monate bei der Taufe
Peter, Sohn, 22
Felizitas, genannt Fitzi, Tochter, 16
Paul, Sohn, 11
Hans Hablützel, Wildhüter, 58
Betti, seine Frau, Merets Schwester, 54
Eugen Walter, ihr Vater
Ilse Biber, 39, Freundin
Menchuberta Assunta Garcia, verh. Walter, genannt Berti, 52
Shishi Tade, Chinesin, Putzfrau bei Walters
Kevin Pfähler, Besitzer von ›Kevins Blechparadies‹, 37
Corinna, seine Frau, 30
Eduard Rüdisühli, Autofahrer, 48
Ottilia, seine Frau, 44
Erika Meierhans, Sekretärin im Tibet-Institut
Hans Beer, Noldis Chef
Franz Notter, Markus Eidenbenz, Oskar Kohler, Ruedi Rathgeb, Polizeikollegen von Noldi
Tobias Hiestand, genannt der Beseler
Henrik Niederöst, Arzt
Milena, seine Frau
Stefanie, deren Tochter
Göpf Kläui, Notar
Regina, seine Frau
Vreni Narayan, Sekretärin im Notariat Kläui
Elsbeth Wehrli, Coiffeuse, 66
Karl Eugen Wehrli, ihr Mann, 69
Mariola, Coiffeuse 32
Khandro Wangmo, genannt Käthi, Tibeterin, 38
Bayj, Bayrischer Gebirgsschweißhund, 3
1. Falsche Fährte
Noldi, der Polizist, liegt im Bett und schläft. Seine Frau liegt neben ihm. Er hält mit der linken Hand ihre Brust. Kein Laut ausser ihren ruhigen Atemzügen stört die nächtliche Stille. Da schlägt das Telefon an. Noldi erwacht und flucht, Meret dreht sich auf die andere Seite. Endlich schafft er es, aus dem Bett zu kriechen und den Hörer abzunehmen.
»Polizist Oberholzer«, meldet er sich mit belegter Stimme.
Am Abend vorher ist es spät geworden. Er hat beim Kegeln einen Kranz geschossen, was selten vorkommt, und aus Siegesfreude ein Bier zu viel getrunken. Und wie es sein muss, ruft ausgerechnet in dieser Nacht einer an.
»Ist dort die Polizei?«, keucht die Männerstimme. »Sie müssen kommen, ich habe ein Reh angefahren.«
»Moment, Moment«, sagt Noldi, »wer sind Sie?«
»Rüdisühli, Eduard Rüdisühli, Sie müssen sofort kommen, ich brauche eine Bestätigung, Sie wissen schon, für die Versicherung.«
Noldi fragt: »Und das Reh?«
Darauf der andere: »Keine Ahnung, es ist weg.«
Noldi denkt, das arme Reh interessiert den Kerl überhaupt nicht. Unwirsch fragt er: »Und wo ist es passiert?«
»Zwischen Oberhofen und Neubrunn, die Kurve, wo der Wald bis an die Straße reicht.«
Noldi befiehlt: »Sie rühren sich nicht vom Fleck, bis jemand kommt.«
Dann unterbricht er die Verbindung, um sofort seinen Schwager, den Jagdaufseher, anzurufen. Der soll gehen, dazu ist er verpflichtet. Er, als Polizist, hat anderes zu tun. In diesem Fall, denkt Noldi schadenfroh, einfach wieder ins Bett zu kriechen.
Auch Hans Hablützel flucht, nicht weil es so früh ist, das macht ihm nichts aus. Er geht jeden Tag schon vor Morgengrauen ins Revier. Sondern wegen der Nachsuche. Angefahrene Tiere aufzuspüren, ist eine heikle Sache. Meist sind sie innerlich verletzt und hinterlassen kaum eine Schweißspur. Hablützel regt sich über die sinnlose Raserei der Autofahrer auf, die immer wieder zu solchen Unfällen führt.
Freude hat zunächst nur Hablützels Hund. Er glaubt, es ginge auf die Jagd. Als er aber sieht, dass sein Herr die Schweißleine vom Haken nimmt, zieht er sich eilig wieder in seinen Korb zurück. Er schätzt die Nachsuche nach verletzten oder verendeten Tieren bei Weitem nicht so wie eine Pirsch.
Hablützel dagegen findet, es sei eine gute Gelegenheit, Bayj wieder einmal richtig dranzunehmen, gerade weil er weiß, dass sein Hund von dieser Arbeit nicht begeistert ist.
»Also, Bayj«, sagt er, »raus!«
Der Hund folgt nur widerwillig. Man kann den Stimmungsumschwung deutlich an den müden Bewegungen seiner Rute erkennen.
Bevor Hablützel das Haus verlässt, nimmt er den stets bereiten Rucksack, stülpt sich den Hut auf den Kopf, und Bayj bekommt einen aufmunternden Klaps auf sein Hinterteil.
In der Garage springt der Hund wie immer als erster ins Auto. Sein Herr folgt, startet, hält draußen noch einmal, um das Tor zu schließen.
Es ist Anfang November, noch Nacht, neblig und kalt.
Hans Hablützel biegt in die Tösstalstraße ein. Sie führt durch ganz Turbenthal. Das alte Straßendorf, das erst später in die Tiefe wuchs, gehört zu jenen Siedlungen, die im Tösstal entstanden, als man für die Industrialisierung auf Wasserkraft angewiesen war. Vorwiegend Spinnereien ließen sich hier nieder. Noch heute kann man Überreste alter Leitungen und Kanäle entdecken, welche das Wasser aus künstlich angelegten Weihern ins Tal und auf die Wasserräder des aufkommenden Gewerbes leiteten.
Hablützel fährt bis zur Kirche mit dem Hahn auf der Turmspitze, an der man sieht, dass die Dorfbewohner vorwiegend reformiert sind. Erst mit dem Einzug der italienischen Gastarbeiter wurde ein katholisches Gotteshaus erbaut, sehr zum Ärger der Protestanten. Inzwischen gibt es auch eine Methodisten-Kapelle.
Hablützel hat vom Schwager nur die dürftigen Ortsangaben erhalten, welche der Autofahrer liefern konnte. Er biegt in Richtung Bichelsee ab. Das Tal, in das sie fahren, ist weit. Rechts und links der Straße liegen Wiesen, dann steigen bewaldete Hänge steil an.
Hans schmunzelt in sich hinein. Er weiß genau, dass der Schwager sich nach dem Telefonat sofort wieder ins warme Bett verkrochen hat. Er hat die krächzende Stimme gehört und erinnert sich noch zu gut an das feuchtfröhliche Fest vom Vorabend. Er kennt Oberholzer, der verträgt nicht viel. So ist sein unerwartetes Glanzresultat vor allem für die anderen Kegelbrüder ein willkommener Grund zum Anstoßen gewesen.
Als sie zu der Kurve kommen, von der Hablützel meint, die könnte es nach der Beschreibung des Schwagers sein, steht dort kein Auto.
Hans sagt zum Hund: »Jetzt hat Noldi dem Kerl so eingebläut, er dürfe sich nicht von der Stelle rühren. Und der haut einfach ab.«
Trotzdem steigt er aus, leint Bayj an. Der seufzt innerlich. Pflichtbewusst schnüffelt er ein wenig am Straßenrand. Hablützel führt ihn auf beiden Seiten der Fahrbahn auf und ab. Bayj lässt die Rute hängen. Das heißt: »Mein Lieber, hier gibt es nichts zu suchen.«
Prompt sagt sein Herr: »Dann fahren wir weiter. Da vorne ist noch eine Kurve, die infrage kommt.«
Bayj springt wieder in den Wagen, er hofft auf einen weiteren Flop. Doch beim nächsten Halt findet er die Spur sofort. Auch hier steht kein Auto. Dafür sieht Hablützel im Schein seiner Taschenlampe am Straßenrand einen Glassplitter liegen, der von einem Scheinwerfer stammen könnte. Er hebt ihn auf und steckt ihn in den Hosensack. Dann folgt er seinem Hund über die Böschung auf die Wiese. Zum Glück ist sie jetzt im Herbst gemäht, sonst müssten sie durch kniehohes, nasses Gras waten. Nach den ersten Schritten prüft er den Boden auf Schweiß. Tatsächlich findet er einige wenige Blutstropfen.
Jetzt geht es los. Der Hund prellt vor und legt sich in die Leine.
»Brav, Bayj, schön, such voran!«, ruft sein Herr ihm zu.
Bald erreichen sie den Waldrand. Dort geht es scharf bergauf und sie kommen nur mühsam weiter. Stellenweise muss Hans auf allen Vieren kriechen. Er hält sich an Wurzeln, Stauden, an allem fest, was ihm unter die Finger kommt. Immer noch ist es stockdunkel, wodurch jeder Schritt zusätzlich erschwert wird. Sogar für ihn, der als Jäger an solche Klettertouren gewöhnt ist, dauert es sehr lange, bis Bayj plötzlich die Nase hochwirft.
Endlich, denkt Hablützel. Doch irgendetwas stimmt nicht. Der Hund steht stocksteif, weiß nicht, soll er der Fährte folgen oder sich dem unbekannten Geruch von links zuwenden.
Wenn hier kein Reh liegt, überlegt Hans, warum tut der Hund dann so dumm? Mit einem unguten Gefühl kämpft er sich hinter Bayj in ein Brombeerdickicht. Nach wenigen Metern verhofft der Hund schon wieder und gibt Laut. Sich mühsam aufrecht haltend, zündet Hans mit der Taschenlampe in die nasse Finsternis. Links entdeckt er einen hellen Fleck. Er kriecht ein Stück näher und stellt fest, dass da ein Stofffetzen in den Dornen hängt. Ein Negligé, denkt er irritiert. So eines mit Rüschen daran hat er einmal seiner Frau geschenkt. Er nimmt Bayj an die kurze Leine und macht noch einen Schritt. Der Hund drängt zurück. Hans kann bei bestem Willen nichts als einen blassen Haufen ausnehmen. Er schaut und schaut, schwenkt die Lampe. Erst langsam dämmert ihm, was er da vor sich hat. Der Schreck fährt ihm in die Glieder. Da liegt einer, denkt er, Hals über Kopf unter den Stauden, fast nackt. Er muss sich überwinden, dann schiebt er, ganz vorsichtig, den Fuss vor und berührt den Körper, nur um sicherzugehen. Er weiß schon, dass sich nichts rühren kann. Tot, denkt er, tot.
Hastig zieht er den Hund zurück, sagt: »Platz, Bayj, Platz!«, und leint ihn rasch am nächsten Baum an. Dann reißt er das Handy aus dem Sack.
Noldi schläft inzwischen längst wieder selig neben seiner Frau. Doch sobald das Telefon läutet, kommt er rasch auf die Beine, als ahnte er bereits den Ärger voraus.
»Noldi«, sagt Hans, »du musst sofort kommen. Du glaubst es nicht. Da oben liegt kein Reh, sondern eine Leiche.«
»Bleib, wo du bist, rühr nichts an und halt den Hund zurück, ich bin gleich da!«, ruft Noldi erschreckt.
Er fährt in die Hosen, küsst seine Frau, sagt: »Ich muss weg, da ist eine verfluchte Schweinerei passiert.«
Meret lächelt noch verschlafen, hält mit einer Hand den Kopf ihres Mannes fest, während sie mit der anderen versucht, sein dünner werdendes Haar ein wenig zu glätten.
Noldi wirft sich ins Auto und rast los. Zum Glück ist es noch Nacht, keiner unterwegs und der Himmel stockdunkel. Erst an der Abzweigung nach Bichelsee sieht er talaufwärts den ersten Tagesschimmer.
Noldi surrt der Kopf. Kein Reh, denkt er, aber eine Leiche. Und wo ist der Rüdisühli?
Er findet den Wagen des Schwagers ohne Mühe. Als er dahinter hält und aus dem Auto springt, sieht er Hablützel über die Wiese stapfen.
»Bayj ist oben«, sagt der Schwager. »Ich bin heruntergekommen, dich zu holen. Allein findest du da nie hinauf.«
Der Regen hat in diesem Herbst früh eingesetzt, das Laub von den Bäumen geholt und die Böden in Schlamm verwandelt.
Sie marschieren los. Hans leuchtet mit der Taschenlampe. Der Hang ist zu steil, als dass sie viel zum Reden kommen. Noldi, nicht so geländegängig wie der Jäger, kämpft und schnauft, verwünscht die Nässe, den glitschigen Boden unter den Füßen.
»Du hast hoffentlich nichts angefasst«, stösst er zwischen zwei Atemzügen hervor, als sie einen Moment innehalten.
»Nein«, sagt Hablützel, »natürlich nicht. Nur kurz mit dem Fuss gestoßen. Da rührt sich nichts. Ich glaube, Noldi, wir haben eine Leiche am Hals.«
»Und Bayj?«
»Ist angeleint.«
Dann kriechen sie weiter bergauf.
»Da«, sagt sein Schwager endlich, »da sitzt Bayj. Und dort vorne ist es.«
Er deutet und leuchtet mit der Lampe.
Noldi sieht das dünne Gewebe im Gestrüpp. Ihm wird kalt.
»Du, das schaut wie ein Nachthemd aus.«
»Ein Negligé«, bestätigt Hans. »Betti hat auch so eines.«
Nur widerwillig schiebt Noldi sich näher heran. Hans hält sich dicht hinter ihm und leuchtet. Die Leiche liegt mit dem Kopf nach unten tief in den Brombeeren. Sie sehen nur ein Stück des Rückens und das hochgereckte Gesäß in einer zerrissenen Spitzenunterhose.
Noldi schnappt nach Luft. Dem breiten Becken nach zu schließen, handelt es sich um eine Frau.
Auf die Distanz können sie keine Verletzungen erkennen.
Noldis Karriere als Polizist war bis jetzt nicht von Leichen gesäumt. Klar hatte er immer wieder mit Toten zu tun. Er legte Hand an, sie aus den Wracks ihrer Autos zu befreien, Motorradfahrer, die ihre Fähigkeiten überschätzen, von Bäumen zu kratzen und Selbstmörder vom Strick zu schneiden. Es gab auch echte Kriminalfälle, Brandstiftung zum Beispiel. Damals hatte er sich mit Erfolg unter den Feuerwehrleuten nach dem Täter umgesehen. Es gab auch Tote, wenn sie einander im Suff die Schädel einschlugen. Da konnte er den Schuldigen meist neben dem Opfer verhaften. Aber eine weibliche Leiche im Wald in dieser obszönen Pose, das ist eine Nummer zu groß für ihn. Hablützel geht es ähnlich. Beide sind sie gestandene Männer, verheiratet, aber ohne viel Erfahrung mit anderen als den eigenen Frauen. So befällt sie jetzt eine jungenhafte Scheu, als sähen sie etwas, das nicht für sie bestimmt ist.
Ohne sich mit einem Wort darüber zu verständigen, gehen sie rückwärts Schritt um Schritt zu Bayj, der hoch aufgerichtet unter dem Baum sitzt und mit gespitzten Ohren das Geschehen verfolgt.
Zum Glück ist Noldi ein gesunder Pragmatiker. Statt der Beklommenheit nachzugeben, zückt er sein Handy und meldet der Kantonspolizei in Winterthur den Leichenfund.
Fast flüsternd fragt Hans: »Ist es wirklich eine Frau oder so ein Spinner, der in Damenwäsche herumirrt?«
Das hat sich Noldi im Stillen auch schon gefragt.
»Ich weiß nicht«, sagt er.
»Ich glaube«, meint Hablützel nach einer Weile, »dass es doch eine Frau ist.«
»Ja, wahrscheinlich«, antwortet Noldi einsilbig.
»Meinst du, sie ist vergewaltigt worden?«
»Keine Ahnung. Vielleicht war sie auch nur verwirrt und ist hier gelandet.«
Noldi weiß, wie unwahrscheinlich das ist, aber ihm wäre jede andere Lösung lieber als ein Sexualmord in seinem Bezirk. Tatsächlich ist es schon vorgekommen, dass Leute in geistiger Umnachtung von zu Hause weggelaufen sind und nicht mehr zurückfanden. Das waren aber meist Ältere. Und außerdem wüsste er es als Kantonspolizist, wäre jemand in der Gemeinde als vermisst gemeldet.
Sie schweigen und brüten vor sich hin.
Noldi denkt, wie wird das alles weitergehen?
Hans erinnert sich, dass er auf der Suche nach etwas ganz anderem war. Und auch der Hund denkt an die Witterung, die er aufgenommen hat, bevor er sich durch diesen fremden Geruch von der Fährte abbringen ließ. Das hat er davon, jetzt sitzt er da, angebunden, und sein Herr rührt sich nicht vom Fleck.
Der sagt endlich: »Da oben gibt es eine Forststraße. Vielleicht ist sie von dort heruntergestürzt.«
»Ja«, stimmt Noldi ihm zu. »Aber kaum von allein.«
Dann schweigen sie wieder.
Plötzlich hören sie auf der Straße unten ein Hupen.
»Du«, sagt Noldi, »die sind schon da. Die müssen geflogen sein. Ich gehe. Sie haben gesagt, ich soll sie einweisen.«
Damit rutscht er den Abhang hinunter.
Als er die Straße erreicht, ist zu seiner Verblüffung nicht die Polizei eingetroffen, sondern ein weiterer Personenwagen, in dem einer sitzt. Noldi geht zur Fahrertür und klopft ans Fenster.
Der andere lässt die Scheibe herunter.
»Was machen Sie da?«
»Das kann jeder fragen. Was wollen Sie und wer sind Sie?«
Als Noldi sich ausweist, sagt er: »Ah, der Herr Polizist«, und springt aus dem Wagen.
»Rüdisühli mein Name, wir haben telefoniert. Haben Sie das Reh gefunden?«
»Das Reh«, sagt Noldi verständnislos, klappt aber sofort den Mund wieder zu. Er hat das Reh vollständig vergessen. Das muss er dem Mann allerdings nicht auf die Nase binden. Er umrundet prüfend das Auto. An der rechten Vorderseite ist der Scheinwerfer eingeschlagen und der Kotflügel beschädigt.
Noldi fragt: »Wo waren Sie? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich nicht vom Fleck rühren.«
»Das habe ich«, erwidert Rüdisühli, »die längste Zeit. Aber keiner ist aufgetaucht. Da bin ich weggefahren. Ich brauchte dringend einen Kaffee.«
»Und haben Sie ihn bekommen?«, fragt Noldi automatisch.
»Ja, hat leider gedauert. Alles war noch zu.«
»Und wo?«
»In Bichelsee im Löwen«, antwortet der andere ungehalten.
Noldi überlegt während der unsinnigen Konversation, ob dieser Rüdisühli etwas mit der Leiche zu tun haben kann. Sie schaut zwar nicht ganz frisch aus. Aber vielleicht ist er an den Tatort zurückgekommen, warum auch immer. Da wäre er schön blöd, denkt er, wenn er sich jetzt freiwillig meldet.
»Was ist mit dem Reh?«, erkundigt sich Rüdisühli noch einmal.
»Wir suchen es«, sagt Noldi diplomatisch.
»Geben Sie mir Ihre Personalien, dann halte ich Sie nicht länger auf.«
Rüdisühli ist erleichtert, Noldi misstrauisch. Er nimmt die Daten auf.
Der Mann wohnt in Wil, St. Gallen.
»Wo waren Sie vorige Nacht?«
»In Eschlikon im Löwen«, gibt Rüdisühli zunehmend verärgert Auskunft.
»Wie lange waren Sie dort?«
»Bis gegen zwölf.«
»Und dann?«
»Bin ich auf den nächsten Parkplatz gefahren und habe geschlafen, wegen der Promille. Ich bin Vertreter für Landwirtschaftsmaschinen, da kann ich mir nicht erlauben, meinen Führerschein aufs Spiel zu setzen.«
»Aha«, sagt Noldi, »und was macht man dann zwischen Oberhofen und Neubrunn um fünf Uhr in der Früh, wenn man aus Eschlikon kommt und in Wil wohnt?«
Jetzt wird Rüdisühli wütend.
»Was geht Sie das an? Ich habe den Unfall gemeldet. Dafür will ich eine Bestätigung. Das ist alles.«
»Also, Herr Rüdisühli«, sagt Noldi, »dann können Sie jetzt fahren. Sie hören von uns. Wir stellen Ihnen die Bestätigung zu.«
Der andere steigt in den Wagen und fährt los. Noldi notiert noch schnell die Autonummer.
Rüdisühli überdenkt während der Fahrt seine Situation. Er ist achtundvierzig, gut aussehend, ein äußerst umsichtiger Mann. Soviel er sehen kann, überlegt er, hat er keine Fehler gemacht. Er hat ein Reh angefahren, doch das nützt ihm eher, als es ihm schadet. Er war nicht betrunken und es ist ihm nichts passiert. Er hat den Unfall ordnungsgemäß gemeldet. Seine Frau wird Mühe haben, ihm etwas vorzuwerfen, am allerwenigsten sein langes Ausbleiben.
Rüdisühli ist geschieden und wieder verheiratet. Aus seiner ersten Ehe hat er einen Sohn, von dem er nicht einmal weiß, was aus ihm geworden ist. Seine zweite Ehe blieb kinderlos. Scheidungsgrund war seine jetzige Frau, die ihm vollkommen den Kopf verdreht hat. Leider hielt seine Begeisterung für sie nicht an. Die Dame erwies sich, kaum verheiratet, als eher träge und ungepflegt. Von dem Feuer, das sie als seine heimliche Geliebte gezeigt hatte, blieb nicht viel mehr als Eifersucht.
Trotzdem führt Rüdisühli eine mustergültige Ehe. Er trägt seine Frau auf Händen und liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab – wenn er daheim ist, was jedoch selten vorkommt. Das bringen sein Beruf mit sich und das unstillbare Bedürfnis nach diesen hastigen, heimlichen Begegnungen mit anderen Frauen. Sie müssen nicht schön und jung sein. Seine Zielgruppe sind eher die so genannten einsamen Herzen, alleinstehende Frauen mittleren Alters, die, wider besseres Wissen, ihre Hoffnungen auf Männer wie ihn setzen. Wenn ihm das jeweilige Opfer, nachdem er es auf sein Erscheinen lange genug hat warten lassen, gleich bei der Wohnungstür mit einem seligen Seufzer in die Arme sinkt, fühlt er sich als toller Hecht. Er will keine Beziehung, auch Sex ist sekundär, er will nur dieses Gefühl von Macht, danach ist er süchtig. Sobald eine Frau beginnt, Ansprüche an ihn zu stellen, was früher oder später stets der Fall ist, tritt er den Rückzug an. Rüdisühli verheimlicht nie, dass er verheiratet ist. Und er macht von Anfang an klar, eine Scheidung komme für ihn nicht infrage. Seine Frau sei kinderlos und daher depressiv. Sie bringe sich um, wenn er sie verließe.
Er nimmt das Handy, das er auf den Beifahrersitz gelegt hat, und ruft zu Hause an.
»Hallo, Schatz!«, sagt er fröhlich, sobald seine Frau sich meldet. »Bist du schon auf? Ich komme. Gibt es einen Kaffee bei dir? Es war eine furchtbare Nacht. Ich erzähle dir alles, wenn ich da bin.«
Damit unterbricht er die Verbindung, bevor sie wie üblich wegen seiner Abwesenheit zu jammern beginnt. Er weiß, sie verdächtigt ihn der Untreue, nur beweisen kann sie ihm nichts. Dazu ist er zu geschickt. Er verwischt seine Spuren stets recht sorgfältig. Das Spiel ist riskant, aber da er bei seinen Abenteuern nie den eigenen Namen benützt und auch in den Details äußerst vorsichtig bleibt, glaubt er nicht, dass sie ihm so leicht auf die Schliche kommt.
Bei der nächsten Gelegenheit fährt er den Wagen von der Straße, hält und holt unter seinem Sitz ein weiteres Handy hervor.
Wieder sagt er: »Hallo Schatz, bist du schon auf? Wollte dir nur sagen, es war eine wunderbare Nacht mit dir.«
Die Frau am anderen Ende seufzt beglückt.
Rüdisühli lächelt fein und fährt fort: »Fast wäre es unsere letzte gewesen. Sei froh, dass es mich noch gibt. Um ein Haar hätte es mich erwischt. Mir ist ein Reh ins Auto gesprungen. Nein, nein, rege dich nicht auf, mir ist nichts passiert. Ich muss jetzt aufhören. Ich melde mich.«
Auch hier beendet er das Gespräch, bevor die Frau zu Wort kommt. Dann verstaut er das Handy wieder sorgfältig unter dem Sitz.
Inzwischen wartet Noldi an der Straße. Er reibt sich die Augen. Für einen Moment glaubt er zu träumen. Gleichzeitig taucht wieder die bange Frage auf, was da passiert ist und noch auf ihn zukommt. Er setzt sich schließlich in seinen Wagen, starrt wie blind durch die Windschutzscheibe. Trotz aller Befürchtungen ist er fast eingeschlafen, als die Winterthurer eintreffen.
Zuerst Bezirksarzt und Staatsanwalt. Sie kommen in einem Wagen, wie meistens. Die beiden können es gut miteinander. Auf dem Polizeiposten in Winterthur haben sie den Spitznamen ›Die Zwillinge‹. Gleich nach ihnen hält der blaugraue Kombi mit den Kollegen der Spurensicherung.
»Endlich«, sagt Noldi. »Der Wildhüter, der oben wartet, muss noch ein angefahrenes Reh suchen.«
Der Bezirksarzt, mit dem Noldi schon oft gearbeitet hat, klopft ihm auf die Schulter.
»Hallo, Noldi, was ist mit dir los? Du musst Halluzinationen haben. Wo hat man jemals so etwas gehört: Eine Leiche im Neubrunnertal. Das gibt es doch nicht.«
Er lacht.
Zu munter, denkt Noldi, für die Tageszeit. Aber alle auf dem Revier wissen, der Doktor macht die Arbeit gern und sehr genau. Für ihn ist es eine willkommene Abwechslung zum täglichen Einerlei in seiner Allgemeinpraxis.
Der Staatsanwalt sagt nichts. Er überlässt das Reden für gewöhnlich dem anderen. Immerhin nickt er bekräftigend.
»Denkt, was ihr wollt«, antwortet Noldi gutmütig, »ich führe euch jetzt hinauf.«
Er kennt die Herablassung der Kollegen gegenüber einem vom Land. Aus dem Tösstal noch dazu. Das ist für die Winterthurer wie hinter dem Mond. Während er sie über die Wiese lotst, malt er sich mit einer gewissen Schadenfreude aus, wie sie sich gleich mit ihren Utensilien den Hang hinauf schleppen werden.
Sie ziehen weiter über ihn her. »He, Noldi«, keuchen sie, »hättest du dir nicht einen noch blöderen Ort aussuchen können?«
Als sie nach dem mühseligen Aufstieg endlich oben ankommen, sind sie verstummt. Sie schnaufen und schwitzen, und Bayj, der Hund, denkt, dass sie nie eine Spur aufnehmen könnten bei dem Geruch, den sie selbst verbreiten.
»Da«, sagt Noldi und deutet, »da ist die Leiche.«
Plötzlich fühlen sich auch die Neuankömmlinge beklommen. Sie sind nicht abgebrüht genug, Gewalt und Tod gleichgültig zu begegnen. Einer versucht noch einen unpassenden Spruch, aber keiner lacht mehr.
Hablützel berichtet kurz, wie der Hund auf der Suche nach einem angefahrenen Reh die Leiche entdeckt hat.
Der Bezirksarzt sagt: »Also, ich schau sie mir jetzt einmal an.«
Er steigt in das Brombeergestrüpp, und sie hören ihn sagen: »Tot, und zwar nicht erst seit heute.«
Bevor er die Leiche bewegt, meldet sich der Fotograf, der seine Aufnahmen machen will.
Hablützel steht auf.
»Mich braucht ihr jetzt nicht mehr.«
Er bindet den Hund los.
»Komm, Bayj. Los, an die Arbeit. Hier sind wir nur im Weg. Wir gehen jetzt endlich unser Reh suchen.«
Sie steigen ein kurzes Stück den Hang hinunter, nehmen die ursprüngliche Fährte wieder auf, gelangen nach kurzer Zeit hinauf an die Waldstraße. Gleich oberhalb davon stösst Bayj auf das verendete Tier. Es liegt unter einem Busch und ist noch warm. Das heißt, es hat den Unfall um Stunden überlebt. Sonst wäre es bei den herbstlichen Temperaturen bereits ausgekühlt.
Hablützel lobt den Hund, verspricht ihm die übliche Belohnung und leint ihn schließlich am nächsten Baum an. Als er das Reh untersucht, stellt er fest, dass es an Ort und Stelle verblutet ist. Das Becken ist an der rechten Seite stark zerschlagen und ein Hinterlauf gebrochen. Das arme Tier muss sich auf drei Läufen bis an diese Stelle geschleppt haben, wo es aus Erschöpfung verendet ist.
Hablützel beginnt, es aufzubrechen. Nach der Jagd ist das eine Beschäftigung, der er sich gerne und in Ruhe widmet. Dabei lässt er in Gedanken noch einmal den Jagdverlauf vorüberziehen. Diesmal muss es schnell gehen. Bayj erhält als Belohnung die Milz, die er sich mit einem glücklichen Aufjaulen schnappt. Danach versorgt Hans Herz, Leber und die Nieren in einem Plastikbehälter, den er immer im Rucksack hat. Er holt die Eingeweide aus der Bauchhöhle und wirft sie mit dem zerschlagenen Bein ins Gebüsch. Das ist nicht die edle Waidmannsart. Doch die Füchse, denkt er, werden in der nächsten Nacht sicher aufräumen. Er stemmt das Tier hoch und dreht es so, dass es ausbluten kann. Schließlich ist er so weit. Er wischt die blutigen Finger im Laub am Boden ab, fischt sein Handy aus dem Sack und informiert Noldi, dass Bayj das Tier gefunden, und wo es gelegen habe. Dann schultert er das Reh und macht sich an den Abstieg. Er wird es auf dem Rückweg beim Metzger vorbeibringen. Unterwegs ruft er seine Frau an.
»Du«, sagt er ohne Einleitung, »da ist eine ganz grausige Geschichte passiert. Kannst dich auf etwas gefasst machen. Wir haben nicht nur das Reh gefunden, sondern auch eine Leiche.«
Bevor seine Frau ihn mit Fragen bombardieren kann, sagt er kurz angebunden: »Ich komme jetzt und will mein Frühstück. Ich bin halb am Verhungern.«
Kaum hat Hans aufgelegt, ruft seine Frau ihre Schwester an.
»Meret«, sagt sie atemlos, »stell’ dir vor, sie haben eine Leiche gefunden, dein Noldi und mein Hans. Irgendwo im Wald. Eigentlich hat Hans nach einem angefahrenen Reh gesucht. Das wird einen Wirbel geben.«
Meret seufzt.
»Das heißt, ich kann Noldi für längere Zeit abschreiben. Und erst Pauli. Wenn der das erfährt. Seit Neuestem will er Detektiv werden.«
Betti Hablützel seufzt ebenfalls und sagt: »Zum Glück hat Hans das Reh gefunden. Sonst wäre er wieder tagelang ungenießbar gewesen. Es wird immer schlimmer mit ihm. Zum Hund ist er freundlicher als zu mir.«
Meret unterbricht sie.
»Du, da ist jemand an der Tür. Tut mir leid, ich muss aufhören. Ich melde mich.«
Einen Moment lang hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Schwester anlügt. Aber sie kennt deren Litanei und weiß, wie der Schwager sein kann. Sie weiß auch, dass die Schwester den Trick durchschaut. Sie wendet ihn nicht zum ersten Mal an. Natürlich ist niemand an der Tür. Aber im Moment hat sie andere Sorgen, als sich die Eheprobleme ihrer Schwester anzuhören.
Die Oberholzers haben vier Kinder. Die Älteste, Verena, glücklich verheiratet, hat vor zwei Monaten ihr erstes Kind geboren. Peter, der Zweitälteste, absolviert eine Banklehre in Zürich. Nur die beiden jüngeren, die sechzehnjährige Felizitas, genannt Fitzi, und der elfjährige Paul leben noch bei den Eltern. Fitzi besucht das Gymnasium in Winterthur. Sie würde gerne Krankenschwester werden. Doch Noldi, der stolze Vater, hat mit seiner Tochter Größeres im Sinn.
»Du mit deinem Kopf«, sagte er einmal, »könntest Stadtpräsidentin von Winterthur werden.«
Es war als Scherz gemeint, doch insgeheim fand er die Idee nicht so abwegig.
Um Fitzi macht sich Meret keine Gedanken. Die Tochter, die geht ihren Weg, wickelt nicht nur ihren Vater mit ihrer klugen und nüchternen Art um den Finger. Sorgen bereitet Meret ihr Jüngster. Pauli ist ein aufgewecktes Kind. Er interessiert sich für alles, nur leider nicht für die Fächer, die in der Schule gefragt sind.
Rechnen und Rechtschreiben sind ihm herzlich egal. Bei Diktaten vergisst er die Hälfte, nicht weil er es nicht kann, sondern weil es ihn langweilt.
Meret hat schon wiederholt mit ihrem Mann darüber gesprochen, und sie haben vereinbart, dass er sich mehr Zeit für den Jungen nimmt. Doch wie es aussieht, würde er in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, wieder nicht dazu kommen.
Noldi und Meret sind seit fünfundzwanzig Jahren verheiratet. Es kam in dieser Zeit nicht allzu häufig vor, dass Noldi wegen eines Todesfalls gerufen wurde. Aber Meret erinnert sich lebhaft, wie ihr Mann sie bei ihrer ersten Verabredung sitzen ließ, weil sich einer im Dorf aufgehängt hatte. Sie sind trotzdem ein glückliches Paar geworden, und Meret hat nie bereut, einen Polizisten geheiratet zu haben.
Wie Meret vermutet, durchschaut Betti ihre Schwester. Sie versteht sie sogar, weiß selbst, dass sie zu viel jammert. Sie weiß natürlich auch, worüber sich Meret Sorgen macht. Sie kennt ihren Neffen Paul recht gut, hat ihn oft genug im Haus, denn Bayj, der Hund, ist sein bester Freund.
Betti ist keine Dumme, wenn sie ihr Licht auch meist unter den Scheffel stellt. Hans Hablützel erträgt die geistige Überlegenheit seiner Frau nur schlecht. Das ist einer der Gründe für seine Grobheit ihr gegenüber. Aber Betti liebt diesen Mann so, wie er ist, hat ihn von allem Anfang an geliebt.
Ein Motorengeräusch holt sie aus ihren Gedanken. Das ist Hans, denkt sie, stürzt zur Türe. Zuerst springt der Hund mit einem Satz aus dem Auto, dann folgt langsamer Hablützel. Er wirkt bedrückt.
»Erzähl«, fordert Betti, bevor er noch das Haus betreten kann, »was ist mit der Leiche? Ist das ein Witz?«
»Nein«, sagt Hans, überraschend sanft, »ob du es glaubst oder nicht. Es ist so, ich erzähle es dir, aber zuerst brauche ich einen Kaffee.«
Betti wird es warm ums Herz. Gleichzeitig denkt sie, dort im Wald muss es schlimm gewesen sein, wenn er plötzlich so milde gestimmt ist.
Sie hat in der Küche den Tisch schon gedeckt, der Kaffee steht bereit. Hans muss nur vorher noch ans Telefon. Er ruft den Obmann seines Jagdreviers an.
»Du«, sagt er, »wir haben einen weiteren Verkehrsunfall. Es hat schon wieder ein Reh erwischt. Hättest du Interesse an Leber und Herz?«
Der andere antwortet: »Nein, behalt sie. Du hast den Ärger gehabt.«
»Was heißt da Ärger?«, erwidert Hablützel. »So etwas ist noch nie passiert. Nachsuche nach einem Reh, und weißt du, was wir finden, der Bayj und ich? Halte dich fest. Eine Frauenleiche, halbnackt.«
Der andere ist platt.
»He, das musst du mir genau erzählen. Treffen wir uns am Abend? Wie immer um sieben, oben in der Jagdhütte. Abgemacht?«
»Abgemacht«, sagt Hans und legt auf.
Betti ist enttäuscht. Das heißt, er wird am Abend wieder nicht zu Hause bleiben. Und wenn er sich mit dem trifft, dauert es meist Stunden, bis er zurückkommt.
Trotzdem lässt sie sich nichts anmerken. Sie schenkt Kaffee ein, gibt zwei Löffel Zucker und Milch dazu. Rührt um und stellt ihm die Tasse hin.
Sie streicht ihm über den Arm.
»Da ist dein Kaffee. Und jetzt erzähl.«
Aber noch bevor ihr Mann mit dem Frühstück fertig ist, muss Betti los. Sie küsst Hans und ist gerührt, dass er sie nicht wie sonst ungeduldig wegschiebt. Sie hat einen frühen Termin für ihre Massage.
Jede Woche lässt sie sich in dem neuen Fitnesscenter massieren, das eine ihrer Bekannten betreibt. Sie legt großen Wert auf Körperpflege und tut alles, um für ihren Mann attraktiv zu bleiben. Außerdem trifft sie dort andere Frauen und kann über ihre Ehe reden. Sie haben alle ihre Probleme mit den Ehemännern oder Freunden. Entweder sie gehen fremd, trinken zu viel oder geben das ganze Geld für teure Autos aus. Das Thema ist unerschöpflich und mindestens so wichtig für das Wohlbefinden der Frauen wie die Massage, das Krafttraining und der gesunde Vitamin-Mix, den sie nachher an der Bar durch einen Trinkhalm schlürfen.
Kaum kommt Betti bei der Tür herein, ruft sie schon: »Stellt euch vor, mein Mann, der Hans, hat im Wald eine Leiche gefunden!«
Sofort wird sie zum absoluten Mittelpunkt. Die Frauen verlassen ihre Trainingsgeräte und scharen sich schwitzend um sie.
»Eigentlich«, berichtet Betti, »sollte er ein angefahrenes Reh suchen. Da liegt eine im Wald. Tot. Noch dazu halbnackt. Es war dunkel, er ist fast über sie gestolpert.«
»Weiß man, wer sie ist?«, fragt aufgeregt Martha, die Besitzerin des Fitnesscenters.
»Nein«, erwidert Betti, »noch nicht.«
Schon geht ein wildes Rätselraten los, wer das sein könnte. Jede überlegt, wen sie schon wie lange nicht mehr gesehen hat. Da sie aber nichts über die Tote wissen, außer dass sie nackt war, bleiben alle Überlegungen nur Geschwätz.
Der Bezirksarzt bestellt telefonisch den Leichenwagen, der die Tote ins Institut für Rechtsmedizin nach Zürich bringen soll. Es handelt sich tatsächlich um eine Frau, soviel wissen sie jetzt, untersetzt, ungefähr vierzig. Bei seiner ersten Untersuchung konnte der Doktor keine Anzeichen eines gewaltsamen Todes feststellen. Aber niemand von ihnen glaubt, dass sie sich selbst ins Dornengestrüpp gestürzt hat. Fragt sich nur, wer da die Finger im Spiel hatte.
»Für solche Spekulationen«, sagt der Bezirksarzt, »ist es noch zu früh.«
Dann klettern er und der Staatsanwalt mit Noldi zur Straße hinunter. Der Staatsanwalt erzählt, dass er in den letzten zwei Wochen drei Mal ausrücken musste. »Zwei«, sagt er, »waren Selbstmörder, der Dritte ein ungeklärter Todesfall. Und jetzt noch die da. Ausgerechnet im Tösstal. Übrigens, wird jemand aus der Gegend vermisst?«
»Nicht, dass ich wüsste«, antwortet Noldi.
»Also dann.«
Der Staatsanwalt winkt müde und steigt zum Doktor in den Wagen.
Der ruft Noldi zu: »Du bekommst Bericht, so schnell ich kann!«
2. Ohne Schuhe
Die Familie Oberholzer bewohnt ein Haus an der Sunnematt in Rikon. Der Ort gehört mit vier weiteren zur politischen Gemeinde Zell. In den letzten Jahren ist er mehr und mehr zu einem Schlafdorf verkommen. Arbeitsplätze gibt es kaum, seit die Spinnereien im Tösstal schließen mussten. Leute, die hier wohnen, pendeln nach Winterthur oder sogar nach Zürich. Rikon besitzt weder Kirche noch Polizeiposten, dafür einen Bahnhof. Die Eisenbahn, der sogenannte Tösstaler, ist das einzige öffentliche Verkehrsmittel, das Rikon mit dem Rest der Welt verbindet.
Als der Polizist in die Einfahrt seines Hauses biegt, ist der Vormittag schon fortgeschritten. Noldi lässt den Wagen vor der Garage stehen, in der die Familie neben den beiden Autos auch ihre Gartenzwerge, Werkzeuge, Velos und Gerümpel aufbewahrt.
Das Haus aus den frühen Fünfzigerjahren ist solide gebaut. Es besitzt ein an den Seiten weit heruntergezogenes Dach und eine kleine Treppe, die zum Eingang führt. Noldi steigt die fünf Stufen müde hinauf, öffnet die Haustüre, schließt sie hinter sich und dreht den Schlüssel. Dann atmet er ein paar Mal tief durch. Vor ihm liegt der Flur, der das Haus in zwei Hälften teilt. Auf der einen Seite befinden sich die große Küche mit Speisekammer, Dusche und WC sowie einem weiteren Raum, welcher der Familie als Garderobe dient. Die ganze andere Seite nimmt die Stube mit Blick auf den Garten ein. Sie ist lang, aber schmal. Ursprünglich waren es zwei Zimmer. Nachdem Noldi und Meret das Haus gekauft hatten, ließen sie die Wand herausbrechen und bauten eine Terrasse an.
Meret wuchs in Marthalen auf. Ihr Vater, René Bossart, war dort Bahnhofsvorstand, in der Gemeinde hoch geachtet. Er hatte einen prächtigen Schnauz und war überhaupt ein schöner Mann, groß, aufrecht, mit hellen Augen, den Kopf voller Locken, die seine Töchter von ihm geerbt haben. Seine Frau Regula dagegen war eine zarte, blasse Stadtzürcherin. Sie gebar zwei Töchter, denen sie die Namen Betti und Meret gaben, denn René Bossart war ein glühender Verehrer von Gottfried Keller. Sie führten keine besonders glückliche Ehe, aber die Kinder hielten sie zusammen, und sie waren stets freundlich zueinander. Betti, die Ältere, und die fünf Jahre jüngere Meret verbrachten eine sorglose Kindheit. Der Bahnhof Marthalen hatte damals drei Geleise. Bossart wohnte mit seiner Familie wie üblich im Bahnhofsgebäude im ersten Stock. Hinter den Geleisen besaß er einen Schrebergarten, in dem seine Frau Gemüse und Kartoffeln zog. Damals kam ein Bahnhofsvorstand zur Abfahrt eines Zuges noch aus dem Büro, setzte seine rote Mütze auf und blies ohrenbetäubend in die Trillerpfeife.
Bei Merets Geburt ereignete sich ein Unglück. Die Mutter ging mit ihrer älteren Tochter Betti in den Schrebergarten. Sie war hochschwanger und schleppte schwer an ihrem Bauch. In ihrer Mühsal ließ sie das Gartentor offen, das sie sonst wegen des Kindes immer sorgfältig geschlossen hielten. Die fünfjährige Betti spielte im Sand, während die Mutter Bohnen erntete. Plötzlich sah die Kleine ihren Vater auf der anderen Seite der Geleise. Sie ließ ihr Sandeimerchen fallen und stürzte aus dem offenen Gartentor, als gerade der Zug einfuhr. Das Kind wurde auf den Bahnsteig geschleudert. Wie durch ein Wunder blieb es bis auf blaue Flecken und Abschürfungen unverletzt. René Bossart weinte, als er seine gerettete Tochter in die Arme schloss. Seine Frau kam vor Schreck im Garten nieder. Aber auch dieses Kind war gesund und munter und brüllte, kaum geboren, wie am Spieß.
Im offenen Land aufgewachsen, hatte Meret am Anfang ihrer Beziehung zu Noldi über das Tösstal nur gelästert. So etwas, sagte sie, das sei absoluter Horror, nichts als auf einer Seite einen Hang, dann eine Wiese, die Straße, Bahnlinie, Wiese, den Fluss, Wiese und wieder einen Hang.
Trotzdem willigte sie ein, mit ihm das Haus in Rikon zu kaufen.
Für Noldi war es seine Heimat. Er hatte sich gerade nach Turbenthal versetzen lassen und wollte eine Familie gründen.
Vor Abschluss des Kaufvertrages fuhren sie nach Rikon, um das Haus noch einmal anzusehen.
Bevor sie wieder ins Auto stiegen, drehte Noldi seine Braut zu sich herum.
»Und, was ist?«, fragte er ein wenig ängstlich. »Kannst du dir vorstellen, hier mit mir zu leben.«
Wenn sie absolut nicht will, dachte er bei sich, müsste er sich wieder versetzen lassen. Das wäre schwierig, die Kollegen würden lachen, aber sollten sie. Es wäre ihm egal. Für diese Frau täte er alles.
Er war frisch verliebt, der Hochzeitstermin stand fest.
Doch Meret warf ihm die Arme um den Hals, küsste ihn heftig auf offener Straße und sagte: »Mit dir gehe ich überall hin, sogar an den Nordpol.«
Jetzt geht Noldi in die Küche. Sie ist leer, das Frühstücksgeschirr bereits abgeräumt. Nur die rotweiß getupfte Tasse, die ihm seine Tochter Fitzi einmal zum Geburtstag geschenkt hat, steht noch auf dem Tisch. Die Kinder sind längst in der Schule, seine Frau rumort irgendwo im Haus. Vor den Fenstern kann man im grauen Himmel die Sonne ahnen. Da wird ihm bewusst, dass er nicht mehr als ein paar Stunden weg war.
Er geht zurück auf den Flur. Die Kellertüre ist angelehnt und dahinter brennt Licht. Er ruft: »Hallo, ich bin’s.«
Meret kommt die Treppe heraufgelaufen.
»Die Waschmaschine spinnt«, sagt sie statt einer Begrüssung. »Ich kriege die Tür nicht mehr auf.«
Dankbar, dass es auf der Welt noch Haushaltsprobleme gibt, küsst Noldi sie auf den Mund.
»Komm«, sagt sie, »ich habe frischen Kaffee gekocht.«
Sie gehen gemeinsam in die Küche zurück. Noldi setzt sich an den Tisch, seine Frau gießt ihm Kaffee ein, er schaufelt Zucker dazu, rührt lange und heftig um. Schweigend.
Das liebt er an seiner Frau, dass sie ihn nicht bedrängt. Sie weiß, er redet, wenn er so weit ist. Aber jetzt braucht er Zeit, um den Fall aus der sicheren Distanz seines Hauses zu überdenken.
Nach einigen Minuten sagt Meret: »Meine Schwester hat schon telefoniert. Aber ich bin nicht ganz schlau geworden aus dem, was sie gesagt hat. Stimmt es, dass ihr eine Leiche gefunden habt, du und der Hans?«
Nach längerer Pause kommt ein Ja.
Meret setzt sich zu ihrem Mann, schenkt sich ebenfalls eine Tasse ein, trinkt, wartet.
»Es ist eine Frau. Sie ist in einem Brombeergestrüpp hängen geblieben. Mit dem Kopf nach unten. Nichts am Leib als einen zerrissenen Slip.«
»Die Ärmste«, sagt Meret. »Weiß man, wer sie ist?«
»Nein.«
Dann kommt Noldi in den Sinn, dass keiner von ihnen auch nur einen Augenblick an die Tote als Person gedacht hat. Für sie alle war sie Objekt einer polizeilichen Untersuchung. Jetzt denkt er, das war einmal eine lebende Frau, und versucht, sie sich vorzustellen.
»Sie muss etwas vorgehabt haben«, sagt er fragend zu Meret. »Spitzenunterhosen zieht man doch nicht ohne Grund an und dazu ein rosarotes Negligé. Glaubst du, das Zeug war für einen Mann gedacht, ihren eigenen, einen fremden, wofür sonst? Und was ist dann passiert? Ist er erschienen? Ist sie ihn in diesem Aufzug suchen gegangen, ihm nachgerannt, hat sie aus irgendeinem Grund den Verstand verloren?«
Meret dreht ihre Tasse in den Händen. Sie überlegt.
»Weiter als ein paar Meter kann sie so kaum gelaufen sein«, sagt sie dann. »Hatte sie Schuhe an?«
Noldi weiß es nicht. Darauf hat er nicht geachtet.
Meret sagt nüchtern: »Du hast dich geschämt.«
»Ja«, sagt Noldi, lauter als nötig.
»Warum eigentlich?«
»Keine Ahnung. Es war so obszön.«
»Außerdem«, fügt er schnell hinzu, »finde ich, ist das ein Fall für Winterthur.«
»Du weißt, dass es an dir hängen bleiben wird«, sagt Meret.
Noldi zuckt mürrisch mit den Achseln.
»Also, denk nach, woran erinnerst du dich?«
»An nichts«, brummt Noldi. Dann plötzlich: »Doch, ich erinnere mich, Hans hat etwas gesagt. Von einer Forststraße weiter oben.«
»Na also«, sagt Meret, »geht doch.«
Sie steht auf.
»Ich muss in die Waschküche, sehen, was die Maschine macht. Ich habe noch einmal ein Programm durchgelassen. Vielleicht geht sie jetzt auf. Bin gleich wieder da.«
Noldi sieht ihr nach, wie sie durch die Tür verschwindet.
Sie ist eine kräftige Frau, neunundvierzig. Sie lacht und redet laut und hat den Kopf voller brauner Locken, die langsam grau werden. Nach den Geburten hat sie zugenommen, aber ihre Figur ist immer noch beachtlich.
Vor ihrer Heirat war sie Handarbeitslehrerin. Ihre erste Anstellung hatte sie in Marthalen, ihrem Heimatort, nahe bei Winterthur. Damals war sie mit einem Kollegen befreundet, der ein Motorrad besaß, und sie hatte geraucht.
Nach der Heirat gab sie den Beruf auf, und sobald das erste Kind unterwegs war, auch die Zigaretten. Als Einziger hat ihr Jüngster, sehr zu seinem Ärger, ihre Locken geerbt. Er trägt sie stets kurz geschoren, weil er Angst hat, wie ein Mädchen auszusehen. Das will er nicht.
Meret steckt den Kopf noch einmal zur Tür herein.
»Übrigens, der Pauli ist sauer auf dich. Du hast ihm immer wieder versprochen, du nimmst ihn mit, wenn du ausrückst.«
»Aber«, sagt ihr Mann entsetzt, »ich kann ihn doch nicht zu einer Leiche mitnehmen.«
»Natürlich nicht«, antwortet sie. »Aber das wirst du ihm erklären müssen.«
Noldi macht sich ebenfalls Sorgen um seinen Jungen, aber im Moment interessiert ihn nur eines: Hatte die Leiche Schuhe an? Warum hat er nicht darauf geachtet?
Er trinkt den kalten Kaffee, denkt an die Tote im Brombeergestrüpp und ist unendlich glücklich, weil seine Frau lebt. Er stellt die leere Tasse in den Spültrog und rennt in den Keller, wo Meret dabei ist, die endlich geöffnete Waschmaschine zu leeren. Er hilft ihr schnell, die Leintücher aufzuhängen, sagt, schon bei der Tür mit einem verlegenen kleinen Kratzfuß: »Vielen Dank, Frau Oberholzer, mit Ihrem Tipp wegen der Schuhe haben Sie mir sehr geholfen. Ich fahre noch einmal hin.«
»Ausgerechnet vor dem Mittagessen«, bemerkt seine Frau trocken. »Pauli wird noch wütender sein, wenn du nicht rechtzeitig zurück bist. Ich hoffe, du drückst dich nicht.«
Noldi stürzt davon, grunzt etwas Unverständliches. Er muss jetzt in den Wald. Er ist sicher, er wird das alles dort mit anderen Augen sehen.
Er fährt ins Neubrunnertal, stellt das Auto ab, stapft wieder über die Wiese, den Hang hinauf. Der Tag ist immer noch grau, aber zumindest heller als am Morgen. Sie alle, die hier auf und ab gestiegen sind, haben einen Trampelpfad ausgetreten. Geknickte Ästchen markieren den Weg. Die Brombeerranken haben sich noch nicht wieder aufgerichtet. Neben dem Gestrüpp, in dem die Leiche lag, findet er eine Rolle Absperrband, das die Kollegen vergessen haben. Die Fundstelle ist nicht gesichert.
Noldi betrachtet diesmal alles ganz genau, er findet keine Spur von Damenschuhen, so sehr er auch sucht. Wohl kann er den einen oder anderen verrutschten Fußabdruck im nassen, schweren Lehm erkennen. Die stammen eindeutig von den Kollegen. Sie sind zu frisch. Dann, überlegt er, müsste man Zeichen von ihrem Sturz sehen. Auch da ist nichts, keine Schleifspur im Laub, keine abgebrochenen Zweige. Noch einmal kontrolliert er den Boden. Er geht waagrecht zum Hang, Stufe um Stufe höher, stochert im Laub, hebt da und dort ein Ästchen auf, bis er oben beim Forstweg ankommt. Auf ihm wandert er ein gutes Stück in jede Richtung. Die Reifenspuren stammen alle von einem schweren Fahrzeug. Wahrscheinlich wurde hier Holz abtransportiert.
Als Pauli aus der Schule kommt, ist er so beleidigt, dass er kein Wort mit dem Vater spricht. Sonst begrüßt er ihn immer freudig, springt an ihm hoch wie ein junger Hund.
Jetzt schaut er ihn nicht einmal an, sondern stopft das Essen stumm in sich hinein. Sie sind nur zu dritt. Fitzi, die Tochter, ist noch in der Schule.
Meret tritt ihren Mann unter dem Tisch.
»Entschuldige«, sagt Noldi zu seinem Sohn, »dass ich mein Versprechen nicht gehalten habe.«
Da wird Pauli erst recht wütend.
»So gemein«, platzt er heraus.
»Pauli«, sagt Meret warnend.
Sie ist eine liebevolle und großzügige, aber konsequente Mutter, einen solchen Ton duldet sie nicht an ihrem Tisch.
»Ist doch wahr«, mault der Kleine.
Noldi bietet seinem Sohn als Wiedergutmachung an, mit ihm gemeinsam den Fundort der Leiche zu besichtigen.
»Und wenn du willst«, sagt er aufmunternd, »fahren wir gleich nach dem Essen los.«
Im Neubrunnertal, klettern sie den Hang hoch. Als sie die Stelle erreichen, sagt Pauli enttäuscht: »Aber da ist keine Leiche.«
»Nein, die ist schon in der Rechtsmedizin«, stimmt Noldi zu. Dann sagt er: »Komm, schau mich an, Pauli. Würdest du die tote Frau wirklich sehen wollen?«
Der Junge hebt den Kopf. Seine Augen sind dunkel vor Angst und Entschlossenheit.
»Ja.«
Noldi überlegt, dann sagt er: »Bei dem ersten Toten, den ich gesehen habe, nach einem Verkehrsunfall, habe ich gekotzt.«
Darauf antwortet Pauli ernst: »Ich habe die Großmutti auch gesehen, als sie tot war, und mir ist nicht schlecht geworden.«
»Nein«, gibt Noldi zu, »du hast dich großartig gehalten.«
Plötzlich bricht es aus Pauli heraus: »Ich will Detektiv werden.«
Er sagt es mit fester Stimme. Dabei schaut er so kindlich und verletzbar aus, dass Noldi ihn am liebsten in die Arme gerissen hätte. Er unterdrückt die sentimentale Anwandlung, weil er sich rechtzeitig erinnert, wie peinlich ihm das in dem Alter gewesen wäre.
Außerdem geht ihm durch den Kopf, dass eine alte Frau, die mit siebenundachtzig friedlich in ihrem Bett eingeschlafen ist, im Tod fast noch ein Lächeln auf dem Gesicht, und die halb nackte Leiche in ihrer obszönen Stellung zwei sehr verschiedene Dinge sind. Während er noch grübelt, wie er Pauli das erklären könnte, sagt der Junge: »Da müsste man mit dem Bayj her.«
Noldi antwortet: »Aber der Onkel war mit ihm schon hier.«
Pauli würde ihm gern erklären, dass der Hund da nach einem verletzten Reh gesucht hat. Das ist etwas ganz anderes. Doch er sagt nichts. Sein Vater ist Polizist, kein Jäger, denkt der Junge in einer Art kummervoller Zärtlichkeit. Er, Pauli, aber meint, man müsse als Detektiv auch wie ein Jäger denken.
Nachdem er seinen Jüngsten zu Hause abgeliefert hat, fährt Noldi wie immer am Freitag ins Büro. Es liegt am oberen Dorfende von Turbenthal gleich nach der reformierten Kirche. Das Haus, in dem die Kantonspolizei sich eingemietet hat, gehört einem Bauunternehmen. Der Raum ist durch eine Theke abgeteilt. Vorne stehen drei Stühle und in der Ecke eine verstaubte Plastikpflanze. Im immergrünen Laub hängt ein echter dürrer Ast. Den hat Meret, Noldis Frau, eines Tages dort montiert. »Damit«, sagte sie, »die Pflanze echter aussieht.«
Auf der Theke liegen Berge von Prospekten. Da gibt es Unterlagen über Fahr- und Schleuderkurse, über Hundetraining, Formulare für die Anmeldung zur Fahrprüfung ebenso wie für einen Platz im Altersheim. Hier kann man Bußen bezahlen, damit man dazu nicht nach Winterthur muss. Man kann Diebstähle und Einbrüche melden, Vermisstenanzeigen aufgeben, Hundemarken oder Autobahnvignetten beziehen. Die Kantonspolizei hat im Zuge der Rationalisierung ihre Posten in den Dörfern geschlossen und sich auf Büros in Zürich und Winterthur beschränkt. Deshalb gibt es in Turbenthal nur mehr Schalterstunden. Nachmittags von Montag bis Freitag. Noldi versieht den Dienst hier allein. Nur für die Ferien hat er eine Vertretung.
Es gibt Tage, da kommt niemand, höchstens ein Bekannter auf einen Schwatz, oder Meret, die ihm ein Stück Kuchen bringt, wenn sie in der Migros und beim Ehriker Beck einkaufen war.
Einmal besuchte ihn auch sein Sohn Pauli, der sich dafür in aller Form vom Turnunterricht abgemeldet hatte. Er sagte, er habe eine Vorladung bei der Polizei in Turbenthal. Die Lehrerin war neu und noch unerfahren. Sie wunderte sich, ließ ihn aber gehen. Die Sache flog auf und Pauli fasste eine saftige Strafaufgabe. Er musste einen Aufsatz über seine Vorladung bei der Polizei schreiben. Erst weigerte er sich, aber Meret kannte kein Erbarmen. Er ist ein recht guter Aufsatzschreiber, sein Stil flüssig, seine Schilderung lebhaft und seine Fantasie grenzenlos. So kam es in seinem Aufsatz über den Besuch beim Vater auf dem Polizeiposten auch zu einem Überfall mit einer wilden Schießerei, die sie nur heil überstanden, weil sie sich unter dem Schreibtisch verschanzten.
Noldi lächelt in Erinnerung an die Räubergeschichte seines Sohnes. Pauli wurde von der Lehrerin sogar gelobt, weil sich in dem Aufsatz nicht allzu viele Rechtschreibfehler befanden.
Die Neuigkeit vom Leichenfund hat bereits am Vormittag aus dem Fitnesscenter blitzschnell die Runde gemacht und trägt Noldi am selben Tag noch drei sogenannte Hinweise aus der Bevölkerung ein.
Als Erstes ruft einer an, als Noldi gerade die Post holen will. Ein Mann am anderen Ende sagt, er hätte eine wichtige Mitteilung zu machen. Am Donnerstag sei er mit dem Mountainbike unterwegs gewesen und im Wald einer Frau begegnet, die er noch nie zuvor dort gesehen habe.
Noldi erkundigt sich, wo genau das gewesen sei. Die Stelle ist weit vom Fundort entfernt. Außerdem lag die Leiche zu dieser Zeit schon in den Brombeeren. Er lässt sich die Personalien des Mannes geben und erinnert sich an ihn. Es ist ein chronisch Arbeitsloser, der ständig mit allen möglichen Tricks versucht, an Geld zu kommen.
Tatsächlich erkundigt sich der Anrufer sogleich, ob es eine Belohnung gebe.
»Bis jetzt noch nicht«, sagt Noldi und legt auf. Er geht vor die Tür, um die Post aus dem Briefkasten zu nehmen. Da sieht er in der Einfahrt jemanden stehen, der unschlüssig von einem Fuß auf den anderen steigt. Er nähert sich ihm vorsichtig, um ihn nicht zu verscheuchen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt er.
Es ist ein kleiner, abgezehrter Mann um die fünfzig, ein Asylwerber, der mit seinen paar Brocken Deutsch herauszufinden sucht, um wen es sich bei der Toten im Wald handelt.
Noldi sagt freundlich: »Kommen Sie ins Büro!«, bietet ihm dort einen Stuhl an.
Der andere hat sichtlich Angst. Er folgt ihm nur zögernd, hinsetzen will er sich auf keinen Fall. So steht er da, knetet seine Hände und ringt um Worte.
Es dauert eine geraume Weile, bis Noldi aus dem Mann schlau wird.
Er berichtet, er sei zu einer Prostituierten gegangen.
Gute, gute Frau. So drückt er sich aus, weil er nicht weiß, wie er es sonst sagen soll. Sie hatten es schön und sie sagt, bald wiederkommen. Von dem Moment denkt er an nichts anderes mehr als an diese Frau. Schon nach zwei Tagen kratzt er sein letztes Geld zusammen, will wieder zu ihr. Doch sie ist weg. Nicht mehr da, und keiner weiß, wo sie ist.
Den hat es erwischt, denkt Noldi, der muss grausam verliebt sein, wenn er sogar zur Polizei kommt, um die Frau wieder zu finden. Im Allgemeinen meiden Asylwerber die Polizei wie der Teufel das Weihwasser.
»Der Täter?«, fragt sich Noldi. Er mustert ihn genauer. Die scharfen Falten in dem hageren Gesicht erzählen von einem schweren Leben.
Immerhin könnte der Hinweis eine brauchbare Spur sein. Doch nach der Beschreibung, welche er dem Mann mit viel Geduld entlockt, ist die Frau nicht älter als zwanzig.
Als Noldi ihn um seinen Ausweis bittet, sieht es so aus, als würde der Mann davonlaufen. Noldi versucht ihn zu beruhigen, sagt, die Frau würde bestimmt wieder auftauchen. Er verspricht ihm, sich zu melden, sobald er etwas herausfindet.
Der Mann schaut ihn lange an. Er glaubt ihm nicht. Noldi kann es an seinen Augen erkennen. Er lässt ihn gehen, beobachtet ihn, wie er leicht gebückt durch die Tür verschwindet. Nur zögernd schließt er sie hinter sich.
»Trotzdem«, sagt sich Noldi, »war dieser Hinweis nicht vergebens.« Der Mann hat ihn auf eine Idee gebracht.
Er weiß, dass in seiner Gemeinde und in der ganzen Nachbarschaft niemand als vermisst gemeldet ist, auf den die Beschreibung der Toten nur annähernd passt. Das heißt, ihr Verschwinden wurde nicht gemeldet. Ist sie Ausländerin? Eine Illegale? Ist es möglich, dass sie aus dem Puff in Kollbrunn kommt? So wie sie aussah, wohl kaum. Aber, denkt er, das muss er überprüfen.
Er setzt sich an den Computer, um sich die Website des Hotels Pamplona anzusehen. Vielleicht, denkt er, haben sie Fotos von den Frauen im Internet, und staunt nicht schlecht, was er da alles findet. Das als Hotel getarnte Bordell bietet Wohnungen an, Studios, Zimmer, vermerkt eine Waschküche mit zwei Waschmaschinen und zwei Tumblern. Alle Stockwerke, heißt es extra, sind rollstuhlgängig. Im Parterre gibt es den Cabaret-Betrieb und Tabledance. Als er allerdings die Fotos der Mädchen ansehen will, steht da, die Bilder der Künstlerinnen, ha, Künstlerinnen, denkt Noldi, sind, um deren Anonymität zu schützen, nur im Member-Bereich zugänglich. Login und Passwort gebe es ausschließlich für Gäste persönlich an der Bar.
Noldi seufzt. Dann muss er selbst dort vorbeischauen, denkt er. Vielleicht hat er bis dahin schon ein Bild von der Toten, das er zeigen kann.
Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und schaut sich um. Alles scheint wie immer: schäbig, staubig und vertraut. Er fragt sich für einen Augenblick, ob die Ereignisse vom frühen Morgen Wirklichkeit seien. Dann sieht er die Post auf seinem Schreibtisch und der Alltag holt ihn wieder ein. Er zieht den Stapel heran und blättert ihn durch. Viel Gescheites ist nicht darunter, Werbung, die Regionalzeitung ›Der Tössthaler‹ sowie ein Kuvert aus Zürich. Noldi reißt es auf, überfliegt es.
Es handelt sich um das Dossier über seinen Schwager, den Jagdaufseher.
Das war eine leidige Geschichte: Hablützel nahm im Spätsommer als Gast an einer Jagd in Buch am Irchel teil. Die Bauern forderten von den Jägern, so viele Wildschweine wie möglich abzuschießen, weil die Tiere große Flurschäden verursachen. Hans hatte Pech und erwischte eine Sau, die er nicht hätte schießen dürfen, weil sie noch säugte. Das ist ein Straftatbestand.
Der Schwager schilderte ihm den Vorfall. Er sagte, er hätte genau aufgepasst. Eine Wildsau, die irgendwo im Unterholz ihr Versteck hat, verlässt es stets nur kurz und kehrt dann rasch zu den Jungen zurück. Hans beobachtete das Tier längere Zeit im freien Feld und schoss erst, als er sicher war, dass es ein Einzelgänger war. Doch wie sich herausstellte, waren ihre Milchdrüsen noch geschwollen. Sie wurden herausgeschnitten und ins Labor geschickt.
Nun ist der Befund zurück mit dem Vermerk, das Verfahren gegen Hablützel sei eingestellt. Das Tier habe zwar in einer Zitze Milch gehabt, in der anderen jedoch nur mehr eine krümelige Substanz, was als Zeichen gilt, dass sie nicht mehr gesäugt habe.
Noldi ist für seinen Schwager erleichtert und will ihm sofort Bescheid geben.
Er greift zum Telefon.
»Glaubst du, dass es einer aus der Gemeinde war?«, fragt Hablützel sofort, als Noldi sich meldet. »Hast du einen Verdacht? Weiß man schon, wer die Tote ist?«
»Das«, antwortet Noldi, »sind viele Fragen auf einmal. Eigentlich rufe ich an, um dir zu sagen, dass die Sache mit der Wildsau vom Tisch ist.«
Hans reagiert kaum.
»Ah ja«, sagt er nebenbei und bohrt sofort weiter, »ehrlich, Noldi, kannst du dir vorstellen, dass es jemand aus der Gemeinde ist? Muss es ja fast. Wer sonst kennt sich im Neubrunner Wald aus?«
»Das hat etwas«, gibt Noldi zu. »Aber so weit bin ich noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie vermisst wird. Muss das erst überprüfen.«
Hablützel sagt düster: »Da hinten wohnen ein paar Familien. Kann mir zwar vorstellen, dass der eine oder andere Dreck am Stecken hat. Aber Mord, das ist etwas anderes.«
»Wenn es Mord ist«, wirft Noldi ein. »Auch das wissen wir noch nicht.«
Hablützel widerspricht ihm. »Du selbst hast gesagt, dass sie nicht von alleine dort hingekommen ist.«
»Ja, aber das ist auch schon alles, was zurzeit einigermaßen feststeht. Der Rest ist Spekulation. Aber, Hans, du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Ich werde mich bei denen im Tal einmal umhören. Vielleicht haben die irgendetwas bemerkt. Grüß Betti von mir. Ich melde mich.«
Damit legt er auf, wendet sich wieder dem Computer zu und loggt sich in die internen Polizeiberichte ein. Er will schauen, ob in der Umgebung eine Frau vermisst wird, deren Beschreibung auf die Tote passt. Nicht, dass er sich viel davon verspricht. Wenn es so wäre, wüsste er es, aber er will auf Nummer sicher gehen.
Noldi ist kein Freund von Schreibtischarbeit, deshalb begnügt er sich nicht mit den Meldungen im Computer, die alle negativ sind, sondern hängt sich wieder ans Telefon. Er ruft die Kollegen in den Nachbargemeinden an, erkundigt sich, ob sie etwas über eine alleinstehende Frau mittleren Alters mit etwas eigenartigen Lebensgewohnheiten wüssten, Männerbesuche, auffallende Kleidung, Drogen, übermäßiger Alkoholkonsum, irgendetwas.
Nachdem ihm niemand weiter helfen kann, tut er etwas, das eigentlich nicht erlaubt ist.
Er schließt das Büro vor Ende der Schalterstunden, heftet einen Zettel mit seiner Handynummer für Notfälle an die Tür und fährt noch einmal ins Neubrunnertal. Dort geht er von Haus zu Haus und fragt, ob jemandem etwas aufgefallen sei. Ob irgendetwas in den letzten Tagen anders war, und seien es nur Kleinigkeiten. Eine fremde Frau, ein fremder Mann, ein Paar, ein Auto, das da irgendwo an der Straße, in einer Einfahrt für längere Zeit gehalten habe, vielleicht eine leere Weinflasche im Straßengraben.
Niemand weiß etwas, will möglicherweise etwas wissen. Sie zucken die Achseln, schütteln die Köpfe. Einer sagt: »Da fahren dauernd Wagen vorbei bis eins, zwei in der Nacht.«
Noldi muss keine Visitenkarten verteilen mit dem Spruch, falls jemand noch etwas in den Sinn kommt. Die meisten kennen ihn und versprechen bereitwillig, sich zu melden. Aber alle wissen ebenso gut wie er, dass sie es kaum tun werden.
Mit dieser mageren Ausbeute kehrt Noldi nach Turben-thal zurück. Er beschließt, beim Ehriker Beck vorbeizufahren und einen Nachtisch für den Abend zu kaufen. Und eine Kleinigkeit für sich selbst. Er findet, das habe er sich verdient. Doch bevor er den Laden betreten kann, ereilt ihn der dritte Hinweis dieses Tages in Gestalt einer Tibeterin aus Rikon. Sie ist schon als Kind in die Schweiz gekommen. Ihr Name lautet Khandro Wangmo, aber im Dorf heißt sie bei allen nur Kathi. Seit sie eine Praxis für tibetische Massage eröffnet hat, hört sie diesen Schweizer Namen nicht mehr gern.
Sie kommt im dümmsten Moment daher. Noldi ist gerade mit der Entscheidung beschäftigt, ob er sich ein Eclair oder eine Cremeschnitte gönnen soll.
»Herr Oberholzer!«, ruft sie.
»Hallo, Kathi«, sagt er mürrisch.
Er kennt die Frau noch aus der Zeit, als es mit ihrem halbwüchsigen Sohn Probleme gab. Damals hieß es, der Junge habe im tibetischen Kloster an der Wildbergstraße Geld aus dem Spendenkorb gestohlen. Der Verdacht konnte allerdings nie bewiesen werden. Inzwischen ist von dem Jungen nicht mehr die Rede, dafür umso mehr von der Mutter, die eine auffällige Erscheinung ist mit ihren Gewändern und dem ein wenig exaltierten Gehabe.





























