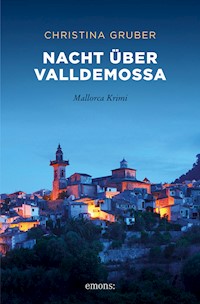
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mallorca Krimi
- Sprache: Deutsch
Mallorcas dunkle Seite Wer hat den alten Millionär Horst Hallter vor zwanzig ahren in seiner Villa bei Valldemossa getötet? Inspector Héctor Ballester will genau das herausfinden, wie immer tatkräftig unterstützt von Privatermittlerin Johanna Miebach und ihrer Enkelin Gemma. Gemeinsam kommt das Trio einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur, das weit in die Vergangenheit reicht. Doch die Uhr tickt – denn am nahenden Silvestermorgen verjährt die Tat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christina Gruber ist freie Autorin, Journalistin und Medienberaterin sowie Dozentin für Digitaljournalismus, Content-Marketing und Storytelling. Sie ist mit einem Polizisten verheiratet. Wenn sie nicht gerade mit ihrem Mann die Welt bereist, schreibt und arbeitet sie in Köln und auf Mallorca.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer mit einem Motiv von lookphotos/Jürgen Richter
Lektorat: Jana Budde, Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-793-4
Mallorca Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die
Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Auf Mallorca ist die Stille unergründlicher als anderswo.
George Sand, »Ein Winter auf Mallorca«
Prolog
Der Mann ging schweigend den Gefängnisflur entlang. Graue Betonmauern, gelbe Gitterstangen vor den Fenstern. Draußen regnete es in weichen Schlieren. Durch die hellen Stäbe sah er die abgeernteten Felder, die Weiden, die Autobahn M-609 mit ihrem rastlosen Gewimmel, Autos und Lastwagen. Dahinter, weit in der Ferne, lag Madrid.
Ein Wachmann schloss ihm die Eisentür auf, die zu einem weiteren Flur und von dort aus in den schmucklosen Saal führte, in dem die Strafgefangenen Besucher empfangen durften.
So oft war der Mann diesen Weg schon gegangen. Doch nicht seine Familie erwartete ihn, nicht seine Liebste, sondern Pater Stephan. Seit fast zwanzig Jahren immer nur Pater Stephan. Sie waren zusammen alt geworden, der Häftling und der Geistliche, der im Centro Penitenciario Madrid V in Soto del Real für die Seelen der deutschen Strafgefangenen betete.
Dem Mann war Pater Stephan seit jeher ein Rätsel gewesen. Voller Sorgen, voller Befürchtungen. Ein ängstlicher Geistlicher, schmal und klein, der so wirkte, als hätte Gott ihn schon vor langer Zeit verlassen.
Zusammengekauert hockte der Pater am Tisch beim Fenster und starrte auf seine Hände. Der Mann grüßte ihn und setzte sich. Für eine Weile sagten beide kein Wort. Die anderen Gefangenen unterhielten sich leise mit ihren Familien und Freunden, eine Frau schluchzte.
»Du bist spät dran. Die Besuchszeit ist schon fast vorbei«, sagte Pater Stephan weniger vorwurfsvoll als gleichgültig.
»Ich habe meine Strafe abgesessen. Übermorgen kann ich diesen gastlichen Ort für immer verlassen«, erwiderte der Mann ironisch. »Wenn du meine Seele bis jetzt nicht gerettet hast, wird daraus sowieso nichts mehr.«
Der Pater putzte seine Brille, setzte sie auf und rutschte auf seinem Stuhl noch ein Stück in sich zusammen. »Weißt du, was du nach deiner Entlassung machen wirst?«
Ja, das weiß ich, dachte der Mann düster. Aber er würde es ganz sicher nicht dem Pater verraten, seinem einzigen Besucher in all den Jahren. Sie waren nie Freunde geworden.
»Ich werde wohl irgendwohin fliegen, vielleicht nach Mallorca«, antwortete der Mann vage.
Pater Stephan schluckte. »Das halte ich für keine gute Idee«, murmelte er beunruhigt. »Du kannst in ein Wiedereingliederungsprogramm in Deutschland, das weißt du. Ich habe dir doch die Broschüre gegeben.«
Das Heftchen mit den gut gemeinten Ratschlägen, wie Menschen nach langen Haftstrafen wieder in die bürgerliche Gesellschaft zurückfanden, lag bereits ganz unten im Papierkorb der Zelle. Der Mann nickte geduldig. »Ich weiß, Stephan. Aber ich mache ein bisschen Urlaub, schnuppere Freiheit. Auf Mallorca.«
»Nach allem … was dort passiert ist?« Pater Stephan zwinkerte nervös. »Willst du die Vergangenheit aufwühlen? Das geht selten gut.«
Er sprach es nicht aus, natürlich nicht. Dem Seelsorger war es nur einige wenige Male gelungen, das Wort auszusprechen. Mord.
»Das ist lange her«, sagte der Mann. Seine grünen Augen glommen.
Eingehend betrachtete Pater Stephan die Kerben und Schrammen auf dem Tisch zwischen ihnen. Es schien so, als wollte er etwas sagen, tat es aber nicht.
Ein Gong ertönte, der das Ende der Besuchszeit ankündigte.
Der Pater räusperte sich, beugte sich hinunter und wühlte in seiner ledernen Aktentasche, die neben ihm unter dem Tisch stand. »Falls du einen Job oder eine Wohnung brauchst, guck mal in die Kleinanzeigen.« Er zog eine deutschsprachige Wochenzeitung aus Mallorca aus der Tasche. »Habe ich für meine Schwester gekauft, die liest die gern. Aber nimm sie nur.« Er betreute zeitweise auch die deutschen Häftlinge im Gefängnis von Palma und reiste zwischen den Haftanstalten hin und her.
Der Mann griff nach der Zeitung und rollte sie zusammen. »Danke. Nicht nur für die hier. Für alles.«
Umständlich setzte Pater Stephan die Brille ab und steckte sie in die Brusttasche seines Hemdes. »Das ist doch meine Christenpflicht.« Er stand auf, nahm seine Jacke vom Haken an der Wand und hob die Tasche auf. »Ja dann. Das war mein letzter Besuch. Ich wünsche dir alles Gute.«
Der Mann stand ebenfalls auf. Ein unspektakulärer Abschied nach zwanzig Jahren. Das passte zu Pater Stephan.
»Ja dann«, echote der Mann. »Dir auch alles Gute.«
Sie gaben sich nicht die Hand.
Pater Stephan wandte sich zum Gehen, drehte sich an der Tür um. »Ich habe dich nie gefragt, aber nun tue ich es. Warst du es? Du hast es vor Gericht geleugnet. Aber du hast deine Strafe verbüßt, deshalb frage ich dich: Warst du der Mörder?«
»Spielt das noch eine Rolle?« Nein, dachte der Mann. Was war, ist vorbei. Es gibt nur noch das Morgen, es gibt nur noch die Zukunft.
Pater Stephan verschwand durch die Eisentür.
Der Mann sah ihm nach. Adios, Pater, dachte er. Dieser Abschied ist für immer.
Zurück in seiner Zelle, setzte sich der Mann an den Tisch vor dem Fenster. Vor den Stäben rauschte unaufhörlich der Regen. Die langen, weichen Schlieren wichen harten Böen, der Wind riss an den Büschen draußen auf den Feldern, peitschte über die versprengten Rinder auf der Weide.
Zwanzig lange Jahre. Und er hatte jeden einzelnen Tag gewusst, was er als Erstes tun würde, sobald er das Gefängnis verlassen würde. Er würde sie suchen. Und finden. Um jeden Preis.
Er atmete tief ein und aus, öffnete und schloss die Augen. Sein Blick fiel auf die Zeitung. Ein Fenster zum Leben, das in zwei Tagen endlich sein Leben sein würde. Das Leben draußen, ohne gelbe Stäbe. Er schlug das Blatt auf.
In Palma de Mallorca gab es Streit um die Kosten für die geplante Weihnachtsbeleuchtung der Stadt. Meteorologen warnten vor Herbstunwettern auf der Insel. Der Fußballclub Atlético Baleares hatte ein Spiel verloren. Der lokale Zusammenschluss der Händler in Llucmajor vergab einen Preis für das nachhaltigste Sortiment.
Der Mann überflog die nächsten Seiten und stockte plötzlich. Er keuchte auf, rückte die Leselampe näher und hielt die Zeitungsseite darunter.
»Llucmajor: Preis für Nachhaltigkeit geht an ›Gecko Galdent‹« lautete die Headline.
Auf dem Archivfoto waren eine zierliche ältere Dame und eine große, sportliche junge Frau zu sehen, die vor dem hübsch dekorierten Schaufenster eines Ladenlokals standen. Darunter las er: »Johanna Miebach (74) und ihre Enkelin Gemma Miebach (21) führen das ›Gecko Galdent‹ in Llucmajor, zu ihrem Sortiment gehören nachhaltig produzierte Gewürze, Öle, Essige und ausgewähltes Kunsthandwerk von der Insel.«
Es war fast lächerlich, lächerlich einfach gewesen. Er hatte sie gefunden. Und sie waren auf Mallorca. Das Schicksal hatte ihm diese Zeitung gebracht, davon war er überzeugt. Der kleine, ängstliche Erzengel Stephan, der heilige Sankt Sorgenfalte.
Er schmunzelte in sich hinein, schließlich brach er in schallendes Gelächter aus. Sein Plan stand fest. Schon lange.
Teil 1
Väter
Wir waren seit drei Wochen in Establiments, als die Regenperiode einsetzte. Bisher hatten wir herrliches Wetter gehabt, die Zitronenbäume und die Myrten blühten noch.
George Sand, »Ein Winter auf Mallorca«
1
Drei Monate später
Johanna Miebach hatte ein schlechtes Gefühl. Ein ganz schlechtes Gefühl. Sie rutschte unbehaglich auf dem harten Plastiksitz am Gate C70 des Flughafens Köln/Bonn hin und her. Der Flug nach Palma war längst angekündigt. Die dazugehörige Verspätung auch. Ihr war kalt, der Sitz war unbequem. Gemma ging nicht ans Telefon. Héctor auch nicht.
Sie drehte ihren Gehstock. Was war nur los daheim?
Von ferne juchzte eine hohe Frauenstimme. »Johanna! Hannilein! Wie wunderbar, dich zu sehen.«
Johannas Laune sackte in den Keller. Das Unglück kam in Gestalt ihrer Finca-Nachbarin Angelika Bernhard durch die Flughafenhalle herangerauscht. Angelika war beladen mit etwas, das sie selbst vermutlich als »Handgepäck« bezeichnete, jeder andere jedoch als Expeditionsausrüstung betrachtet hätte. Auf das Rollköfferchen hatte sie einen voluminösen Edelanorak mit Pelzkragen geschnallt, um ihre Schulter schlang sich eine vollgestopfte Basttasche, an der ein pinkfarbenes Reisekissen baumelte, dazu trug sie zwei prall gefüllte Plastikbeutel mit dem Werbeaufdruck aus einem Flughafengeschäft und einen Shopper aus bunten Lederflicken.
Johanna mochte Angelika, eigentlich. Sie war – objektiv gesehen – eine hilfsbereite, freundliche Frau Mitte fünfzig, die lediglich ein bisschen viel redete, sehr neugierig war und stets jeden noch so dubiosen Klatsch glaubte und herumerzählte. Leider war Johanna nicht nach einem Plausch, doch der war nicht mehr abzuwenden. Sie würden zusammen zurück zu ihrer Heimatinsel Mallorca fliegen, und Angelika würde es garantiert gelingen, im Flugzeug einen Platz neben Johanna zu ergattern, egal, was auf ihrem Ticket stand.
Johanna ergab sich in ihr Schicksal. Sie selbst trug lediglich eine braune Lederhandtasche und eine beige Steppjacke, die sie sich um die Schultern geschlungen hatte. Das restliche Gepäck hatte sie abgegeben.
Umstandslos drückte Angelika ihr eine Einkaufstüte und die Basttasche gegen die Knie. »Ich wusste, dass ich jemanden mit Kapazität treffe«, sagte sie fröhlich.
Sie trug wie so oft eine Sonnenbrille als Haarreif im kurzen gefärbten Blondhaar. Johanna hatte noch nie gesehen, dass sie die Brille tatsächlich auf der Nase hatte.
»Mit dem ganzen Kram lassen die mich nicht in den Flieger, aber wenn wir das unter uns aufteilen, geht es.« Angelika fummelte das Reisekissen vom Henkel der Tasche. »Das nehme ich so«, murmelte sie, während sie ihre restlichen Habseligkeiten sortierte.
»Wo ist die zweite Duty-free-Tüte?«, rief sie hektisch und wühlte in der Basttasche.
»Die hast du mir eben vor die Füße geworfen«, antwortete Johanna geduldig und zog den Beutel hervor. »Außerdem – wir fliegen nach Mallorca. Da kannst du doch gar nicht steuerfrei einkaufen.«
Angelika grinste. »Da ist ja auch nur Wäsche drin. Ich hatte zu viel Gepäck und habe den Rest in alten Duty-free-Tüten verstaut. Die erlauben sie meistens, weil sie denken, ich habe was am Flughafen gekauft. Zack, schon brauche ich kein Übergepäck zu zahlen.«
Johanna fand das zwar clever, aber umständlich. »Und warum buchst du nicht einfach einen Koffer dazu?«, tadelte sie und musterte den sündhaft teuren Anorak. Angelika konnte es sich schließlich leisten.
»Hilfe, nein! Ich bin doch keine Touristin. Und ich war nur für zwei Tage in Köln, ich habe doch kaum was mit.« Sie raffte ihre Siebensachen zusammen. Der Flug war aufgerufen worden. »Wo sitzt du?«
»4F«, sagte Johanna.
»Perfekt! Ich habe 12B, aber ich setze mich einfach zu dir. Ich muss dir dringend etwas erzählen.«
Johanna hatte es ja geahnt.
Sie reihten sich in die Schlange zum Boarding ein, dahinter führte die Tür zum Fingerdock und ins Flugzeug. In der Maschine warf sich Angelika sofort auf den jungen Mann, der Anstalten machte, sich auf 4E niederzulassen. Er hatte keine Chance gegen sie, akzeptierte sein Schicksal sofort und gab den Platz kampflos auf.
Nachdem Angelika ihr Gepäck in drei verschiedenen Fächern verstaut hatte, ließ sie sich schwer atmend neben Johanna fallen und schob den Ledershopper in den Fußraum. Sie reckte den Kopf über die vorderen Sitze, bevor sie sich umständlich anschnallte. In der Reihe vor ihnen saßen drei Männer im mittleren Alter, die sich Kopfhörer aufgesetzt und die Augen zu einem Nickerchen geschlossen hatten. Der Gangplatz neben Angelika war frei, die Reihe hinter ihnen war besetzt von einem nervösen Paar mit lautstark quengelndem Kleinkind. Die beiden versuchten gerade, eine Katastrophe abzuwenden.
»Wo ist der Schnuller? Du hattest ihn doch eben noch. Hast du ihn eingesteckt?«, fragte die Frau bebend.
Ihr Mann hustete nervös. »Oh Gott, nein, ich dachte, du hast …« Seine Stimme ging in einem ohrenbetäubenden Schrei unter. Sie fingen an, hektisch in allen Taschen nach dem Schnuller zu fahnden.
»Na, die sind beschäftigt.« Angelika wandte sich zu Johanna. »Wie gesagt, ich muss dich unbedingt sprechen. Du warst ja bestimmt ein halbes Jahr nicht daheim«, sagte sie mit vorwurfsvollem Ton.
Johanna fand, dass Angelika zu Übertreibungen neigte. »Drei Monate.«
»Und Gemma ist auch laufend unterwegs. Nach dem großen Unwetter habe ich sie oft draußen im Garten gesehen, es gab ja viel aufzuräumen. Aber seit zwei Wochen nicht das kleinste Lebenszeichen.«
Damit sprach Angelika den Sturm mit heftigen Regenfällen und Überschwemmungen an, der die Insel im Oktober heimgesucht hatte und bei dem dreizehn Menschen ums Leben gekommen waren. Gemma hatte danach angerufen, um zu bestätigen, dass das Haus noch stand.
»Ach.« Johanna wurde ein wenig bang. Warum war Gemma seit zwei Wochen nicht im Haus? Und warum ging sie noch nicht einmal mehr ans Handy?
Der Flieger rollte zur Startbahn, was Angelika ein heiteres »Es geht los!« entlockte. Sie zog Magazine, Taschentücher, eine Rolle Minzdrops und ein Buch aus ihrer übervollen Tasche, warf alles auf den leeren Sitz neben ihr und lehnte sich zurück.
Johanna hingegen war besonders wach und aufmerksam. Unfälle im Flugverkehr, das wusste sie, ereigneten sich oftmals beim Start – und bei der Landung. Ein kluger Mensch hatte ihr mal empfohlen, sich auch zum tausendsten Mal die Sicherheitshinweise des Flugpersonals anzusehen, sich einzuprägen, wo die Notausgänge sind, und um Himmels willen niemals die Schuhe auszuziehen. Bei der Flucht durch Glassplitter aus einem brennenden Flugzeug entscheide gutes Schuhwerk über Leben und Tod, hatte er gesagt.
Johanna betrachtete ihre robusten braunen Stiefeletten. Dimitri war ein kluger Mann gewesen. Gewesen? Ob er noch lebte?
Die Maschine drehte eine Runde auf der Startbahn, rollte schneller und hob ab. Der Schub drückte die Passagiere in ihre Sitze, es ging weiter und weiter nach oben, bis Köln unter ihnen lag wie eine Spielzeugstadt, durchzogen vom silbernen Band des Rheins.
Angelika riss Johanna aus ihren Gedanken. Sie überprüfte, ob die Platznachbarn vor und hinter ihnen noch beschäftigt waren, und raunte: »Du und Gemma, ihr macht doch noch diesen Ermittlerkram?«
Johanna gab es zu. Sie saß im Billigflieger nach Palma und wirkte wie die netteste ältere Dame, die man sich vorstellen konnte. Das Haar trug sie heute in weichen weißen Wellen, dazu ein Twinset aus flauschigem Mohair in einem pudrigen Rosé und weite helle Leinenhosen. Harmloser ging es nicht. Eine deutsche Geschäftsfrau aus Llucmajor, die gemeinsam mit ihrer einundzwanzigjährigen Enkelin ein erfolgreiches Ladenlokal mit nachhaltig produzierten mallorquinischen Spezialitäten und Kunsthandwerk führte. Doch sie und Gemma hatten neben ihrem Geschäft noch ein zweites Betätigungsfeld: Sie waren Privatdetektivinnen.
Erst im Sommer hatten sie gemeinsam mit Gemmas Freund Héctor Ballester, Inspector der Policía Nacional in Palma, eine Mordserie auf der Insel aufgeklärt – ein verstörender Fall, bei dem sie und Gemma in tödliche Gefahr geraten waren. Eingeweihte wussten, dass Johanna die vermutlich beste und härteste Ermittlerin der ganzen Insel war, wenn nicht sogar ganz Spaniens. Doch ihre Geheimnisse kannten noch nicht einmal die Eingeweihten.
Das Geschrei des Kleinen hinter ihnen ging in ein lang anhaltendes Geheul über, unterbrochen von wütenden Schluchzern.
Angelika nutzte den Lärm, um die Katze aus dem Sack zu lassen. »Jetzt pass auf. Ich glaube, ich habe einen Mord beobachtet.« In diesem Moment brach das Gebrüll ab, da der Papa den Schnuller gefunden und dem Kind in den Mund gestopft hatte. Das Wort »Mord« schallte durch das plötzlich viel stillere Flugzeug. »Ähm, wir reden später darüber.« Angelika sah sich unbehaglich um, nahm eine Zeitschrift vom Nebensitz und lehnte sich zurück.
Johanna war neugierig geworden. »Einen Mord?«, flüsterte sie.
»Pscht«, machte Angelika. »Das hören doch alle!«
Das taten alle mitnichten; die Leute waren, nachdem sie bei »Mord« aufgehorcht hatten, wieder zu ihren üblichen Flugreisetätigkeiten übergegangen: dösen, Snacks knabbern, Musik hören, Bücher lesen, im Bordmagazin blättern, dösen und Snacks knabbern. Ein paar Unerschütterliche diskutierten über ein erstes Bier, es gehe schließlich »nach Malle«, teilten sie den benachbarten Passagieren mit.
Angelika war ihre ungeheure Behauptung offenbar postwendend entfallen. Sie wies amüsiert auf ein Foto in ihrem Magazin. Es zeigte einen Esel mit Hut, er hatte eine Blume im Maul. »Der ist ja unfassbar süß.«
»Sehr niedlich.« Johanna betrachtete das Bild nachdenklich. Das Motiv hatte sie in Zeitschriften und Kalendern bestimmt an die hundert Mal gesehen, aber es schien Menschen immer wieder zu erfreuen. Esel haben bei uns großes Glück, dachte sie. Sie gelten als niedlich und tragen Hüte fürs Fotoshooting. Kühe hingegen werden oft nur als Steak auf dem Teller fotografiert, mit Soße und ohne Hut. Das Leben ist ungerecht.
Angelika rollte die Zeitschrift zusammen, stopfte sie in den Shopper, schloss die Augen und döste ein.
Johanna fragte sich, warum zum Teufel Menschen in Flugzeugen unbedingt zusammensitzen wollten. Neben den Kindern, ja. Aber die Erwachsenen schliefen ohnehin praktisch nach fünf Minuten, lasen still oder hörten Musik. Sie hatte am Flughafen schon wahre Dramen erlebt, wenn Paare für zwei Stunden Flug keine Plätze nebeneinander bekamen, zum Beispiel weil sie beim Einchecken getrödelt hatten. Oft hatten sich die Paare mit viel Hin und Her und unter Protest die gewünschten Sitze ertrotzt. Um sich anschließend hinzusetzen und sofort einzudösen. Sehr seltsam.
Angelika wurde wach, als das Flugzeuginnere längst sein Grundrauschen – wie Johanna es nannte – auf Flughöhe aufgenommen hatte. Kramen in Taschen, Knistern mit Chipstüten, das Klappern der Servierwagen, das beruhigend gleichmäßige Dröhnen der Turbinen. Der Kleine hinter ihnen behielt endlich seinen Schnuller im Mund, trug dicke Kopfhörer auf den Ohren und summte munter ein Kinderlied mit, das auf seinem iPad lief.
Angelika befand den Geräuschpegel offenbar als ausreichend. »Pass auf, du erinnerst dich noch an den alten Lopez, du weißt schon, der mit der etwas verwahrlosten Finca gegenüber von dir, an meiner südlichen Grundstücksgrenze?«
»Nein«, sagte Johanna. »Ich bin doch erst dieses Jahr im Frühjahr eingezogen. Da war er schon tot. Die Erben streiten sich um die Finca, richtig?«
»Ach, stimmt ja. Genau, die Erbengemeinschaft hat sich länger gezankt, nach langen Verhandlungen bekommt der Enkel nun das Haus. Felipe heißt er, Nachnamen weiß ich gar nicht. Ob der auch ein Lopez ist? Na, egal.«
Die Flugbegleiterin kam mit dem Getränkewagen vorbei, Angelika bestellte umständlich ein Glas Rotwein, bezahlte mit ihrer Kreditkarte, trank das Glas ohne Umschweife leer.
»Das Haus wird komplett umgebaut und saniert, seit etwa vier Wochen. Da sind jeden Tag Handwerker zugange. Das hast du ja auch nicht mitbekommen. Aber pass auf. Ist etwa sechzehn oder siebzehn Tage her, ein Mittwoch war das. Ich gehe am Nachmittag mit Günther Gassi …«
Johannas Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Gassi gehen? Mit Günther? Sie war sich sicher gewesen, dass Angelikas Mann Wolfgang hieß.
»Günther ist unser neuer Hund«, informierte Angelika, der Johannas Gedankengänge schwanten. »Dackel. Der hieß schon so. Gehörte vorher einer alten Dame, einer Deutschen aus Arenal, die ist ins Altenheim gezogen. Also, ich gehe mit Günther Gassi und höre Stimmen nebenan.«
Sie reckte den Kopf und murmelte etwas von »Stewardess«. Die stand mit dem Getränkewägelchen schon vier Reihen hinter ihnen. Angelika setzte ihr nach und kam mit einem zweiten Glas Rotwein zurück.
»An diesem Tag waren die Handwerker nicht da, ich dachte noch: Die sind ja spät dran heute. Ich habe denen nachmittags immer einen Kaffee rübergebracht, das hat ja sonst keiner getan.«
Es war typisch für Angelika, dass sie die Arbeiter auf anderer Leute Baustellen mit Kaffee und Keksen versorgte.
Sie ist eben ein herzensguter Mensch, dachte Johanna wohlwollend. Allerdings war Angelikas Mann häufig auf Geschäftsreise, und ihr war wohl manchmal ein bisschen langweilig, das konnte mit hineinspielen. Und ihre nicht zu unterschätzende Neugier. Angelika war stets bestens darüber informiert, welcher Nachbar seinen Pool neu fliesen ließ, in welcher Farbe, von welchem Bauunternehmen und zu welchen Kosten. Meistens wusste sie sogar vor dem Nachbarn selbst, was bei den Bauarbeiten als Nächstes schiefgehen würde. Johanna hatte sich manches Mal gedacht, sie sollte Angelika in ihrer Detektei einstellen, als Rechercheurin leistete sie Großartiges.
»Ich bin also zurück, hab Kaffee gemacht und bin mit dem Tablett durch den Zaun, wie immer.«
»Durch den Zaun?«
»Klar, der hat ein Loch an der Seite zu meinem Grundstück.«
»Du dringst einfach in das Grundstück des Nachbarn ein?«, fragte Johanna noch einmal.
Angelika ignorierte den Einwurf, sie nahm mit unschuldiger Miene einen Schluck Rotwein. »Die Stimmen kamen von der Terrasse; ich hab auch gesehen, dass das große Außenlicht an war. Es war ein düsterer Tag, dunkle Regenwolken, eklig. Ich will also hin, doch da merke ich, das sind gar nicht die Handwerker. Ich höre einen Mann und eine Frau, die sich anschreien. Auf Spanisch.« Sie drehte das Glas in der Hand. »Ich stelle das Tablett ab und gucke erst einmal vorsichtig ums Haus. Da steht der Enkel vom alten Lopez und daneben eine Frau, gut aussehend, vielleicht Mitte dreißig.«
Johanna runzelte die Stirn. »War das bestimmt Spanisch? Nicht vielmehr mallorquí?« Soweit ihr bekannt war, waren die Lopez eine alteingesessene einheimische Familie.
»Was weiß ich, das ist doch fast das Gleiche.«
Angelika hatte nur begrenzte Spanischkenntnisse, mallorquí sprach sie überhaupt nicht. Johanna hatte sich schon gedacht, dass sie den Unterschied nicht heraushörte.
»Sie haben sich also angeschrien, und du hast gelauscht?« Johanna beschlich das Gefühl, dass Angelika, die oft Dinge missverstand, sich da eine ziemliche Räuberpistole zusammenspann.
»Tja, ich stehe da hinterm Haus und weiß nicht, wohin. Freundlich Hallo sagen? Leise zurückziehen?« Sie nippte am Rotwein. »Um ehrlich zu sein, ich war auch gespannt, wie die Sache ausgehen würde.«
Johanna fand das verständlich. In ihrer ländlichen Ecke im Norden von Llucmajor, am Fuß des Randabergs, umgeben von Weiden mit idyllischen Trockenmauern, Mandelbäumen und Schweinekoben, passierte selten etwas Aufregendes.
»Ich gucke also noch mal um die Ecke, doch Felipe und die Frau sind ins Haus gegangen, haben auch das Terrassenlicht ausgemacht. Sie schreien drinnen weiter.«
»Und dann?«, fragte Johanna, zunehmend ungeduldig.
»Auf einmal ist es totenstill. Kein Mucks. Ich höre nur ein dumpfes … Tja, ein dumpfes Stampfen, dann ein Klappern. Ein Scharren und Rascheln. Ich dachte, kämpfen die etwa miteinander?«
»Was hast du getan?« Langsam wurde es doch interessant.
»Ich habe gewartet. Ich meine, der ganze Bereich ist voller Bauschutt, lauter Stolperfallen. Da kann man kaum treten, ohne dass dich jemand hört.«
Johanna war überzeugt, dass Angelika das bereits ausprobiert hatte. Garantiert ging sie regelmäßig nachsehen, wie der Um- und Ausbau beim Nachbarn voranging.
»Ich bin nach einer Weile trotzdem ganz leise am Haus entlang. Gucke ins Fenster neben der Terrasse. In dem Moment macht der Kerl im Inneren so eine Baulampe an, grelles Neonding. Hab gedacht, ich werde blind. Ich bin so erschrocken, dass ich zurückgestolpert und vor Angst schnell durch den Zaun in meinen Garten gehuscht bin.«
»Hat er dich gesehen? Oder gehört?«
Angelika betrachtete beunruhigt ihr nunmehr leeres Weinglas. »Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht.« Sie beugte sich hinunter und fummelte zwei Schokoriegel aus der Tasche, hielt Johanna einen hin, die verneinend mit der Hand wedelte.
»Auf jeden Fall: Ich warte in meinem Garten und lausche. Erst komplette Ruhe, alles still. Und schließlich höre ich Felipes Auto.« Sie wickelte den ersten Schokoriegel aus. »Verstecke mich hinter meinem Zaun, von da aus kann man alles sehen. Er fährt vorbei, ich gucke also in das Auto, aber was soll ich sagen? Er sitzt ganz allein drin! Die Frau ist nicht im Wagen.«
»Ganz bestimmt? Vielleicht saß sie im Heck?«
»Er war mit einem Cabrio unterwegs, Verdeck offen. War idiotisch, bei dem Wetter. Da war niemand außer ihm. Und die Frau war nicht zu sehen, weder am Haus noch auf der Straße, auch nach einer halben Stunde nicht. Ich will gerade rüber und im Haus nachsehen, da kommt Felipe zurück. Er bleibt eine Stunde, macht irgendeinen Lärm, den ich nicht zuordnen kann, und fährt zum zweiten Mal weg, immer noch allein.«
Johanna fand das nicht allzu verdächtig.
»Ich schlüpfe also wieder durch das Loch im Gartenzaun. Hab ja das Tablett stehen lassen. Gehe aber extra mit Taschenlampe noch mal ums Haus, es fing an zu dämmern. Leuchte durch die Fenster, gucke in jeden Winkel, sogar in den Bauschuttcontainer; der ist halb leer, paar Steine, Müllsäcke, alte Kacheln und solche Sachen. Aber: keine Menschenseele da«, schloss sie dramatisch, als wäre dies eine spektakuläre Entdeckung gewesen – und nicht das Gegenteil.
Johanna zog die Augenbrauen hoch. »Na ja, die Frau kann doch zu Fuß weggegangen sein. Wenn sie sich mit Felipe gestritten hat, wollte sie vielleicht nicht mehr mit ihm im Auto sitzen. Wäre das nicht die denkbarste Lösung?«
»Du weißt doch, das Grundstück ist im Osten und Süden von einer hohen Mauer mit Gestrüpp davor umschlossen. Man kann zu Fuß nur am Nordrand rüber in meinen Garten, durch den Zaun eben. Am Westrand führt ein Tor zur Straße. So. Und sie ist nicht auf mein Grundstück gekommen und auch nicht auf die Straße gegangen. Da müsste sie an meinem Tor vorbei, ist sie aber nicht. Richtung Süden sind etliche Häuser mit Wachhunden, es hat aber keiner angeschlagen. Sie kann nicht zu Fuß gegangen sein.«
»Na schön, nehmen wir an, sie ist nicht zu Fuß weg. Wo ist sie hin?«
»Das sage ich dir. Ich habe mich überall umgeschaut, wie gesagt, keine Menschenseele. Aber eine frische Betondecke. Er hat die Terrasse erhöht, ein Fundament gegossen.« Triumphierend kaute Angelika ihren Schokoriegel. »Auf einmal kam der Lkw, um den Bauschuttcontainer abzuholen, fand ich komisch, wo der doch noch nicht voll war. Ich bin flott mit dem Tablett zurück zu mir.«
»Und jetzt denkst du …?«
»Genau. Er hat sie getötet und die Leiche unter der Terrasse einbetoniert.« Angelika wickelte auch den zweiten Schokoriegel aus und biss hinein.
Wo lässt sie das nur, fragte sich Johanna, sie wiegt keine sechzig Kilogramm. Die Geschichte fand sie reichlich abstrus. »Oder die junge Dame ist am Ostrand über die Mauer geklettert und von dort zurück auf die Straße. Oder sie hat sich im Haus vor dir versteckt und ist später in der Nacht zu Fuß weggegangen. Oder sie ist mit dem Lkw-Fahrer weggefahren, der den Bauschutt geholt hat.«
Angelika stopfte energisch die Verpackung der Riegel in das Einwegglas und gab beides dem jungen Steward, der mit dem Müllwägelchen vorbeikam.
»Das kann alles sein. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl. Da war etwas Böses, das habe ich gespürt. Dieser Felipe ist mir nicht geheuer. Ich dachte, ich könnte dich darauf ansetzen, aber du scheinst mir ja nicht zu glauben.« Angelika war sichtbar beleidigt. Sie kramte demonstrativ ihr Magazin hervor und blätterte aggressiv und ohne zu lesen darin.
Eine Leiche im Beton, also bitte!, dachte Johanna. Das klang allzu sehr nach Kriminalroman. »Hast du die Frau überhaupt richtig gesehen? Könntest du sie beschreiben?«
Angelika legte die Zeitschrift ruckartig weg. »Natürlich. Wie schon gesagt, die beiden standen ja direkt im Licht der Lampe auf der Terrasse, praktisch im Flutlicht.« Sie schloss die Augen. »Ungefähr einen Meter siebzig groß, schlank. Lange dunkle Locken. Rundes Gesicht, erinnerte ein bisschen an Selena Gomez. Du weißt schon, die Schauspielerin. Ich habe sie auf Anfang, Mitte dreißig geschätzt, ungefähr so alt wie der Lopez-Enkel. Dunkler Hosenanzug, ist auf High Heels durch den Bauschutt gestolpert. Hatte eine Handtasche im Arm, die aussah wie eine ›City‹-Bag von Balenciaga. In Knallrot. Kann aber auch eine Fake-Marke gewesen sein, das sieht man ja nicht von fern.«
Johanna musste zugeben, dass sie beeindruckt war. »Du kannst gut beobachten. Aber sag mal, wenn du so überzeugt bist, dass etwas Schlimmes passiert ist, warum hast du nicht die Polizei gerufen?«
Hilflos hob Angelika die Hände. »Na, ich habe genau genommen keinen Mord gesehen. Kann ja sein, dass gar nichts passiert ist. Dass es so war, wie du sagst, und sie ist doch einfach nachts weggegangen. Der Typ wird schließlich unser neuer Nachbar, da sollten wir schon Gewissheit haben, oder?«
Das fand Johanna wiederum nachvollziehbar. »Okay, ich sage dir etwas. Ich sehe mal, was ich herausfinden kann, ja? Aber wenn sich da nur ein junges Paar ein bisschen gestritten hat und die Frau demnächst quicklebendig mit dem Enkel einzieht, dann gibst du zu, dass bei dir nur die Phantasie durchgegangen ist, okay?«
Angelika wurde ernst. »Danke«, sagte sie schlicht. »Ich konnte tagelang nicht gut schlafen wegen der Sache und habe gehofft, dass du und Gemma endlich zurückkommt und mir helft und bestätigt, dass da tatsächlich nichts passiert ist.« Sie begann, ihre Sachen in ihre Tasche zu räumen, die sie auf dem freien Gangplatz verstreut hatte.
Der Pilot hatte die baldige Ankunft auf Mallorca angekündigt, die Maschine zog eine weite Kurve über das blaue Meer. Es entstand Unruhe, weil alle Passagiere eilig zusammenpackten, noch schnell zur Toilette wollten oder ihr Nickerchen beendeten und plauderten. Die Maschine war fast ausgebucht, trotz Nebensaison.
Im Flugzeug saß das typische Winterpublikum. Hinten die Touristen, sportlich mit Wanderstiefeln und Outdoorjacken. Vorn die Mallorca-Profis – Residenten und Stammgäste. Viele im Beach-Hippie-Chic, wie Johanna es nannte. Die Herren in knittrigen hellen Leinenhemden, mit Lederkettchen um den Hals. Die Damen als Boho-Queens in bunten Flatterkleidern oder Batikblusen, ebenso mit Hippieschmuck, die wie Angelika volle Basttaschen in die Gepäckablage gehievt hatten, als gingen sie zum Strand. Viele über fünfzig, mit ledrigen gebräunten Gesichtern. Die Residenten reisten auch aus dem Grund oft weit vorn im Flugzeug, weil sie meist nur Handgepäck bei sich trugen und von der Maschine gleich zügig zum Ausgang durchmarschieren wollten, ohne am Gepäckband warten zu müssen.
Johanna presste die Nase an das Fensterchen, sie überflogen das Cap de Formentor. Die felsige Landzunge ragte weit ins Meer und war ein vertrauter Anblick. Johanna glaubte, einen rötlichen Fleck an der Spitze des Kaps zu erkennen, das ziegelrot gestrichene Dach des flachen Gebäudes, auf dem der Leuchtturm stand.
Sie war bald zu Hause und sollte sich freuen. Daheim bei Gemma, ihrer komplizierten Enkelin, dem Menschen, den sie am meisten liebte auf dieser Welt. Aber da war dieses schlechte Gefühl. Es ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung, dachte Johanna.
Heute war Samstag, der 1. Dezember, sie war fast drei Monate weg gewesen. Ein Spezialauftrag, hatte sie Gemma gesagt, ein geheimer Spezialauftrag. Dieser Auftrag hatte sie in drei Länder geführt und sich als anstrengend herausgestellt. Anstrengend, gefährlich – und erfolgreich. Und sie würde Gemma davon nicht erzählen können, wie so oft.
Gemma hatte früher viel gefragt und irgendwann damit aufgehört. Hatte sie es akzeptiert, dass es eben Geheimnisse, Familiengeheimnisse, gab, über die Johanna nicht sprach? Niemand sagte Gemma die Wahrheit über ihren Vater und ihren Großvater. Und schon gar nicht die Wahrheit über Johanna selbst.
Irgendwann werde ich über all das mit ihr reden müssen, dachte Johanna. Aber nicht jetzt.
Doch vor ungefähr zwei Wochen musste etwas passiert sein. Ihre ohnehin schreibfaule Enkelin hatte kaum noch auf Textnachrichten geantwortet, sie war nicht mehr ans Telefon gegangen. Da die Rechnungen für Finca und Geschäft pünktlich überwiesen worden waren, wie Johanna an den Kontoauszügen und Kreditkartenabrechnungen hatte sehen können, war zumindest nichts Lebensbedrohliches geschehen. So viel war immerhin klar.
Doch auch der sonst so kommunikative Héctor, ihr Schwiegerenkel in spe, schrieb nur noch sehr einsilbig. Gestern hatte er sogar ihren Anruf weggedrückt. Das passte gar nicht zu ihm.
Ja, sie war beunruhigt. Gemma und Héctor waren seit knapp acht Monaten ein Paar. Hatten sie sich gestritten?
Vielleicht waren sie nur einem neuen Fall auf der Spur und hatten keine Zeit. Das konnte es sein. Das musste es sein.
Die Maschine flog noch eine Schleife über die Bucht von Palma und setzte sanft auf dem Rollfeld auf, wurde eingewiesen und parkte schließlich an einem der Finger, die in den Bauch des Airports führten.
Im Flugzeug brach die übliche Hektik aus, die Passagiere standen praktisch gleichzeitig auf und zerrten Taschen, Hüte und Rucksäcke aus den Gepäckfächern. Angelika sah aus wie ein Packesel, nachdem sie ihr Handgepäck zusammengerafft hatte.
Johanna war ruhig auf ihrem Platz sitzen geblieben, während sich die anderen schon in den Mittelgang gequetscht hatten. »Ich werde abgeholt«, informierte sie Angelika und wies auf ihren Gehstock.
Zum allerersten Mal in ihrem Leben hatte sie bei der Onlinebuchung das Kästchen für die Ausstiegshilfe angeklickt. Es ist so weit, hatte sie gedacht. Ich werde alt. Die Wege auf dem Flughafen in Palma schaffte sie zwar noch, aber mittlerweile brauchte sie sehr lang, um zu den Gepäckbändern und zum Ausgang zu kommen. Sie musste endlich einsehen, dass sie vierundsiebzig Jahre alt war.
Vergnügt ließ sich auch Angelika zurück auf ihren Platz sinken. »Oh, toll. Ich mache auf Begleitperson, dann muss ich nicht laufen mit dem ganzen Kram.«
Johanna nickte ergeben.
Nachdem sich die Maschine geleert hatte, kam draußen ein Wägelchen angefahren, das neben ihnen parkte und seine Kabine auf die Höhe des Flugzeugs ausfuhr. Die Stewardess entriegelte die zweite Tür der Maschine gegenüber dem Ausstieg, der ausgefahrene Transporter öffnete sich. Zwei junge Männer kamen heraus und nahmen die gehbehinderten Fluggäste in Augenschein.
»Señora, können Sie alleine gehen?«, fragte einer der Helfer Johanna auf Spanisch.
»Sí, gracias.« Johanna stemmte sich vom Sitz hoch, griff nach Gehstock und Handtasche und marschierte zu der Kabine.
Angelika wieselte hinterher. »Ich bin die Begleitung«, flötete sie zuckersüß.
Die Männer hoben einen jüngeren Passagier von seinem Sitz in einen schmalen Rollstuhl, dazu kam eine Frau um die neunzig, die sich wie Johanna auf einen Gehstock stützte. Gemeinsam fuhren sie mit der Kabine nach unten, anschließend kurvte das Wägelchen zu einem der Eingänge des Flughafengebäudes. Sie stiegen in flüsterleise Elektrotransporter um, durchquerten den Flughafen und hielten an den Gepäckbändern.
»Brauchen Sie noch Unterstützung, um zum Taxi oder zu den Bussen zu kommen?« Einer der Männer wies auf einen Rollstuhl, der an den Gepäckbändern parat stand.
Johanna verneinte erneut und bedankte sich. Erfreut stellte sie fest, dass die Ausstiegshilfe des Flughafens hervorragend organisiert war.
»Soll ich dich mitnehmen, oder wirst du abgeholt?«, fragte Angelika, die ihr Köfferchen und die Taschen auf eine Gepäckkarre getürmt hatte. »Ich habe das Auto beim Langzeitparken stehen.«
»Lass nur, Gemma oder Héctor werden gleich hier sein.« Johanna war sich nicht ganz sicher, ob dies der Wahrheit entsprach. Sie wollte der klatschsüchtigen Angelika auf keinen Fall ein Familiendrama bieten.
Winkend verabschiedete sich diese. »Komm morgen auf einen Kaffee zu mir, ich zeige dir unseren Tatort!«, rief sie beim Gehen über die Schulter.
Johanna wartete am Band, bis ihr dunkelblauer Trolley vorbeigefahren kam. Mit Koffer und Gehstock machte sie sich auf zum Ausgang. Sie hatte Gemma und Héctor gestern eine Nachricht geschrieben und sie gebeten, sie vom Flughafen abzuholen. Sie hatte keine Antwort erhalten, aber die blauen Häkchen verrieten ihr, dass ihre Nachricht gelesen worden war.
Sie werden mich doch nicht vergessen haben?, dachte sie, nahm ihr Smartphone und schaltete im Gehen den Flugmodus aus. Das Handy suchte einen Moment und loggte sich ins mallorquinische Netz ein. Sofort kam der Signalton, dass eine Textnachricht von Gemma eingetroffen war. Erleichtert tippte Johanna auf ihr Handy, um sie zu öffnen.
»Sorry, bin unterwegs«, stand dort. »Lass dich von Héctor abholen. LG G.«
Verwirrt hielt Johanna inne. Sie war froh, dass Gemma endlich ein Lebenszeichen von sich gegeben hatte, aber überrascht von der distanzierten Form. Warum hatte Gemma mit »LG G.« unterschrieben? So förmlich wurde sie nur, wenn sie richtig sauer war. Normalerweise nutzte sie nämlich gar keine höflichen Grußformeln.
Johanna durchforstete ihr Gehirn, was sie wohl verbrochen haben könnte. Warum war Gemma wütend auf sie? Es fiel ihr partout kein Vergehen ein.
Von Héctor war gar keine Nachricht gekommen. Auch der hübsche, etwas pummelige Polizist mit den schwarzen Locken war weit und breit nicht zu sehen.
Die beiden ließen sie tatsächlich am Flughafen stehen, nach drei Monaten Abwesenheit kam sie niemand abholen! Angelika war natürlich schon über alle Berge.
Verärgert und besorgt zerrte Johanna den Rollkoffer hinter sich her in Richtung Taxistand. Sie beschrieb der Fahrerin auf Spanisch den Weg zu ihrer abgelegenen Finca und lehnte sich im Sitz zurück.
Während das Taxi über die Autobahn Ma-19 in Richtung Llucmajor fuhr, klingelte ihr Handy. Héctor. Endlich!
»Hola, Johanna, ho sento«, sagte er mit gepresster Stimme. »Es tut mir leid, ich habe deine Ankunft verpasst. Wo bist du?«
Johanna erklärte, sie sitze im Taxi nach Llucmajor. »Was ist los mit euch? Wo ist Gemma?«, fragte sie.
Zu ihrem Entsetzen schluchzte Héctor auf. »Sie ist weg«, sagte er leise. »Sie ist weg, und sie hat einen anderen.«
2
Es dämmerte bereits, als Johanna schließlich an ihrer Finca ankam. Sie entlohnte die Taxifahrerin und schloss das schwarze Eisentor auf, das auf die gekieste Einfahrt führte. Das Grundstück der Lopez, das Angelika für einen Tatort hielt, befand sich gleich gegenüber auf der anderen Seite des ungeteerten Sträßchens. Das helle Haus lag unschuldig im Zwielicht, Johanna erahnte Baumaterial, Bauschutt und einen Zementmischer durch die Maschen des Zauns. Kein Auto, die Fenster dunkel. Es war offenbar niemand da.
Ebenso wenig in ihrem eigenen Haus. Trotz der einbrechenden Dunkelheit bemerkte sie sofort, dass Gemma sich seit längerer Zeit um nichts mehr gekümmert hatte. Das Unkraut war durch den Kies gekrochen, die Einfahrt ähnelte schon fast einer Wiese. In den hübschen Beeten mit Oleander, Kapmargeriten, Zwergpalmen und Hibiskus war der wilde Spargel emporgeschossen.
Johanna ärgerte sich. Gemma war noch nie Heldin des Haushalts gewesen, aber sie hatte zumindest den Garten halbwegs in Ordnung gehalten. Zum Haus gehörte auch ein Gelände mit Orangen-, Zitronen- und Mandelbäumen, zwischen denen Gras und Unkraut wucherten.
Der Oktobersturm hatte ihre Finca zwar weitgehend verschont, aber dennoch gab es Schäden. Neben dem in einer alten Zisterne untergebrachten Pool stand ein schöner algarroba, ein Johannisbrotbaum. Der war nun arg zerzaust, Äste waren aus dem Wipfel gebrochen, das zerborstene Holz lag in einem Stapel darunter. Immerhin schien Gemma nach dem Sturm etwas aufgeräumt zu haben.
Johanna zog den Koffer mühsam über den Kies auf die Terrasse und schloss die Tür zum Haus aus sandfarbenem Bruchstein auf. Es war feucht und kühl im Inneren.
Sie schaltete als Erstes die Heizung an und machte einen Rundgang durch die Räume. In Gemmas Zimmer stellte sie fest, dass die Sporttasche fehlte. Der Schrank war halb leer, Jeans, T-Shirts und Gemmas warme Jacke waren fort, dazu mindestens zwei oder drei Paar Schuhe.
Wo war das Kind nur? Warum waren Gemmas Sachen weg? Warum ging sie nicht ans Handy?
Seit mehr als sieben Jahren wohnte Gemma bei Johanna auf Mallorca. Damals hatte ihre Tochter Marion verzweifelt angerufen und ins Telefon geweint, sie komme mit der störrischen Vierzehnjährigen nicht mehr zurecht. »Mutti, ich kann nicht mehr«, hatte Marion gesagt und Gemma einfach zu ihr geschickt.
Auch das Verhältnis zwischen Johanna und Marion war nicht einfach. Johanna hatte einige Lebensentscheidungen ihrer Tochter missbilligt. Und sie wusste nur zu genau, dass sie selbst als Mutter schlichtweg versagt hatte. Wenn sie sich um Gemma kümmerte, wäre das eine Art von Wiedergutmachung, hatte sie gehofft.
Die mürrische, maulfaule Gemma war zuvor in Köln zum zweiten Mal von der Schule geflogen und hatte sich allen Therapie- und Gesprächsangeboten widersetzt. Sie hatte nur über den Sommer bei Johanna auf Mallorca bleiben sollen. Doch mit ihrer Großmutter und den Mallorquinern kam sie erstaunlicherweise wunderbar zurecht. So war sie bei Johanna geblieben.
Die hatte schnell gemerkt, was mit Gemma los war – das Kind war hochintelligent und einzelgängerisch, brauchte viel geistige Abwechslung und spannende Aufgaben. Davon hatte Johanna reichlich zu bieten. Sie hatte Gemma an der spanischen Schule in Llucmajor angemeldet und ließ sie in ihrem Laden und vor allem in der Detektei mitarbeiten. Es klappte ganz wunderbar.
Doch Gemma wurde erwachsen. Johanna fürchtete sich vor dem Moment, in dem sie sagen würde, sie wolle ausziehen. War es so weit? Wo war sie nur?
Gemma hasste es, wenn Johanna ihr hinterherspionierte, aber das war heute egal. Johanna schritt in ihr Ankleidezimmer, das Gemma hartnäckig »Deep Space Nine« nannte. In diesem Raum lagerte Johanna Verkleidungen für ihre waghalsigen Undercoveraktionen, Gemma hatte hier ihr komplettes Computerequipment aufgebaut, das sie für ihre Arbeit als Ermittlerin brauchte.
Johanna schaltete einen der Laptops ein, über den sie via GPS verfolgen konnte, wo Gemma steckte. Für ihre mitunter gefährlichen Aufträge hatten Oma und Enkelin vereinbart, ihre Handyortung freizugeben, um sich im Notfall finden zu können. Für Gemma hatte sich dies Anfang des Jahres als lebensrettend erwiesen. Ein Mörder, dem sie auf der Spur gewesen waren, hatte sie überwältigt und töten wollen. Im letzten Moment hatten Héctor und Johanna sie aufspüren und das Schlimmste verhindern können.
Doch die Ortung blieb erfolglos. Gemma hatte die Funktion ausgeschaltet. Während Johanna noch grübelnd vor dem Laptop saß, hörte sie einen Wagen vorfahren. Das musste Héctor sein. Er hatte versprochen, sofort zu ihr zu kommen und zu berichten, was geschehen war.
Erleichtert lief Johanna nach draußen. Alles würde sich aufklären.
Sie mochte den geradlinigen, gutherzigen Inspector sehr gern, fast wie einen Enkel. Und sie hatte es auch sehr gern gesehen, als Gemma und er ein Liebespaar geworden waren. Er hatte gut auf die draufgängerische Gemma aufgepasst.
Johanna öffnete das große Eisentor, Héctor rollte mit seinem Dienstwagen in den Hof und stieg aus.
Überrascht blieb Johanna stehen. Der sonst so hübsche junge Mann hatte sich lange nicht rasiert. Seine schwarzen Locken hingen ihm strähnig ins Gesicht, unter seinen Augen lagen dunkle Schatten.
»¡Héctor, noi! Junge, bist du krank?«, rief sie besorgt.
Héctor schloss sie in die Arme. »¡Johanna, gràcies a Déu! Gott sei Dank, dass du da bist!«, stieß er hervor.
Sie zog ihn ins Haus, Héctor ließ sich im Wohnzimmer auf den schäbigen, aber bequemen alten Cordsessel fallen, den Gemma schon zweimal vor dem Sperrmüll gerettet hatte. Sie kochte Kaffee und stellte das Tablett mit Tassen, Zucker und Héctors geliebten Schokoladenkeksen auf den Tisch.
»So, erzähl bitte alles. Wo ist Gemma?«
Mit unglücklichem Dackelblick betrachtete Héctor die Kekse. »Du warst ja eine Ewigkeit auf deinem Sondereinsatz oder was das war.« Er hielt inne. »Wo warst du überhaupt?«
Unwillig reckte Johanna das Kinn. »Auf einem Sondereinsatz eben, spielt doch keine Rolle.«
Héctor riss die Arme hoch. »Das ist doch das Drama! Geheimnisse, wo man hinsieht. Das hat Gemma von dir!« Er trank einen Schluck Kaffee, griff fast automatisch nach einem Keks, behielt ihn aber in der Hand und begann endlich zu erzählen. »Das Ganze ist ungefähr zwei Wochen her.«
Gemma habe bis Mitte November immer abwechselnd mit ihrer Freundin Bárbara im Laden gearbeitet, Fälle für die Detektei habe es keine gegeben. Bárbara half seit Jahren im »Gecko Galdent« aus, wenn die Miebachs anderen Aufgaben nachgehen mussten oder viel zu tun war.





























