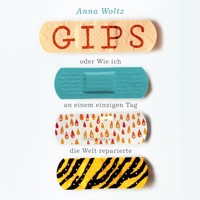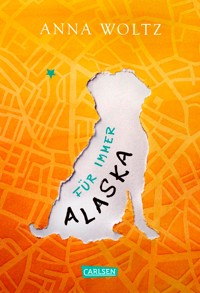7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wir drei haben alles überstanden. Die Bomben, die Brände, die Nächte. Wir sind noch da. Unser Leben fängt gerade erst an. London, September 1940. Fast jede Nacht wird die Stadt bombardiert. Ella und ihr kleiner Bruder Robbie suchen Schutz in den weitverzweigten Tunneln der U-Bahn. Wie Sardinen liegen die Menschen dort unten dicht an dicht auf dem Boden. Auch Jay ist darunter, der sich ganz allein durchschlägt, und Quinn, die vom Landsitz ihrer Eltern abgehauen ist, um im Krankenhaus zu helfen. Nach und nach erzählen sich die vier von ihrem Leben und ihren Hoffnungen für die Zukunft. Sie werden zu einer eingeschworenen Gemeinschaft, die auch dann nicht zerbricht, als das Schlimmste passiert. Denn das Leben fängt gerade erst an. Eine starke Protagonistin voller Hoffnung in einem ebenso herzzerreißenden wie zuversichtlichen Buch über ein nach wie vor aktuelles Thema. Anna Woltz gehört zu den ganz großen Stimmen der internationalen Kinder- und Jugendliteratur. Mit den unvergesslichen Kinder und Jugendlichen aus ihren Büchern möchte man sich augenblicklich anfreunden. Warmherzig und fesselnd erzählt sie konsequent aus deren Sicht und behandelt so auch schwierige Themen unerschrocken, mit großem Feingefühl und Sprachwitz. Ausgezeichnet mit dem LUCHS-Preis (DIE ZEIT und Radio Bremen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ANNA WOLTZ – NÄCHTE IM TUNNEL
Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann
London, September 1940. Fast jede Nacht wird die Stadt bombardiert. Ella und ihr kleiner Bruder Robbie suchen Schutz in den weitverzweigten Tunneln der U-Bahn. Wie Sardinen liegen die Menschen dort unten dicht an dicht auf dem Boden. Auch Jay ist darunter, der sich ganz allein durchschlägt, und Quinn, die vom Landsitz ihrer Eltern abgehauen ist, um im Krankenhaus zu helfen. Nach und nach erzählen sich die vier von ihrem Leben und ihren Hoffnungen für die Zukunft. Sie werden zu einer eingeschworenen Gemeinschaft, die auch dann nicht zerbricht, als das Schlimmste passiert. Denn das Leben fängt gerade erst an.
WOHIN SOLL ES GEHEN?
Buch lesen
Viten
ZUERST DAS
Wir sind jetzt zu dritt.
Wir waren zu viert, aber einer von uns wird sterben. Besser, du weißt das. Jetzt schon, bevor ich anfange.
Einer von uns stirbt, aber darum geht es nicht. Es änderte alles, das schon. Aber es geht darum, dass drei von uns weiterleben.
Wir drei haben alles überstanden. Die Bomben, die Brände, die Nächte. Wir sind noch da.
Unser Leben fängt gerade erst an.
Wir waren zu viert, aber oft hätten wir genauso gut allein sein können.
Wenn du Nacht für Nacht im Dunkeln wartest, die knallharten Eisenrippen des Tunnels im Rücken, während über deinem Kopf die Welt zusammengeschlagen wird, was bringen dir dann andere Menschen?
Manchmal gar nichts.
Aber manchmal hilft es.
Wir waren zu viert, und das half.
1
Auf der anderen Straßenseite steht ein Junge. Er lehnt an der Mauer, die Hände in die Hosentaschen geschoben. Die Ärmel von seinem verschlissenen Hemd sind aufgerollt, seine Arme mit schwarzen Schmutzstreifen überzogen.
Er schaut zu mir.
Ich stehe in der Schlange zwischen zweihundert anderen Menschen und trotzdem bin ich mir sicher: Er schaut zu mir.
Er ist zu jung, um Soldat zu sein, aber zu alt für einen Schuljungen. Seine Hose ist dreckig, seine braunen Haare sind zu lang und fallen ihm vor die Augen.
Jetzt schaut er zu Robbie, der neben mir steht. Wir tun, als würde ich auf meinen kleinen Bruder aufpassen, aber wir wissen beide, dass es umgekehrt ist: Robbie passt auf mich auf.
Während ich ein Jahr lang im Bett lag, war Robbie draußen. Er kennt jeden Markthändler, jeden Straßenhund und jede Gasse.
Plötzlich pfeift der Junge. Ein kurzer, herrischer Pfiff. Robbie schaut auf und der Junge winkt ihn herbei.
»Bleib hier«, flüstere ich.
Aber mein Bruder geht sofort los. Er hat ein Jahr warten müssen, bis der Krieg wirklich anfing, und jetzt ist es endlich so weit. Jede Nacht fallen Bomben. Überall in London sieht man riesige Brände und zerstörte Häuser und vielleicht auch Tote. Und was machen wir? Wir stehen schon über vier Stunden in der Schlange mit einem Karren voller Kissen und Decken.
»Du gehst nicht zu ihm!«, zische ich, aber da überquert Robbie schon die Straße.
Ich bleibe zurück. Ganz allein zwischen all den anderen Menschen. Ich habe nächtelang nicht geschlafen und die Welt scheint aus Glas zu sein. Eine einzige falsche Bewegung und alles bricht zusammen.
Reglos und stumm stehe ich da. Ich trage eine Strickjacke über meinem Sommerkleid, meine Beine sind kalt. Die Luft riecht nach Brand.
Zeitungen dürfen nichts über die Bombardements schreiben, denn Hitler liest mit. Wohnt man allerdings ein paar Meilen vom Hafen entfernt, braucht man keine Zeitungen. Jeden Abend sieht es aus, als würde die Sonne an der falschen Seite untergehen. Die gesamte Nacht über glüht der östliche Himmel in feurigem Orange.
Wir wissen es alle: Der Hafen brennt. Und man riecht genau, welches Lagerhaus gerade dran ist: Schiffsladungen voller Pfefferkörner, die um die halbe Welt gefahren sind, um hier in Flammen aufzugehen. Sirup. Tee. Rum.
An der gegenüberliegenden Straßenseite sehe ich den Jungen auf mich zeigen. Robbie fängt an zu lachen. Ganz kurz denke ich an die Möglichkeit, dass er fragt, ob Robbie ein Date für ihn regeln kann.
Und dann kommt mein Bruder aufgeregt zurückgerannt. Fast wird er von einem Doppeldecker überfahren, ein Löschwagen voller Feuerwehrmänner hupt lange und laut, aber Robbie ist das völlig egal.
»Ella, dieser Typ da braucht dich!«
Um uns herum wird es still. In der Schlange stehen fast nur Frauen und ein paar Kinder, hier und dort ein alter Mann mit krummem Rücken und wenigen Zähnen.
Wir können natürlich nicht weg von hier, dann ist unser Platz futsch. Vergeben. Robbie zieht mich ein wenig zur Seite, ich beuge mich vor. Ich habe keine Ahnung, was man bei so einem Date macht. Und mein blaues Kleid mit den Gänseblümchen ist zu kurz. Da muss ich erst den Saum auslassen.
»Dieser Typ hat dein Bein gesehen«, sagt Robbie leise. »Und er hat gesehen, wie blass du bist und wie schlecht du aussiehst.« Er mustert mein Gesicht. »Ja, tut mir leid, aber das hat er nun mal gesagt! Hätte ich ihm eine runterhauen sollen?«
Ich seufze. »Nein, alles gut. Erzähl nur weiter.«
»Also, er heißt Jay, und er ist schon sechzehn. Und er hat einen Plan. Wenn wir dem Wärter sagen, du könntest wirklich nicht so lange anstehen, dann dürfen wir vor. Dann können wir jetzt schon rein und als Erste unsere Decken hinlegen!«
Mir wird schwindlig, aber das passiert mir öfter.
»Aber das Beste kommt noch«, flüstert Robbie. Er strahlt, und ich wollte, ich wäre auch neun. Und könnte durch die Straßen rennen und wäre glücklich, wenn ich ein paar von unseren Spitfires über die Stadt fliegen sehe. »Jay sagt also, wir könnten total viel Geld verdienen. Es gibt immer Leute, die später kommen. Die müssen arbeiten, und wenn sie dann endlich hier sind, ist schon alles voll. Aber wenn wir jetzt ein paar zusätzliche Decken hinlegen, können wir diese Plätze nachher für viel Geld verkaufen!«
»Echt jetzt?«, frage ich. »Dieser Kerl will Geld verlangen für einen sicheren Platz?«
Robbie nickt. »Das hat er gestern auch gemacht, er weiß, wie’s geht. Wenn dein Bein uns jetzt schon reinbringt, dann teilen wir uns nachher den Gewinn. Das hat er gesagt!«
Ich atme tief ein.
Jeden Moment kann der Luftalarm wieder losgehen. Alle sind ständig auf der Hut. Man sieht, dass die Leute sich zusammenreißen, aber ganz London fühlt sich an wie eine UXB. Seit einer Woche weiß ich, was das ist.
Eine unexploded bomb.
»Und?«, fragt Robbie.
Ich räuspere mich. »Nein.«
»Aber …«
»Kommt überhaupt nicht infrage.«
Plötzlich setzt sich die Schlange in Bewegung. Das Gitter des U-Bahnhofs öffnet sich. Endlich dürfen wir rein.
Schnell klauben alle ihre Bündel mit Decken und Kissen zusammen, die Taschen mit Sandwiches und Thermoskannen, die Kinderwagen voller Gepäck. Alle warten, bis sie an der Reihe sind, aber man spürt, dass sie am liebsten die Treppen runterstürmen würden. Weg aus der Sonne und von den offenen Straßen, hinein in die Tiefe.
Ich weiß, dass Jay noch immer da steht und schaut, aber trotzdem muss ich jetzt das ganze lange Stück zum Eingang hinken. Mein Körper ist steif von den vielen Stunden anstehen, hinter mir spüre ich die drängenden Menschen.
Ich gehe los.
Mein linkes Bein ist träger als der Rest. Bei jedem Schritt muss ich meinen Fuß hinter mir herziehen. Die Ärzte sagen, ich hätte unglaublich viel Glück gehabt. Ich brauche keine Krücken oder so was, nur Spezialschuhe.
UXB, denke ich, und es fühlt sich an wie ein Fluch.
Was für ein unglaubliches Glück soll das sein?
Ich bin vierzehn. Wie viele Spezialschuhe werde ich noch brauchen?
Neben mir schiebt Robbie den Karren mit unserem Gepäck, und alles an ihm schaut empört. Seine störrischen Zottelhaare, die aufgeschlagenen Knie, seine kurze Hose mit den Hosenträgern.
»Ich finde das so unfair.« Er zieht die Nase hoch. »Ich habe schon fast genug für ein neues Flugzeug. Jay sagt, er hätte gestern sieben Shilling verdient. Das ist mächtig viel Geld!«
Ich greife nach seinem Arm.
»Kapierst du das denn nicht?«, flüstere ich.
»Ich kapiere mehr als du«, flüstert er sofort zurück.
Ich schüttele den Kopf. »Wenn wir den Krieg verlieren, dann liegt das an solchen Gaunern wie Jay. Stell dir das doch nur mal vor! Leute, die den ganzen Tag hart gearbeitet haben, die müssen für einen Platz hier unten bezahlen? Während so ein Typ hier ewig herumlungert?«
»Warum arbeitet er denn nicht?«
»Gute Frage«, sage ich. »Genau das meine ich.«
Bevor wir runtergehen in die Liverpool Street Station, werfe ich einen letzten Blick zurück. Zu den schwarzen Taxis und den Gruppen von Soldaten und dem Pub mit den Sandsäcken davor. Es ist vier Uhr nachmittags. Wir kommen erst morgen früh wieder nach draußen. Ich habe keine Ahnung, ob die Stadt dann noch da ist.
Und dann höre ich neben mir eine muntere Stimme. »Soll ich mal kurz helfen mit dem Karren?«
Ich drehe mich um.
Es ist Jay.
2
Er ist einen Kopf größer als ich. Seine Arme sind muskulös, seine Augen haben dieselbe Farbe wie die Sperrballons über unseren Köpfen. Diese silbergrünen Riesen schweben über ganz London, mit schweren Kabeln an den Boden gekettet.
Den ganzen Sommer lang schauten wir zufrieden zu den kolossalen Ballons am Himmel. Es fühlte sich an, als hätte jedes Viertel sein eigenes Haustier; die braven Tiere über unseren Köpfen würden uns gegen die Flugzeuge beschützen.
Aber die neuesten Bombenwerfer fliegen höher als die höchsten Ballons.
»Lass uns in Ruhe«, sage ich zu Jay.
Die Leute hinter uns drängeln. Es sind sicherlich hundert, und weiter hinten in der Schlange sehen sie nicht, dass wir hier zum Stillstand gekommen sind. Ich schaue zu der steilen Treppe und weiß, dass ich Robbie mit unserem Karren nicht helfen kann. Und außer Jay sind alle so schwer bepackt, wie es nur geht.
Jede Familie schickt einen Kundschafter vor: einen nutzlosen Opa oder eine Tante oder ein Hinkebein, das nichts Besseres zu tun hat, die anderen kommen später.
»Das ist aber nett von dir«, sagt Jay, als er den Karren vorn anhebt. »Das sagt man, wenn jemand einem Hilfe anbietet.«
Auf seiner Wange klebt getrocknetes Blut. Er grinst mich an, weil es ihm jetzt also doch gelingt. Er hat keine einzige Sekunde Schlange gestanden. Und trotzdem kommt er in den U-Bahnhof. Niemand sagt was, schließlich hilft er einem verkrüppelten Mädchen und ihrem kleinen Bruder.
Ich beiße die Zähne zusammen. Schritt für Schritt gehe ich die Treppe hinunter. Ich hoffe, dass Jay sich nicht umschaut, und gleichzeitig finde ich mich total lächerlich. Warum ist mir nicht schnurzpiepegal, ob er mein Gesicht sieht? Was macht es aus, wenn er weiß, dass ich Schmerzen habe?
Unten in der Halle stehen lange Schlangen vor den Automaten und Schaltern. Ob man nun zu einem anderen U-Bahnhof fährt oder die ganze Nacht hierbleibt, ohne Fahrschein kommt man nirgends hin.
Ich schwanke und Robbie zeigt auf eine schmale Bank an der Wand. »Setz du dich da hin. Ich kaufe die Karten.«
Es ist idiotisch. Nach all den Monaten im Bett fühlt es sich an, als würde sich die Welt schneller drehen als vorher. Leute bewegen sich eiliger, das Licht ist schärfer, Geräusche sind schriller. Ich setze mich auf die Bank und schaue auf meine Hände. Ich bin noch immer in Schwarz-Weiß. Und die Welt ist plötzlich in Farbe.
Erschöpft lehne ich den Kopf gegen die Wand. Sofort denke ich wieder an den Knall.
Vergangene Nacht haben Robbie und ich zehn Stunden lang im Schrank unter der Treppe gehockt. Unsere Mutter passte nicht mehr rein. Sie saß auf dem Boden vor der Schranktür und weigerte sich, ihren Platz mit mir zu tauschen.
Stundenlang sagten wir kein einziges Wort. Die Flakgeschütze knallten überall um uns herum, Flugzeuge brüllten, dumpfe Explosionen dröhnten durch die Stadt.
Und dann war da diese eine Bombe. Ein sirrender Pfeifton schwirrte direkt auf uns zu und ich war mir sicher: Diese Bombe ist für uns. Das war’s. Und plötzlich dachte ich: Von mir aus. Komm nur, du Scheißding!
Aber die Bombe war nicht für uns. Sie schlug zwei Straßen weiter ein und die Kinder, die dort genau wie wir zusammengepfercht im Schrank unter der Treppe saßen, wurden heute Morgen tot unter dem Schutt hervorgezogen.
Also sind wir jetzt hier.
Als Robbie mit den Fahrscheinen zurückkommt, gehen wir zusammen zu den Rolltreppen. Jay ist nirgends mehr zu sehen, also brauche ich auch nicht mehr zu schauen, als würde ich mein tragisches Schicksal tapfer tragen. Und auf der Rolltreppe kommen wir ganz gut ohne ihn klar: mit einer Hand halte ich den Karren fest, mit der anderen umklammere ich den Handlauf.
Ich starre zu den Plakaten, die langsam an der Wand neben mir vorbeiziehen. Ein Bild von zwei rotwangigen Kindern, darunter der Satz: Für Kinder ist es sicherer auf dem Land … lasst sie dort. Eine Werbung für ein Mittel gegen Kopfweh. Ein Plakat, das Leute nachdrücklich auffordert, ihr eigenes Gemüse anzubauen.
Und dann schaue ich aus Versehen in die Tiefe.
Es ist ein Bild wie aus einem Albtraum. Ohne uns selbst zu bewegen, gleiten wir durch ein riesiges Rohr in die Erde. Unterwegs zu einer Welt aus summendem Metall und elektrischem Licht. Vor einem Jahr war ich hier zum letzten Mal. Nach dem Krankenhaus traute ich mich nicht mehr, und jetzt weiß ich genau, warum.
Sobald wir unten an der Rolltreppe ankommen, schiebt die Menschenhorde uns weiter durch die weiß gefliesten Gänge. Wir biegen um eine Ecke, danach um eine weitere, und dann befinden wir uns an dem langen, schmalen Bahnsteig der Central Line. Daneben verlaufen die Bahngleise, durch die ununterbrochen Strom gejagt wird. Wenn man darauffällt, wird man frittiert.
»Sieh nur!« Robbie klingt, als würde er einen Ausflug machen. »Da an der Wand ist noch ein Platz frei.« Er rennt dorthin und fängt an, Decken vom Karren zu zerren. »Hier kann Papa liegen. Und da Mama, hier ich. Onkel und Tante können hier … Wo willst du?«
Ich balle die Fäuste.
Ein Jahr lang habe ich grässliche Übungen gemacht und mir die Wangen kaputt gebissen, wenn wieder heiße Kompressen auf meinen Körper gedrückt wurden. Geplant war, dass ich danach fast erwachsen wäre. Dass ich mich auf die Suche nach einem Job machen könnte, heimlich Geschichten schreiben würde, mit Freundinnen zusammen Kriegskekse backen.
Dieses stickige Gleis voll fremder Menschen, die ihre halbe Einrichtung mitschleppen, als wollten sie unter der Erde Vater-Mutter-Kind spielen, war nicht geplant. Jede Nacht neben meiner gesamten Familie zu schlafen war auch nicht geplant.
Aber daran lässt sich nichts ändern. Ich setze mich und strecke meine mageren Beine auf der Decke aus. Ein Gleiswächter ruft streng, dass Platz für die Reisenden bleiben muss, weil die Züge noch über Stunden fahren werden.
Neben mir verputzt Robbie ein ganzes Sandwich mit Ei und Margarine, und dann fängt er plötzlich an zu winken. Fünf Decken weiter winkt ein verstaubter kleiner Junge zurück.
»Der ist bei uns in der Schule«, sagt Robbie mit vollem Mund. Er steht auf. »Ich gehe mal zu ihm! Ja, Ella?«
Die Schule ist schon ein Jahr geschlossen und ich bin auf gar keiner Schule mehr, aber er sagt trotzdem einfach »unsere Schule«.
»Um sechs bist du wieder hier!«, rufe ich ihm nach. »Dann kommen die anderen. Und du bleibst hier an diesem Gleis!«
Er schaut sich nicht mehr um und langsam atme ich aus.
Ich bin vollkommen ungeeignet für die Rolle der tapferen Invalidin.
Schnell nehme ich das Heft, das ich heute Morgen tief unten im Karren versteckt habe. Meine Mutter findet, dass Schluss sein muss mit den erfundenen Geschichten. Was bringen einem Wörter, wenn man stattdessen Socken stricken kann?
Aber ich will weg von hier. Das Heft in meinen Händen ist eine Leiter. Es ist ein Seil aus aneinandergeknoteten Laken, ein Luftballon.
Die Decken um mich herum verströmen den Geruch von Mottenkugeln. Ich will nicht mehr hören, wie Züge durch dunkle Tunnel rattern. Ich will nicht von Reisenden gemustert werden, die durch ein Meer von Menschen waten, die schon jetzt ein Versteck vor den Bomben suchen. Vor den Bomben, die erst nachts fallen werden.
Ich will nicht mehr bei jedem Typen, der vorbeigeht, aufschauen, um zu sehen, ob es Jay ist.
Ich nehme meinen Bleistift und fange an zu schreiben.
3
Ich dachte, ich würde meinen eigenen Körper hassen, aber nach dieser ersten Nacht hier unten weiß ich es ganz sicher: Die Körper der anderen sind noch schlimmer.
Da liegen wir. Dreihundert Fremde auf einem grell beleuchteten Bahnsteig. In U-Bahnhöfen ist es immer miefig, aber nach so vielen Stunden mit so vielen Menschen ist die Luft hier zum Schneiden. Ein erstickendes Gemisch aus Schweiß, abgestandenem Brandgeruch, fish & chips und Urin.
Wie magere Sardinen in einer kolossalen Büchse liegen wir Seite an Seite auf dem Boden. Unsere Köpfe nah an der Wand, die Füße Richtung Gleise. Wer zuletzt gekommen ist, hat Pech und kann nur noch quer liegen, nah am Rand und an all diesen Füßen.
Ich liege unter einer karierten Decke und unter dem Kopf habe ich eine aufgerollte Weste. Neben mir wird ein kleines Kind in einem aufgeklappten Koffer ins Bett gebracht, etwas dahinter trinkt ein Neugeborenes bei seiner Mutter. Sie sitzt mit halb entblößter Brust mitten auf dem Bahnsteig, aber niemand sagt etwas.
Bis halb elf abends fahren die Züge noch. Aber auch danach ist es keinen Moment still. Die Körper wälzen sich und husten, schnauben und röcheln. Sie kratzen sich so ausgiebig, dass ich mir nach einer Weile sicher bin, auch überall Flöhe zu haben.
Und dann ist da noch meine Familie.
Ich entdecke meine Mutter erst, als ein Schatten auf mein Heft fällt. Sie befeuchtet ihren Finger, beugt sich über mich und wischt etwas von meiner Wange. Schweigend klappe ich mein Heft zu und nehme den Strumpf, der noch gestopft werden muss.
Und jetzt liegen sie also um mich herum. Mein immer gut gelaunter baumlanger Onkel, meine Tante, die kaum was sagt. Mein Vater, der sogar im Schlaf vor Müdigkeit grau aussieht.
Seit den Bombardements hat er jede Nacht als Nachbarschaftswächter gearbeitet. Während alle irgendwo Schutz suchen, geht er durch die Straßen. Er kontrolliert, ob wirklich nirgendwo ein Lichtstrahl aus dem Fenster kommt, er löscht Brandbomben, er ist als Erster bei bombardierten Häusern.
Es könnte sich so sicher anfühlen: Durch die ganze Stadt gehen Menschen, die nachts Wache halten. Bloß ist es mein eigener Vater, der dort zwischen den Bomben herumgeht. Das hier ist seine einzige freie Nacht, morgen muss er wieder los.
Dicht neben mir am Bahnsteig liegt Robbie. Die Knie hochgezogen, seine blonden Zottelhaare glänzend im grellen Licht. Zu Hause teilen wir uns ein Zimmer, und ich dachte, er würde mich ertragen, wie er so vieles erträgt: Läuse, Schuhsohlen mit Löchern, verklumpten Brei oder eben eine große Schwester in seinem Zimmer.
Aber hier hat er sich wortlos wieder neben mich gelegt.
In dieser ersten Nacht schlafe ich keine Sekunde.
Über der Erde fallen Bomben, unter der Erde erfüllt Schnarchen den Raum. Kurz nach Mitternacht fangen zwei Leute an, sich zu küssen. Ich kann ihr Geschmatze deutlich hören und lausche, ohne es zu wollen. Meine Lippen kribbeln und das macht mich wütend, weil ich weiß, wie ich aussehe.
Es sollte verboten werden, Menschen halb kaputt zu machen.
Um zehn vor zwei pinkelt ein alter Mann auf die Gleise. Nicht verstohlen in eine Ecke, sondern genau unter der großen Bahnhofsuhr. Meine Stirn ist schweißnass, meine Augen brennen. Ich will schreien, aber das mache ich natürlich nicht. Schreien kostet viel Kraft, das habe ich im Krankenhaus gelernt.
Und dann, nachts um Viertel vor drei, sehe ich Jay wieder.
Er geht über den schmalen Streifen, den wir auf dem Bahnsteig frei lassen müssen. Seine Haare sind zerzaust. Manchmal muss er über einen Arm oder ein schlafendes Bein steigen, einmal bückt er sich, um eine Decke wieder über die Schultern eines kleinen Mädchens zu ziehen.
Und dann erblickt er mich und bleibt stehen.
Gerade erst hat er das fremde Mädchen zugedeckt und ganz kurz habe ich die unsinnige Hoffnung, er könnte besser sehen als die anderen.
Dass er sieht, wer ich früher war.
Dass er mich in Farbe sieht.
Langsam zieht er etwas aus seiner Hosentasche und ich halte die Luft an. Ich weiß nicht, was ich erwarte.
Eine Leiter. Ein Seil aus aneinandergeknoteten Laken.
Es sind glänzende Münzen. Er hält sie triumphierend hoch und lacht wieder so, wie er es auf der steilen Treppe getan hat. Ein Lachen, das sagt: Mir gelingt alles.
Er hat es also wieder getan. Ganz normale Leute für einen sicheren Platz bezahlen lassen. Ich will etwas sagen, oder ihm auf jeden Fall einen vernichtenden Blick zuwerfen, aber er geht schon weiter.
Seine Schritte werfen ein Echo gegen das kahle Gewölbe. Und dann passiert es. Er dreht sein linkes Bein nach innen und tut, als würde er hinken.
Pfeifend geht er um die Ecke. Ich bleibe reglos sitzen.
Ich kann erst wieder richtig atmen, als wir die Liverpool Street Station verlassen. Es ist Viertel nach sechs morgens und allmählich wird es hell.
Die Bahnsteigwärter haben uns weggeschickt, sobald der Fliegeralarm das All Clear-Signal gegeben hatte. Jetzt wischen sie blitzschnell den Bahnhof sauber, bevor die Züge wieder fahren.
Es ist, als sähe ich London zum ersten Mal.
Der Himmel ist aus grauem Samt, die Bombenwerfer sind weg. Die Flakgeschütze schweigen. In aller Ruhe ziehen die Menschen mit ihren Bündeln und Karren durch die stillen Straßen zurück nach Hause. Wer nicht sofort zur Arbeit muss, geht schnell noch ins Bett.
Zehn Minuten dauert der Fußweg vom Bahnhof zu unserem Haus. Der leichte Brandgeruch, an den haben wir uns gewöhnt. Staubwolken in der Ferne können uns auch nichts anhaben. Wir schnuppern, ob wir frische Flammen riechen. Schauen, ob wir qualmende Rauchwolken sehen, lauschen, ob wir hier im Viertel Sirenen hören.
Je näher wir unserer Straße kommen, desto schneller gehen wir. Und dann biegen wir um die letzte Ecke.
Es steht noch da.
Wir haben noch ein Haus.
4
Ich wache auf und alles ist still. Sofort sehe ich, dass neben meinem Bett ein Zettel liegt.
Meine Mutter steht schon wieder in der Schlange vor dem Bahnhof. Ich soll sie um halb drei ablösen, dann geht sie zu einer Versammlung vom Freiwilligenkomitee.
Endlich kann sie da wieder hin.
Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hat sie mich monatelang gepflegt. Keiner traute sich, mich zu besuchen. Die Ärzte sagten, ich könne niemanden mehr anstecken, aber was wissen die Ärzte schon? Vielleicht schwebte doch noch was Unheimliches durch mein Zimmer. Vielleicht war es besser, meinen Atem noch eine Weile nicht in die eigene Lunge zu bekommen.
Monatelang sah ich niemanden außer meinem Vater und meiner Mutter und Robbie. Ich las mich durch die gesamte Bücherei, ich schrieb in mein Geschichtenheft. Erst sehnte ich mich nach meinen Freundinnen. Später nicht mehr.
Ich wasche mir Hände und Gesicht in der Küche, löffle kalten Brei aus dem Topf und schreibe in mein Heft.
Als ich rausgehe, stopfe ich das Heft in meine Jackentasche. Es ist windig und bewölkt. Der Herbst ist im Anmarsch.
Bevor ich am Eingang der U-Bahn ankomme, muss ich erst am Bahnhof vorbei. Eine Reihe Kindergartenkinder ist auf dem Weg zum Zug: Ausgelassen winken sie mit Teddybären, Köfferchen und Gasmasken.
Eine Gruppe Soldaten albert miteinander herum und kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen, eine Frau schiebt einen ratternden Karren voller Äpfel vorbei, der Zeitungsjunge schreit: »Alles über die Radiorede des Königs! Neue Auszeichnung für Kriegshelden!«
Und dann bleibt jemand genau vor meiner Nase stehen.
»Excuse me! Darf ich dich was fragen?«
Das Erste, was ich sehe, sind ihre Beine. Sie trägt kein Kleid oder einen Rock, sondern eine braune Männerhose, die mit einem Gürtel um ihre Taille gezurrt ist. Die Hosenbeine sind aufgerollt, damit sie nicht darüber stolpert.
Über dieser Hose sieht das Mädchen aus wie ein Filmstar. Sie hat eine hellblaue Bluse an und schräg auf ihren dunklen Locken thront ein Hütchen. An ihrem Arm hängt eine Tasche, die fast überquillt, als hätte sie gerade eine Bank ausgeraubt.
»Kannst du mir bitte helfen?«, fragt sie. »Ich bin auf der Suche nach einem Krankenhaus.«
Sie klingt so wie die Leute im Radio. Im echten Leben habe ich noch nie jemanden so ordentlich sprechen hören. Schnell streiche ich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Brauchst du einen Arzt? Hier um die Ecke …«
Sie fängt an zu lachen. »Heute brauche ich mal keinen Arzt. Meine Schwestern finden es echt eine Leistung: Ich bin nie krank, aber trotzdem kommt der Arzt meist für mich. In fünfzehn Jahren bin ich von drei Pferden gefallen, fast mit einem selbst gebauten Boot ertrunken, zwei Mal vom Dach gerollt und von einer schlecht gelaunten Ratte gebissen worden. Aber wo ist hier ein Krankenhaus?«
Ich kann den Blick nicht von ihr abwenden. Sie sieht völlig anders aus als die grauen, erschöpften Menschen um uns herum. Dieses Mädchen schaut nicht, als würde sie sich tapfer durchschlagen, sondern als hätte sie wirklich Lust auf diesen Tag.
»Das London Hospital ist in Whitechapel«, sage ich. Plötzlich habe ich auch mehr Lust auf diesen Tag. »Eine halbe Stunde zu Fuß.« Ich zeige nach Osten.
»Aha«, sagt das Mädchen. »In diese Richtung. Danke.« Sie bleibt stehen.
Ich sehe, wie sie in die Artillery Lane blickt. Die schmale Straße macht fast sofort eine Kurve. Die Gassen dahinter sind noch schmaler und verzweigen sich kreuz und quer. Man verläuft sich sofort.
Ich zögere.
Meine Mutter wartet in der Schlange. Sie rechnet mit mir, ich soll sie ablösen. Wenn ich nicht komme, kann sie nicht zu ihrer Besprechung.
Trotzdem sage ich zu dem Mädchen: »Ich begleite dich.«
»Wie nett! Aber …« Sie schaut auf mein Bein. »Ist das nicht zu weit für dich?«
»Nein«, sage ich nur.
Sie schaut immer noch auf mein Bein. »Bist du so geboren worden?«
»Vor einem Jahr konnte ich schneller rennen als alle drei Jungs vom Gemüsehändler.«
»Kann es wieder gesund werden?«
»Nein. Keine Wettrennen mehr.«
»Das tut mir leid«, sagt sie ernst. Sie streckt die Hand nach mir aus. »Ich bin Quinn.«
Ich tue, als würde ich ihre Hand nicht sehen. Monatelang wollte mich keiner anfassen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das geht.
»Ich bin Ella.«
Wir biegen in die schmale Straße. Wenn man Quinn gehen sieht, scheint der Gehweg elastisch zu sein. Oder wie aus der allerneuesten Gummisorte gemacht. Passanten starren auf ihre Hose und ein spindeldürrer Junge ohne Schuhe schreit etwas von einem Kerl mit Titten, aber Quinn winkt ihm einfach fröhlich zu.
»Eine Hose kam mir im Krieg unerlässlich vor«, sagt sie zu mir. »Ich durfte mir diese hier von unserem Stallknecht ausleihen, darum riecht sie ein wenig nach Stroh und Pferdeschweiß. Aber wenn jetzt eine Bombe fällt, kann sich keiner über meinen hochfliegenden Rock beklagen.«
Sie schaut um sich. »Warum ist hier nichts kaputt? Im Radio, das war doch wohl nicht bloß Propaganda? Wenn keine Bomben fallen, hätte ich genauso gut zu Hause bleiben können.«
»Im Ernst?«, frage ich. »Du kommst wegen der Bomben?«
»Findest du das seltsam?«, fragt sie gelassen. »Natürlich wäre mir lieber, es würden keine Bomben fallen. Aber wenn sie sowieso da sind, dann will ich dabei sein.«
Wir gehen durch eine steinalte Gasse, die so schmal ist, dass Autos und Pferdewagen nicht hindurchpassen. Die Geschäfte haben bunte Fassaden, über unseren Köpfen bewegen sich Schilder mit goldenen Buchstaben.
»Wie wunderbar pittoresk!«, ruft Quinn begeistert. »Die abgeblätterte Farbe und eine Katze ohne Schwanz und diese stinkenden Eimer …«
»Warte nur ab«, sage ich. »Das hier ist der gute Teil unseres Viertels.«
»Bestimmt sind diese Häuser richtig alt«, sagt Quinn einen Moment später. »Vielleicht ja sogar gregorianisch?«
Ende der Leseprobe