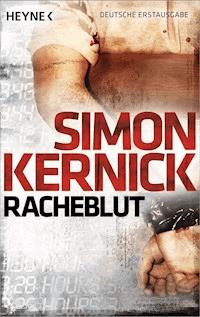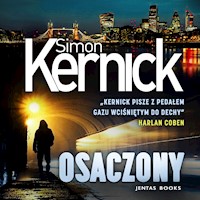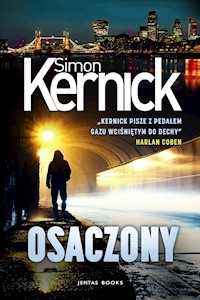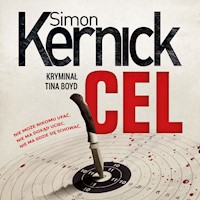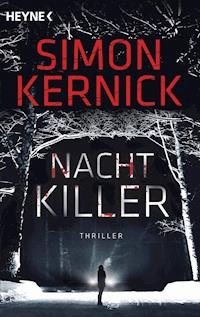
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er findet dich ... wo immer du bist
Jane Kinnear verbringt den Abend bei ihrem Geliebten Anil, als dessen Frau Sharon in der Wohnung auftaucht. In letzter Sekunde kann Jane sich unter dem Bett verstecken. Dann geschieht das Unfassbare: Ein Mann dringt in das Schlafzimmer ein und tötet Anil und seine Frau. Jane hält den Atem an, als Sharon sie flehend ansieht, bevor sie ihre Augen für immer schließt. Fast glaubt sie, dem Albtraum entronnen zu sein. Doch als klar wird, dass Anil ein MI5-Agent war, werden seine Geheimnisse zu ihren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ZUM BUCH
Jane Kinnear verbringt den Abend bei ihrem Geliebten Anil, als dessen Frau Sharon in der Wohnung auftaucht. In letzter Minute kann Jane sich unter dem Bett verstecken. Dann geschieht das Unfassbare: Ein Mann dringt in das Schlafzimmer ein und tötet Anil und seine Frau. Jane hält den Atem an, als Sharons Augen sie flehend ansehen, bevor sie sich für immer schließen. Fast glaubt sie, dem Albtraum entronnen zu sein. Doch als klar wird, dass Anil ein MI5-Agent war, werden seine Geheimnisse zu ihren …
ZUM AUTOR
Simon Kernick, 1966 geboren, lebt in der Nähe von London und hat zwei Kinder. Die Authentizität seiner Romane ist seiner intensiven Recherche zu verdanken. Im Laufe der Jahre hat er eine außergewöhnlich lange Liste von Kontakten zur Polizei aufgebaut. Sie umfasst erfahrene Beamte der Special Branch, der National Crime Squad (heute SOCA) und der Anti-Terror-Abteilung. Mit Gnadenlos (Relentless) gelang ihm international der Durchbruch, mittlerweile zählt er in Großbritannien zu den erfolgreichsten Thrillerautoren und wurde für mehrere Awards nominiert. Seine Bücher sind in dreizehn Sprachen erschienen.
Mehr Infos zum Autor unter www.simonkernick.com.
Ebenfalls erhältlich sind folgende exklusive E-Book-Novellen von Simon Kernick:
Racheblut
Todeszeit 1-3
Mordtage
SIMON KERNICK
NACHTKILLER
Thriller
Aus dem Englischen
von Christoph Hahn
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe The Witness
erschien 2016 bei Century, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 05/2017
Copyright © 2016 by Simon Kernick
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Marcus Jensen
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung von © Shutterstock/SibFilm
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20576-8V001
www.heyne.de
Für Janine. Du warst und bist eine Inspiration.
Prolog
Heute
Der Schuss kracht in meinen Ohren. Die Kugel schlägt nur wenige Zentimeter von meinem Kopf entfernt in die Tür ein. Und obwohl ich auf dem Boden sitze, schnelle ich hoch und stöhne voller Entsetzen auf.
Ich habe Angst. Herrgott, eine Scheißangst.
»Sag die Wahrheit, oder die nächste Kugel ist für dich«, herrscht mich der Mann mit der Waffe an. Er steht gerade mal zwei Meter entfernt und hält den rauchenden Lauf der Pistole auf mich gerichtet. Seine Augen funkeln vor Hass und Wut, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er es ernst meint. Er wird mich umbringen.
»Das ist die Wahrheit«, sage ich mit mehr Selbstvertrauen, als ich eigentlich empfinde.
»Ein Scheiß ist das«, blafft er zurück. »Letzte Gelegenheit. Ich frag nicht noch mal.«
Der Raum ist erfüllt vom Gestank des Todes. Mir gegenüber liegt ein Mann halb mit dem Oberkörper gegen einen Küchenschrank gelehnt. Sein Gesicht und sein Körper sind eine blutige Masse. Er bewegt sich nicht. Ebenso wenig wie die Frau, die hinter dem Mann mit der Pistole seitlich auf dem Boden liegt. Eine Pfütze aus dickflüssigem dunklem Blut bildet sich langsam um ihren Kopf herum, in den dieselbe Pistole, die nun auf mich gerichtet ist, vor ein paar Minuten ein golfballgroßes Loch gestanzt hat.
Ich mache den Mund auf. Ich werde reden, denn ich weiß, dass ich diesem Mann die Informationen geben muss, nach denen er verlangt, auch wenn es mich alles kosten sollte.
Und dann höre ich den Lärm an der Hintertür, die gerade eingetreten wird, gefolgt von wütenden Rufen »Bewaffnete Polizei!« und hastigen Schritten im Korridor.
»Ich bin Polizist«, ruft jemand, der unmittelbar hinter dem Türrahmen steht. »Wir wollen doch nicht, dass irgendwer verletzt wird.«
»Es ist nicht so, wie es aussieht«, ruft der Mann mit der Pistole zurück, ohne mich aus dem Blick zu lassen. »Ich bin auch Polizist.«
»Dann können wir das ja klären«, sagt der andere Mann.
Eine Sekunde später stehen sie in der Küche – zwei Männer in Zivil, sie zielen auf den Mann mit der Pistole, der mich weiterhin fest im Visier hat.
»Legen Sie Ihre Waffe hin«, sagt der Mann auf der linken Seite. »Schön langsam und ruhig.«
»Es ist nicht so, wie es aussieht«, wiederholt der Mann mit der Pistole. Seine Stimme ist gereizt vor Anspannung. Seine Pistole und sein Blick bleiben auf mich gerichtet.
»Wie es aussieht, spielt keine Rolle«, sagt der linke der beiden Männer. »Sie müssen trotzdem Ihre Waffe hinlegen.«
Nichts passiert. Erfüllt von Angst und Furcht, halte ich die Hände in die Luft. Mein Herz pocht wie verrückt, und ich habe das Gefühl, als würde ich jeden Moment ohnmächtig werden.
»Ich habe gesagt, lassen Sie die verdammte Waffe fallen!«
Der Mann mit der Pistole spannt seinen Zeigefinger. »Wenn ihr mich erschießt, nimmt meine letzte Kugel sie mit«, sagt er.
Und in diesem Moment weiß ich, dass ich sterben werde.
LETZTE NACHT
Kapitel 1
Jane Kinnear
Ich schaute die beiden Polizeibeamten an meinem Krankenhausbett an und fragte sie, ob ich eine Zigarette haben dürfte. »Ich weiß, dass es nicht erlaubt ist, aber ich brauche dringend eine, um meine Nerven zu beruhigen, und vor die Tür gehen kann ich ja wohl kaum. Nicht nach dem, was …« Ich ließ meine Stimme ausplätschern, denn es war allen klar, wie der Satz enden würde.
Die Ranghöhere der beiden Polizisten – eine attraktive Schwarze Anfang dreißig, die eine wirklich hübsche Lederjacke über einem eng anliegenden weißen T-Shirt trug – machte zunächst den Eindruck, als wollte sie Nein sagen, doch dann schaute sie zu ihrem Kollegen herüber, einem schmalen Typ, der etwa genauso alt war wie sie und seine schütter werdenden Haare zurückgekämmt trug. »Haben Sie irgendwelche Einwände, wenn diese Dame das Gesetz bricht, DC Jeffs?«
»Falls ich dann auch eine haben kann«, sagte er und warf mir ein verschlagenes Lächeln zu.
»Ich fürchte nur, ich habe keine Zigarette«, sagte ich.
»Nehmen Sie eine von meinen.«
DC Jeffs zog eine Schachtel Silk Cut aus seiner Jackentasche, zündete zwei auf einmal an und reichte mir eine. Mit zitternden Händen nahm ich die Zigarette, murmelte »Danke« und sog gierig daran. Sie schmeckte herrlich. Ich blies den Rauch zur Decke und nahm noch zwei tiefe Züge, während die beiden Polizisten geduldig dasaßen und warteten. Schließlich streifte ich die Asche in den Plastikbecher neben meinem Bett ab. Zum ersten Mal in dieser Nacht fühlte ich mich halbwegs entspannt. Ich wandte mich an die schwarze Polizistin, die sich mir als DS Anji Abbott vorgestellt hatte.
»Wo soll ich anfangen?«, fragte ich.
Sie lächelte und stellte einen Kassettenrekorder auf den Nachtschrank. »Ganz vorne«, sagte sie.
Ich nickte bedächtig und atmete tief durch, um Kräfte zu sammeln für das, was ich zu erzählen hatte.
Ich bin Anil in einem Baumarkt zum ersten Mal begegnet. Klingt merkwürdig, war aber so. Ich war auf der Suche nach professionellem Rohrreiniger, und er wollte – keine Ahnung, was er einkaufen wollte, ich interessierte mich mehr für ihn selbst. Er war ein gut aussehender Bursche, nicht der Größte und auch ein, zwei Kilo fülliger, als normalerweise mein Geschmack ist, aber er hatte ein nettes Gesicht. Wie jemand, der gern lächelt.
Ich fand ihn halt attraktiv. Schöne Hände hatte er auch – das ist etwas, worauf ich bei Männern immer zuerst achte. Also habe ich dafür gesorgt, dass er mich bemerkt, und ihn breit angelächelt. Und das war’s dann. Wir sind ins Plaudern geraten, haben unsere Telefonnummern ausgetauscht, und keine achtundvierzig Stunden später haben wir uns zu unserer ersten Verabredung getroffen.
Das ist zwei Wochen her. Wir hatten dann noch ein weiteres Date vor letzter Nacht, ein Abendessen in einem Restaurant hier in der Gegend. Das endete mit einem Kuss auf dem Gehweg vor meiner Haustür und wäre vielleicht auch weiter gegangen, wenn ich mich nicht an meine eiserne Regel gehalten hätte: nie mit einem Mann vor dem dritten Date ins Bett. Wer nicht so lange warten kann, ist ohnehin nur ein Aufreißer, um den man am besten einen Bogen macht.
Heute Nacht war also unsere dritte Verabredung. Ich habe keinen Führerschein, deshalb sollte Anil mich in meiner Wohnung in Watford abholen, und wir würden dann zu ihm fahren in das kleine Dorf, wo er wohnt, er wollte etwas für uns kochen. Ich denke, wir wussten beide, dass wir miteinander im Bett landen würden, und um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen nervös. Ich hatte schon immer eine ausgeprägte Libido. Das heißt nicht, dass ich mit jedem ins Bett steige – ganz im Gegenteil –, sondern nur, dass es für mich eine gewisse Rolle spielt, dass ein Mann im Bett weiß, was er tut. Ich habe in der Hinsicht ein paar Desaster erlebt, und weil ich Anil wirklich mochte und darauf hoffte, dass es funken würde zwischen uns, hatte ich gleichzeitig Angst, dass es nicht passieren würde, wenn Sie wissen, was ich meine?
Doch schon in dem Moment, als er bei mir zu Hause auftauchte, wusste ich, dass irgendwas nicht stimmte. Er war nervös und angespannt, ganz im Gegensatz zu den ersten Malen. Eindeutig lag ihm irgendwas auf der Seele. Ich habe ihm sogar angeboten, unser Date zu vertagen, und jetzt wünsche ich mir natürlich, er wäre darauf eingegangen, aber er meinte, nein, alles in Ordnung, er hätte nur einen harten Arbeitstag hinter sich. Das war noch so eine Eigenart von Anil. Er blieb immer ziemlich vage, wenn es darum ging, was er beruflich machte. Allem Anschein nach war er Mitinhaber eines kleinen Familienunternehmens, das handgefertigte Designermöbel aus Indien importierte, aber das war auch schon alles, was er dazu zu sagen hatte und sagen wollte. Doch offensichtlich verdiente er ganz gut, denn er konnte es sich leisten, in einem hübschen kleinen Landhaus am Ende einer gewundenen Landstraße mit Blick auf die Felder zu wohnen. Ganz anders als meine Vorstadt in Watford.
»Und, welche kulinarischen Genüsse wirst du für mich aus dem Hut zaubern?«, fragte ich ihn, als wir aus dem Auto gestiegen waren und auf den Hauseingang zusteuerten.
»Hm, ja … da gibt’s ein kleines Problem«, sagte er. »Ich hatte einen hektischen Tag auf der Arbeit und bin nicht dazu gekommen, unser Essen vorzubereiten, aber es gibt hier ein hervorragendes thailändisches Restaurant, die auch nach Hause liefern.« Er schloss die Tür auf und schaute mich mit einem Lächeln an, das viel zu gezwungen aussah, als dass es hätte echt sein können. Dann ging er hinein.
Es war nicht gerade ein verheißungsvoller Anfang für einen romantischen Abend, aber zumindest war sein Haus gut geheizt, und wie sich herausstellte, hatte er einen ordentlichen Vorrat an hochklassigen Weinen, was ja fast jede Situation angenehmer gestaltet. Wir saßen auf dem Sofa und teilten uns eine Flasche angenehm fruchtigen Chablis, und der erwünschte Effekt trat fast augenblicklich ein – er entspannte sich, und auch ich wurde wieder lockerer. Eins führte zum anderen, er machte eine zweite Flasche auf, und es dauerte nicht lange, bis wir herumknutschten. Ich hatte ganz vergessen, dass ich Hunger hatte, und genoss stattdessen die Leichtigkeit, die mit dem Alkohol einherging, und bevor ich mich versah – zumindest sagte ich mir das –, ließ ich mich von ihm die Treppe hinauf ins Schlafzimmer führen.
Ich würde nicht sagen, dass der Sex mit ihm atemberaubend war, aber das ist beim ersten Mal mit jemandem ohnehin selten der Fall, besonders wenn beide getrunken haben. Aber Anil hatte sich passabel geschlagen, und hinterher lagen wir im Bett und redeten über dies und das, und ich weiß noch, dass ich dachte, allmählich wird es ein ganz guter Abend.
Und ziemlich genau in diesem Moment fing alles an schiefzulaufen, denn schon eine Sekunde später hörte ich, wie die Haustür geöffnet wurde und eine Frau Anils Namen rief.
An ihrem fröhlichen, vertrauten Tonfall erkannte ich sofort, dass es entweder Anils Freundin oder seine Frau war, und sein Gesichtausdruck, als er mit einem Mal aufrecht im Bett saß, bestätigte meinen Verdacht.
»Ich bin oben im Schlafzimmer«, rief er fast genau so aufgekratzt zurück. »Ich bin in einer Sekunde unten.« Dann wandte er sich an mich und flüsterte: »Ich kann das alles erklären, aber im Augenblick tu mir bitte einen Gefallen und kriech unters Bett.«
»Was?«, blaffte ich ihn an. Ich konnte es nicht fassen, wie kaltschnäuzig der Kerl war.
»Sie ist echt schwierig, sie geht leicht in die Luft. Ich mein’s ernst. Wenn sie dich hier findet, sind wir beide tot.«
Er schob mich aus dem Bett und sprang sofort selbst auf, um die Weinflasche samt Gläsern unter dem Bett zu verstauen. Seine Klamotten schob er mit dem Fuß hinterher. Er machte dabei so gut wie kein Geräusch, was ich erstaunlich fand, mich aber andererseits vermuten ließ, dass diese Situation nichts Neues für ihn war.
Ich hörte die Freundin oder Ehefrau die Treppe hinaufkommen und wusste, dass ich mich schnell entscheiden musste. Sie hatte nicht sonderlich jähzornig geklungen, als sie nach ihm gerufen hatte, und ich spielte mit dem Gedanken, die Sache einfach durchzustehen und ihr zu erklären, wer ich war und was ich hier machte, meine Klamotten anzuziehen und mich erhobenen Hauptes zu verabschieden. Aber die Vorstellung, nackt in einem fremden Haus herumzustehen und irgendwelche Erklärungen abzuliefern, war dann doch nicht so verlockend, und unter dem Zeitdruck entschloss ich mich für die einfachere Lösung, zog mir hektisch meine Bluse und meine Hose über, schnappte mir meine restlichen Sachen und krabbelte unter das Bett. Zwischen Bettgestell und Boden gab es ungefähr dreißig Zentimeter Platz, sodass ich keine großen Probleme hatte, mich unsichtbar zu machen.
»Wie geht’s dir, Liebling?«, fragte er. »Ich wollte gerade ins Bett, bin total erledigt. Wieso kommst du denn heute schon wieder?«
Mein Gott, dachte ich, während ich halb nackt dalag und mit der Nase fast an den Lattenrost stieß. Wie bringen manche Männer es fertig, sich derart dreist und arschgeigenmäßig aufzuführen?
Genau betrachtet, war das der traurigste Aspekt des Ganzen: Die arme Frau hatte nicht den geringsten Verdacht.
»Ich hatte absolut keine Lust, noch eine Nacht im Hotel zu verbringen«, sagte sie. »Deswegen habe ich mir einen früheren Flug geschnappt. Eigentlich wollte ich dich anrufen, aber dann dachte ich mir, ich überrasche dich lieber.«
Sie lachte, und ich hörte das Rascheln ihrer Kleider, während er sie umarmte und küsste. Ich fragte mich, ob sie ihn wohl im Verdacht hatte, dass er fremdging, und einfach nur die Gelegenheit nutzte, ihm auf den Zahn zu fühlen.
Anil schien das nicht zu kümmern. »Schön, dich wieder hier zu haben, Schatz«, sagte er ohne den geringsten Anflug von Furcht oder Nervosität in seiner Stimme.
Am liebsten wäre ich unter dem Bett hervorgekrochen und hätte lauthals herausposaunt: »Ganz im Gegenteil.« Doch irgendwie riss ich mich zusammen und überlegte mir stattdessen, wie lange ich wohl noch in meinem Versteck festsitzen würde, zumal Anil angekündigt hatte, dass er schlafen wollte.
Es dauerte nicht lange, bis ich eine Antwort bekam. »Oha! Soo müde bist du anscheinend gar nicht …«
Nein, natürlich nicht, dachte ich. Er hat es ja gerade erst mit mir getrieben.
Dann kam die Rettung. »Es ist noch viel zu früh, um ins Bett zu gehen«, sagte sie. »Zieh dir was an, und wir trinken einen im Pub. Hast du schon gegessen?«
Anil verneinte.
»Ich auch nicht. Und ich hab einen Mordshunger.«
Die beiden plauderten, während Anil sich anzog. Er fragte sie, wie ihre Reise gewesen war, und sie fragte, was er in der Zwischenzeit gemacht hatte. Sie klangen wie ein ganz normales Ehepaar, und ich wurde ein wenig eifersüchtig auf ihren lockeren Umgang, denn so etwas hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. Doch dann ermahnte ich mich, dass ihre Beziehung so toll nicht sein konnte, wenn Anil gelegentlich vom Bedürfnis gepackt wurde, sich anderweitig abzureagieren, und seine Frau – ihr Name war übrigens Sharon – nichts mitbekam.
Sharon ging im Zimmer auf und ab, während sie redete, und ich empfand ein beinahe kindliches Prickeln der Erregung, weil ich nur Zentimeter von ihr entfernt war, ohne dass sie das Geringste ahnte. Sie hatte zierliche bronzefarbene Füße mit rot-violett lackierten Zehennägeln, die in hübschen hochhackigen Sandalenpumps steckten. Aus irgendeinem Grund weckte dieser Anblick mein Mitleid. Sie war offensichtlich eine Frau, die auf sich achtete und dachte, sie hätte eine Beziehung mit einem anständigen Kerl, während sie tagein, tagaus betrogen wurde, weil er nun mal einfach kein anständiger Kerl war. Sondern ein Stück Scheiße. Ich spürte, wie der Zorn in mir aufstieg. Ich war drauf und dran, unter dem Bett hervorzukriechen und ihr zu sagen, was ihr Freund in Wirklichkeit veranstaltete. Ich wollte ihr alles erzählen – wie ich ihn getroffen hatte, wie er sich im Restaurant an mich herangemacht hatte und dass von einer Freundin nie die Rede gewesen war, weil ich ihn sonst nicht mal mit der Kneifzange angefasst hätte, weil ich nämlich nicht so eine bin, die –
»Was ist das für ein Geräusch?«, sagte Sharon.
»Welches Geräusch?«, sagte Anil, der gerade eine Schranktür öffnete.
Doch Sharon kam nicht dazu, ihm zu antworten, denn im nächsten Moment ging die Schlafzimmertür auf, und ich hörte sie erstaunt nach Luft schnappen. Dann folgte ein Geräusch wie beim Entkorken einer Champagnerflasche, und gleich darauf klatschte sie rücklings auf den Boden genau neben dem Bett. Ich war völlig baff und sah mit an, wie sie zur Seite rollte und genau in meine Richtung schaute. Sie war eine attraktive Frau mit olivfarbener Haut – dem Anschein nach zumindest teilweise asiatischer Herkunft. Sie trug ein weißes Kleid unter einem schwarzen Jackett und hielt beide Hände an den Bauch gepresst. Auf dem Kleid breitete sich ein roter Blutfleck aus. Ihre dunkelbraunen Augen hatten einen flehenden Ausdruck, und ich musste alle meine Selbstbeherrschung aufbringen, um nicht laut zu schreien.
Im Gegensatz zu Anil. Er rief voller Entsetzen: »Bitte nicht schießen!«
Dann folgte ein weiteres Geräusch, eine Art elektrisches Knistern oder Funken, und ich spürte, wie Anil rückwärts auf das Bett fiel, mit solcher Wucht, dass die Matratze gegen meine Nase stieß. Der Einbrecher – oder was immer er war – schnappte sich einen Stuhl, der in der Ecke des Zimmers stand, und stellte ihn neben Sharon, die sich unter Schmerzen auf dem Boden wand und stöhnte.
Er bugsierte Anil auf den Stuhl und band ihn mit Klebeband fest, jedenfalls hörte es sich so an.
Von meiner Position aus konnte ich bloß die schwarzen Stiefel des Killers sehen. Einmal reichte er mit der Hand nach unten, um das Klebeband um Anils Knöchel zu wickeln, doch auch da sah ich nur, dass er einen langärmeligen dunklen Pullover und schwarze Handschuhe trug.
Eine solche Angst wie in diesem Moment hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich hielt die Luft an, so lange es ging, und atmete immer nur kurz ein, wenn der Killer ebenfalls irgendwelche Geräusche machte. Ich wusste, dass er mich, falls er mich entdeckte, mit Sicherheit auch umbringen würde. Das war das Schlimmste. Zu wissen, dass mein Leben von einem Moment auf den anderen vorbei sein würde. Ich hatte mal eine kurze Affäre mit einem Detective von der Mordkommission gehabt, der mir immer wieder erzählte, dass die meisten Mörder irgendwelche gescheiterten Deppen sind, die impulsiv handeln und häufig nicht einmal vorhaben, einen Mord zu begehen, weshalb sie entsprechend planlos handeln. Dieser Kerl hier war ganz anders. Er – und obwohl ich ihn nicht sehen konnte, wusste ich, dass es ein Mann war – verhielt sich methodisch und ruhig, als ob er genau wusste, was er tat. Er war ein fleischgewordener Albtraum, und er stand nicht mal einen Meter von mir entfernt.
Meine Angst wurde fast unerträglich, und ich musste all meine Kraft und meinen Willen aufbringen, um sie unter Kontrolle zu halten, denn mir war klar, dass davon mein Leben abhing.
Anil kam wieder zu sich und stöhnte. Er klang müde.
»Was ist hier los?«, fragte er erschöpft.
Auf seine Frage folgte eine lang anhaltende Stille.
Dann sagte der Eindringling: »Wenn du meine Frage korrekt beantwortest, wirst du schnell sterben. Wenn nicht, dauert es länger. Hast du das kapiert?«
Es war, wie ich vermutet hatte, ein Mann. Sein Akzent war schwer auszumachen – er klang ziemlich neutral –, aber andererseits habe ich darauf auch nicht so sehr geachtet. Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass er Engländer war.
»Bitte. Meine Frau … Sie ist verletzt.«
»Wenn du meine Frage beantwortest, wird sie am Leben bleiben.«
Ich konnte Anils Antwort nicht verstehen, aber der Killer fragte ihn dann, wie viele Handys er besaß.
»Nur eins«, sagte Anil, der mittlerweile wesentlich wacher klang.
Der Eindringling machte eine schnelle Bewegung, und Anil schrie vor Entsetzen und Schmerz laut auf. Er zitterte am ganzen Leib – so sehr, dass der Stuhl wackelte. In diesem Moment verflog sämtliche Wut, die ich ihm gegenüber empfunden hatte.
»Ich werde dich in Stücke schneiden, wenn’s sein muss«, sagte der Killer seelenruhig. »Oder dich bei lebendigem Leib abfackeln. Aber du wirst meine Fragen beantworten.«
»Mein Gesicht«, wimmerte Anil, während dicke Blutstropfen auf den Teppich vor dem Stuhl fielen.
»Wie viele Handys?«
»Zwei«, presste Anil hervor. »Eins in meiner Jeans und eins in der Schublade, hinter mir.«
Der Killer fand die beiden, und es herrschte eine kurze Zeit Stille, während er sie überprüfte – zumindest vermutete ich das.
»Nächste Frage«, sagte er schließlich. »Was weißt du über den geplanten Anschlag?«
»Bitte. Ich hab keine Idee, wovon Sie reden.«
»Anil. Mach dir nichts vor. Ich weiß genau Bescheid über deine geheime Existenz, deshalb ist es sinnlos, irgendwelche Spielchen mit mir zu treiben. Also wirst du dich jetzt kooperativ verhalten. Oder soll ich dir die andere Seite vom Gesicht auch noch aufschlitzen?«
Es folgte ein kurzes Schweigen, bis Anil wieder etwas sagte. Seine Stimme klang resigniert. »Ich weiß, dass ein Anschlag unmittelbar bevorsteht.«
»Wer hat dir das erzählt?«
»Karim.«
»Nenn mir die Details.«
»Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es eine größere Operation ist und dass sie sehr bald über die Bühne gehen wird. Das ist alles, was Karim mir erzählt hat. Ich hab selbst versucht, mehr rauszufinden, aber er hat nichts gesagt. Ich weiß nicht mal, ob er selbst die Details kennt.«
Der Killer sagte kein Wort. Ich hörte, wie er sich umdrehte und aus dem Zimmer ging und anscheinend die Treppe hinunterstieg. Mit einem Mal herrschte eine eisige Stille – abgesehen von Anils schwerem Atem und dem stetigen Geräusch der Blutstropfen, die auf den Teppich fielen. Wollte Anil vielleicht versuchen, mich dazu zu bringen, ihn zu befreien? Ich betete darum, dass er das bleiben ließ, denn der Killer würde schnell wiederkommen.
»Bist du okay?«, hörte ich ihn sagen, und eine Woge der Angst schoss mir durch den Körper. »Sharon, bist du okay?«
Sharon rollte sich auf den Rücken. Ihr Kleid war mittlerweile komplett von Blut getränkt und ihr Gesicht ganz bleich infolge des Blutverlusts. »Es tut so weh«, presste sie flüsternd hervor. Für mehr reichte ihre Kraft nicht.
Eine Minute verging. Vielleicht auch zwei. Es war schwer zu sagen, denn die Zeit schien im Schneckentempo dahinzukriechen, und ich hatte Angst, dass Anil mit mir reden würde und der Killer es mitbekam. Und dann hörte ich Schritte auf der Treppe, und der Killer war wieder im Zimmer.
»Bitte, ich hab Ihnen doch alles gesagt, was ich weiß«, sagte Anil voller Verzweiflung. »Und ich hab Ihr Gesicht nicht gesehen. Ich werde niemandem von alldem hier erzählen. Ich schwöre es.«
Ich hörte, wie irgendein Behälter aufgeschraubt wurde, und dann sah ich die Füße des Killers genau neben dem Bett und eine klare Flüssigkeit, die über Sharon ausgekippt wurde. Es dauerte nur einen kurzen Moment, bis ich begriff, dass es Benzin war. Sie hustete und spuckte und wand sich in dem Versuch, dem Schwall auszuweichen, doch es war vergeblich. Anil schrie und bettelte, und auch ich wurde von Panik erfasst, weil ich ebenfalls bei lebendigem Leib verbrennen würde, wenn ich unter dem Bett blieb. Ich hatte solche Angst, dass ich kurz davor stand, hervorzukriechen und einen Fluchtversuch zu unternehmen, doch irgendwie schaffte ich es, die Beherrschung zu behalten, da mir klar war, dass ich es nie im Leben schaffen würde.
»Wem hast du von dem Anschlag erzählt?«, fragte der Killer.
»Der MI5 weiß Bescheid.«
»Was wissen die?«
»Nur dass demnächst ein Anschlag stattfinden wird. Aber nicht, wann und wo und wer darin verwickelt ist.«
»Und was erwarten sie von dir?«
»Dass ich weiterhin versuche, aus Karim Informationen herauszuholen. So viele wie möglich.«
»Haben sie das Haus hier verwanzt?«
»Ja.«
»Und wird es überwacht?«
»Ja.«
»In diesem Augenblick?«
»Keine Ahnung, aber ich schätze, ja. Hören Sie …« Anil geriet ins Stocken. »Bitte tun Sie meiner Frau nichts.«
Der Killer machte eine weitere schnelle Bewegung, und wieder schrie Anil auf wie ein verwundetes Tier.
»Ich will mehr Details zu dem Anschlag wissen. Raus damit.«
»Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Ich schwöre es.«
Der Killer machte zwei Schritte vorwärts. Seine Stiefel waren gerade mal einen halben Meter von mir entfernt. Er stand genau vor Anil.
Anil wiederholte, dass er ihm alles gesagt hatte, was er wusste, doch der Killer rasselte gebetsmühlenartig immer wieder die gleiche Frage herunter. Er blieb dabei ruhig und gelassen, als ob das Ganze für ihn eine gewohnte Routine war. Dann hörte ich, wie weiteres Klebeband von der Rolle abgewickelt wurde, und mit einem Mal war von Anil nur noch ersticktes Gemurmel zu hören.
Etwas wurde durchgeschnitten, und der Stuhl, auf dem Anil saß, begann heftig zu wackeln und zu zittern. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte – glücklicherweise nur ein paar Sekunden –, dann verebbte Anils Keuchen, und der Killer trat einen Schritt zurück und riss das Klebeband von Anils Mund herunter. Jetzt machte Anil kein Geräusch, und im Zimmer herrschte mit einem Mal eine Totenstille.
Der Killer räusperte sich. »Anil. Fangen wir von vorne an. Was weißt du über den Anschlag? Erzähl mir alles. Ansonsten gibt es noch genug andere Körperteile, die ich abschnippeln kann.«
Doch Anils einzige Antwort war ein stoßweises Röcheln.
Ich hörte das Geräusch von einem weiteren Schnitt, und Anil schien heftig auf seinem Stuhl zu zucken und zu zittern, bis er sich schließlich gar nicht mehr rührte.
Mehr Blut tropfte auf den Teppich, und der Killer trat von dem Stuhl weg. Ich dachte, er würde weggehen, doch schon einen Augenblick später stellte ich mit Entsetzen fest, dass er anfing, die Schubladen und Schränke zu durchwühlen. Ich wusste, dass er irgendwann unter dem Bett nachschauen würde, und dann …
Ich erstarrte. Jede Faser meines Körpers war angespannt. Ich wagte es nicht, meinen Kopf zu bewegen, sondern schaute starr nach oben in der Hoffnung, dass, wenn er mich finden würde, er mich wenigstens schnell erledigen würde. Ich dachte an meine beiden Söhne, die weit weg waren, durch jeweils einen Ozean von mir getrennt, und fragte mich, ob ich sie jemals wiedersehen würde und wie erschüttert sie wären, wenn sie erfuhren, dass sie ihre Mutter unter solchen Umständen verloren hatten. Meine Jungs waren mitfühlend und immer um mich besorgt, und beide würden nie darüber hinwegkommen, dass meine letzten Minuten derart qualvoll und entsetzlich verlaufen waren.
So lag ich da und wartete. Und wartete. Und überlegte, wie viel Zeit mir noch blieb. Denn das Merkwürdige an diesem Killer war, dass er anscheinend nicht die geringste Eile hatte. Neben mir lag Sharon, glücklicherweise von mir abgewandt auf der Seite. Sie wimmerte leise, während sich unter ihr auf dem Teppich eine rote Lache ausbreitete.
Ich hörte, wie die Schranktür zugeschlagen wurde und sich die Stiefel des Einbrechers wieder näherten.
Er würde gleich unter dem Bett nachschauen. Herrgott, und dann würde er mich sehen.
Aber nichts passierte. Stattdessen schritt er um das Bett herum, blieb vor Sharon stehen und schoss ihr zweimal ins Gesicht.
Sie bäumte sich auf, ihre Hände landeten links und rechts von ihrem Körper, dann bewegte sie sich nicht mehr.
Ich hörte, wie der Killer die Tür zum angrenzenden Badezimmer öffnete und hineinging. Er legte seine Pistole irgendwo ab, machte seinen Reißverschluss auf und pinkelte los.
Ich hatte die Wahl: Blieb ich, wo ich war, und wurde mit einiger Sicherheit erschossen, oder kroch ich unter dem Bett hervor und rannte weg?
Ich habe mich schon immer von meinen Impulsen leiten lassen. Was mir nicht jedes Mal gut bekommen ist – unter anderem deswegen war ich mit neunzehn schon Ehefrau und Mutter. Aber in diesem Moment wusste ich, dass ich keine Sekunde hatte, um mich zu entscheiden.
Also rollte ich auf der von der Toilette abgewandten Seite unter dem Bett heraus und sprang auf. Als ich gerade losrennen wollte, schaute ich unwillkürlich herüber in Richtung Badezimmer. Mein Blick schweifte kurz über Anil, der zusammengesunken mit hängendem Kopf auf dem Stuhl saß, und dann sah ich den Killer. Er hatte wohl eine Art Maske getragen, die er sich jetzt über die Stirn geschoben hatte, sodass ich sein Gesicht erkannte. Unsere Blicke trafen sich. Er starrte mich überrascht an, und bevor er nach seiner Pistole greifen konnte, die er auf dem Spülkasten abgelegt hatte, rauschte ich zur Schlafzimmertür heraus und knallte sie hinter mir zu. Dann rannte ich weiter zur Treppe und nahm in meiner verzweifelten Angst immer drei oder vier Stufen auf einmal, um so schnell wie möglich zu verschwinden.
Aber er war ebenfalls schnell. Ich hörte ihn mit schweren Schritten durch das Schlafzimmer rennen, und als ich das Erdgeschoss erreicht hatte, sah ich, wie er zur Schlafzimmertür herausstürzte.
Ich rannte durch den Wohnzimmerbereich zur Haustür und zerrte daran, doch sie ging nicht auf.
Der Killer kam die Treppe herunter, und es würde nur noch Sekunden dauern, bis er mich im Blickfeld hatte. Ich wusste, dass er ein guter Schütze war, und nachdem ich gesehen hatte, mit welcher Ruhe er Sharon zweimal ins Gesicht geschossen hatte, nahm ich nicht an, dass er Skrupel haben würde, mir eine Kugel in den Hinterkopf zu jagen.
Ich versuchte meine Panik zu unterdrücken und stellte fest, dass die Tür von innen verriegelt war. Ich traute mich nicht, mich umzublicken, für den Fall, dass er gerade auf mich anlegte, sondern schob den Riegel zur Seite. Dann war ich draußen im Freien, und die kalte Luft stach mir ins Gesicht.
Ich knallte die Tür hinter mir zu, um mir zusätzlich Zeit zu verschaffen, und rannte, so schnell ich konnte, laut schreiend. Die Gegend war zwar nicht weit weg von London, aber doch ziemlich ländlich, und gegenüber von Anils Haus gab es nichts als Felder, die auf den ersten Blick keinerlei Deckung boten. Deshalb bog ich scharf nach links auf einen Feldweg ab, der zu einer Gruppe von Bäumen führte.
Es waren nur zwanzig Meter bis dahin, und ich rannte die Strecke so schnell, wie ich noch nie in meinem Leben gelaufen bin, und ohne mich um die Steine und den Kies zu kümmern, die sich in meine nackten Füße bohrten, denn ich wusste, dass mich jeden Moment eine Kugel erwischen konnte.
Ich erreichte das Wäldchen und lief mit unvermindertem Tempo weiter. Das Adrenalin rauschte nur so durch meinen Körper. Zwischen den Bäumen sah ich die Lichter eines Hauses, das gerade mal dreißig Meter entfernt war. Ich hörte den Killer zwar nicht, doch trotzdem konnte er in der Nähe sein. Ich musste mir schnell überlegen, was ich tat. Anils Haus stand ziemlich abgelegen vom Rest des Ortes. Es gab nicht einmal Verkehrslärm, deswegen war es eher unwahrscheinlich, dass mich jemand gehört hatte, als ich um Hilfe geschrien hatte. Und wenn der Killer wirklich so cool war, wie es schien, dann konnte er sich einfach Zeit lassen und mich in jedes x-beliebige Haus verfolgen, in das ich mich verkroch. Ich stellte eine Bedrohung für ihn dar, ich hatte sein Gesicht gesehen. Zwar nur für einen Sekundenbruchteil, aber lange genug, um ihn zu identifizieren und mit einem Doppelmord in Verbindung zu bringen.
Ich musste mich irgendwo verstecken. Ich zwang mich, einen Blick über die Schulter zu werfen, doch außer Bäumen war nichts zu sehen. Ich schlug einen Haken scharf nach rechts, weg von dem Haus, lief in geduckter Haltung ungefähr zehn Meter weiter und verkroch mich dann unter ein paar Brombeerranken und drehte mich so, dass ich in die Richtung blickte, aus der ich gekommen war. Ich lag mucksmäuschenstill da und versuchte nicht lauter zu atmen als das leise Rauschen der Bäume um mich herum.
Zehn Sekunden vergingen. Dann zwanzig. Ich hörte, wie jemand durch das Unterholz schlich.
Ich presste mich an den Boden und hielt die Luft an. Im Nachhinein war ich froh über meinen Entschluss, zu meiner Verabredung mit Anil dunkle Sachen anzuziehen.
Er kam näher, aber ich konnte ihn nicht sehen, weil ich mein Gesicht gegen den Boden drückte, damit meine helle Haut in der Dunkelheit nicht herausstach.
Plötzlich knackte höchstens fünf Meter entfernt ein Zweig. Ich lauschte und hörte seinen langsamen, regelmäßigen Atem. Er jagte mich. Langsam und methodisch. Er schien alle Zeit der Welt zu haben.
»Ich weiß, dass du hier irgendwo bist«, rief er in einem merkwürdigen Singsang, gerade so, als würde er mit einer Gruppe von Kindern Versteck spielen. »Ich werde dich finden, und wenn ich dich finde, dann …«
Er kam immer näher. Herrgott, er war ganz dicht bei mir, und das Verlangen, einfach aufzuspringen und wegzurennen, wurde fast übermächtig, aber ich rührte mich nicht. Ich hielt die Luft an. Damals in Südafrika, als kleines Mädchen, konnte ich richtig lange die Luft anhalten. Einmal, mit zwölf, schaffte ich zweieinhalb Minuten. Natürlich war ich nicht mehr so gut wie damals, aber immer noch überdurchschnittlich, was sich in diesem Fall als sehr nützlich herausstellte, denn ich hörte weitere Schritte, die näher kamen.
Hatte er mich am Boden liegen sehen? Spielte er nur ein Spielchen mit mir?
Mein Körper stand unter Hochspannung. Ich wartete.
Noch ein Schritt.
Er stand beinahe genau vor mir. Meine Lungen brannten.
Und dann hörte ich es. Irgendwo in der Ferne. Das jammernde Heulen einer Polizeisirene. Es war schwer zu sagen, ob sie sich näherte oder entfernte, aber das spielte keine Rolle, denn der Killer stieß einen leisen Fluch aus und lief dann durch das Wäldchen zurück.
Ich holte vorsichtig Luft, aber wagte es nicht, mich zu bewegen, bis ich ein paar Minuten später hörte, wie ein Wagen angelassen wurde. Ich griff vorsichtig in meine Hosentasche und nahm mein Handy heraus. Ich hatte nur ein schwaches Signal. Ich wählte die 999, blieb aber dennoch auf der Hut, obwohl der Wagen davonfuhr.
Es klingelte am anderen Ende. Einmal. Zweimal. Dann meldete sich eine Frauenstimme. Mir fiel ein Stein vom Herzen.
»Notrufzentrale. Um was für einen Notfall handelt es sich?«
»Mord«, flüsterte ich und hoffte inständig, dass dieser Albtraum endlich vorbei war. »Ich möchte einen Mord melden.«
Kapitel 2
Der Schockzustand ist eine merkwürdige Sache. Er setzt nicht dann ein, wenn man es erwarten würde. Nach dem, was ich gesehen und gehört hatte, sollte man denken, ich würde wie gelähmt in Schockstarre verfallen, und doch saß ich relativ ruhig und gelassen in einer warmen Küche und trank einen starken und überaus wohlschmeckenden Kaffee, während im Hintergrund leise klassische Musik dahinplätscherte.
Es war die Küche von Ben und Diane Miller, den nächsten Nachbarn von Anil. Nach meinem Anruf bei der Polizei fühlte ich mich allmählich etwas sicherer, wagte mich aus meinem Versteck im Wald und klopfte an ihre Haustür. Mr. und Mrs. Miller waren nette Leute – Anfang sechzig, beide im Ruhestand und wohlsituiert. Und sie waren immer noch ineinander verliebt, das war unübersehbar. Sie wickelten mich in eine Decke ein, kümmerten sich sehr liebevoll um mich und spendeten mir Trost, während wir auf die Polizei warteten. Ihre Freundlichkeit war wie Balsam für die Seele nach dem Blutbad dieser Nacht. Sie erinnerten mich an die Eltern, die ich mir immer gewünscht, aber nie gehabt habe, und ich fühlte mich sicher in ihrer Gesellschaft.
Es dauerte fünfzehn Minuten, bis das erste Polizeiauto aufkreuzte, was einem nicht wirklich Mut machte angesichts der Tatsache, dass ich eben erst einen Doppelmord gemeldet hatte. Die Herren Beamten waren auch nicht gerade geeignet, weiteres Vertrauen zu schaffen. Der eine mittelalt und fett und vermutlich nicht mal in der Lage, eine Uhr aufzuhalten, von einem entschlossenen Kriminellen ganz zu schweigen, und der andere ein Milchbubi, der aussah wie frisch von der Schule. Sie hatten bei den Millers nur einen Zwischenstopp eingelegt, um festzustellen, ob ich unverletzt war, und sagten, ich sollte bleiben, wo ich war, während sie weiter ermitteln würden. Danach habe ich sie nie wieder gesehen.
Glücklicherweise dauerte es bloß ein paar Minuten, bis es von Polizei nur so zu wimmeln begann. Dieses Großaufgebot benutzte das Haus der Millers als provisorische Kommandozentrale, ich sah im Erdgeschoss bewaffnete Beamte in Uniform, Leute in weißen Overalls und ernst wirkende Detectives in zerknitterten Anzügen, die ständig ein und aus gingen. Schließlich kam ein Arzt, der mich untersuchte. Er fragte mich, ob ich mich in der Lage fühlte, eine Aussage zu machen. Ich sagte, es ginge mir gut, bat aber darum, die Aussage so bald wie möglich machen zu können, weil mir kalt war und ich Hunger hatte und müde war. »Ich bin sicher, dass man Ihnen gleich jemanden vorbeischickt«, sagte er aufmunternd, doch dann war niemand aufgetaucht, und alles, was von der gesamten Polizeipräsenz irgendwann übrig blieb, war ein bewaffneter Beamter draußen vor der Küchentür.
Mr. und Mrs. Miller hatten mir die ganze Zeit Gesellschaft geleistet und waren ein paar Minuten zuvor gegangen – er, um herauszukriegen, wie lange es noch dauern würde, bis ich meine Aussage machen konnte, und Diane, die sichtlich mitgenommen und erschöpft war, weil sie ins Bett wollte.
Ich saß also in der Küche mit einer Tasse Kaffee in der Hand und dachte darüber nach, wie das Leben einem manchmal eine volle Breitseite verpassen kann, als ein groß gewachsener Anzugträger hereinkam. Den hatte ich bis dahin zwar noch nicht gesehen, aber seiner Ausstrahlung nach war er der Chef.
»Miss Kinnear«, sagte er und streckte mir die Hand entgegen. »Ich bin DI Alan Clarke. Ich leite die Ermittlungen in diesem Fall. Sie haben ganz offensichtlich Schreckliches erlebt. Wie geht es Ihnen?«
Sein Tonfall klang ruhig und gelassen, und ich fühlte mich sofort geborgen, fand es beruhigend zu wissen, dass die Guten den Bösen gegenüber in der Überzahl waren. Er sah auch nicht gerade übel aus. Und trug keinen Ehering, wie ich durch einen blitzschnellen Blick auf seine Hand feststellen konnte.
»Mir geht’s ganz passabel«, sagte ich mit einem Seufzen. »Ich hatte mir den Abend allerdings ein bisschen anders vorgestellt.«
»Da bin ich mir sicher. Und so wie es aussieht, hatten Sie noch großes Glück, dass Sie es geschafft haben zu entkommen. Darf ich fragen, in welcher Beziehung Sie zu Mister Rahman standen?«
»Ich dachte, er wäre mein neuer Freund, aber dann wurde klar, dass ich nicht die einzige Frau in seinem Leben war.«
Es war mir peinlich, in die Details zu gehen, aber das ließ sich nicht umgehen, und deshalb habe ich ihm eine Kurzfassung geliefert und darauf gehofft, dass er keine allzu schlechte Meinung haben würde.
Doch wie es schien, war er wesentlich mehr daran interessiert, was ich gesehen und gehört hatte, bevor Anil ermordet worden war. »Sie befanden sich also die ganze Zeit über im Zimmer, als der Killer Mr. Rahman gefoltert hat?«
Ich nickte. »Genau.«
»Und was wollte er?«
»Informationen. Er fragte, was Anil – Mr. Rahman – von einem bevorstehenden Anschlag wusste. Mit wem er darüber geredet hatte.« Ich versuchte, die gesamte Unterhaltung, soweit ich mich noch daran erinnern konnte, nachzuerzählen. Die Miene von DI Clarke wurde mit jedem Wort finsterer. Seltsam, aber die Bedeutung von dem, was ich da gehört habe, wird mir erst jetzt klar.
Als ich fertig war, ging DI Clarke das gesamte Gespräch mit mir noch einmal durch. Es war nicht zu übersehen, dass der Inhalt ihn sehr beunruhigte. »Ich weiß, dass es hart für Sie ist, Miss Kinnear, aber sollten Ihnen weitere Details dazu einfallen, dann melden Sie sich bitte sofort bei uns. Nun zu etwas anderem. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt einen Blick auf den Killer werfen können?«
Mir war klar, dass ich, wenn ich in dieser Situation Ja sagte, mein Leben abhaken konnte. Nichts würde mehr so sein wie früher. Ich wäre das, was sie in diesen Fernsehshows einen »unentbehrlichen Zeugen« nennen – verpflichtet, in einem zukünftigen Mordprozess eine Aussage zu machen. Die Angst davor, in den Zeugenstand treten zu müssen – oder schlimmer noch, selbst zu einer Zielscheibe zu werden –, würde über Monate, wenn nicht Jahre mein Leben bestimmen. Ich bin eine ganz normale Frau, die ein ganz normales Leben führt, ohne große Ansprüche außer vielleicht, das zu vergessen, was ich gerade durchgemacht hatte.
Und so schüttelte ich den Kopf. »Leider nein. Ich habe ihn nicht gesehen, ich war zu sehr damit beschäftigt wegzurennen.«
Ich atmete schwer und durchlebte noch einmal die Angst, während ich die Treppe herunterhetzte und wusste, dass das sadistische Dreckschwein, das Anil zu Tode gefoltert hatte, mir dicht auf den Fersen war.
»Es tut mir aufrichtig leid für Sie«, sagte DI Clarke und tätschelte sachte meinen Arm. »Ich lasse ein paar Beamte kommen, die Sie zum Revier nach Watford bringen. Dort werden sich die Leute von unserer Spezialeinheit um Sie kümmern, und wenn Sie dann bereit sind, nehmen wir eine offizielle Aussage auf. Doch jetzt sind Sie erst einmal in Sicherheit. Es ist vorbei.«
»Danke«, sagte ich, und dann wurde mir mit einem Mal das ganze Ausmaß dessen, was ich gerade erlebt hatte, klar, und es brachen bei mir alle Dämme und Schleusen.
Kapitel 3
Zehn Minuten später saß ich auf dem Rücksitz eines Streifenwagens, der von einer fröhlich-beschwingten Beamtin gesteuert wurde, die in Begleitung eines männlichen Kollegen war. Beide hatten versucht, sich mit mir zu unterhalten und mich aufzumuntern, woraus ich schloss, dass sie nicht wirklich wussten, was in Anils Haus passiert war. Ich war nicht in der Stimmung, mich zu unterhalten, und nachdem ich das geäußert hatte, ließen sie mich in Ruhe und quasselten weiter über einen ihrer Ansicht nach völlig unfähigen Kollegen, der seine total ungerechtfertigte Beförderung auf einen Posten, mit dem er absolut überfordert war, nur seinem ausgeprägten Talent zur Arschkriecherei verdankte. Sie konnten ihn offensichtlich beide nicht ausstehen und machten auch keinen Hehl daraus. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell Leute auf den Vordersitzen vergessen, dass hinten im Wagen noch jemand sitzt. Dennoch fühlte ich mich durch ihre Unterhaltung besser. Es tat gut, wieder mit dem normalen Alltagsleben konfrontiert zu sein – Klatsch und Tratsch inklusive.
Ich dachte über meine Entscheidung nach, DI Clarke nicht zu erzählen, dass ich das Gesicht des Killers gesehen hatte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ganz besonders in einem Fall wie diesem, wo der Killer vermutlich kaum Spuren hinterlassen hatte und ein Schuldspruch samt Verurteilung wahrscheinlich davon abhängen konnte, dass er von einem Zeugen eindeutig wiedererkannt wurde. Zumal ich nicht nur einen flüchtigen Blick auf ihn geworfen hatte, sondern sich seine Gestalt in mein Gedächtnis eingebrannt hatte. Ich habe ihn immer noch vor Augen. Er war ein Weißer, ungefähr vierzig Jahre alt, schlank und muskulös. Ich glaube, wenn er jetzt vor mir stünde, würde ich ihn identifizieren.
Der Gedanke daran ließ mich nicht los. Ich bin eigentlich niemand, der einem Konflikt aus dem Weg geht. Ich bin vielleicht keine große Heldin, aber wenn’s drauf ankommt, kann ich durchaus die Zähne zusammenbeißen. Und das hier war überhaupt nicht mein Stil. Was hätte mein Vater mir wohl geraten, wenn er in diesem Moment da gewesen wäre? »Tu, was du für richtig hältst.« Das heißt nicht, dass er das selbst befolgt hätte. Dennoch beschloss ich in diesem Moment, mit der Wahrheit herauszurücken und zuzugeben, dass ich das Gesicht des Killers gesehen hatte.
Aber dann wurde ich durch die Stimme der Polizistin am Steuer aus meinen Gedanken gerissen. »Herrgott, was macht der Kerl denn da?«, sagte sie laut, während sie in den Rückspiegel schaute. »Sieht der nicht, dass wir die Polizei sind?«
Plötzlich erfüllte ein helles Licht den Wagen, und als ich mich herumdrehte, sah ich zwei Scheinwerfer, die sich in einem Mordstempo auf uns zu bewegten.
Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Nach all den Horrorereignissen dieser Nacht lagen meine Nerven blank, und ich war übervorsichtig. Also kauerte ich mich auf dem Rücksitz zusammen, damit ich nicht gesehen werden konnte.
Mir fiel wieder ein, dass Anils Mörder absolut gelassen und methodisch vorging. Die Art und Weise, wie er einfach so ins Haus spaziert war und Sharon mit einem einzigen Schuss niedergestreckt hatte, bevor er Anil ausgeschaltet hatte, ohne dass ihm auch nur ein Wort über die Lippen gekommen wäre. Ein solcher Mann würde sich nicht von zwei unbewaffneten Polizisten aufhalten lassen.
Mein Verstand – und ob Sie es glauben oder nicht, das ist der Teil meiner Persönlichkeit, der meistens das Sagen hat – redete mir ein, dass ich einfach nur paranoid war und dass DI Clarke recht hatte, als er meinte, es sei alles vorbei, und dass es lächerlich war, sich auf dem Rücksitz zu verkriechen wie ein verängstigtes Kätzchen. Aber das half nichts gegen die Angst, die immer wieder in Wellen über mich hereinbrach. Ich war Augenzeugin eines Doppelmords, und wir fuhren mitten in der Pampa auf einer verlassenen Straße, die von Bäumen gesäumt war – die perfekte Umgebung für einen Hinterhalt.
Das Auto hinter uns schwenkte nun aus und setzte zum Überholen an. Der Polizist auf dem Beifahrersitz drehte sich zu mir herum und sagte: »Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird nicht lange dauern, aber wir müssen diesen Wagen anhalt–«
»Gott im Himmel, der Typ hat eine Knarre«, kreischte seine Kollegin.
Ich ging ruckartig in Deckung, und einen Moment später explodierte die Seitenscheibe unter einer Salve von Kugeln aus einer automatischen Waffe, es regnete Glasscherben auf mich.
Ich konnte es eher hören als sehen, wie die Beamtin am Steuer auf ihrem Sitz zusammenbrach. Der Wagen schlingerte wild hin und her. Der Polizist auf dem Beifahrersitz stieß einen Fluch aus, duckte sich und packte das Lenkrad, aber in diesem Moment ratterte eine zweite Salve los. Der Streifenwagen rauschte über die Fahrbahnbegrenzung und rumpelte über unebenes Gelände, ohne dass der Mann auf dem Beifahrersitz das Geringste dagegen tun konnte.
Ich merkte, dass der Wagen langsamer wurde, doch wir waren immer noch mit einem Affenzahn unterwegs, und ich hörte Zweige und Äste an der Wagenseite vorbeischrammen, bis wir gegen einen Baum krachten und ich gegen die Lehnen der Vordersitze geschleudert wurde.
Mit einem Mal war alles still. Nur das Stöhnen des Polizisten auf dem Beifahrersitz war zu hören. Ich wusste nicht, ob er von einer Kugel getroffen worden war, aber er machte den Eindruck, als wäre er verletzt und nicht ganz da. Ich rührte mich nicht und sagte kein Wort. Ich hatte das Gefühl, im Kino zu sitzen und einen Film anzuschauen, ohne den geringsten Einfluss auf die Ereignisse zu haben. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie der männliche Polizist die Beifahrertür aufdrückte und sich mühsam aus dem Wagen hievte.
Er machte ein paar Schritte und stand dann schwankend da wie ein Betrunkener und schaute in Richtung Straße. Ich löste meinen Sicherheitsgurt, denn ich dachte, es wäre sinnlos, einfach nur im Wagen herumzuliegen. Ich musste dem Mann helfen.
Doch als ich mich gerade aufrichten wollte, hörte ich weitere Schüsse krachen und ging sofort wieder in Deckung. Der Polizist fiel zu Boden.
Der Schütze war noch immer da. Ich saß in der Falle. Mein Herz hämmerte, und ich lag so reglos wie nur irgend möglich mit dem Gesicht nach unten auf dem Sitz und stellte mich tot.
Vor ein paar Jahren habe ich mal ein paar Fotos im Internet gesehen, die mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Das erste zeigte eine Reihe irakischer Soldaten, die mit verbundenen Augen vor einem Massengrab knieten, während schwarz gekleidete Kämpfer des IS hinter ihnen mit ihren Gewehren auf sie anlegten. Auf dem zweiten Foto lagen die irakischen Soldaten tot in dem Massengrab, und unter ihren Körpern bildeten sich Blutlachen, während ihre Henker jubelnd und feiernd am Rand der Grube standen. Was ich am schrecklichsten fand, war die Vorstellung, welche Ängste diese armen Soldaten durchlebt haben mussten, während sie auf die Kugel warteten, die unweigerlich kommen würde, und ich dankte Gott dafür, dass mir so etwas nie passieren würde, weil ich Tausende von Kilometern entfernt gut aufgehoben und wohlbehütet in England war.
Und jetzt lag ich da und wartete genauso hilflos auf die Kugel, die unweigerlich kommen würde. Vorher, unter dem Bett, hatte ich noch Glück gehabt, aber wie es aussah, hatte ich mein Glück damit aufgebraucht.
Eine Minute verging. Ich weiß das deshalb, weil ich die Sekunden in meinem Kopf gezählt habe. Nichts passierte. Abgesehen von dem Klingeln in meinen Ohren infolge der Schüsse herrschte Ruhe.
Ich zählte weiter. Nachdem ich bei hundert angekommen war, zuckte ein Funken Hoffnung in mir auf. Als ich dann die Zweihundert erreichte, glaubte ich, dass der Schütze sich aus dem Staub gemacht hatte. Nicht mal jemand, der so selbstsicher war wie er, würde sich unnötig lange am Tatort herumtreiben, oder?
Und dann hörte ich Geräusche. Den Motor eines Wagens. Schließlich Schritte, die näher kamen.
Ich lag da und machte mich auf das Schlimmste gefasst, und dann hörte ich durch das zersplitterte Wagenfenster jemanden sagen: »Herrgott im Himmel, ruf die Polizei. Die sind alle tot.«
Und da schaute ich nach oben und sah das entsetzte Gesicht von einem Typen Anfang zwanzig, und mit einem Mal fühlte ich mich unendlich erleichtert.
Der Albtraum war wirklich vorbei.
Ich seufzte und trank einen Schluck Wasser, um auf diese Weise die Gedanken an die Schrecken der Nacht hinter mir zu lassen und mich stattdessen wieder in der Enge des kleinen Zimmers zu orientieren, in dem ich mich nun befand. Meine Hände zitterten nicht mehr, und ich wurde mit jedem Moment ruhiger, während ich die beiden Polizeibeamten mir gegenüber anschaute.
DS Anji Abbott nickte langsam. Ihrem Gesicht war nicht anzusehen, was sie dachte. »Das ist ja eine sehr bizarre Geschichte«, sagte sie schließlich.
»Sie haben offenbar einen Schutzengel«, sagte DC Seamus Jeffs, und seinem Tonfall war anzuhören, dass er meine Darstellung der Ereignisse aus welchen Gründen auch immer nicht ganz glaubte.
»Oder eben nicht«, sagte ich. »Jedenfalls hat er mich nicht davor bewahrt, mich mit Anil Rahman einzulassen. Wenn ich ihm nicht begegnet wäre, wäre all das nicht passiert.«
DC Jeffs nickte bedächtig, wirkte aber immer noch nicht vollständig überzeugt. Ich ging nicht weiter darauf ein.
»Wie geht es den beiden Polizisten, die mit mir im Auto waren?«, fragte ich. »Haben sie überlebt?«
»Leider nicht«, sagte DS Abbott. »Es gibt da ein paar Details in Ihrer Geschichte, über die wir noch mal sprechen müssen – wenn Sie damit einverstanden sind?«
Ich nickte.
»Was uns besonders interessiert, sind die Informationen, die der Killer von Mr. Rahman wollte.« Und genau wie schon DI Clarke im Haus der Millers ließ sie mich die gesamte Konversation zwischen Anil und dem Killer wiederholen, und im Anschluss daran stellten sie mir beide weitere Fragen zu diversen Teilen meiner Zeugenaussage.
»Dann bleibt nur noch eine Sache zu klären«, sagte DS Abbott schließlich. »Wie viele Männer saßen in dem Wagen, aus dem die Schüsse auf den Polizeiwagen abgegeben wurden?«
»Ich weiß nicht. Ich habe überhaupt niemanden gesehen, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, auf dem Rücksitz in Deckung zu gehen.«
»Ist Ihnen an dem Fahrstil irgendetwas aufgefallen?«
»Dass er schnell war.«
»Das habe ich nicht gemeint. Wir versuchen herauszufinden, ob jemand zweites am Steuer saß, während der erste Mann schoss, denn nach den bisherigen Ergebnissen sind die Schüsse mit großer Genauigkeit abgefeuert worden, was für jemanden, der gleichzeitig auch noch ein Auto steuert, recht schwierig zu bewerkstelligen ist.«
Ich dachte einen Moment darüber nach. »Mir ist nicht aufgefallen, dass er Schlangenlinien gefahren wäre, deshalb würde ich vermuten, dass es zwei Leute waren.« Ich schauderte und nahm noch einen Schluck Wasser. »Mein Gott. Daran habe ich ja überhaupt noch nicht gedacht. Es kann also sein, dass es mehr als nur ein Killer war.«
Die beiden Beamten schauten sich kurz an, und dann sagte DS Abbott: »Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Aber im Haus haben Sie nur einen Killer gesehen und gehört?«
Ich nickte. »Das stimmt. Im Haus war definitiv nur eine Person.«
Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen im Zimmer. Die beiden brauchten offensichtlich Zeit, um diese Information zu verdauen.
»Und was passiert jetzt?«, fragte ich.
»Das wissen wir noch nicht«, sagte DS Abbott, »aber ich will Ihnen gegenüber ehrlich sein. Wir haben es hier mit einem durchorganisierten Mord zu tun, und als Zeugin, die das Gesicht von zumindest einem der Mörder gesehen hat, sind Sie ein mögliches Anschlagsziel. Im Augenblick sind Sie in Sicherheit. Wir haben bewaffnete Beamte draußen vor der Tür, am Eingang zur Station und draußen vor dem Krankenhaus. Heute Nacht wird Ihnen niemand an den Kragen gehen, aber Sie werden in Zukunft eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung brauchen.«
Ich schluckte. »Und für wie lange?«
»So lange es eben dauert«, sagte DS Abbott. »Und jetzt muss ich mit meinem Chef sprechen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen.« Und mit diesen Worten des Bedauerns, vorgebracht im Tonfall einer Krebsdiagnose, gingen sie und DC Jeffs zur Tür und ließen mich allein in dem Zimmer – und wie es mir schien, allein auf der Welt – zurück.
Kapitel 4
Ray Mason
Es gibt heutzutage Tausende von Möglichkeiten, jemanden zum Reden zu bringen, doch als Polizist ist man in der Auswahl seiner Mittel ziemlich eingeschränkt. Wie Sie bestimmt wissen, haben Tatverdächtige im Vereinigten Königreich jede Menge Rechte, die jeder Kriminelle, der etwas auf sich hält, selbstverständlich allesamt auswendig herunterbeten kann. Falls Sie wegen unglücklicher Umstände noch in der Anfängerliga spielen und den ganzen Kram nicht so draufhaben, brauchen Sie sich aber keine Sorgen zu machen, denn Ihr Anwalt, für den Sie keinen Cent zahlen müssen, wird Ihnen schon auf die Sprünge helfen. Ein Bulle darf Sie nicht schlagen; er darf Ihnen nicht drohen oder Sie irgendwie einschüchtern. Er darf Sie nicht einmal anlügen, zum Teufel. Wir dürfen Sie natürlich unter Druck setzen, um Sie auf diese Art und Weise zur Kooperation zu bewegen – aber auch nur, wenn wir einen Riesenhaufen Beweise haben, auf die wir unsere Anschuldigungen stützen können. Und das ist nicht immer einfach, nicht mal in Zeiten des technologischen Fortschritts mit Überwachungskameras an jeder Ecke und chemischer Testverfahren, die so empfindlich sind, dass Ihnen aufgrund einer winzigen DNA-Spur auf einem Staubkorn die Anwesenheit am Tatort nachgewiesen werden kann.
Als Polizist muss man daher lernen, kreativ zu sein. Und genau deshalb war ich an diesem Werktag um halb eins in der Nacht im Dungeon of Desire in 23 Gladstone Crescent – einem heruntergekommenen Haus am Ende einer trostlosen Reihenhaussiedlung in Hackney, die sich bisher jeglichen Gentrifizierungstendenzen entzogen hatte.
»Er ist in dem Zimmer am Ende der Treppe«, sagte Madame Sin, deren richtiger Name Ola Wercieska war und der das Etablissement gehörte. Sie hatte eine Zigarette im Mund und trug schwarze Overknee Boots, schwarze Netzstrümpfe und ein Korsett, das aussah, als würde es jeden Moment unter dem Druck ihrer wogenden Massen explodieren. Sie machte keinen besonders glücklichen Eindruck, was aber auch daran liegen mochte, dass mein Besuch für sie ziemlich überraschend gekommen war. Außerdem gefiel ihr die Art gar nicht, wie ich mich an ihrem Liebhaber Pietr vorbeigedrängt hatte, der als Türsteher des Kerkers der Lüste fungierte. Pietr war gerade mal knapp über sechzig Kilo schwer und sah aus wie das »Vorher«-Bild in einer Anzeige für Muskelpräparate, was ihn für seinen Job nicht unbedingt prädestinierte. Er saß nun ebenfalls eine Zigarette rauchend mit gesenktem Kopf auf einem Stuhl und gab sich alle Mühe, Olas eiskalten, stählernen Blicken auszuweichen.
»Sie versprechen, dass Sie mich nicht hochgehen lassen, klar?«, sagte sie mit dem gleichen harten Blick.
»Versprochen. Ich will nur kurz mit ihm plaudern, und dann sehen Sie mich nie wieder.«
»Er ist ein guter Kunde«, sagte sie mit einem Anflug von Bedauern. »Aber irgendwie riecht er merkwürdig.«
»Das haben Leute wie er so an sich. Ist er, ähm, bekleidet?«
Sie verzog das Gesicht. »Leider nein.«
Und so stieg ich schweren Herzens die Treppe hinauf, öffnete die Tür und betrat den Kerker.
Der Mann, hinter dem ich her war, lag nackt und mit ausgestreckten Armen und Beinen auf einem fleckigen Laken, die Hand- und Fußgelenke jeweils an einen der vier Bettpfosten gefesselt. Sein ganzer Körper zitterte in Erwartung der Rückkehr von Madame Sin. Zumindest hoffte ich, dass er es war, denn unter der schwarzen Latexmaske über seinem Kopf, die als einzige Öffnung einen Reißverschluss im Mundbereich hatte, war seine Identität noch nicht festzustellen. Verwirrender war in diesem Zusammenhang, dass das einzige weitere Kleidungsstück, das er trug, eine Unterhose aus Latex und Stahl war, ausgestattet mit einem penisförmigen Käfig, der in einem fünfundvierzig Grad Winkel nach unten gebogen war, um so jede Erektion abzuwürgen. Allein der Anblick dieser Konstruktion trieb mir schon die Tränen in die Augen.
Bei Madam Sins Unternehmen handelte es sich um einen Familienbetrieb, mit ihrer Cousine Katja – genannt Dark Mistress – als Mitarbeiterin. Und da ich hören konnte, wie diese im Zimmer gegenüber jemandem eine Abreibung verpasste, war ich ziemlich sicher, dass ich den richtigen Mann vor mir hatte.
Die Fensternische der gegenüberliegenden Wand war ausgefüllt von einem Regal, das bis zur Decke reichte und aussah wie die Warenauslage eines Sexshops für Fortgeschrittene: Peitschen, Dildos, Paddel, Umschnalldildos, noch mehr Peitschen und ein paar Sachen, die ich noch nie gesehen hatte und deren Funktionsweise und Anwendung ich mir gar nicht erst vorstellen mochte. Hinter dem Regal klapperte der Fensterrahmen, als ein Zug auf dem Bahndamm neben dem Haus vorbeirumpelte.
»Herrgott«, sagte ich, am Fußende des Bettes, »hier riecht’s tatsächlich wie in einem Kerker.«
Joe Thomas hörte sofort auf mit seinem erwartungsfrohen Gezitter und fing an, sich in seinen Fesseln zu winden und den Kopf in sämtliche Richtungen zu drehen, um irgendwie herauszubekommen, was los war. »Wer zum Teufel sind Sie«, fragte er mit einem starken nordirischen Akzent. Seine Stimme klang aggressiv und nervös zugleich.
»Einen Moment«, sagte ich. »Ich schieße nur kurz ein Foto.«
Ich hob mein Smartphone und knipste ihn in seiner ganzen Pracht. Der Zug war mittlerweile vorbeigerauscht und das Geräusch des Auslösers deutlich zu hören. Um auf Nummer sicher zu gehen, drückte ich noch ein zweites Mal ab.
»Sie legen jetzt sofort die verfickte Kamera weg und machen mich los«, rief er wütend. »Oder ich sorge dafür, dass Ihnen das Ganze hier sehr leidtun wird.«
»Ach wirklich?«, sagte ich. »Und wie wollen Sie das bitte schön anstellen? Wenn ich richtig informiert bin, besteht doch das Vergnügen bei Fesselnummern darin, sich völlig in die Gewalt von jemand anderem zu begeben. Was einen aber auch ziemlich verwundbar macht, oder?«
Ich schaltete die Videofunktion meines Handys ein, drückte die Aufnahmetaste und filmte, wie ich den Reißverschluss der Latexmaske aufzog und sie ihm vom Kopf zerrte. Zum Vorschein kam das blasse, aufgedunsene Gesicht eines Mannes Mitte fünfzig, der einen sorgsam gestutzten Bart trug, ansonsten aber kaum Haare auf dem Kopf hatte. Er drehte sein Gesicht von der Kamera weg und zerrte an seinen Fesseln, während ich munter weiterfilmte, doch es nützte ihm herzlich wenig.
Als ich alles im Kasten hatte, was ich brauchte, steckte ich mein Handy wieder in die Tasche.
Joe Thomas hörte auf zu zappeln und starrte mich ein paar Sekunden lang an.
Ich starrte zurück.
»Wer sind Sie?«, sagte er schließlich. Mittlerweile hatte er sich anscheinend abgeregt, er klang wesentlich ruhiger als zuvor.