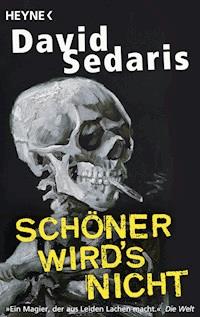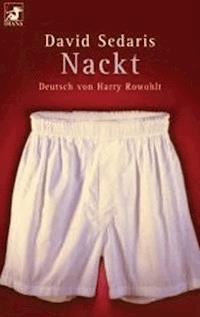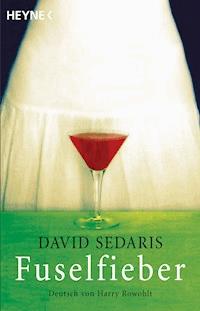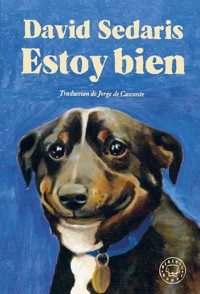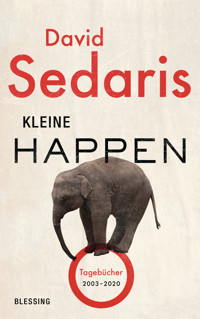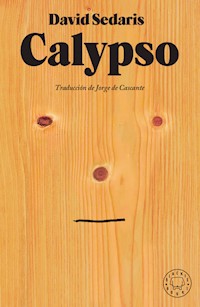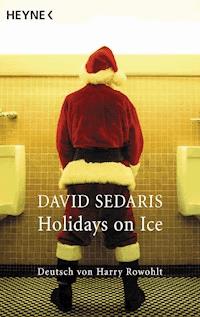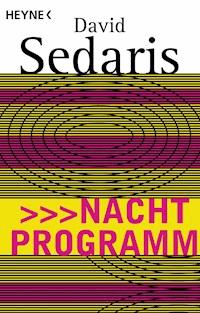
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oft kopiert – nie erreicht: Sedaris ist das Original, denn niemand kann die Schrecken des Jungseins und des Familienlebens so haarsträubend komisch und charmant schildern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch:
Erinnert sich noch jemand? Daran, dass die Jugendzeit eben nicht voller Verheißung sondern voller grausamer Missverständnisse war? Spätestens nach der Entdeckung des ersten Pickels geht einem ein Licht auf, so grell, dass man die Wahrheit nicht mehr ignorieren kann: die Mutter lebt in ihrer eigenen Welt und hat dich sowieso nie verstanden; der vergötterte Vater ist in Wirklichkeit ein peinlicher Wicht; alle Klassenkameraden sind cooler, reicher und stehen auf Mädchen; es gibt Außerirdische, die der menschlichen Rasse weit überlegen sind. Zum Glück erinnert sich David Sedaris für uns, und so lesen sich plötzlich alle kleinen und großen Katastrophen der Jugend wie eine urkomische Autobiographie.
»Wieder belustigt, erschreckt und befreit uns die Offenheit, mit der Sedaris so kühl wie präzis von seinen Ticks, Phobien und Phantasien erzählt.« Neue Zürcher Zeitung
Der Autor:
David Sedaris, geboren am 26.12.1956 in Johnson City, New York, aufgewachsen in Raleigh, North Carolina; lebt zur Zeit in Paris; schreibt u. a. für The New York Times, The New Yorker und Esquire.
Inhaltsverzeichnis
Für Hugh
Die und wir
Als meine Familie nach North Carolina zog, mieteten wir zuerst ein Haus, das nur drei Blocks von der Schule entfernt lag, in der ich nach den Ferien die dritte Klasse besuchen würde. Meine Mutter freundete sich mit einer Nachbarin an, mehr aber auch nicht. Da wir in einem Jahr schon wieder woanders sein würden, erklärte sie, mache es keinen Sinn, engeren Kontakt zu Leuten zu knüpfen, von denen wir uns dann verabschieden müssten.
Unser nächstes Haus war keine Meile entfernt und der Umzug insofern kein Grund für einen tränenreichen Abschied. Es hatte mehr was von »Na dann, bis später«, doch machte ich mir die Einstellung meiner Mutter zu Eigen, weil ich dadurch so tun konnte, als verzichtete ich bewusst darauf, neue Freunde zu suchen. Ich hätte ohne weiteres welche finden können, nur war es dafür eben nicht der rechte Augenblick.
In New York hatten wir auf dem Land gewohnt, ohne Bürgersteige oder Straßenbeleuchtung; man konnte aus dem Haus gehen und war immer noch für sich. Wenn man jetzt aus dem Fenster schaute, sah man andere Häuser, und darin waren Leute. Ich stellte mir vor, abends im Dunkeln umherzustreifen und Zeuge eines Mordes zu werden, doch hockten unsere Nachbarn meistens nur in ihren Wohnzimmern vor dem Fernseher. Die einzige wirkliche Ausnahme war das Haus von Mr. Tomkey, der nicht an das Fernsehen glaubte. Wir erfuhren dies von der Freundin meiner Mutter, als sie eines Nachmittags einen Korb mit Okraschoten vorbeibrachte. Die Frau ließ sich nicht weiter darüber aus, sondern traf lediglich eine Feststellung, aus der ihre Zuhörerin machen konnte, was sie wollte. Hätte meine Mutter gesagt, »das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe«, hätte die Freundin vermutlich zugestimmt, und hätte sie gesagt, »ein Hoch auf Mr. Tomkey«, wäre sie damit ebenso einverstanden gewesen. Es war eine Art Test, genau wie die Okraschoten.
Zu sagen, man glaube nicht an das Fernsehen, war etwas anderes, als zu sagen, man mache sich nichts daraus. Glaube beinhaltete, dass hinter dem Fernsehen eine Idee steckte und dass man dagegen war. Und Glaube deutete auch darauf hin, dass man zu viel nachdachte. Als meine Mutter uns erzählte, Mr. Tomkey glaube nicht an das Fernsehen, sagte mein Vater: »Schön für ihn. Ich wüsste auch nicht, dass ich dran glaube.«
»Ganz meine Meinung«, sagte meine Mutter, und dann sahen meine Eltern die Nachrichten und was immer danach kam.
Bald wussten alle, dass Mr. Tomkey keinen Fernseher besaß, und man hörte hier und da, das sei alles schön und gut, nur sei es unfair, anderen seine Überzeugungen aufzuzwingen, ganz besonders seiner Frau und seinen Kindern, die nichts dafür konnten. Man spekulierte auch, dass so, wie ein Blinder ein gesteigertes Hörvermögen entwickelt, die Familie auf irgendeine Weise den Verlust kompensieren müsse. »Vielleicht lesen sie«, sagte die Freundin meiner Mutter. »Vielleicht hören sie Radio, aber irgendwas werden die schon machen.«
Ich wollte herausbekommen, was dieses Irgendwas war, und begann damit, durch die Fenster ins Haus der Tomkeys zu spähen. Tagsüber stand ich gegenüber auf der anderen Straßenseite und tat so, als warte ich auf jemanden, abends, wenn die Sicht besser war und ich nicht so schnell entdeckt werden konnte, schlich ich mich in den Vorgarten und versteckte mich in den Büschen hinter dem Zaun.
Weil sie keinen Fernseher hatten, mussten die Tomkeys beim Abendessen miteinander reden. Sie hatten selbst keine Vorstellung davon, wie armselig ihr Leben war, und schämten sich auch nicht, dass eine Kamera sie uninteressant gefunden hätte. Sie wussten nicht, was aufregend war oder wie ein Abendessen auszusehen hatte oder auch nur, um wie viel Uhr man aß. Manchmal saßen sie erst um acht am Tisch, wenn alle anderen schon längst abgeräumt und gespült hatten. Beim Essen donnerte Mr. Tomkey ab und zu mit der Faust auf den Tisch und zeigte mit der Gabel auf seine Kinder, doch wenn er damit fertig war, fingen alle an zu lachen. Ich hatte den Verdacht, dass er jemanden nachmachte, und fragte mich, ob er vielleicht uns heimlich beim Abendessen beobachtete.
Als im Herbst die Schule anfing, sah ich die Tomkey-Kinder mit Papiertüten in der Hand den Hügel hinaufstiefeln. Der Junge war eine Klasse unter, das Mädchen eine über mir. Wir redeten nie miteinander, doch manchmal begegneten wir uns im Flur, und ich versuchte, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Wie fühlte es sich an, so ahnungslos und abgeschnitten zu sein? Konnte ein normaler Mensch sich das überhaupt vorstellen? Ich stierte auf seine Butterbrotdose mit dem Elmer-Fudd-Aufdruck und versuchte mich von allem zu lösen, was ich darüber wusste: Elmers Probleme, den Buchstaben »r« auszusprechen oder dass er ständig hinter einem kleinen und sehr viel berühmteren Hasen her war. Ich versuchte, eine bloße Zeichnung darin zu sehen, doch war es mir unmöglich, die Figur von ihrem Filmruhm zu trennen.
Eines Tages war einer meiner Mitschüler, der William hieß, im Begriff, eine falsche Antwort an die Tafel zu schreiben. Unsere Lehrerin ruderte mit den Armen und sagte: »Achtung Will. Gefahr. Gefahr.« Sie gab ihrer Stimme einen blechernen, monotonen Klang, und wir alle lachten, weil wir wussten, dass sie einen Roboter aus einer Fernsehserie über eine Familie imitierte, die irgendwo im Weltall lebte. Die Tomkeys hingegen hätten es für einen Herzanfall gehalten. Ich hatte das Gefühl, dass sie einen Führer brauchten, jemanden, der sie durch einen ganz normalen Tag lotste und ihnen alle die Dinge erklärte, die sie nicht verstehen konnten.
Ich hätte die Aufgabe an Wochenenden übernehmen können, doch hätte eine nähere Bekanntschaft ihnen ihr Geheimnis genommen und mich obendrein um das gute Gefühl gebracht, sie bemitleiden zu können. Also hielt ich mich von ihnen fern.
Anfang Oktober kauften die Tomkeys ein Boot, zur großen Erleichterung aller, jedoch ganz besonders der Freundin meiner Mutter, die feststellte, der Motor sei eindeutig secondhand. Wie wir erfuhren, hatte Mr. Tomkeys Schwiegervater ein Haus am See und der Familie angeboten, es jederzeit zu benutzen. Das erklärte, wo sie übers Wochenende steckten, doch machte es ihre Abwesenheit keineswegs erträglicher. Mir kam es so vor, als hätte man meine Lieblingsserie abgesetzt.
Halloween fiel in diesem Jahr auf einen Samstag, und als unsere Mutter endlich mit uns ins Geschäft ging, waren alle guten Kostüme bereits weg. Meine Schwestern verkleideten sich als Hexen, und ich ging als Landstreicher. Ich wollte in meiner Verkleidung bei den Tomkeys klingeln, doch waren sie zum See gefahren, und das Haus war dunkel. Auf der Veranda vor dem Haus stand aber eine Kaffeedose mit Weingummis und daneben ein Stück Pappe mit der Aufschrift: ANDERE WOLLEN AUCH NOCH WAS. Von allen denkbaren Halloweensüßigkeiten waren lose Weingummis so ziemlich das Allerletzte. Die vielen Weingummis, die im Wassernapf für den Hund trieben, waren dafür der eindeutige Beweis. Es war abstoßend, sich vorzustellen, dass ein Weingummi im Magen genau so aussah, und es war beleidigend, gesagt zu bekommen, man solle nicht zuviel von etwas nehmen, das ohnehin niemand wollte. »Für wen halten diese Tomkeys sich eigentlich?«, sagte meine Schwester Lisa.
Am Abend nach Halloween saßen wir alle vor dem Fernseher, als es an der Tür klingelte. Da wir nur selten Besuch hatten, blieb allein mein Vater sitzen, während meine Mutter, meine Schwestern und ich im Pulk nach unten stürmten, die Haustür öffneten und die komplette Familie Tomkey auf unserer Veranda vorfanden. Die Eltern sahen so aus wie immer, doch der Junge und das Mädchen waren verkleidet – sie als Ballerina und er als eine Art Nagetier mit Plüschohren und einem Schwanz, der aussah wie ein Stück Verlängerungskabel. Anscheinend hatten sie den Abend zuvor ganz allein am See verbracht und Halloween verpasst. »Also, wir dachten, dann kommen wir eben heute vorbei, wenn es Ihnen nichts ausmacht«, sagte Mr. Tomkey.
Ich erklärte mir ihr Verhalten damit, dass sie keinen Fernseher hatten, andererseits lernte man auch nicht alles durch das Fernsehen. Am 31. Oktober von Haus zu Haus zu gehen und um Süßigkeiten zu bitten, nannte man Halloweenstreich, aber am 1. November um Süßigkeiten zu bitten hieß betteln, und das mochten die Leute nicht. Das gehörte zu den Dingen, die einem das Leben selbst beibrachte, und es ärgerte mich, dass die Tomkeys dies nicht begriffen.
»Aber natürlich macht es uns nichts aus«, sagte meine Mutter. »Kinder, wie wär’s, … wenn ihr … die Süßigkeiten holt.«
»Aber wir haben keine mehr«, sagte meine Schwester Gretchen. »Du hast gestern Abend alles verteilt.«
»Nicht die Süßigkeiten«, sagte meine Mutter. »Die anderen. Wie wär’s, wenn ihr die holt?«
»Du meinst unsere Süßigkeiten?«, fragte Lisa. »Die wir uns verdient haben?«
Genau davon redete meine Mutter, nur wollte sie es vor den Tomkeys nicht so direkt sagen. Um ihr Empfinden zu schonen, wollte sie so tun, als hätten wir ständig einen Eimer voller Süßigkeiten irgendwo im Haus herumstehen und warteten nur darauf, dass jemand an die Tür klopfte und danach fragte. »Na los doch«, sagte sie. »Nun macht schon.«
Mein Zimmer lag gleich neben dem Eingang, und wenn die Tomkeys dorthin geschaut hätten, hätten sie mein Bett mit der braunen Einkaufstüte und der Aufschrift MEINS! PFOTEN WEG! gesehen. Damit sie nicht mitbekamen, wie viel ich hatte, ging ich in mein Zimmer und machte die Tür hinter mir zu. Dann zog ich die Vorhänge vor und schüttete den Inhalt der Tüte auf mein Bett, um das auszusortieren, was ich am wenigsten mochte. Seit Kindertagen vertrage ich keine Schokolade. Ich weiß nicht, ob ich dagegen allergisch bin oder was, jedenfalls bekomme ich schon von einem winzigen Stück höllische Kopfschmerzen.
Mit der Zeit lernte ich, die Finger davon zu lassen, doch als Kind wollte ich nicht zurückstecken. Hatte ich Brownies gegessen und es fing in meinem Kopf an zu hämmern, lag das am Traubensaft oder am Zigarettenqualm meiner Mutter oder am Druck des Brillengestells – nur niemals an der Schokolade. Meine Schokoriegel waren deshalb Gift, aber es waren alles bekannte Marken, also kamen sie auf Stapel Nr. 1, der ganz bestimmt nicht an die Tomkeys gehen würde.
Draußen im Flur hörte ich, wie meine Mutter verzweifelt ein Gespräch in Gang zu bringen versuchte. »Ein Boot!«, sagte sie. »Das klingt großartig. Können Sie damit gleich ins Wasser fahren?«
»Wir haben dafür einen Anhänger«, sagte Mr. Tomkey. »Damit setzen wir rückwärts ins Wasser.«
»Oh, einen Anhänger. Was für eine Sorte?«
»Nun ja, einen Bootsanhänger«, sagte Mr. Tomkey.
»Sicher, aber ich meine, einen aus Holz oder … also, es würde mich interessieren, was für ein Typ Anhänger es ist?«
Die Sätze meiner Mutter enthielten zwei Botschaften. Die erste und offensichtliche war: »Ja doch, ich rede von Bootsanhängern, und ich habe nicht den leisesten Schimmer davon.« Die zweite, die nur für meine Schwestern und mich bestimmt war, hieß: »Wenn ihr nicht sofort mit den Süßigkeiten anrückt, ist es mit Freiheit, Freude und der Aussicht auf eine herzliche mütterliche Umarmung ein für alle Mal vorbei.«
Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie in mein Zimmer käme und sich irgendwelche Süßigkeiten schnappte, ohne jede Rücksicht auf mein Bewertungssystem. Ein einziger klarer Gedanke hätte ausgereicht, die wertvollsten Posten in der Kommodenschublade verschwinden zu lassen, doch befiel mich bei der Vorstellung, ihre Hand könne bereits nach dem Türknauf greifen, eine solche Panik, dass ich damit begann, die Papiere abzureißen und mir einen Riegel nach dem anderen in den Mund zu schieben wie bei einem Wettfressen. Die meisten waren Miniriegel, die sich leichter im Mund verstauen ließen, doch war der Platz begrenzt, und es war auch nicht ganz einfach, gleichzeitig zu kauen und weitere Riegel nachzuschieben. Der Kopfschmerz setzte auch unverzüglich ein, doch führte ich dies auf die Anspannung zurück.
Meine Mutter erklärte den Tomkeys, sie müsse kurz etwas nachschauen, dann öffnete sie die Tür und steckte den Kopf in mein Zimmer. »Was zum Teufel machst du da?«, flüsterte sie, aber ich konnte ihr mit meinem voll gestopften Mund keine Antwort geben. »Bin gleich wieder da«, rief sie, zog die Tür hinter sich zu und kam auf mein Bett zu. Im gleichen Moment begann ich damit, die Brausetaler und Traubenzuckerketten von Stapel Nummer zwei zu zerbrechen. Es waren die zweitbesten Sachen, die ich bekommen hatte, und so weh es mir tat, sie zu zerstören, noch schmerzhafter wäre es gewesen, sie einfach wegzugeben. Ich war gerade dabei, eine kleine Schachtel Fruchtdrops zu zerpflücken, als meine Mutter sie mir aus der Hand riss und ein Sturzbach großkalibriger Kugeln klackernd über den Fußboden hüpfte. Noch während ich ihnen hinterhersah, schnappte sie sich bereits eine Rolle Schaumzuckerwaffeln.
»Die nicht«, bettelte ich, wobei mein Mund anstelle von Wörtern nur halb gekaute Schokolade absonderte, die auf dem Ärmel ihres Pullovers landete. »Die nicht. Die nicht.«
»Du solltest dich nur mal sehen«, sagte sie. »Ich meine, dich wirklich einmal ansehen.«
Außer den Schaumzuckerwaffeln nahm sie noch eine Hand voll Kirschlutscher und ein halbes Dutzend einzeln eingepackter Sahnebonbons. Ich hörte, wie sie sich bei den Tomkeys für die kurze Abwesenheit entschuldigte und wie anschließend meine Süßigkeiten in ihren Tüten landeten.
»Wie sagt man?«, fragte Mrs. Tomkey.
Und die Kinder sagten: »Vielen Dank.«
Ich hatte mir Ärger eingehandelt, weil ich meine Süßigkeiten nicht früher herausgerückt hatte, doch war der Ärger für meine Schwestern noch viel größer, weil sie erst gar nichts in dieser Richtung unternommen hatten. Den frühen Abend verbrachten wir alle auf unseren Zimmern, dann schlichen wir einer nach dem anderen nach oben und setzten uns zu meinen Eltern vor den Fernseher. Ich kam als Letzter und hockte mich neben das Sofa auf den Boden. Es lief ein Western, doch selbst ohne das Hämmern in meinem Kopf hätte ich der Geschichte kaum folgen können. Eine Hand voll Outlaws stand auf einem felsigen Hügelkamm und spähte blinzelnd nach einer sich von Ferne nähernden Staubwolke, und ich musste wieder an die Tomkeys denken und wie einsam und verloren sie in ihren albernen Kostümen ausgesehen hatten. »Was hatte der Junge da eigentlich als Schwanz?«, fragte ich. »Pssst!«, kam es von allen Seiten.
Monatelang hatte ich diese Leute beschützt und auf sie aufgepasst, doch jetzt hatten sie durch eine einzige dumme Tat dafür gesorgt, dass mein Mitleid sich in etwas Hartes und Hässliches verwandelt hatte. Es hatte keine Freundschaft gegeben zwischen den Tomkeys und mir, aber immerhin hatte ich sie mit dem Geschenk meiner Neugier bedacht. Über die Tomkey-Familie nachzudenken, hatte mir ein Gefühl von Großherzigkeit gegeben, doch jetzt würde ich einen anderen Gang einlegen und Spaß daran finden müssen, sie zu hassen. Die einzige Alternative war, dem Rat meiner Mutter zu folgen und einen scharfen Blick auf mich selbst zu werfen. Es war ein alter Trick, um den Hass auf andere nach innen zu lenken, und ich war entschlossen, nicht darauf hereinzufallen, auch wenn sich das von ihr beschworene Bild nicht so leicht abschütteln ließ: ein Junge, der auf seinem Bett sitzt, den Mund mit Schokolade verschmiert. Er ist ein menschliches Wesen, gleichzeitig aber auch ein Schwein, das inmitten von lauter Abfällen hockt und gierig alles verschlingt, damit nur ja kein anderer etwas abbekommt. Gäbe es nur dieses eine Bild auf der Welt, wäre man gezwungen, seine ganze Aufmerksamkeit darauf zu richten, doch zum Glück gab es noch andere. Die Kutsche, zum Beispiel, die mit Kisten voller Gold in der Wegbiegung erschien. Das glänzende, neue Mustangcabriolet. Das Mädchen mit dem wallenden Haar, das Pepsi durch einen Strohhalm schlürfte, ein Bild nach dem anderen, ohne Unterbrechung, bis zu den Nachrichten und was immer danach kam.
Lass es schneien
In Binghamton, New York, bedeutete Winter Schnee, und obwohl ich noch klein war, als wir wegzogen, konnte ich mich an große Mengen Schnee erinnern und dies als Beweis dafür in Anschlag bringen, dass North Carolina bestenfalls eine drittklassige Einrichtung war. Das bisschen Schnee, das dort herunterkam, war gewöhnlich ein oder zwei Stunden später bereits geschmolzen, und dann stand man da in seiner Windjacke und den wenig überzeugenden Fäustlingen und formte ein klumpiges Gebilde, das größtenteils aus Dreck bestand. Schneeneger sagten wir dazu.
In dem Winter, als ich in die fünfte Klasse ging, hatten wir allerdings Glück. Es schneite, und zum ersten Mal seit Jahren blieb der Schnee auch liegen. Die Schule fiel aus, und zwei Tage später hatten wir noch einmal Glück. Es lagen zwanzig Zentimeter Schnee, und anstatt zu tauen, bekamen wir Frost. Am fünften Tag unserer Ferien erlitt meine Mutter eine kleine Nervenkrise. Unsere Anwesenheit hatte ihr geheimes Leben durcheinander gebracht, das sie führte, während wir in der Schule waren, und als sie es nicht länger aushielt, setzte sie uns vor die Tür. Nicht mit einer freundlichen Bitte, sondern mit einem handfesten Rausschmiss. »Schert euch bloß aus meinem Haus«, sagte sie.
Wir erinnerten sie daran, dass es auch unser Haus war, woraufhin sie nur die Haustür öffnete und uns in den Carport schob. »Und wehe, es kommt einer rein!«, rief sie.
Meine Schwestern und ich gingen den Hang hinunter und fuhren mit den Kindern aus der Nachbarschaft Schlitten. Einige Stunden später kehrten wir nach Hause zurück, doch war die Tür zu unserer Überraschung immer noch verschlossen. »Also, jetzt ist aber genug«, sagten wir. Ich drückte auf die Klingel, und als niemand kam, gingen wir zum Fenster und sahen unsere Mutter in der Küche vor dem Fernseher. Normalerweise wartete sie bis fünf mit ihrem ersten Drink, allerdings war sie in den letzten Tagen davon abgerückt. Da es nicht als Alkoholtrinken zählte, wenn man auf ein Glas Wein eine Tasse Kaffee folgen ließ, hatte sie neben dem Weinglas noch einen Kaffeebecher vor sich auf der Küchentheke stehen.
»He!«, brüllten wir. »Mach die Tür auf. Wir sind’s.« Wir klopften gegen die Scheibe, doch ohne auch nur in unsere Richtung zu blicken, füllte sie ihr Glas auf und ging aus dem Zimmer.
»Die gemeine Ziege«, sagte meine Schwester Lisa. Wir hämmerten weiter gegen das Fenster, und als meine Mutter sich nicht rührte, gingen wir um das Haus herum und warfen Schneebälle gegen ihr Schlafzimmerfenster. »Wenn Daddy nach Hause kommt, gibt es richtig Ärger!«, riefen wir, woraufhin meine Mutter nur die Vorhänge zuzog.
Als es zu dämmern begann und kälter wurde, kam uns der Gedanke, dass wir erfrieren könnten. So etwas kam tatsächlich vor. Egoistische Mütter, die das Haus für sich allein wollten, und Jahre später entdeckte man ihre Kinder, steif gefroren wie Mastodons in dicken Eisklötzen.
Meine Schwester Gretchen schlug vor, unseren Vater anzurufen, doch wusste keiner von uns die Nummer, und vermutlich hätte er auch nichts unternommen. Er war vor allem deshalb zur Arbeit gegangen, um unserer Mutter zu entfliehen, und in Anbetracht der Wetterlage und ihrer Stimmung konnte es Stunden, wenn nicht gar Tage dauern, bis er nach Hause kam.
»Einer von uns müsste unters Auto kommen«, sagte ich. »Das würde ihnen beiden eine Lehre sein.« Ich stellte mir Gretchen vor, ihr Leben an einem seidenen Faden, während meine Eltern im Flur des Rex Hospitals auf und ab liefen und sich wünschten, sie wären fürsorglicher gewesen. Es war tatsächlich die perfekte Lösung. War sie erst aus dem Weg, würden wir anderen wertvoller erscheinen und hätten außerdem mehr Platz im Haus. »Gretchen, leg dich auf die Straße.«
»Amy soll sich hinlegen«, sagte sie.
Amy wiederum schob es auf Tiffany, die die Jüngste war und noch keine Vorstellung vom Tod hatte. »Es ist wie schlafen«, erklärten wir ihr. »Nur dass du in einem Himmelbett schläfst.«
Die arme Tiffany. Sie hätte alles getan für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Man brauchte nur Tiff zu ihr zu sagen und bekam alles, was man wollte: ihr Taschengeld, ihren Teller beim Abendessen, den Inhalt ihres Osternests. Als wir ihr sagten, sie solle sich mitten auf die Straße legen, fragte sie nur: »Wo?«
Wir suchten eine kleine Mulde zwischen zwei Straßenkuppen, an der die Autofahrer unweigerlich ins Schlittern geraten mussten. Sie nahm ihren Platz ein, ein sechsjähriges Mädchen im buttergelben Mantel, und wir anderen stellten uns an den Straßenrand und warteten. Das erste Auto, das vorbeikam, gehörte unserem Nachbarn, ein Yankee wie wir, der Schneeketten aufgezogen hatte und wenige Fuß vor unserer Schwester zum Stehen kam. »Liegt da ein Mensch auf der Straße?«, fragte er.
»So in etwa«, sagte Lisa. Sie erklärte ihm, dass man uns zu Hause ausgesperrt hatte, und obwohl der Mann dies offenbar als vernünftige Erklärung akzeptierte, bin ich mir sicher, dass er derjenige war, der uns anschwärzte. Ein zweiter Wagen fuhr vorbei, und dann sahen wir unsere Mutter, eine keuchende Gestalt, die sich mühsam über die Hügelkuppe schob. Sie trug keine Hose, und ihre Beine versanken bis zur Hüfte im Schnee. Wir wollten sie zurück ins Haus schicken, sie aus der freien Natur verbannen, so wie sie uns zuvor aus dem Haus verbannt hatte, doch war es schwer, weiter auf jemanden wütend zu sein, der so bemitleidenswert aussah.
»Hast du etwa deine Hausschuhe an?«, fragte Lisa, und meine Mutter reckte nur einen nackten Fuß in die Luft. »Ich hatte meine Hausschuhe an«, sagte sie. »Ganz sicher, eben war er noch dran.«
So ging das immer. Erst sperrte sie uns aus unserem eigenen Haus aus, und im nächsten Moment wühlten wir alle im Schnee nach ihrem linken Schlappen. »Ach, vergesst es«, sagte sie. »Der taucht in ein paar Tagen wieder auf.« Gretchen zog ihre Mütze über den Fuß meiner Mutter. Lisa wickelte ihren Schal darum, und sie fest von allen Seiten stützend, machten wir uns auf den Weg nach Hause.
Klar Schiff
Meine Mutter und ich standen in der Reinigung hinter einer Frau, die wir noch nie gesehen hatten. »Eine attraktive Frau«, sagte meine Mutter später. »Gute Figur. Sehr elegant.« Die Frau trug passend zur Jahreszeit ein leichtes Baumwollkleid mit übergroßen Gänseblümchen. Ihre Schuhe hatten die Farbe der Blütenblätter, und ihre Tasche, die schwarz-gelb gestreift war, hing lose über ihre Schulter und umschwirrte die Blüten wie ein träges Bienchen. Sie reichte den Abholschein herüber, nahm ihre Kleider in Empfang und bedankte sich für den schnellen und zuverlässigen Service. »Wissen Sie«, sagte sie, »es wird viel über Raleigh geredet, aber das stimmt alles nicht, nicht wahr?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!