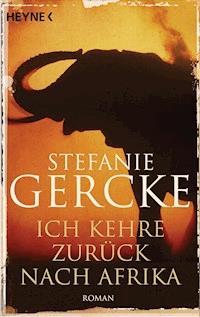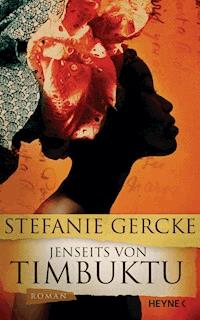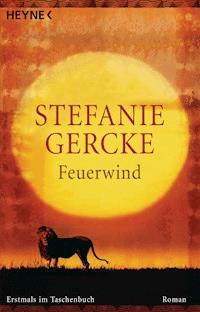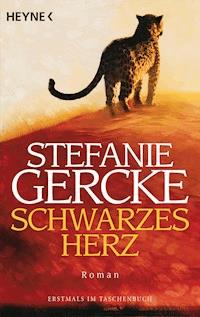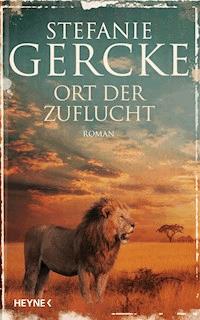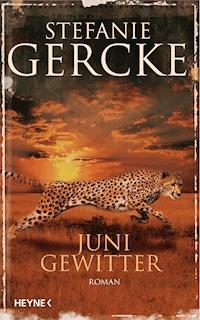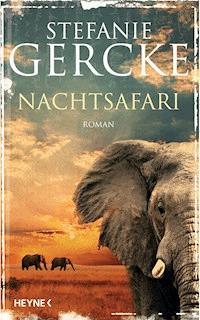
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Große Gefühle, fesselndes Drama, flammendes Afrika
Silke begleitet ihren Verlobten Marcus auf einer Geschäftsreise nach Südafrika. Dort ist sie nie gewesen, auch ihr Verlobter Marcus nicht, wie er behauptet. Seltsam ist nur, dass man ihn in Zululand offenbar sehr gut kennt. So gut, dass er zum Opfer einer Entführung wird. Den Kopf voller ungelöster Fragen nimmt Silke die Verfolgung auf, gegen allen Widerstand der Einheimischen. Und auf einmal bricht die Hölle los, der Busch steht in Flammen, und jede Rettung droht zu spät zu kommen ...
Angeblich ist Marcus Bonamour, Leiter einer Firma für Seltene Erden, noch nie in Südafrika gewesen. Doch kaum ist er mit seiner Verlobten Silke dort angekommen, wird sein Verhalten zunehmend rätselhaft. Auf einer Safari werden die beiden von einem schwarzen Ranger verfolgt. Und als sie bei Einbruch der Nacht in eine riesige Elefantenherde geraten und den massiven Angriff der wütenden Tiere nur knapp überleben, werden sie von dem Ranger überfallen. Marcus wird entführt, und Silke bleibt allein im Busch zurück. Hilfsbereite Zulus bringen sie auf die Farm »Inqaba«. Doch statt mit Mitgefühl begegnen ihr die Anwesenden dort mit Misstrauen und unterziehen die ahnungslose junge Frau einem harten Verhör. So erst erfährt sie, warum Marcus seinen Vater so sehr hasst, und muss nun fürchten, dass ihr Verlobter für die Vergehen des Vaters während der Apartheid büßen soll. Wird es gelingen, den unschuldigen Sohn aus den Fängen seiner Entführer zu retten? Ist er tatsächlich unschuldig? Wird der jungen Liebe ein jähes Ende bereitet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
STEFANIE
GERCKE
NACHTSAFARI
ROMAN
Prolog
Es war Juni, als sie sich kennenlernten. Die Schwalben zwitscherten auf den Dachfirsten, die Kastanien blühten, und Jasminduft hing süß und schwer in der warmen Luft. Bis an sein Lebensende würde dieser Duft Marcus an jenen Tag erinnern, bis an sein Lebensende würde er für ihn ein seelischer Zufluchtsort bleiben. Der Tag, an dem er sich unsterblich in Silke Ingwersen verliebte.
Er war geschäftlich von München nach Hamburg geflogen und auf der Suche nach der Adresse seines Geschäftspartners in eine ruhige Nebenstraße eingebogen. Dort fiel ihm ein quietschrotes Mini-Cabrio auf, das mit den Vorderrädern auf dem Bürgersteig parkte. Die Fahrertür stand offen, die Warnlichter blinkten. Er war schon fast vorbeigefahren, als er einen kleinen Jungen entdeckte, der weinend neben seinem zertrümmerten Rad hockte. Sofort stieg er in die Bremsen, fuhr die paar Meter zurück und sah genauer hin. Der Junge blutete aus mehreren Schürfwunden und zitterte vor Schock. Offensichtlich war das Kind angefahren worden.
Er schaltete ebenfalls den Warnblinker ein, sprang aus dem Wagen und ging vor dem Kleinen in die Hocke. Behutsam legte er ihm eine Hand auf die Schulter, spürte mit Genugtuung, wie das Zittern nachließ, die hastige Atmung sich beruhigte. Leise fragte er den Jungen nach seinem Namen und wo genau es ihm wehtue, als ihn eine wütende Frauenstimme unterbrach. Er fuhr herum.
Eine Frau – um die dreißig, sensationelle Figur, blondes, gelocktes Haar – hielt einen jüngeren Mann in Lederkluft und Fahrradhelm mit beiden Händen am Revers der Jacke gepackt und schüttelte ihn, obwohl er gut einen halben Kopf größer war als sie.
»Erst ein Kind anfahren und dann abhauen, Sie Schwein«, schrie sie den Mann an und schüttelte ihn noch einmal, dass Marcus hören konnte, wie ihm die Zähne klapperten. »Sie bleiben hier, bis die Polizei kommt, verstanden!«
Entgeistert starrte der Radfahrer auf die Frau herunter, schien so fassungslos zu sein, dass er nur Gestammel hervorbrachte.
»Was?« Aufgebracht zerrte die Frau an der Lederjacke.
Marcus stand auf, um ihr zu helfen, und erst in diesem Moment schien sie ihn zu bemerken. Prompt richtete sich ihr wutfunkelnder Blick auf ihn.
»Verdammt, glotzen Sie nicht so blöd! Rufen Sie die Polizei und einen Krankenwagen, Sie Trottel, und kümmern Sie sich um den Kleinen! Ich muss diesen Kerl hier daran hindern, sich aus dem Staub zu machen. Hiergeblieben!«, herrschte sie den Radfahrer an, als dieser versuchte, sich aus ihren Fäusten zu winden. »Fahrerflucht ist das«, fauchte sie und, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, bohrte ihm einen ihrer hohen, unangenehm spitzen Absätze in den Fußrücken.
»Und wenn Sie nicht gleich stillhalten, ramm ich Ihnen das Knie zwischen die Beine … Sie … Sie Fahrradterrorist!« Ihr Gesicht war krebsrot, ihre Augen schossen Blitze.
Das war der Augenblick, in dem Marcus sich unsterblich in sie verliebte.
Er hatte nur noch Augen für sie, registrierte kaum noch, dass die Polizei mit rotierendem Blaulicht und heulender Sirene erschien, kurz darauf ein Krankenwagen den Jungen abtransportierte und der Radfahrer in den Peterwagen verfrachtet und weggebracht wurde. Die Frau und er blieben allein zurück.
Über ihnen rauschten die uralten Kastanienbäume, der Jasmin duftete betörend. Ihre Augen waren blau. Nicht hellblau, nicht dunkelblau. Leuchtend blau wie die wilden Kornblumen auf den Wiesen in Bayern. Entrückt verlor er sich in der kornblumenblauen Tiefe.
»Was ist?«, raunzte sie ihn ungeduldig an. »Habe ich einen großen Pickel auf der Nase?« Sie wühlte in ihrer Umhängetasche.
Er riss sich zusammen. »Nein … natürlich nicht … Entschuldigung.« Ihm blieb die Stimme weg. Die Zunge klebte ihm am Gaumen. Mit steigender Verzweiflung überlegte er, wie er sie davon abhalten konnte, für immer aus seinem Leben zu verschwinden, da fiel sein Blick auf ein Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er räusperte sich und verbeugte sich leicht. »Ich heiße Marcus, Marcus Bonamour … Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche jetzt einen Kaffee oder etwas Stärkeres. Wie ist es – da drüben ist ein Italiener, der sieht doch ganz nett aus?«
Und morgen können wir dann heiraten, hätte er fast hinzugesetzt, hielt sich aber gerade noch zurück. Das Blut schoss ihm heiß ins Gesicht, und er hoffte inständig, dass sie das nicht merken würde.
Sie streifte ihn mit einem flüchtigen Blick. »Hi, Silke Ingwersen«, erwiderte sie und sah dabei auf die Uhr. »Danke, aber ich habe überhaupt keine Zeit.« Sie zog ihren Wagenschlüssel aus der Tasche und wandte sich von ihm ab.
»Bitte«, sagte er und wurde von einem Gefühl überschwemmt, das er seit seiner Teenagerzeit nicht mehr gespürt hatte. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, bekam aber nur ein weiteres gestottertes »Bitte« hervor.
Für einige Sekunden musterte sie ihn schweigend. Der Sommerhimmel spiegelte sich in ihren Augen wider. Ihm wurden die Knie weich.
»Okay«, entgegnete sie überraschend und marschierte quer über die Straße auf das Restaurant zu.
Benommen folgte er ihr, und kurz darauf nahmen sie an einem der langen Holztische vor dem Lokal Platz. Sie fegte die heruntergefallenen Kastanienblüten vom Tisch und stellte ihre Umhängetasche neben sich auf die Sitzbank.
»Keinen Alkohol«, wehrte sie sein Angebot für einen leichten, spritzigen Weißwein ab. »Cola, bitte. Ich muss noch fahren.«
Während sie die Speisekarte eher aus Verlegenheit studierten, stellten sie aber beide fest, dass sie ziemlich hungrig waren und dass Spaghetti alle vongole ihrer beider Lieblingsgericht war. Marcus rief die Kellnerin an den Tisch und gab die Bestellung auf.
»Das war sehr mutig von Ihnen«, sagte er, um das entstandene Schweigen zu füllen. »Der Kerl war größer und jünger als Sie. Und viel kräftiger.«
»Ich war wütend«, erklärte sie mit einem Schulterzucken.
Das war vor zweieinhalb Jahren gewesen. Nachdem sie viel zu lange eine Wochenendbeziehung geführt hatten, sich oft für mehrere Wochen aus beruflichen Gründen nicht sehen konnten, war Silke Anfang dieses Jahres zu ihm nach München gezogen. Nun wollten sie am 14. Januar heiraten, und zum ersten Mal in seinem Leben wusste Marcus, wie sich reines Glück anfühlte.
In den folgenden Monaten, in denen sein Leben auf den Kopf gestellt wurde, Dinge passierten, die er sonst nur von höllenschwarzen, durchwachten Nächten kannte, flüchtete er sich oft in den innersten Kern seiner Seele, in die Welt, wo es Silke gab und Licht und Wärme. Und eine Zukunft.
1
Am 29. November 2011 wölbte sich der azurblaue Himmeleines herrlichen Frühsommertages über Zululand. In der Hauptstadt Ulundi wurden um acht Uhr morgens 26 Grad Celsius gemessen, die Luft war weich und würzig, die Sonne strahlte, und die ekstatisch balzenden Webervögel blinkten wie Goldstücke zwischen saftig grünen Blättern. In München tobte zur selben Zeit ein Schneesturm.
Hector Mthembu hatte sein bescheidenes Haus, das in den Hügeln nördlich von dem Wildreservat Hluhluwe lag, schon vor Sonnenaufgang verlassen und erreichte nun die Mine, zu deren Wachmannschaft er gehörte. Die Luft stand still, es herrschte bereits eine Affenhitze, und er schwitzte wie ein Stier.
Auch Scott MacLean war heiß. Außerdem war er nach einer Nacht im Busch todmüde. Um seine Augen glühten rote, ringförmige Abdrücke, die ihn wie eine exotische Eule aussehen ließen, weil er auf der Suche nach der trächtigen Leopardin stundenlang durch sein Nachtglas gestarrt hatte. Trotz schmerzender Muskeln und brennender Augen war er restlos glücklich.
Im Morgengrauen hatte er die gefleckte Großkatze endlich in einer Felshöhle aufgestöbert und zu seinem Entzücken entdeckt, dass sie vier Junge säugte. Vier prachtvolle, gesunde Kätzchen. Als am längsten dienender Ranger des Wildreservats Hluhluwe würde er seinen Kollegen einen ausgeben müssen. Vierfacher Papa wurde man nicht jeden Tag.
Abgesehen davon hatte er sich vor zwei Tagen wieder mit Kirsty getroffen. Kirsty Collier mit den langen Beinen und der hinreißenden Sanduhr-Figur. Und den schönsten Augen, in die er je geblickt hatte. Wie er nach seiner Zeit auf der Universität, an der sie wie er Biologie und zusätzlich Tiermedizin studiert hatte, überhaupt je den Kontakt zu ihr hatte verlieren können, war ihm heute ein Rätsel. Vielleicht, weil sie sich damals Hals über Kopf in einen anderen verliebt hatte, einen, der ihr mehr bieten konnte als er, und vielleicht auch, weil er sich daraufhin zurückgezogen hatte, um seine Wunden zu lecken.
Erst Monate später hatte ihm ein Freund erzählt, dass der sie hatte sitzen lassen, ohne Vorwarnung, ganz brutal. Aber wie das Leben eben so ist, konnte er es sich damals weder zeitlich noch finanziell leisten, mal eben eintausendfünfhundert Kilometer quer durchs Land zu reisen. Anrufen wollte er sie nicht, weil er nicht wusste, was er einer Frau sagen sollte, die von jenem Mistkerl den Laufpass bekommen hatte, dessentwegen sie ihn verlassen hatte. Mit solchen Dingen tat er sich schwer.
Bald darauf hatte Kirsty wohl die Universität gewechselt, jedenfalls war sie, als er nachfragte, in ihrer alten Alma Mater nicht mehr eingeschrieben. Da er weder Telefonnummer noch Adresse von ihr hatte, war sie bald nur noch eine sehnsüchtige Erinnerung.
Doch das Schicksal war gnädig gewesen. Vor Monaten waren sie sich unvermittelt im Foyer des Durbaner Hotels über den Weg gelaufen, wo er auf der Tagung für Wildtier-Management einen Vortrag halten musste. Plötzlich stand sie vor ihm. Smart gekleidet in weißer Bluse, engem Rock und High Heels, was so ungewöhnlich für sie war, dass er im ersten Augenblick seinen Augen nicht traute. Ihm traten vor Aufregung Schweißperlen auf die Stirn, obwohl die Hotelhalle klimatisiert war.
»Scott«, begrüßte sie ihn. »Hallo.«
Verwirrt schaute er auf ihr Namensschild, das ihre Zugehörigkeit zu einer Cateringfirma verkündete. Kirsty Collier, stand da. Eventmanagerin. Seine Augenbrauen schossen erstaunt hoch. Die Kirsty, die er gekannt hatte, hatte überhaupt nichts für Tätigkeiten übrig, die nichts mit ihrem angestrebten Beruf Tierärztin zu tun hatten.
»Ich kann auch ziemlich gut kochen«, erklärte sie auf seine Reaktion hin trocken.
Er stammelte irgendetwas Unzusammenhängendes und sah ihr anschließend für lange Sekunden stumm in die Augen. Dann öffnete er einfach seine Arme, und sie schmiegte sich an ihn.
»Du riechst nach Raubtierkäfig«, stellte sie fest und lachte.
Ein sinnliches Lachen, bei dem es ihm heiß und kalt den Rücken hinunterlief, und im selben Moment erkannte er, dass er das gefunden hatte, wonach er so lange gesucht hatte. Dieses Mal würde er Kirsty nicht wieder gehen lassen.
Mit einem versonnenen Lächeln marschierte er durch ein trockenes Flussbett zu seinem Geländewagen.
Marcus Bonamour hatte extrem schlechte Laune. Weil es Montag war, weil er sich mal wieder mit seinem Vater gestritten hatte und weil das Wetter in München seit Wochen einfach unerträglich scheußlich war. Ein bleischweres Gewicht in seiner Magengegend kündigte seine Winterdepression an, die in ihm hochkroch wie ein gefräßiges schwarzes Tier. Immer in diesen kalten, dunklen Tagen schlug es seine Klauen in seine Seele. Er ballte die Hände zu Fäusten. Einzig der Gedanke an Silke bewahrte ihn noch davor, in einer Welle von Trostlosigkeit zu ertrinken. Mit überwältigender Heftigkeit überfiel ihn die Sehnsucht nach ihr. Ihrem Lächeln, ihren Augen, ihrer duftenden Haut. Danach, sein Gesicht in ihrem seidigen Haarschopf zu vergraben. Seine Silky, wie nur er sie nennen durfte.
Keiner der drei Männer ahnte etwas von der Existenz des anderen. Auch Hector Mthembu und Scott MacLean waren sich noch nie begegnet, obwohl sie nur wenige Kilometer entfernt voneinander lebten. Sowohl Hector als auch Scott trafen an diesem 29. November eine Entscheidung, die unter normalen Umständen nur sie selbst berührt hätte, aber da Marcus Bonamour war, wer er war, überrollten ihn die Auswirkungen mit der tödlichen Wucht eines Hochgeschwindigkeitszuges und stießen ihn hinab in seine ganz private Hölle – geradewegs in die Arme derjenigen, die seine schwärzesten Albträume bevölkerten.
Was genau die Ereignisse schließlich ins Rollen brachte, ist im Nachhinein schwer festzulegen. Aber letzten Endes war die Bildung einer Methangasblase tief unter der kleinen Mine ausschlaggebend. Das Gas sickerte durch das Vulkangestein in den Stollen, und da es leichter war als Luft, verteilte es sich schnell, zog wie Rauch bis in die letzte Nische. Bald war der Punkt erreicht, an dem ein einziger Funke genügen würde, um den gesamten Berg in die Luft zu sprengen.
In der Mine wurden seltene Erden von großer Reinheit gewonnen, die im Zeitalter von Atomreaktoren, Bildschirmen und Lasern immense Bedeutung erlangt hatten und von Tag zu Tag teurer wurden. Jeder Erdhaufen wurde durchgesiebt, um auch noch das letzte kostbare Gramm zu gewinnen. Als man den Schatz an seltenen Erden entdeckte, war das kleine Bergwerk schon wegen Unrentabilität seit einiger Zeit stillgelegt, Wartungen waren seit Langem nicht mehr durchgeführt worden. Überhastet wurde trotz veralteter Ausrüstung der Betrieb wiederaufgenommen.
Hector hatte von Technik keine Ahnung. Zuvor arbeitete er als Einkaufswagen-Manager für einen Supermarkt. Das hieß, er schob die über den Parkplatz verstreuten Einkaufswagen zu einer langen Schlange ineinander und bugsierte die zur Wagenstation. Von Gefahren, die Gasansammlungen in einer Mine darstellten, hatte er noch nie etwas gehört.
Früher trugen Bergleute Kanarienvögel im Käfig mit in die Grube, die sie vor Giftgasen warnen sollten. Fielen die Vögel tot um, war es höchste Zeit, den Stollen zu verlassen. Aber seitdem die Schächte von Neonlampen beleuchtet wurden und es elektrische Grubenlampen gab, waren die lebenden Warnanlagen überflüssig geworden. Paradoxerweise kostete Hector Mthembu jedoch tatsächlich ein elektrischer Funke das Leben sowie die Tatsache, dass zwischen ihm und seinem Kollegen Wiseman Luthuli ein ständiger Streit schwelte.
Wiseman war zwar ohnehin ein Draufgänger, aber zunehmend unberechenbarer geworden, seit er vor Monaten angefangen hatte, Tik zu rauchen. Er ignorierte jegliche Vorschriften, besonders wenn Mädchen im Spiel waren. Und die umschwärmten den jungen Mann wie die Motten das Licht. Ständig brauchte er Geld. Viel Geld. Für Tik und für die Mädchen. Auch Hector hatte er schon angepumpt. Und natürlich keinen Cent zurückgezahlt. Doch neuerdings schien er überraschend flüssig zu sein, und Hector war sich sicher, dass er einer Gang angehörte, die für die vielen Überfälle in der Gegend verantwortlich war. Immer öfter erschien er einfach nicht zum Dienst oder verdrückte sich mit seiner Freundin in ein lauschiges Eckchen. Hector hatte es mittlerweile restlos satt, ständig für ihn einspringen und lügen zu müssen. Sowie sich die Gelegenheit ergab, würde er mit dem Minenmanager über Wiseman sprechen.
Der Eingang zum Schacht war heute, an einem Montag, mit einem soliden Eisentor verschlossen, weil die gesamte Belegschaft singend und tanzend – und mit Hackmessern, Speeren und Schusswaffen bewaffnet – zu einer Protestveranstaltung der Minenarbeitergewerkschaft gezogen war, um höhere Löhne zu erstreiten. Da Hector und Wiseman nicht der Gewerkschaft angehörten, waren sie vom Management zum Wachdienst eingeteilt worden. Sie verbrachten die Zeit im Schatten des Wachhäuschens, rauchten und tranken Bier, wobei sie ausgiebig über ihre Familien, die örtliche Politik und die Auswirkungen des Streiks auf ihre mageren Geldbeutel diskutierten.
Nachmittags gegen vier Uhr erschien überraschend Wisemans neue Freundin. Seine Hand auf ihr ausladendes Hinterteil gelegt, verdrückte er sich sogleich mit einem erwartungsfreudigen Grinsen mit ihr hinter das Gebäude.
Hector lehnte sich an die Hauswand und schloss die Augen. Ein merkwürdiger Schrei aus der Tiefe jenseits des Tores ließ ihn allerdings aufhorchen. Er rief nach Wiseman, der mit missmutigem Gesicht auftauchte und sich gar nicht erst die Mühe machte, seinen offen stehenden Hosenstall zu schließen. Hector erklärte ihm, was er gehört hatte.
Wiseman aber winkte hastig ab. »Easy, Mann! Da wird nichts sein. Das Tor ist zu, da kommt nicht mal ’ne Maus rein. Und da drin gibt’s doch nichts zu holen.«
Seine Freundin, die Hände über den bloßen Brüsten gekreuzt, streckte den Kopf um die Hausecke und rief kichernd nach Wiseman – was ihm das Leben retten sollte.
Als Wiseman eiligst seiner Freundin wieder hinter das Gebäude folgte, stand Hector murrend auf, ergriff seine Taschenlampe, schloss den Personendurchgang auf und schob sich durchs Drehkreuz. Da er sich vor dunklen Löchern fürchtete, näherte er sich nur schrittweise dem gähnenden Maul des Mineneingangs, hielt sich am Torpfosten fest und spähte mit gerecktem Hals hinein.
Kühle, erdig-feuchte Luft strich ihm aus dem Schlund des Schachts entgegen, aber in der undurchdringlichen Finsternis konnte er außer einer toten Fledermaus zu seinen Füßen absolut nichts erkennen, auch vernahm er kein weiteres Geräusch. Gar nichts. Erleichtert richtete er sich auf.
Wiseman machte gerade eine weitere Flasche Bier auf, die Freundin kicherte, und Hector stellte sich seine junge Frau vor, ihre weichen Lippen, die Augen, die dunkel waren wie ihr schöner, wohlgerundeter Körper. Ihm wurde fast schwindelig vor Verlangen. Glücklicherweise war bald Feierabend.
Nur die unerfreuliche Vorstellung, zur Verantwortung gezogen zu werden, sollte doch ein Schaden entstanden sein, bewog ihn, lieber auf Nummer sicher zu gehen. Er wandte sich wieder dem bodenlos erscheinenden Loch zu, knipste seine Taschenlampe an und drückte mit der anderen Hand den großen Hebel herunter, der die Neonröhren an der Decke des Schachts anschaltete.
Der Hebel hakte. Hector klemmte sich die Taschenlampe unter den Arm, packte den Hebel mit beiden Händen, nahm alle Kraft zusammen und drückte. Aber nichts rührte sich. Das lag daran, dass Wartungsarbeiten viel zu selten und außerdem schlampig ausgeführt wurden, weil der Besitzer einen Hungerlohn zahlte und keiner sich verantwortlich fühlte.
So geschah es, dass vor einiger Zeit versehentlich eine Ratte im Kasten eingeschlossen wurde, ohne dass es irgendjemand bemerkt hätte. Da Ratten ständig Hunger haben und alles fressen, was sie zwischen die Zähne bekommen, hatte das Tier in seiner Not sogar die Kunststoffabdichtung des explosionsgeschützten Schaltkastens angenagt. Es war schon vor mehr als zwei Wochen verendet, als Hector entschied, den Schalter zu betätigen.
Hätte sich in den vergangenen Tagen der Druck auf die Methangasblase im Gestein nicht stetig erhöht, wäre vermutlich auch nichts passiert. Aber das Gas hatte sich immer weiter ausgebreitet, war durch winzige Felsritzen in den Schacht und schließlich durch die beschädigte Abdichtung ins Schaltgehäuse gekrochen.
Davon ahnte Hector natürlich nichts, als es ihm mit einem kraftvollen Ruck endlich gelang, den Hebel herunterzudrücken. Metall schlug auf Metall, Funken sprühten. Das dumpfe Grollen, das Sekunden später die Erde um ihn erschütterte, nahm Hector anfänglich nur unbewusst wahr, weil die Neonröhren aufleuchteten und er in ihrem Schein in einigen Metern Entfernung weitere tote Fledermäuse entdeckte. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen wollte er herausfinden, warum die Fledermäuse tot von der Decke fielen, als ein weiß glühender Blitz ihn blendete.
Ihm war nur ein winziger Augenblick vergönnt, in dem er hätte verstehen können, was geschah, aber er tat es nicht, weil er nichts von Schlagwettern wusste. Was sicherlich ein Glück für ihn war, denn ohne Vorwarnung verwandelte sich seine Welt in einen brüllenden Feuerball.
Die ortsansässige Affenherde jedoch, die sich am Fuß der Mine an den Früchten eines Marulabaums gütlich tat, merkte es einen Atemzug, bevor die Methangasblase explodierte und der Berghang sich nach außen wölbte. Sie retteten sich auf einen entfernten Baum, wo sie sich schlotternd vor Angst an den Ästen festklammerten, während die Druckwelle unter Tage Hector in einen rötlichen Sprühregen verwandelte.
Der Stollen brach auf der gesamten Länge ein, das rare Erz wurde unerreichbar unter zig Tonnen von Geröll verschüttet. Hector Mthembus Überreste legten sich nach und nach als feiner, glänzend roter Film über den Schutt.
Scott MacLean hatte seinen Geländewagen inzwischen erreicht und wollte soeben einsteigen, blieb aber überrascht stehen. Er meinte, ein winziges Beben zu spüren, so als hätte sich die Erde kurz geschüttelt. Stirnrunzelnd konzentrierte er sich auf den Boden unter seinen Füßen. Aber alles blieb ruhig, es bewegte sich nichts, und er kam schnell zu dem Ergebnis, dass er sich wohl geirrt hatte. Offenbar hatte er gestern Abend wohl doch ein Bier zu viel getrunken, dachte er lächelnd. Er schwang sich auf seinen Sitz, startete den Motor und setzte langsam zurück auf die Sandstraße, die zu seiner Unterkunft führte.
Die Explosion in der kleinen Mine im Norden KwaZulu-Natals schaffte es nicht in die Medien im Rest der Welt, weil gleichzeitig die Eilmeldung von einem durchgeknallten Waffennarr, der im morgendlichen Berufsverkehr am Pariser Gare du Nord ein Dutzend Menschen mit Handgranaten in die Luft gesprengt und weitere Hunderte verletzt hatte, alle Nachrichten beherrschte. So erfuhr auch Marcus Bonamour, Geschäftsführer einer renommierten Erz-Handelsfirma und langjähriger Geschäftspartner der Minengesellschaft, nichts darüber.
Während die Arbeiter im heißen Zululand begannen, die Felsbrocken vor dem Mineneingang beiseitezuräumen, um nach Hector zu suchen und herauszufinden, was die Explosion hervorgerufen hatte, hatte Rob Adams, der weiße Manager der Mine, dagegen absolut existenzielle Sorgen. Sein Boss, der Besitzer der Mine, war ein harter Mann, der ihn auf der Stelle feuern würde, sollte sich herausstellen, dass schlampige Wartung die Ursache der Explosion gewesen war. Es gab genug arbeitslose Minenmanager, die seinen Job mit Kusshand übernehmen würden. Hektisch versuchte er im Laufe des Tages, die Lager anderer Minen bis hinauf nach Mosambik leer zu kaufen, um irgendwie die laufenden Lieferverträge erfüllen zu können und damit Zeit zu gewinnen, den Schutt wegzuräumen und die Produktion wieder aufzunehmen. Und um alles zu vertuschen.
Zwar war es ihm möglich, sich einige Partien zu sichern, doch die Nachricht von dem Unglück hatte sich wie ein Lauffeuer im Land verbreitet. Daher musste er Preise zahlen, die ihm die Tränen in die Augen trieben. Aber dafür würde er einige seiner wichtigsten Kunden beliefern können. Vorläufig wenigstens und auch nur teilweise, wie bei der Firma Bonamour & Sohn in München.
Von all diesen Vorgängen ahnte Marcus nichts. Zu diesem Zeitpunkt drängte er sich mit seiner Verlobten im winterlichen München durch die Menschenmenge, um Berge von Weihnachtsgeschenken für die Kinder von Silkes Cousine zu kaufen. Der Schneesturm, der morgens die Stadt in eine weiße Märchenlandschaft verwandelt hatte, hatte sich gelegt, und Silkes zwitschernd guter Laune war es gelungen, Marcus’ Depression in die Schatten zu verbannen.
Tagsüber war der Schnee zu einem hässlichen Matsch geschmolzen. Silke machte gerade einen Satz über eine vereiste Pfütze, rutschte dabei aus und fiel Marcus lachend in die Arme. Prompt ließ er die Einkaufstüten fallen, zog sie an sich und küsste sie mit einer solchen Hingabe, dass der Fluss der Passanten stockte.
»Ich bin ein Eiszapfen«, murmelte Silke, noch immer mit ihren Lippen auf seinen. »Lass uns ins Luitpold gehen, Kaffee trinken und das größte Stück Torte mit den meisten Kalorien essen, das die zu bieten haben. Vielleicht kriegen wir sogar einen Platz im Palmengarten.«
Er lachte, ein warmes Glucksen tief in seiner Kehle. »Ich hätte da noch eine tolle Methode, dich aufzuwärmen«, flüsterte er.
Silke rieselte ein wohliger Schauer über den Rücken. »Lustmolch«, kicherte sie albern. »Füttere mich mit Sahnetorte, und du kannst alles mit mir machen.«
»Okay, dann nichts wie ins Luitpold. Je eher wir dort sind, umso schneller sind wir wieder weg.« Er grinste, ein augenblitzendes, freches Grinsen.
Silke wurden die Knie weich. Schon bei ihrem ersten Zusammentreffen hatte sie sich in dieses Lächeln verliebt. Und in seine gold funkelnden, braunen Augen, den kräftigen Mund. In den Geschmack seiner Haut und die Berührung seiner Hände, die immer sicher die Stelle fanden, wo sie gestreichelt werden wollte. Ihr Puls wurde schneller. Sie reckte sich hoch und küsste ihn.
»Andiamo, ab ins Luitpold!«, gurrte sie.
Marcus hob die Einkaufstüten hoch. »Holla«, sagte er, als sie ihm die Arme herunterzogen. »Scheint, als wäre unser Beutezug erfolgreich gewesen. Haben wir unser Soll denn schon erfüllt?«
Silke überlegte. »Ein paar Sachen fehlen noch, aber die könnte ich natürlich auch im Internet bestellen.«
»Doch da gibt’s keinen Glühwein, und es macht nicht halb so viel Spaß«, protestierte er. »Du weißt, welches Vergnügen mir das bereitet … Wenn wir erst selbst Kinder haben, dann …« Wieder dieses intime Grinsen.
Silke jedoch durchfuhr ein scharfer Stich, und sie wurde aus ihrer euphorischen Stimmung gerissen. »Ach, so ein Mist!«, fiel sie ihm hastig ins Wort und sah weg, als sein Lächeln verrutschte. »Ich habe nasse Fuße bekommen, und nun sind sie zu Eisklumpen gefroren«, sprudelte sie heraus. Immer noch geflissentlich seinen Blick vermeidend, streckte sie ein Bein vor und betrachtete mit gespielt ärgerlicher Miene die Schneeränder auf den Stiefeln. »Ich muss mir unbedingt neue Stiefel kaufen. Overknee wären am besten.«
Aber es gelang ihr nicht, die Kälte, die sich auf einmal in ihr ausgebreitet hatte, wegzureden. Sie stockte, sah sich wie in einer Blitzlichtaufnahme vor vierzehn Jahren in jener nüchternen Arztpraxis in England sitzen, drei kleine, weiße Tabletten vor sich auf dem Tisch aufgereiht, ein Glas Wasser daneben. Sie spürte wieder die Verzweiflung, die sie dorthin getrieben hatte, und gleichzeitig die pechschwarze Hoffnungslosigkeit, die von ihr Besitz ergriffen hatte, als ihr die Gynäkologin vor Kurzem eröffnet hatte, dass ihre Chancen auf eine Schwangerschaft äußerst gering seien.
Wegen der Abtreibung damals, weil nach Einnahme der Tabletten nicht alles restlos abgegangen war und der Arzt eine Ausschabung vornehmen musste, hatte sie ihr erläutert. Da sei etwas schiefgegangen.
Marcus wollte unbedingt Kinder haben – eine ganze Fußballmannschaft, wie er ihr lachend versicherte –, und sie hatte längst die Pille abgesetzt, aber bis heute hatte es nicht geklappt. Und bis heute hatte sie nie den Mut gefunden, ihm diese Abtreibung und deren grässliche Folgen zu beichten.
Doch wenigstens jetzt hatte sie es geschafft, Marcus abzulenken, denn er grinste und deutete auf ihre Stiefel. »Hoffentlich nicht mit Absätzen wie diese, dafür brauchst du eigentlich einen Waffenschein.« Er nahm alle Tüten in eine Hand und legte ihr den freien Arm um die Schultern. »Komm, ich habe Kaffeedurst. Hinterher ist ja noch genügend Zeit, die restlichen Läden leer zu räumen. Oder auch für etwas anderes …« Wieder der funkelnde Blick.
Froh, diese Klippe mal wieder umschifft zu haben, hakte sie sich bei ihm ein und zog ihn eilig über den Salvatorplatz. Dicke Flocken fielen aus steingrauen Wolken und bedeckten den Schmutz der Stadt mit blendendem Weiß, die Weihnachtsbeleuchtung blinkte wie Millionen Kerzen, Kinderaugen strahlten. Sie fanden einen Platz im Palmengarten, bestellten Luitpoldtorte und Café crème. Silke zog die Liste heraus, die sie bis zu ihrer großen Verlobungsparty nach Silvester noch abzuarbeiten hatten. Sie war längst überfällig, denn noch im Januar sollte die Hochzeit stattfinden.
Sie schaute hinaus. Draußen hatte starker Wind eingesetzt, der Himmel hing schiefergrau über den Dächern, der Schnee trieb waagerecht als glitzernd weißer Spitzenvorhang an den hohen Fenstern vorbei. Auf einem winterkahlen Baum hockten zwei Rabenkrähen. Schwarz, unheilvoll. Etwas wie eine böse Vorahnung kräuselte die Oberfläche ihres Bewusstseins. Fröstelnd verschränkte sie die Arme.
»Schön kuschelig hier«, sagte sie laut, als wollte sie jemanden übertönen. »Eigentlich sollten wir im Frühling heiraten. Wir könnten ein Schiff mieten und über den Starnberger See schippern.«
Marcus grinste. »Glaub nur nicht, dass ich dich noch so lange frei herumlaufen lassen werde.« Er zog ihren Kopf zu sich und küsste sie im Schutz der hochgehaltenen Speisekarte ausgiebig.
Silke fing dabei den Blick einer hübschen Dunkelhaarigen vom Nebentisch auf, die Marcus unverhohlen anflirtete. Über seine Schulter sandte sie ihr schweigend eine unmissverständliche Botschaft: Hände weg. Die Frau verzog süffisant die Mundwinkel, senkte aber ihren Blick.
Marcus stocherte in seiner Torte herum. »Mein Vater hat uns eingeladen, am zweiten Weihnachtstag mit ihm essen zu gehen«, sagte er zusammenhanglos, sah sie dabei nicht an.
Silke vergaß die Dunkelhaarige, warf die Liste auf den Tisch und überlegte ein paar Sekunden, wie sie am besten formulierte, was sie von dieser Einladung wirklich hielt. Ich lass mir von deinem Vater nicht Weihnachten verderben, hätte sie ihm gerne gesagt. Ich will nicht, dass er wieder versucht, dich kleinzumachen, wie fast jedes Mal, wenn wir ihn besuchen. Ich will nicht, dass du danach für Tage in einem schwarzen See von Schweigen versinkst und unerreichbar für mich bist. Er ist bösartig, und ich will eigentlich, dass du ihn aus deinem, aus unserem Leben verbannst.
Nach kurzem Nachdenken schluckte sie alles herunter und zwang sich stattdessen zu einem Lächeln. »An und für sich war geplant, dass wir meine Cousine besuchen. Ehrlich gesagt, habe ich versprochen, dass wir kommen. Die Kleinen freuen sich schon wahnsinnig. Du weißt, sie sind völlig vernarrt in dich und werden furchtbar enttäuscht sein, wenn wir nicht erscheinen.«
Im Geiste machte sie sich eine Notiz, Kathrin sofort anzurufen und ihr wegen der Einladung, die bisher noch gar nicht ausgesprochen worden war, Bescheid zu sagen. Ein Problem würde es nicht geben. Ihre große Cousine, zu der sie erst wieder Kontakt aufgenommen hatte, seitdem sie in München lebte – Kathrin war in Bayern geboren, aufgewachsen und verheiratet und einfach räumlich zu weit vom Norden entfernt –, mochte Marcus sehr gern. »Aber ich kann natürlich wieder absagen, wenn du lieber deinen Vater besuchst.«
Er reagierte, wie sie erhofft hatte. Spontan schüttelte er den Kopf. »Wir können doch die Kinder nicht enttäuschen«, rief er und blickte sehr zufrieden drein. »Da kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir wohl bei Kathrin feiern.«
Das alles lag mittlerweile rund fünf Wochen zurück. Weihnachten war vorbei, und Marcus, der an diesem Freitag vor Silvester in seiner Firma am Schreibtisch saß, dachte mit einem Lächeln an das Fest bei Kathrin und ihrer großen Familie in deren idyllisch gelegenem Hof östlich des Ammersees. Es war herrlich turbulent gewesen, voller Wärme und Kinderlachen. Kathrin war eine wunderbare Köchin, und Silky und er hatten den Tag restlos genossen. Zu seiner heimlichen Freude hatte sich sein Vater eine saisonale Grippe eingefangen und musste die Feiertage im Bett verbringen. Zwar hatten sie ihn am zweiten Weihnachtstag in dem großen, überheizten Penthouse besucht, aber der Alte hatte sich so schlecht gefühlt, dass seine Haushälterin Marcus bat, den Besuch kurz zu halten. Nach einer halben Stunde hatten sie sich guten Gewissens wieder verabschieden können. Als er mit Silke das Haus seines Vaters verlassen hatte, war ihm der trübe Wintertag danach hell und freundlich erschienen. Vor lauter Begeisterung, dass er dieses Jahr so glimpflich davongekommen war, hatte er Silke in ein sündhaft teures Restaurant eingeladen.
Morgen stieg bei Freunden eine rauschende Party, wo sie das nervenzerfetzende Börsenjahr endlich zu Grabe tragen würden. Das versprach Vergnügen pur zu werden. Zusätzlich war am gestrigen Morgen die Nachricht gekommen, dass die erste Lieferung seltener Erden aus der letzten Bestellung aus Südafrika den Hamburger Hafen erreicht hatte. Somit konnte er den Vertrag mit seinem Hauptkunden pünktlich erfüllen.
Wie bei allen vorherigen Lieferungen hatte er sofort veranlasst, dass einige Muster gezogen wurden, um sicherzugehen, dass er gleichbleibende Qualität liefern konnte. Das Labor war überlastet, Silvester stand vor der Tür, und so würde das Ergebnis erst im Laufe der nächsten Woche feststehen. Aber da die ganze Sache nichts weiter als Routine war – bisher hatte die Qualität des Erzes immer der entsprochen, die den Kaufverträgen zugrunde lag –, sah er keinen Anlass zu besonderer Eile. Heute war ohnehin nichts mehr auf den Rohstoffmärkten los, die meisten Firmen machten entweder Inventur oder hatten wegen der Feiertage geschlossen. Er entschied, nach Hause zu fahren. Silky wollte noch Einzelheiten für ihre Verlobungsparty besprechen, die für sie, wie er schnell begriffen hatte, von größter Wichtigkeit war. Eine Art Nestbautrieb, vermutete er. Sie wohnten schon fast ein Jahr zusammen, waren jedoch nie dazu gekommen, alle seine Freunde einzuladen. Aber nun stand das Datum fest, und alle Eingeladenen hatten zugesagt, auch zwei Paare von Silkys Freunden aus ihrer Heimat Hamburg würden anreisen.
Gerade als er sich gut gelaunt seine Lederjacke anzog und seine Sekretärin nach Hause schicken wollte, klingelte das Telefon. Überraschenderweise meldete sich der Geologe vom Labor. Mit trockener Stimme trug er Marcus die Ergebnisse der Analyse vor und wünschte ihm anschließend ein frohes neues Jahr, bevor er auflegte.
Marcus erwiderte tonlos seine Wünsche und blieb, das Telefon noch in der Hand, wie erstarrt stehen. Ein Zittern schüttelte ihn. Das Telefon glitt ihm aus der Hand und schlug klappernd auf dem Tisch auf. Er nahm es nicht wahr. Lange Zeit stand er bewegungslos da und fixierte einen Punkt im Nichts.
Irgendwann riss er sich zusammen. Mit einer abrupten Bewegung zerrte er sich die Lederjacke von den Schultern, schleuderte sie auf den Boden und trat anschließend so voller Wut den Papierkorb quer durchs Büro, dass er gegen die Wand krachte. Erschrocken riss seine Sekretärin die Tür auf.
»Alles okay, Frau Miltenberg«, presste er hervor und winkte sie hinaus.
Die zwei schwarzen Haare auf Frau Miltenbergs Warze, die ihre Oberlippe zierte, bebten neugierig wie die Schnurrhaare eines Nagetieres, und Marcus musste sich beherrschen, sie nicht anzubrüllen. Er konnte diese Frau nicht ausstehen. »Sie können Schluss machen. Heute passiert hier nichts mehr. Na, gehen Sie schon.«
Die Sekretärin zog sich mit misstrauischem Ausdruck zurück. Allerdings war er sich sicher, dass sie hinter der Tür stand und lauschte. Und vermutlich würde sie seinem Vater hinterher alles brühwarm erzählen. Bei diesem Gedanken wurden ihm die Hände feucht. Energisch rieb er sie an den Hosen trocken. Auf irgendeine Weise musste er diese widerliche, schnüffelnde Spitzmaus loswerden. Einmal hätte er sie in einem grässlichen Anfall totalen Irrsinns fast die Treppe heruntergestoßen. Der Lift war defekt gewesen, sie stand vor ihm auf dem Treppenabsatz, sagte irgendetwas in ihrer nervigen, schrillen Stimme, und plötzlich war die Frustration der letzten Jahre wie ein glühender Lavastrom in ihm hochgeschossen. Wie ferngesteuert hatte er die Hände zum Stoß gehoben. Nur das Auftauchen des Mechanikers hatte ihn gerettet. Und Frau Miltenberg natürlich.
Er stellte sich ans Fenster und lehnte die Stirn ans kalte Glas. Sein Vater besaß achtzig Prozent der Firma, ihm gehörten die restlichen zwanzig und der Titel Geschäftsführer. Praktisch jedoch hatte er keinerlei Entscheidungsgewalt, war nichts weiter als ein kleiner Angestellter. Sein Vater befahl, er musste gehorchen. Sollte sein Hauptkunde ausfallen, geriet die Firma ins Trudeln, und dafür würde sein Vater ihm die Schuld geben. Ganz gleich, was der tatsächliche Grund war. Seit sein Vater sich vor vielen Jahren von seinem Amt als Richter zurückgezogen hatte, richtete er seine geballte Aufmerksamkeit nur auf ihn, sodass sich Marcus oft vorkam wie ein im Scheinwerferkegel gebanntes Wild. Und solange das so war, würde die Spitzmaus ihn überwachen. Reglos starrte er hinaus in das trübe Winterwetter. Den ganzen Tag war es nicht richtig hell geworden. Es war gerade früher Nachmittag, trotzdem war es praktisch schon dunkel. Er hasste diese Jahreszeit, vermisste Licht und Wärme und den klaren, weiten Himmel, vermisste Luft zum Durchatmen. Zwar würde es ab jetzt aufwärtsgehen, die Tage würden wieder länger werden, quälend langsam zwar, aber er bildete sich krampfhaft ein, dass sich das Licht schon verändert hatte, die Sonne, wenn sie denn mal schien, heller war und man ihre Strahlen spürte.
Doch heute war davon überhaupt nichts zu bemerken. Seit Tagen lastete eine graue Wolkendecke auf der Stadt, eisiger Ostwind heulte um die Häuserecken und zerrte an den Schirmen der Passanten. Abwesend beobachtete er die graue Masse Mensch, die als geduckter Schatten durch den trüben Schein der Straßenlaternen huschte. Lange stand er so da, die Lippen zusammengepresst, die Hände noch immer zu Fäusten geballt. Seine Gedanken rasten im Kreis. Verbissen mühte er sich, Ordnung in das Chaos zu bringen. Er beleuchtete die Situation von allen Seiten, versuchte, dem tonnenschweren Schatten seines Vaters zu entkommen, die kalte Stimme nicht zu hören, die ihm Schmerzen verursachte, als wäre sie ein Messer. Auf seiner Seele hatte sich über die Jahre ein dichtes Narbengewebe gebildet.
Irgendwann durchlief ihn ein Ruck. Langsam öffneten sich seine Hände, er kehrte in die Gegenwart zurück. Nach einem letzten Blick in die Düsternis wandte er sich vom Fenster ab. Es gab keine Alternative. Er musste nach Südafrika fliegen, sich vor Ort selbst ein Bild machen, was da los war. Und er musste dringend seinen Bedarf an seltenen Erden durch andere Minen abdecken, vielleicht sogar neue Geschäftsbeziehungen aufbauen. Die Flüge würde er selbst buchen. Nur so konnte er verhindern, dass Frau Miltenberg seinen Vater umgehend von seinen Plänen informierte.
Die Nummer des Reisebüros hatte er in seinem Telefon gespeichert. Er rief sie auf und wählte. Und wartete. Lange.
Obwohl es ihm für gewöhnlich durch eiserne Selbstkontrolle gelang, nicht zu viel über seinen Vater nachzugrübeln, brach sein Sicherheitswall in diesem Augenblick zusammen, und das Gesicht, das ihn bis in seine Träume verfolgte, tauchte vor ihm auf. Die mitleidlosen, glitzernd schwarzen Augen, diese Maske steinerner Verachtung, mit der Henri Bonamour schon diejenigen einzuschüchtern pflegte, die einst im Gericht vor ihm auf der Anklagebank saßen. Und immer hatte er gnadenlos die vom Gesetz erlaubte Höchststrafe verhängt. Allein der Gedanke daran löste in Marcus ein nervöses Flattern aus. Unbewusst griff er sich an die Kehle, hasste sich dafür, dass er noch im Alter von neununddreißig Jahren auf diese Weise reagierte und diesem Gefühl von Ohnmacht nichts entgegensetzen konnte.
Er hob seinen Blick und sah sich seinem Spiegelbild im Fensterglas gegenüber. Ein breitschultriger Mann schaute ihn an. Eins sechsundachtzig groß, kantiges Gesicht, braune Augen – glücklicherweise die seiner Mutter, nicht die glitzernd schwarzen seines Vaters, die undurchsichtig und hart wie Stein waren –, kurzes, dunkelbraunes Haar. Muskulös, obwohl er nun, da ihm sein Vater die Leitung der Firma übertragen hatte, wenig Zeit hatte, Golf zu spielen oder im Fitnessstudio zu trainieren. Joggen im Winter war ihm ein Graus. Für ihn war das eine Strafe und kein Vergnügen, denn seine Neigung, sich freiwillig so zu quälen, war sehr gering ausgebildet. Trotzdem waren seine Schultern noch immer breit, Arme und Beine die eines Sportlers, der Blick ruhig und entschlossen. Sein Gesicht verriet wenige Emotionen, das wusste er, er hatte sich das antrainiert. Das brachte ihm gelegentlich den Vorwurf von Arroganz ein, doch das störte ihn nicht.
Der Eindruck war der eines Mannes, mit dem zu rechnen war. Warum also konnte er seinem Vater nicht die Stirn bieten? Warum genügte der bloße Gedanke an diesen alten Mann, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen? Er konnte das nicht verstehen.
Voller Unruhe musterte er sich noch einmal, und plötzlich, wohl durch eine Lichtspiegelung, meinte er hinter seinem Gesicht das seines Vaters zu erkennen.
Der gleiche kantige Schnitt, aber die Haut gelblich fahl und faltig, das Haar weiß, der Mund, schmaler als seiner, eingefasst durch tiefe Kerben. Und die Augen aus schwarzem Stein. Nicht wie seine. Der einzige Trost.
Er wusste tief in seinem Inneren, wo er sich selbst nicht mehr belügen konnte, dass er erst sein eigenes Leben leben konnte, wenn sein Vater tot war. Endlich gestorben. Eine explosive Mischung aus Frustration und brennender Wut schoss in ihm hoch, die sofort in bleierner Hilflosigkeit versank. Der Alte war bei guter Gesundheit, seine Aussicht, noch zehn, fünfzehn Jahre zu leben, war hoch. Zehn, fünfzehn Jahre, während deren er ihn weiter schikanieren würde.
Aber das würde er nicht noch einmal zulassen, schwor er sich. Diese Sache würde er allein durchziehen. Es musste endlich Schluss sein. Ein für alle Mal. Auch Silkys wegen. Er umklammerte das Telefon.
Die Pausenmusik verstummte endlich, eine weibliche Stimme tönte aus dem Hörer und verscheuchte vorübergehend seine Dämonen.
»Ich brauche zwei Plätze auf dem ersten Flug nach Südafrika, der von München abgeht. Ob Johannesburg oder Kapstadt als Ankunftsort ist mir egal, Hauptsache ist, ich komme so schnell wie möglich dorthin. Von da aus muss ich den nächsten Anschlussflug nach Durban erreichen.«
Während er auf die Antwort wartete, entlud sich seine Anspannung in einem Schweißausbruch. Kalte Nässe breitete sich unter den Armen aus, unter dem Pullover klebte ihm sein Hemd unangenehm auf der Haut. Kurzerhand schaltete er das Telefon auf Lautsprecher und zog Pullover und Hemd aus. Unter Druck schwitzte er immer, deswegen hielt er stets einen Vorrat an frischen Hemden im Büro bereit. Er holte eins aus dem Schrank neben der Tür, riss mit den Zähnen die Plastikverpackung auf und schüttelte das Hemd heraus. Gerade als er es in die Jeans steckte, meldete sich die Angestellte des Reisebüros wieder und teilte ihm mit, dass es für die nächsten zwei Wochen von München aus keine freien Plätze mehr gebe. Nicht einmal in der ersten Klasse. Südafrika sei ein sehr beliebtes Ziel und meist schon Wochen und Monate im Voraus ausgebucht. Besonders zwischen den Jahren gebe es keine Chance, einen Platz zu bekommen.
»Total überbraten«, sagte die Frau. »Überbucht«, setzte sie als Erklärung hinzu. »Ellenlange Wartelisten. Auch für Business und First.«
»Egal wie, ich muss nach Durban«, knurrte Marcus.
Nach hektischem Hin und Her gelang es ihm, für Mittwoch zwei Plätze in der Businessclass von Frankfurt aus zu ergattern. Der Preis allerdings ließ ihn trocken schlucken. Doch er hatte keine Wahl.
»Okay«, erwiderte er. »Noch mal zur Bestätigung. Die Plätze sind für Mittwoch, den 4. Januar, Businessclass. Ich will am Fenster sitzen, nicht in der Mittelreihe. Stellen Sie die Rechnung an mich aus und schreiben Sie vertraulich auf den Umschlag.« Er hoffte, dass er auf diese Weise die Miltenberg davon abhalten konnte, den Brief zu öffnen.
Nachdem er den Pullover wieder übergestreift hatte, suchte er aus einer Liste die billigste Vorwahl für Südafrika heraus und wählte die Nummer der Mine. Den Manager, Rob Adams, erreichte er zwar, aber der Anruf stellte sich als äußerst frustrierend heraus. Der Mann behauptete, keine Ahnung zu haben, wovon Marcus redete, und als der massiv wurde, faselte er etwas von schlechtem Empfang, weil er in ein Funkloch geraten sei. Sekunden später war die Verbindung unterbrochen. Marcus stand mit dem rauschenden Hörer in der Hand da. Durch die verdächtige Reaktion überzeugt, dass der Mann alles nur vorgetäuscht hatte, um irgendetwas zu verbergen, brüllte er ein paarmal ins Mikrofon. Anschließend wählte er noch einmal, bekam aber nur das Besetztzeichen. Wütend knallte er das Telefon zurück auf die Ladestation und ließ seine Faust auf den Schreibtisch krachen. Wenigstens brachte ihn der Schmerz wieder einigermaßen zur Besinnung, und er überlegte, ob er Silky anrufen sollte, um ihr mitzuteilen, dass sie die Verlobungsfeier wegen einer dringenden geschäftlichen Verpflichtung absagen müssten, oder ob es ratsam wäre, ihr das persönlich zu sagen.
Er schwankte nur kurz mit seiner Entscheidung. Sie war seine große Liebe, und wollte er offenen Beziehungskrieg vermeiden, musste er ihr das persönlich sagen. Silky wirkte mit ihren strahlend blauen Augen und den weichen blonden Locken restlos bezaubernd. Und harmlos. Was auch meistens zutraf, nur wenn sie in Wut geriet, glich sie einem explodierenden Vulkan, bei dem alle in Deckung gingen. Er als Allererster.
Seine Gedanken sprangen zurück zu dem Augenblick ihres Kennenlernens im Frühsommer vor über zwei Jahren. Plötzlich roch er Jasmin, süß und betörend, meinte das Rauschen von uralten Kastanienbäumen zu vernehmen, das Zwitschern der Schwalben auf den Dachfirsten und fühlte die knisternde Spannung, die ihm den Atem genommen hatte, als er ihr zum ersten Mal in die Augen geblickt hatte.
Sein Herz reagierte mit einem Doppelschlag. Er lächelte. Für immer würde er mit diesem Duft, diesen Geräuschen, die Erinnerung an den wunderbarsten Tag seines Lebens verbinden. Für ihn hatte Silky ihre Karriere und ihre Freunde hinter sich gelassen, deswegen musste er jetzt sofort nach Hause fahren, um ihr zu sagen, dass sie die Verlobungsfeier verschieben mussten.
Im Jugendstilspiegel, der zwischen den beiden hohen Fenstern hing, sah er sich selbst ins Gesicht. Wie sollte er ihr das nur beibringen? Hi, Silky, Liebling, du, was ich dir sagen wollte, tut mir leid, aber aus der Verlobungsparty wird nichts …
Das klang so jämmerlich, dass ihm ganz schlecht wurde. Er würde sich etwas anderes einfallen lassen müssen. Niedergeschlagen wandte er seinem Spiegelbild den Rücken zu, hob seine Jacke vom Boden auf, zog sie an, wickelte den dicken Schal um den Hals und schloss das Büro hinter sich ab. Draußen empfingen ihn dichtes Schneegestöber und eisige Kälte. Tief gegen den Wind gebeugt, lief er zur Parkgarage.
2
Silke hatte sich in der Küche einen Kaffee gemacht, als sie Marcus’ Wagen in die Einfahrt biegen sah.
Vergnügt lief sie zur Tür, um ihm zu öffnen. Der Wagen glitt eben in den Carport, und kurz darauf rannte Marcus, Laptop und Aktentasche unter dem Arm, den Weg zum Eingang hoch. Ein Wirbel von Schneeflocken trieb ihn ins Haus, und Silke warf die Tür schnell hinter ihm ins Schloss.
»Gib mir deine Jacke, die ist ja klatschnass. Ich hänge sie auf.«
Er schälte sich aus der Lederjacke, steckte den Schal in den Ärmel und reichte sie ihr wortlos. Silke hängte sie an die Außenseite des Garderobenschranks.
»Toll, dass du früher kommst.« Sie strahlte ihn an. »So können wir noch in Ruhe einen Kaffee trinken, bevor wir essen gehen. Was möchtest du haben? Kaffee, Espresso oder Cappuccino?«, fragte sie und wollte gerade zurück in die Küche gehen, als ihr klar wurde, dass er weder ein Wort gesagt noch ihr einen Kuss gegeben hatte. Was ungewöhnlich war. Sie drehte sich wieder zu ihm um.
Marcus stand mit hängenden Armen vor ihr. Seine Gesichtsfarbe war fahl, Wasser tropfte ihm aus den Haaren in den Hemdkragen, und sein Mund öffnete und schloss sich wie bei einem Fisch auf dem Trockenen, aber er brachte keinen Ton hervor.
»Sind dir Muskeln und Stimme eingefroren?« Mit liebevollem Spott strich sie ihm über die Wange. »Wäre ja kein Wunder bei dieser Kälte.«
Seine Haut fühlte sich kalt und klamm an, und sie hoffte, dass er sich nicht bei seinem Vater mit der Grippe angesteckt hatte. Sie hatte sich auf diese Party schon lange gefreut, und das Kleid, was sie dafür gekauft hatte, war ziemlich teuer gewesen. Mit einem Anflug von Besorgnis befühlte sie seine Stirn. Sie war ebenfalls kalt. Fieber hatte er also wohl nicht.
»Marcus? Ist etwas? Fühlst du dich nicht wohl?«, fügte sie hinzu, als er nicht antwortete.
Mit einer ruckartigen Bewegung wischte er sich mit dem Handrücken über die Stirn und schüttelte gleichzeitig vehement den Kopf. »Nein, ach was, es ist alles … in Ordnung. Bin einfach nur durchgefroren.« Er betrachtete sich im Garderobenspiegel, vermied es aber dabei, sie anzusehen. »Sauwetter heute«, murmelte er und beschäftigte sich mit dem korrekten Sitz seines aufgeweichten Hemdkragens.
Silke versuchte, seinen Blick im Spiegel einzufangen, aber seine Augen glitten zur Seite. Mit beiden Händen strich er sich die Nässe aus dem kurzen Haar, drückte ihr anschließend mit kalten Lippen einen Kuss auf den Mund, klemmte sich Aktentasche und Laptop unter den Arm und lief an ihr vorbei die Treppehoch ins Obergeschoss, wo ihr Schlafzimmer und sein Büro lagen. Oben drehte er sich um.
»Ich stelle nur mein Notebook weg, mach mir doch bitte einen Cappuccino, dann können wir noch ein bisschen klönen, bevor wir uns fertig machen.«
Silke sah ihm nach. Offenbar hatte er einen schlimmen Tag gehabt. Die beste Medizin dagegen war sicher eine Party mit guten Freunden, lauter Musik und jeder Menge Hochprozentigem.
»Liebling, was hältst du von Spaghetti oder Pizza im Vapiano?«, rief sie die Treppe hinauf.
»Ja, ja, wunderbar. Genau das, was ich heute brauche«, kam die Antwort.
Und so verbrachten sie den Abend im Vapiano, wo es voll und laut war, und leerten eine Flasche Wein. Aber als sie dann ziemlich spät ins Bett gingen, hatte Marcus ihr noch immer nicht gesagt, was eigentlich mit ihm los war. Stattdessen hatte er sie wortlos in den Arm genommen und geküsst, seine Lippen über ihren Körper wandern lassen, sie da gestreichelt, wo es ihr ein wohliges Stöhnen entlockte. Doch plötzlich hatte er sich von ihr gelöst und auf den Rücken geworfen.
»Geht heut nicht«, knurrte er. »Tut mir leid.« Damit vergrub er den Kopf im Kissen.
»Kann ja mal passieren«, flüsterte sie und zog ihn an sich.
Am nächsten Morgen standen sie spät auf, und nach einem ausgedehnten Brunch, wobei jeder von ihnen Teile der Süddeutschen las – Marcus den Wirtschaftsteil und Silke das Feuilleton –, schlug sie vor, den Weihnachtsbaum abzuschmücken. So war sie das von ihrem Elternhaus gewohnt.
Marcus, der bisher ziemlich schweigsam gewesen war, legte die Zeitung weg und runzelte die Stirn. »Das ist jetzt wirklich blöd«, erwiderte er. »Ich glaube, ich habe die externe Festplatte mit der täglichen Sicherung im Büro vergessen. Vermutlich liegt sie irgendwo herum, was ja nicht die Idee von einer Sicherung ist. Stell dir nur vor, eine Silvesterrakete fliegt durchs Fenster und es brennt oder so, dann ist alles weg. Grauenvoller Gedanke!« Er stand auf. »Das heißt, ich muss schnell noch mal hinfahren, um sie zu holen. Tut mir leid, aber die Festplatte gehört hier in den Safe, wie jeden Tag.«
Silke kniff enttäuscht die Lippen zusammen, nickte jedoch ergeben. »Lässt sich ja wohl nicht ändern. Aber sei ja rechtzeitig zurück, dass wir uns in Ruhe für die Party fertig machen können.«
»Natürlich«, rief er vom Flur her, zog seinen Daunenmantel an, schnappte sich den Autoschlüssel und stürmte hinaus ins unwirtliche Winterwetter.
Gerade rechtzeitig, um sich umzuziehen, kehrte er nach drei Stunden zurück, erklärte die lange Abwesenheit damit, dass er wegen eines Unfalls im Stau gesteckt habe. Silke war so froh, dass er rechtzeitig aufkreuzte, dass sie nur nickte und auch vergaß, ihn zu fragen, ob er die Festplatte gefunden hatte.
Eilig zogen sie sich um und machten sich auf den Weg zu ihren Freunden. Die Temperatur war noch weiter gesunken, und es schneite schon wieder.
Die Wohnung der Haslingers war hell erleuchtet, Musik und Lärm schallten ihnen schon auf der Straße entgegen. Vom Balkon hörten sie das Gelächter der Gäste, die Nicole zum Rauchen in die Kälte geschickt hatte. Die Party war offensichtlich bereits in vollem Schwung.
Nicole erwartete sie an der offenen Wohnungstür. »Kommt bloß rein in die Wärme«, begrüßte sie sie mit Küsschen rechts und Küsschen links.
»Meine Güte, da wird man ja taub«, entgegnete Silke. »Haben eure Nachbarn schon die Polizei gerufen, oder sind die vorübergehend ausgewandert?«
»Nee.« Nicole grinste fröhlich. »Die sind vollzählig hier bei uns.«
»Ich brauche einen Wodka«, sagte Marcus und strebte umgehend zur überfüllten Bar, auf die Olaf so stolz war.
Silke entledigte sich ihrer Stiefel und stieg in die mitgebrachten High Heels. Von der Diele aus sah sie, dass am langen Tisch im Wohnzimmer mindestens ein Dutzend Gäste versammelt waren und lautstark miteinander plauderten.
»Sind wir die Letzten?«
Nicole sah sich um. »Mitnichten, da fehlen noch einige und die, die ohne Einladung kommen. Such dir einen Platz.«
Silke wurde mit viel Hallo begrüßt, und irgendjemand schob ihr einen Stuhl hin.
»Und, was gibt’s Neues?«, fragte Nicole und goss ihr ein Glas Wein ein. »Hast du schon ein Kleid für deine Verlobungsparty? Komm, erzähl, ich platze sonst.« Sie lehnte sich mit neugierig glitzernden Augen vor.
»Na, was glaubst du denn.« Silke lachte und zeigte ein Foto von dem Kleid auf ihrem Handy herum. Aber immer wieder sah sie abgelenkt hinüber zur Bar. Marcus stand mit Olaf und ein paar anderen am Tresen und hielt schon das zweite Glas Wodka in der Hand. Vergeblich versuchte sie, seinen Blick einzufangen. Irgendetwas war mit ihm nicht in Ordnung. Mit halbem Ohr lauschte sie dem neuesten Klatsch, den Nicole stets parat hatte und mit saftigem Spott erzählte, bekam aber nur ein paar Brocken mit. Der aggressive Hardrock, der durchs Haus hämmerte, machte eine normale Unterhaltung fast unmöglich. Sie nippte an ihrem Weinglas und beobachtete Marcus mit steigender Sorge.
Der tobte sich – das braune Haar wirr, die Hände zu Fäusten geballt – allein zwischen seinen Freunden auf der Tanzfläche aus. Das Hemd hing ihm offen über die Hose, die nackte Brust war schweißüberströmt, seine Augen waren merkwürdig starr und gerötet. Wie in Trance tanzte er. Sie stellte ihr Glas hart auf dem Tisch ab. Tanzen konnte man das nicht mehr nennen. Es war nicht ausgelassen oder fröhlich, sondern wirkte eher wie die Choreografie eines Kampfsports.
Frustriert biss sie sich auf die Lippen. Offenbar war es mal wieder so weit. Insgeheim nannte sie es seine Anfälle. Vier, fünf Mal waren sie, seit sie sich kannten, durchgebrochen und hatten ihn derart verwandelt, dass sie ihn kaum als den Mann wiedererkannte, in den sie sich verliebt hatte. Ein paar Wochen nachdem sie sich kennengelernt hatten, hatte er sie nach München eingeladen, und da war es zum ersten Mal passiert. Auch auf einer Party bei den Haslingers.
Kurz nach ihrer Ankunft hatte er einen Anruf bekommen und war auf den Balkon ausgewichen, weil Olaf die Musik aufgedreht hatte. Der Anruf dauerte länger, und als er wieder ins Zimmer kam, wollte er nicht sagen, mit wem er gesprochen hatte, sondern packte sie plötzlich und zerrte sie auf die Tanzfläche. Zu ihrer eigenen Bestürzung wich sie im ersten Augenblick instinktiv vor ihm zurück, aber er nahm keine Rücksicht, sondern wirbelte sie herum, dass ihr schlecht wurde.
»Was ist los mit dir?«, schrie sie ihn bestürzt an und versuchte, sich aus seinem harten Griff zu befreien, aber ohne Erfolg.
Hinterher stellte sie ihn zur Rede.
Seine Antwort kam nach einer atemlosen Pause. »Hart arbeiten, wild feiern, es krachen lassen, das ist es, worum es geht. Sonst zählt doch nichts.«
Aber in seinen Augen glühten dabei ein so verzweifeltes Verlangen und ein Schmerz, derart abgrundtief, dass Silke zutiefst erschrak. In diesem Augenblick war sie sich sicher, geradewegs in die Hölle zu blicken.
»Kann ich dir helfen? Bitte sag’s mir«, bettelte sie ihn an.
Doch er wehrte jede ihrer Fragen mit steinerner Miene mit Banalitäten ab. Am nächsten Tag aber war er wieder da, der Mann mit dem warmen Lächeln, den Augen, aus denen seine Liebe zu ihr sprach. Der Mann, den sie mehr liebte als sonst einen Menschen auf der Welt. Er nahm sie in die Arme und hielt sie fest, als wollte er sie nie wieder gehen lassen.
Ihre Angst verflüchtigte sich unter seinen Zärtlichkeiten. Sie schob das Ganze auf zu viel Alkohol und verdrängte den Vorfall. Doch dann passierte es nach ein paar Monaten noch einmal. Und dann wieder, und dieses Mal war der Abstand kürzer geworden. Und als Weihnachten näher rückte, brach es erneut aus ihm heraus.
Bis heute war sie noch nicht auf den Grund seiner Hölle gelangt. Zeitweise schien es ihm besser zu gehen. Er war ausgeglichener, doch die sprühende Energie, die ihn sonst umgab, schien abgestumpft. Den Grund fand sie eines Tages im Papierkorb des Badezimmers: eine leere Packung eines Medikaments, dessen Namen sie nicht kannte. Die Packungsbeilage war nicht dabei, und so holte sie sich aus dem Internet die nötigen Informationen. Dabei erfuhr sie, dass das Mittel gegen Depressionen und vor allen Dingen bei Angststörungen eingesetzt wurde.
Bei diesem Wort war spontan das Gesicht des Vaters von Marcus vor ihrem inneren Auge aufgetaucht, sie hatte die frostige Kälte gespürt, die ihn umgab, und sie erinnerte sich an das, was ihr Marcus nach einer Flasche Wein eines Abends gebeichtet hatte.
Dass ihm allein ein Blick aus den stechenden Augen genügte, um ihm Schweißausbrüche zu verursachen, und dass er sich dafür hasste, noch in seinem Alter auf diese Weise auf seinen Vater zu reagieren. Einen zentnerschweren Mühlstein hatte er ihn genannt, der ihm die Luft zum Leben abdrückte.
Und da glühte für eine Sekunde das Höllenfeuer in seinen Augen. Als sie beunruhigt Genaueres wissen wollte, lachte er in einem plötzlichen Gemütsumschwung, küsste sie und meinte, dass er nur gerade mal sauer auf seinen Vater gewesen sei. Danach vermied er es, in dieser Weise über seinen Vater zu sprechen. Eigentlich sprach er so gut wie nie über ihn und auch nicht über den Rest seiner Familie. Sie wusste nur, dass seine Mutter in Australien lebte. Es gab keine Fotos von seiner Familie, keine Erinnerungsstücke. Keine Anekdoten. Nichts.
Irgendwann hatte sie für sich eine Erklärung gefunden, die zu passen schien. Die schmerzhafte Trennung seiner Eltern. Marcus hatte ihr erzählt, dass seine Mutter zu Beginn seines Studiums überraschend die Scheidung eingereicht habe. Danach habe eine verbissene Schlammschlacht stattgefunden. Voller Hass hatten seine Eltern um jede Kleinigkeit gestritten. Zwei Tage nach der Scheidung war seine Mutter mit einem anderen nach Australien ausgewandert und hatte jeden Kontakt abgebrochen. Auch zu ihm.
Als er ihr das erzählte, sah er so verloren aus, dass es ihr das Herz zerriss. Seitdem hatte sie immer wieder versucht, ihn dazu zu bewegen, entweder eine eigene Firma zu gründen oder sich eine Stellung bei einer anderen Firma in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Land zu suchen, um dem Druck seines Vaters zu entkommen. Es würde nicht schwierig für ihn sein, als Geowissenschaftler war er begehrt. Aber sie stieß auf Granit mit ihren Vorschlägen. Alles blieb beim Alten. Und die Hölle flackerte in seinen Augen.
Tief in Gedanken leerte sie ihr Glas. Marcus kämpfte weiterhin seinen einsamen Kampf auf der Tanzfläche. Ein Blick auf die Uhr und das ohrenbetäubende Krachen vorzeitig abgefeuerter Silvesterknaller zeigten ihr, dass die Jahreswende kurz bevorstand. Irgendwie musste sie Marcus dazu bewegen, die Party so schnell wie möglich zu verlassen. Im allgemeinen Getümmel würde es vermutlich nicht auffallen.
Sie ging hinüber zum Buffet, das ziemlich leer geplündert aussah, als wäre eine Horde Affen über das Essen hergefallen. Flüchtig dachte sie darüber nach, wie merkwürdig es war, dass Menschen, die regelmäßig und meist zu viel aßen, auf Partys offenbar vollkommen ausgehungert zu sein schienen. Sie nahm einen Teller und suchte aus den Resten etwas Appetitliches für Marcus zusammen, holte aus der bereitstehenden Kaffeemaschine zwei Espressi und stellte das Tablett auf dem Tisch ab.
»Marcus muss endlich was in den Magen bekommen, sonst haut ihn der Alkohol um. Ich bin sicher, er hat mittags allenfalls ein belegtes Brötchen gegessen«, erklärte sie Nicole, die mittlerweile ein paar Dutzend Champagnergläser zum Anstoßen füllte. Sie bahnte sich ihren Weg durch die Tanzenden zu Marcus. Er sah sie aus glasigen Augen an, schlang aber überraschend die Arme fest um sie, legte die Wange an ihre und wiegte sie mit geschlossenen Augen.
»Lass uns etwas essen!« Sie musste schreien, um die Musik zu übertönen, und wollte ihn zum Tisch bringen, doch Marcus zog sie auf den Balkon.
»Ich brauche frische Luft«, murmelte er. »Nur für einen Augenblick.« Mit dem Fuß schob er die Glastür zu, ehe Silke, die ein schulterfreies Kleid trug, Gelegenheit hatte, ihren Daunenmantel zu holen.
Ohrenbetäubendes Krachen, feurige Farbkaskaden und Funken sprühende Raketen begrüßten sie, und ein eisiger Windstoß wirbelte ihr die Haare hoch. Ein Kälteschauer lief ihr über die Haut. Fröstelnd drängte sie sich näher an Marcus. Dabei spürte sie, dass jeder Muskel seines Körpers zuckte, als stünde er unter Hochspannung.
»Was ist?«, fragte sie leise und streichelte seine Hand. Sie war schweißnass und eiskalt, und sie musste an die Schachtel mit dem Mittel gegen Angststörungen denken. »Friss es nicht in dich hinein«, bat sie. »Sag’s mir. Vielleicht kann ich dir helfen, außerdem ist zu zweit alles leichter. Das Jahr ist fast zu Ende. Jetzt ist eine gute Gelegenheit dazu.«
Ohne Vorwarnung ließ er seine Faust gegen den Rahmen der Balkontür krachen, dass sie zusammenzuckte.
»Verdammte Scheiße!«, brüllte er und hieb abermals auf den Holzrahmen ein, dass die Scheiben schepperten.
Den Ausdruck hatte sie bisher noch nicht oft von ihm gehört. Was setzte ihm nur so zu, dass er derart seine Beherrschung verlor? Sein Hemd war schweißdurchtränkt.
Schweigend reichte sie ihm ein Papiertaschentuch. Wortlos nahm er es und rieb sich Gesicht und Hals trocken. Nach einem langen Blick hinaus über die Stadt, wo alle feierten, wandte er sich ab und sah sie an. Eine grüne Rakete explodierte in der Nähe, und das zuckende Licht gab ihm ein geisterhaftes Aussehen.
»Wir müssen unsere Verlobung absagen«, platzte es aus ihm heraus.
Sie hielt sich am Balkongeländer fest. »Wie bitte?«, flüsterte sie.
»Ich meine nicht … natürlich nicht … nur die Feier …« Hilflos verhedderte er sich in seinen Worten, verstummte, versuchte, ihr ungeschickt einen Arm um die Schulter zu legen, und kratzte ihr dabei über den nackten Oberarm.
Vor Schreck konnte sie ihn nur entsetzt anstarren, verstand sekundenlang nicht, was er gesagt hatte. Dann traf es sie wie ein Schlag. Abrupt schob sie ihn von sich und verschränkte die Arme vor der Brust. Wenn sie sich über etwas aufregte, verschaffte sie sich meistens in flammenden Gefühlsausbrüchen Luft, aber diese Ausbrüche waren wie ein stürmisches Sommergewitter – genauso harmlos und genauso schnell vorüber. Und die Versöhnung umso süßer.
Jetzt aber lag ihr ein harter Eisklumpen im Magen, ein Gefühl von Bedrohung stieg in ihr auf. Die Kälte war plötzlich aggressiv geworden, eine Kälte, die in die Knochen kroch und ihre Seele frieren ließ. Was versuchte er ihr zu sagen? Wollte er mit ihr Schluss machen? In ihrem Kopf überschlugen sich die Fragen, doch sie bekam kein Wort heraus.
»Bitte«, sagte er und wich ihrem Blick aus. Nervös rieb er seine Hände aneinander, stammelte etwas von einem dringenden Flug nach Südafrika und sah dabei zunehmend elender aus.