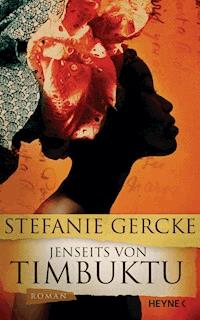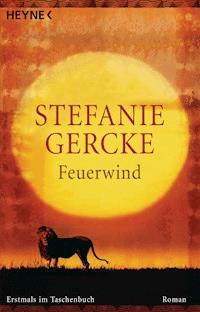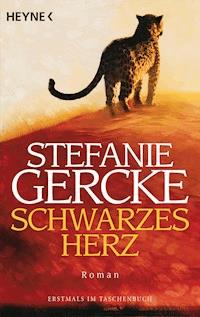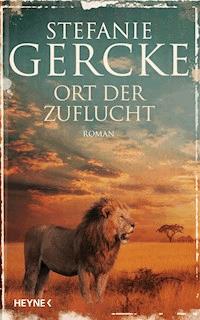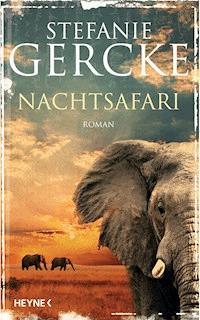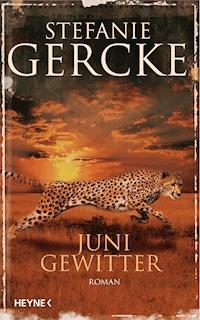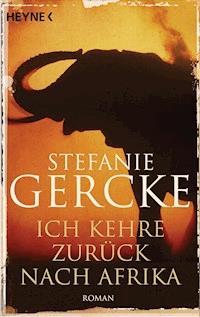
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die junge Henrietta Ende der Fünfzigerjahre auf Geheiß ihrer Eltern nach Südafrika zieht, ist dies eigentlich als Strafe gedacht. Aber Henrietta ist froh, dass sie der Enge und den Konventionen ihrer Heimatstadt entfliehen kann, und baut sich in dem fremden Land ein neues Leben auf. Als sie den Schotten Ian kennenlernt, scheint ihr Glück vollkommen zu sein. Doch bald geraten die beiden mit dem System der Rassentrennung in Konflikt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
DAS BUCH
Als die junge Henrietta Ende der Fünfzigerjahre von ihren Eltern zu ihren Verwandten nach Südafrika geschickt wird, ist das eigentlich als Strafe gedacht, da sie ihrer Familie »Schande« gemacht hat. Henrietta jedoch ist selig über diese Verbannung, ermöglicht sie ihr doch endlich die Flucht aus der Enge ihrer Heimatstadt und vor allen bedrückenden Konventionen.
Die unbekümmerte und unbefangene junge Frau eckt zunächst überall an, versteht die Grenzen der Apartheid nicht und will sich nicht neuen Regeln beugen, nachdem sie die alten gerade erst hinter sich gelassen hat. Sie weiß nur eines: Sie liebt Afrika, dieses rätselhafte Land, von dem sie insgeheim immer geträumt hat. Schritt für Schritt erkämpft sie sich ihren Weg auf diesem Kontinent, dessen Bilder sich ihrer Seele einprägen. Als sie den Schotten Ian kennenlernt, scheint Henriettas Glück vollkommen zu sein. Mit ihm wird sie sich, so meint sie, endgültig ein eigenes Leben in diesem Land aufbauen können. Doch die Zeit und die politischen Verhältnisse sind gegen das junge Paar. Bald schon geraten die beiden mit dem System der Rassentrennung in Konflikt, und es geschieht, was Henrietta nie für möglich gehalten hätte: Sie muss aus ihrem geliebten Afrika fliehen.
Ein packender Roman über eine Frau, die ihren Traum von Afrika zu verwirklichen sucht, und gleichzeitig eine große Saga in der Tradition von Tania Blixen und Stefanie Zweig.
»So offenbart Gerckes Roman mit aller Deutlichkeit die Absurdität der Rassentrennung. [Er hat] das Verdienst, die Abnormität einer Regierung darzustellen, die nur von wenigen Europäern kritisiert wurde.«
Goethe-Institut
DIE AUTORIN
Stefanie Gercke wurde auf einer Insel des Bissagos-Archipels vor Guinea-Bissau/Westafrika als erste Weiße geboren und wanderte mit 20 Jahren nach Südafrika aus. Heute lebt sie mit ihrer großen Familie bei Hamburg. Zuletzt erschien ihr Bestseller Nachtsafari.
Inhaltsverzeichnis
Dienstag, den 26. März 1968
DURCH DAS DRÖHNEN der Flugzeugmotoren meinte sie die Stimme ihres Vaters zu hören, traurig und voller Sehnsucht. »Du bist in Afrika geboren, auf einer kleinen Insel im weiten, blauen Meer.« Seine Worte waren so klar wie damals, vor fast dreiundzwanzig Jahren. Sie sah ihn am Fenster lehnen, das blind war von dem peitschenden Novemberregen, seine breiten Schultern nach vorn gefallen, und ihr war, als vernähme sie wieder die windverwehte Melodie von sanften kehligen Stimmen, als stiege ihr dieser Geruch von Rauch und feuchter, warmer Erde in die Nase.
»Afrika«, hatte er geflüstert, und sie wußte, daß er den dunklen Novemberabend nicht sah, daß er weit weg war von ihr, in diesem fernen, leuchtenden Land, dessen Erinnerung ihm, ihrem turmgroßen, starken Vater, die Tränen in die Augen trieb.
Die Stirn gegen das kalte Fenster des großen Jets gepreßt, sah sie hinunter auf das Land, das sie liebte, ihr Paradies. Ein Schluchzen stieg ihr in die Kehle. Sie schüttelte ihre dichten, honigfarbenen Haare schützend vor das Gesicht. Niemand durfte ihr etwas anmerken, niemand durfte wissen, daß sie dieses Land für immer verließ, niemand! Besonders nicht der Kerl da vorne, der in dem hellen Safarianzug mit dem schwarzen Bürstenschnurrbart, der so ruhig an der Trennwand zur ersten Klasse lehnte. Vorhin, als sie einstieg, stand er zwischen den Sitzen in einer der letzten Reihen. Sein Genick steif wie ein Stock, ließ er seine Augen ständig über seine Mitpassagiere wandern. Von Gesicht zu Gesicht, jede ungewöhnliche Regung registrierend, ohne Unterlaß. Daran hatte sie ihn erkannt, an dem ruhelosen, lauernden Ausdruck seiner Augen. Einer von BOSS, dem Bureau of State Security, ein Agent der Staatssicherheit, der gefürchtetsten Institution Südafrikas. BOSS, die eine Akte über sie führten.
Tief unter ihr glitt die Küste von Durban dahin. Die Bougainvilleen leuchteten allenthalben wie rosafarbene Juwelen auf den sattgrünen Polstern gepflegter Rasenflächen. Ihre Augen ertranken in stillen Tränen.
Reiß dich zusammen, heulen kannst du später!
So verharrte sie lautlos, saß völlig bewegungslos, zwang sich, das Schluchzen hinunterzuschlucken. Sie tat es für ihre Kinder, ihre Zwillinge, Julia und Jan, den Mittelpunkt ihrer kleinen Familie, die ganz still neben ihr in den Sitzen hockten.
Ihre Gesichter, von der afrikanischen Sonne tief gebräunt, waren angespannt und blaß, ihre Augen in verständnisloser Angst aufgerissen. Obwohl sie sich bemüht hatte, sich nichts anmerken zu lassen, mußten sie dennoch etwas gespürt haben. Sie waren gerade erst vier Jahre alt geworden. Viel zu jung, um so brutal aus ihrem behüteten Dasein gerissen zu werden, zu klein, um zu verstehen, daß von nun an nichts mehr so sein würde, wie es bisher war. Vor wenigen Wochen erst hatten sie mit einer übermütigen Kuchenschlacht ihren Geburtstag gefeiert, doch Henrietta hatte Mühe, sich daran zu erinnern, denn die folgenden Ereignisse töteten alles andere in ihr, ihre Gefühle, ihre Erinnerungen, ihre Sehnsüchte. Es war, als wüchse ein bösartiges Geschwür in ihr, das sie ausfüllte und langsam von innen auffraß.
Das metallische Signal des bordinternen Lautsprechers schnitt scharf durch das sie umgebende Stimmengesumm. Das Geräusch kratzte über ihre rohen Nerven, sie zuckte zusammen, fing die Bewegung aber sofort auf. Um keinen Preis auffallen! Nur nicht in letzter Sekunde die Fassung verlieren und den Mann gefährden, der dort unten, irgendwo in dem unwegsamen, feuchtheißen, schlangenverseuchten Buschurwald im Norden Zululands versuchte, über die Grenze nach Moçambique zu gelangen. Ihr Mann. Es war ihr plötzlich, als spüre sie seine Hand in der ihren. So stark war ihre Vorstellungskraft, daß sie seine Wärme fühlte. Sie strömte in ihren Arm und breitete sich wohlig in ihr aus, so als teilten sie denselben Blutkreislauf. Sie wußte, solange diese Hand die ihre hielt, konnte ihr nie etwas wirklich Furchtbares passieren. Ihr nicht und Julia und Jan nicht. Sie schloß die Augen und gab sich für einen Augenblick dieser kostbaren Wärme und Geborgenheit hin.
Doch ebenso plötzlich war es vorbei, es fröstelte sie. Eiskalte Angst ergriff ihre Seele. Denn sollte der Agent von BOSS mißtrauisch werden, merken, daß sie auf der Flucht war und nicht die Absicht hatte, nach Südafrika zurückzukehren, würden sie ihn fangen, bevor er die Grenze überquert hatte. Verschnürt wie Schlachtvieh, würden sie ihn in ein vergittertes Auto werfen und dann in einem ihrer berüchtigten Gefängnisse verschwinden lassen. Als Staatsfeind unter dem 180-Tage-Arrest-Gesetz, einhundertachtzig Tage ohne Anklage, ohne Verurteilung und ohne die Möglichkeit für den Gefangenen, einen Anwalt oder auch nur seine Familie zu benachrichtigen. Nach 180 Tagen würden sie ihn freilassen aus der dumpfen, dämmrigen Zelle, zwei, drei Schritte in den strahlenden afrikanischen Sonnenschein machen lassen, die Freiheit des endlosen Himmels kosten, um ihn auf der Stelle für weitere 180 Tage zu inhaftieren. »Bis die Hölle zufriert«, pflegte Dr. Piet Kruger, Generalstaatsanwalt von Südafrika, zynisch zu bemerken. Irgendwann würden sie ihn mit gefälschten Anschuldigungen vor Gericht stellen und dann für viele Jahre qualvoll hinter Gittern verrotten, zum Tier verkommen lassen. Ihr wurde speiübel von den Bildern, die sich ihr aufdrängten.
Als aber die Stewardeß sie nach ihrem Getränkewunsch fragte, konnte sie lächeln, und ihre Stimme war klar und ohne Schwankungen. In den letzten Wochen mußte sie das lernen. Zu lächeln, obwohl ihr das Herz brach. Sie hatte Dinge gelernt und Dinge getan, von denen sie nie ahnte, daß sie dazu fähig sei. Sie hatte gelogen, getäuscht und jede Menge Gesetze gebrochen, mit lachendem Gesicht und einem stummen Schrei in der Kehle, der sie fast erstickte.
Der weiße Jet flog hinaus über die blaue Unendlichkeit des Indischen Ozeans. Der wie helles Gold schimmernde Strand, der um Natal liegt wie ein breites Halsband, wurde zu einem feinen, leuchtenden Reif, die Küste versank im Dunst der Ferne. Kurz darauf legte sich das Flugzeug in eine scharfe Kurve landeinwärts, und sie erkannte Umhlanga Rocks an der aus dem dünnen Salzschleier steigenden Hügellandschaft und dem rot-weißen Leuchtturm, der vor dem traditionsreichen Oyster Box Hotel die Seefahrer vor den tückischen, felsbewehrten Küstengewässern warnte. Und weil sie wußte, wo sie suchen mußte, entdeckte sie das silbergraue Schieferdach ihres Hauses, oben am Hang, unter den Flamboyants. Sie sah es nur für den winzigen Bruchteil eines Augenblicks zwischen dem flirrenden Grün, dann versank es in dem Meer von Bäumen.
Vor etwas mehr als acht Jahren war sie hier gelandet, hungrig nach Leben nach den Einschränkungen der Nachkriegsjahre in Deutschland, gierig nach Freiheit, froh, endlich den erstickenden Vorschriften und Traditionen einer seelisch verkrüppelten Gesellschaft entronnen zu sein. So kam sie im Dezember 1959 nach Südafrika, noch nicht zwanzig Jahre alt, sprühend von Lebensenergie, erfüllt von unbändiger Willenskraft, hier ihr Leben aufzubauen.
Sarahs dunkles Gesicht tauchte vor ihr auf, daneben das von Tita, gerahmt von ihren flammenden Locken, und hinter ihnen gruppierten sich die Menschen, die sie liebte und die sie jetzt verlassen mußte. »Ich kehre zurück, Afrika«, schwor sie und dachte dabei an Papa. »Einmal noch nach Afrika — ich werde nicht nur davon träumen.« Eine übermächtige Wut packte sie auf alle, die ihr und ihrer Familie das antaten, Kampfgeist brach durch ihren Schmerz, doch sie grub ihre Fingernägel tief in die Handflächen. Noch mußte sie durchhalten, noch wenige Stunden. In knapp fünfundvierzig Minuten war die Landung auf dem Jan-Smuts-Airport in Johannesburg vorgesehen. Zwei Stunden später würde sie dann an Bord der British-Airways-Maschine dieses Land verlassen. Wenn sie mich nicht erwischen! Bis dahin muß ich weiter lächeln und lügen und mich verstellen.
Sie sah hinunter auf ihr Paradies, um sich jede Einzelheit einzuprägen. Das Flugzeug stieg steil und schnell, und Umhlanga verschwand hinter den fruchtbaren, grünen Hügeln von Natal. Zurück blieb der Abdruck dieses Bildes, das sich tief und unauslöschlich in ihr Gedächtnis grub.
Es begann vor langer Zeit, als Henrietta noch sehr klein war, als Entfernungen noch in Tagen und Wochen gemessen wurden, zu der Zeit, als sie die Welt bewußt wahrzunehmen begann.
Im sterbenden Licht eines dunklen, stürmischen Novembertages, auf dem dünnen Teppich über dem harten Parkettboden im Wohnzimmer ihrer Großmutter in Lübeck sitzend, wendete sie die steifen Seiten ihres Lieblingsbilderbuches über wilde Tiere in einem fremdartigen, grünen Blätterwald und badete ihre ungestüme Kinderseele in den leuchtenden, bunten Farben. Regen explodierte gegen die Fensterscheiben, und Wind heulte durch die kahlen Bäume, fegte fauchend um die Häuserecken. Ihr Vater lehnte seinen Kopf in den blauen Ohrensessel zurück. Seine Hände, die ein Buch hielten, sanken auf die Knie. »Afrika«, sagte er nach einer Weile leise, und nach einer langen, stillen Pause, »nur noch einmal Afrika.« Seine hellen, blauen Augen blickten durch den grauen Regenvorhang, als sähe er ein Land und eine Zeit jenseits der kalten, unwirtlichen Novemberwelt.
Das kleine Mädchen auf dem Boden hob den Kopf, Lampenlicht vergoldete ihre Locken, und lauschte dem Nachhall der Worte. »Afrika?« wiederholte sie fragend.
Ihr Vater sah hinunter auf seine Tochter und nickte. »Es ist nicht zu früh, du wirst es verstehen«, murmelte er und drückte sich mit seinen kräftigen Armen aus dem Sessel auf die Füße. Sein rechtes Bein war schwach und dünn wie das eines Kindes und mußte durch eine Metallschiene gestützt werden. Die Folgen eines Unfalls und einer verpatzten Operation, die ihn zum Krüppel gemacht hatten. Er stützte sich schwer auf seinen Stock und hinkte zum Glasschrank, der stets verschlossen war und Dinge von seltsamen, fremden Formen hinter den Spitzengardinen verbarg. Er holte einen fleckigen, vergilbten Leinensack heraus und legte ihn geöffnet in ihren Schoß. »Nimm es heraus.«
Ein schwacher, staubiger Geruch von getrocknetem Gras stieg ihr in die Nase, süßlich und kaum wahrnehmbar. Vorsichtig griff sie hinein. An einer festen, geflochtenen Kante aus Bast, die mit schmalen, gezähnten Muscheln besetzt war, hing ein dickes, puscheliges Röckchen aus dunkelbraunem, vom Alter brüchigen Gras. Es war länger als ihr ausgestrecktes Kinderärmchen und reichte bis auf den Teppich.
»Es war dein erstes Kleidungsstück«, lächelte ihr Vater, »ein Baströckchen, wie es die Eingeborenen, die es dir schenkten, auch trugen. Denn du bist in Afrika geboren, auf einer kleinen Insel, unter hohen, flüsternden Palmen, genau in dem Moment, als der große Regen begann. Vor dir war noch nie ein weißes Kind auf dieser Insel geboren worden, und für sie, die sie eine schwarze Haut hatten, warst du ein kleines Wunder mit deinen blonden Haaren und blauen Augen. So nahmen sie dich in ihren Stamm auf.« Er trat ans Fenster, das jetzt dunkel und undurchsichtig war und an dem der Regen wie ein Sturzbach herunterfloß. »Es ist eine sehr kleine Insel. Sie liegt über dem Äquator zwischen anderen Inseln in einem weiten, blauen Meer.« Seine Stimme wurde leiser, und sie hatte Mühe, seine Worte zu verstehen. »Es ist immer warm dort und hell, und Blumen blühen das ganze Jahr.«
Er schwieg und wendete sein Gesicht ab. Seine Schultern bewegten sich.
Henrietta vergrub ihre Nase in dem Baströckchen und sog den Duft ein. Etwas rührte sich in ihr. Sie fühlte eine Wärme auf ihrer Haut, unvergleichlich heißer und lebendiger als die nördliche, blasse Sonnenwärme, und sie hörte eine windverwehte, weit entfernte Melodie von sanften, kehligen Stimmen. Ein anderer Geruch berührte ihr Gesicht, rauchig und vertraut. Schmetterlingszart stieg er auf und streichelte sie. Ein berauschendes Gefühl von Dazugehören und Frieden umschloß sie, hüllte sie ein. Sie hob ihre Augen zu ihrem Vater. »Afrika?« fragte sie, und er nickte.
So begann es.
Afrika. Für Henrietta wandelten sich das Wesen und der Inhalt des Wortes über die Jahre. Für das kleine Kind war es die Welt der Wunder und Märchen, der Traum von Schätzen und dunkelhäutigen Prinzen in prächtigen Gewändern und fernen, in der Sonne glitzernden Küsten, ihr Traum, in den sie sich in den trüben, nordischen Wintern flüchtete.
In jener turbulenten, chaotischen Zeitspanne zwischen Pubertät und Erwachsenwerden war es der geheime Zufluchtsort, in den sie sich zurückzog, wenn die Welt zuviel von ihr verlangte. Der Ort war nirgendwo, hatte keine bestimmte Form, es war nur ein warmes, dunkles Gefühl, ein Rhythmus und eine Erinnerung, Frieden gefunden zu haben.
Wenn ihre Sehnsucht nach Licht und Wärme etwas anderes verlangte als nur Sonne, wenn die verknöcherten Vorschriften ihrer Umgebung zu einem Gefängnis wurden, dann hatte das Wort Afrika die Bedeutung von Hoffnung und Trost und einer Verheißung von Freiheit. Ohne dieses Afrika, ihr Afrika, konnte sie nicht überleben.
»Du bist in Afrika geboren, auf einer kleinen Insel im weiten, blauen Meer«, hatte ihr Vater gesagt, und dann roch sie diesen Duft, rauchig und vertraut, und hörte die windverwehte Melodie dunkler, sanfter Stimmen. Seine Worte waren wie ein Samen, und ihre Sehnsucht, dieses Verlangen nach dem Ort, der ihre Heimat war, wuchs daraus als kräftige, widerstandsfähige Pflanze. Sie wußte, daß sie eines Tages zurück nach Afrika gehen mußte. »Gleich, wenn ich groß bin!« Um sie herum wurde es dann hell und warm, selbst wenn draußen alles Leben unter einer Eisdecke gefror.
Erstes Kapitel
ES WAR 1959, wenige Tage nach dem Weihnachtsfest. — Über dem Limpopo-Fluß wachte Henrietta auf. Sie streckte sich, so gut es in dem engen Sitz möglich war, und das gestaute Blut stach in ihren Beinen. Ein höchst unangenehmes Gefühl. Sie fror unter ihrem dünnen Mantel. Die ausgetrocknete Luft, abgestanden, stickig und beißend von den vielen Zigaretten ihrer Mitreisenden, kratzte ihr im Hals. Sie hustete, und der Mann neben ihr bewegte sich im Schlaf. Sie streifte seine Hand, die ihm herübergerutscht war, von ihrem Knie. Er hatte ihr den Fensterplatz überlassen. Dafür war sie ihm dankbar, hatte aber seine hartnäckigen Versuche, sie in eine Unterhaltung zu verwickeln, und seinen Vorschlag, Adressen auszutauschen, im Ansatz abgewürgt. Für ihr neues Leben in Südafrika wollte sie frei sein wie ein Vogel und ohne eine Verbindung zur Vergangenheit. Leise schob sie das Rollo hoch und drückte ihr Gesicht gegen die kühle Scheibe. Sie flogen sehr tief, denn die Maschine war vollkommen überladen. Es war nicht einmal Platz für die Bordverpflegung, für jede Mahlzeit mußten sie landen. Draußen herrschte noch Dunkelheit. Nicht die bläulichschwarze der nördlichen Länder, sondern die samtene, glühende Dunkelheit der Tropen, fast greifbar weich.
Fast sechzig Stunden war sie jetzt unterwegs auf einer Reise, die in Hamburg ihren Anfang genommen hatte. Hamburg, Basel, Kairo, Khartoum, Entebbe, Nairobi, Salisbury, Bulawayo — Stationen einer Reise, deren Eindrücke mit der zunehmenden Erschöpfung auf dem langen Weg ineinanderflossen. Auf schneidende Kälte folgte brütende Wüstenhitze, auf tintige schwarze Nacht blendendes Sonnenlicht. Bilder und Sprachfetzen füllten ihren Kopf, fremdartige Gerüche stiegen ihr in die Nase. Die Ausdünstungen der vielen Menschen im Flugzeug, die zu lange zusammengepfercht auf zu engem Raum mit zu wenigen, völlig überlasteten und verdreckten Waschräumen zu kämpfen hatten, legten sich klebrig auf ihre Geschmacksnerven. All das und das ständige Dröhnen und Vibrieren der vier Propellermotoren betäubte sie und verdrängte alle anderen Gedanken und Gefühle.
Der Abschied von den Eltern am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages auf dem zugigen, knochenkalten Hamburger Hauptbahnhof war trostlos gewesen. Ihr Vater stand vor ihr, kerzengerade und bleich in dem trüben Schein der Bahnhofsleuchten. »Paß auf dich auf, benimm dich«, sagte er tonlos, »und grüß mir Afrika.«
Dietrich, blaß und schmal, fünf Jahre jünger als sie, boxte sie hart. »Na, Schwesterlein, laß dich man nicht von Löwen fressen!«
Ihre Mutter hatte rotgeränderte Augen und zerknüllte ein nasses Taschentuch. Sie reichte ihrer Tochter die Wange zum Kuß, brachte aber kein Wort heraus. Der Auslöser für diese Reise, David, schien vergessen. Nur dieser schmerzhafte Abschied blieb. Frierend verkroch Henrietta sich in ihrem dünnen Mantel.
Es folgte eine vierzehnstündige Zugfahrt durch das tiefverschneite, nachtdunkle Deutschland nach Basel. Für wenige, kostbare Stunden fiel sie in einen unruhigen Schlaf, häufig gestört durch das Trampeln zusteigender Passagiere im Gang. Morgens in Basel angekommen, trat sie hinaus auf den Centralbahnplatz und versank sofort bis zu den Knöcheln im Schnee. Das Wetter paßte zu ihrer Stimmung. Eine milchigweiße, verwaschene Sonne ertrank in schweren, grauen Wolken. Schneefall setzte ein. Ein eisiger Wind türmte den Schnee am Straßenrand auf und verwandelte die Straße zum Flughafen in einen spiegelglatten, weißen Kristalltunnel. Die Taxifahrt vom Bahnhof zum Flughafen befriedigte ihren Hunger nach Abenteuer vorerst vollauf.
Der Start der hoffnungslos überladenen DC 6 erfüllte sie mit den schlimmsten Befürchtungen. Mächtige Räummaschinen fraßen eine provisorische Startbahn durch die Schneemassen, die sie aus dicken Kanonenrohren auf die Seiten bliesen, wodurch sich bald ein Tunneleffekt ergab, der sie unangenehm an die Taxifahrt erinnerte. Schwerfällig erhob sich das Flugzeug in die Luft und tauchte mit brüllenden Motoren in die dicke Wolkendecke. Während ihrer düsteren Vision von einem heulenden Absturz und darauffolgender Flammenhölle brach die Maschine plötzlich durch die Wolken und schwebte über den blendend weißen Gipfeln der schneebedeckten Alpen in einen strahlenden, tiefblauen Himmel. Aufregung packte sie. Zum ersten Mal empfand sie keine Begrenzung, ahnte sie, was Freiheit hieß. Die Gefängnismauern öffneten sich, und sie wagte einen Schritt hinaus.
Nach Zwischenlandungen in Genf und Kairo, wo sie zu Abend aßen und von freundlichen braunen, in lange helle Gewänder gekleideten Männern zu einem Basar geführt wurden, wo Messingwaren, kleine Mumienpuppen und echte, wirklich ganz echte, altägyptische Statuen angeboten wurden, befanden sie sich gegen Mitternacht über der Nubischen Wüste. Hier stieg die am Tag von einer glühenden Sonne aufgeheizte Luft auf, prallte gegen die kalten Luftschichten der Nacht und verursachte extreme Turbulenzen. Das Flugzeug sackte weg wie ein Stein, arbeitete sich ächzend hoch und fiel dann wieder mehrere hundert Meter tief in ein Luftloch.
Die meisten Passagiere wurden aus einem unruhigen Dämmerschlaf gerissen, als sie in Khartum landeten. Die Luft, die durch die geöffneten Türen strömte, erschien ihr höllenheiß nach der Winterkälte in Basel und der Kühle in Kairo. Sie durften nicht aussteigen. Drei Stunden mußten sie so ausharren, bevor sie endlich nach Entebbe und Nairobi starteten, wo, wie auch während der vorigen Zwischenstops, weitere Passagiere auf sie warteten. Wem nicht von den schlingernden Bewegungen der tief fliegenden Maschine schlecht wurde, wurde bald von suggestiven Würgegeräuschen und dem nachfolgenden, stechenden Gestank überwältigt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!