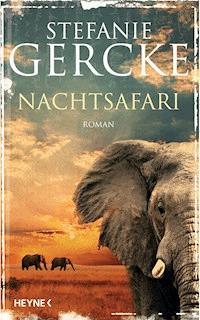6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fernab von der politischen Realität Südafrikas führt Jill Court auf Inqaba, der Farm ihrer Familie in den grünen Hügeln Zululands, das privilegierte Leben einer Tochter aus wohlhabendem Hause. Eines Tages jedoch findet man ihren geliebten Bruder grausam ermordet auf. Als auch noch skrupellose Rassisten und Geschäftemacher drohen, ihr die Familienfarm zu nehmen, erkennt Jill, dass die Zeit der Träume endgültig vorbei ist. Im Kampf um Inqaba reift sie zu einer selbstbewussten und mutigen Frau heran, die sich zu wehren weiß ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1021
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Stefanie Gercke
Ein Land, das Himmel heißt
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Fernab von der politischen Realität Südafrikas führt Jill Court auf Inqaba, der Farm ihrer Familie in den grünen Hügeln Zululands, das privilegierte Leben einer Tochter aus wohlhabendem Hause. Eines Tages jedoch findet man ihren geliebten Bruder grausam ermordet auf. Als auch noch skrupellose Rassisten und Geschäftemacher drohen, ihr die Familienfarm zu nehmen, erkennt Jill, dass die Zeit der Träume endgültig vorbei ist. Im Kampf um Inqaba reift sie zu einer selbstbewussten und mutigen Frau heran, die sich zu wehren weiß …
Inhaltsübersicht
Prolog
Der Anfang
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Das Ende
Dann lachte jemand. Laut [...]
LESETIPP: »Die Achse meiner Welt«
Vorbemerkung
1. Kapitel
Eine Weile stand sie reglos am Rand des Indischen Ozeans. Das klare Wasser umschmeichelte ihre Füße, der warme Seewind strich ihr die Haare aus dem Gesicht. Doch ihre Haut war klamm und gefühllos und ihr Inneres aus kaltem Stein. Sie fühlte nicht, sah nicht, hörte nicht, erinnerte sich nicht, wie sie hierher gekommen war. Eine Ewigkeit hatte sie ihn gesucht, bis sie endlich seine Spur fand, und dann war es um Minuten gegangen, und sie hatte ihn verpasst. Er hatte sich ein Auto gemietet, war auf dem Weg nach Johannesburg und von dort aus in den schwarzen Bauch Afrikas. Er war fort. Endgültig.
»Du hast Recht gehabt, es tut mir Leid, bitte verzeih mir.« Das wollte sie ihm sagen. Aber nun war es zu spät.
Mit leerem Blick schaute sie über das unendliche, sanft wogende Meer. Wie ein atmendes Wesen lag es vor ihr, die bewegte Oberfläche zersplitterte den Abglanz des Himmels in Myriaden flimmernder blauer Sterne. Leise seufzend atmete der Ozean aus, überzog den Strand mit flüssigem Silber, atmete ein, und die Wellen liefen zischend zurück. Aus und ein, aus und ein. Für immer. Bis ans Ende der Zeit.
Für immer, klang es in ihr nach, und eine Gänsehaut kräuselte ihre bloße Haut, denn erst jetzt wurde ihr bewusst, was sie ihm eigentlich sagen wollte. »Ich liebe dich«, wollte sie ihm sagen, »bitte bleib bei mir, ich kann ohne dich nicht leben.« Bis zu den Knien stand sie jetzt im Wasser. Die Wellen zerrten an dem weiten Rock ihres schwarzen Trägerkleides.
»Komm«, lockten sie, »komm mit uns, wir tragen dich.«
Sie schwankte. Mit seinem Fortgehen hatte sie auch jegliche Widerstandskraft verlassen. Dem starken Sog hatte sie nichts mehr entgegenzusetzen. Sie machte ein, zwei Schritte vorwärts, das Wasser stieg ihr bis zur Taille. Aus und ein, aus und ein, atmete sie, spürte, wie das Blut im Rhythmus der Wellen in ihren Adern strömte. Die nächste hob sie liebevoll hoch, bauschte ihren Rock. Wie eine schwarze Rose trieb sie weiter hinaus aufs Meer, bis die Strömung sie auf dem trügerisch sicheren Boden einer Sandbank absetzte. Die Farbe des Wassers wechselte an ihrem Rand in das geheimnisvolle Blau großer Tiefe.
»Komm«, seufzten die Wellen, »komm, lass dich fallen, hier ist es still, hier wird der Schmerz vergehen.«
Das Meer rauschte, eine Möwe schrie. Pfeilschnell glitt der Vogel über die Wellen, wurde vom Aufwind erfasst. Mit einem Schluchzen sah sie ihm nach, bis er nur noch ein weißer Punkt in der gleißenden Helligkeit war, ließ sich mitreißen, flog über die Landschaft ihres Lebens, suchte den Tag, an dem alles begonnen hatte. Einmal war sie unbeschwert gewesen, war ihre Welt festgefügt und ihre Zukunft sicher. Als gerader Weg lag sie im strahlenden Licht vor ihr. Es musste einen Zeitpunkt gegeben haben, an dem sich dieser Weg gegabelt hatte. Sie musste wissen, ob sie je die Freiheit gehabt hatte, die Richtung zu wählen. Schritt für Schritt ging sie zurück.
Sie fand den Punkt. Es gab dort keine Abzweigung. Der Weg führte geradewegs vom Licht in die Schwärze. Sie hatte nie eine Wahl gehabt. Keine Erfahrung hatte sie die Dunkelheit ahnen lassen, die Ängste von Nelly, der Zulu, verursachten kein Vorgefühl des kommenden Unheils.
Die erste Warnung bekam sie am Vorabend des Tages, nach dem nichts mehr so sein sollte, wie es gewesen war.
Der Anfang
1
Die kurze Dämmerung tauchte den Tag in indigoblaues Licht, die Nacht kroch schon aus den Bäumen hoch. Sie standen im Hof von Inqaba. Zweimal strich der Iqola auf schmalen Schwingen im Tiefflug um den Hof, und jedes Mal zeigte er ihnen seinen schwarzen Rücken. Nellys Haut verfärbte sich aschgrau. Sie wusste, dass dies großes Unglück für die Bewohner des Hauses verhieß. Hätte der Iqola ihr die weiße Unterseite gezeigt, sie hätte freudig ein Huhn geschlachtet, frisches Bier gebraut und ihre Nachbarn zu einer Feier gebeten, denn das war ein Zeichen für zukünftiges Glück. »Das Glück wird Inqaba verlassen, für sehr lange Zeit«, flüsterte die Zulu und zeigte dabei das Weiße ihrer Augen.
Jill verstand ihre Warnung nicht, hatte nur gelacht und sie in den Arm genommen. Nelly aber wurde vor ihren Augen zu Stein. Ihre massige Gestalt in dem geblümten Kleid, das dunkle Gesicht mit den großflächigen Wagenknochen, der breite Mund, der so herrlich lachen konnte. Jill streckte ihre Hand aus, berührte Nelly und erschrak. Die Haut der alten Zulu war kalt, schien nicht von Blut durchströmt zu sein. Die schwarzen Augen waren nur leere Löcher, als hätte sie alles Leben verlassen. Es war, als stünde nicht Nelly vor ihr, sondern nur ihre Hülle.
Unwillkürlich fröstelte sie, trotz des heißen Abends. Der Alltag der Zulu wurde von Geistern bevölkert, die Schatten ihrer Ahnen lenkten ihr Leben, umgaben sie mit einer Mauer von Tabus, trieben sie durch ein dunkles Labyrinth von Aberglauben und Ängsten. Als sie noch sehr klein war, wurde Jill mit in diesen verwirrenden Irrgarten gezogen. Sie glaubte sich im Märchen, im Land der Feen und Kobolde, bewegte sich mit kindlicher Unbefangenheit. Doch je mehr sie lernte, je erwachsener sie wurde, desto weiter entfernte sie sich von Nellys übersinnlicher Welt, und eines Tages schlug die Tür zu. Sie stand draußen. So schob sie ihr Unbehagen jetzt auf etwas, was vor langer Zeit passiert war.
Als kleines Mädchen war sie Nelly heimlich zur Hütte des Isangoma Umbani gefolgt. Mit zwei Fingern hatte sie eine Lücke ins Weidengeflecht der Rundhütte gebohrt und hindurchgeschaut. Die Luft, die aus dem Loch strömte, atmete sich schwer, war mit einem Gestank geschwängert, der sie an ihren Besuch im Raubtiergehege des Zoos erinnerte. Mühsam unterdrückte sie ein Niesen. Als sie den Isangoma erblickte, erstarrte sie vor Schreck, wagte nicht, sich zu rühren, denn er war nur zwei Meter von ihr entfernt. Er war riesig und schwarz, mit blutunterlaufenen Augen. Nelly saß vor ihm auf dem Boden, Umbani, der Isangoma, stand über ihr, und der zitternden Jill erschien er wie der Leibhaftige.
Um seinen Kopf trug er einen Löwenschwanz, den mächtigen Körper bedeckte ein Leopardenfell, und eine geschmiedete Kette aus fingerdicken, nach außen zeigenden Eisenstacheln umschloss seinen Hals. Doch das, was Jill noch jahrelang in ihren Albträumen verfolgte, war die über einen Meter lange, armdicke Puffotter, die er mit seiner linken Hand packte. Den Kopf der Schlange, deren Biss in Minuten tötete, hielt er zwischen seinen Zähnen fest, so dass er in seiner Mundhöhle verschwand.
Ein Zischen erfüllte den Raum. Ob es die Schlange war, die wild mit ihrem Schwanz peitschte, oder Umbani, der Zauberer, konnte sie nicht unterscheiden. Um nicht laut loszuschreien, steckte sie ihren Daumen in den Mund, wagte kaum zu atmen und machte sich zu ihrer Scham in die Hose. Erst als Umbani die Schlange mit den zentimeterlangen Giftzähnen sicher wieder in einem Korb verstaut hatte, fand sie den Mut, sich davonzuschleichen. Ihre Angst hatte der wütenden Schlange gegolten, keine Minute hatte sie geglaubt, dass Umbani übernatürliche Kräfte besaß. Sie fand ihn ziemlich dumm, dass er sich auf diese Weise mit einer Puffotter abgab.
Sie hielt sich für eine ganz und gar aufgeklärte und nüchterne Person, und deswegen kam ihr auch nicht in den Sinn, in dem Vorfall am Beginn des heutigen Tages einen weiteren Hinweis auf kommendes Unheil zu sehen. Sie wurde davon vor Sonnenaufgang geweckt.
Es war ein schwaches Geräusch, kaum mehr als ein leises Kratzen, nicht genug, um sie aufzuschrecken, aber es erreichte sie in ihrem Traum, und sie wachte auf. Nicht mit einem Ruck, sondern wie ein Fisch aus dunkler Tiefe tauchte sie ganz langsam auf zum Licht und durchbrach endlich mit einem Seufzer die Oberfläche ihres Bewusstseins. Sie öffnete die Augen, war sich nicht sicher, was sie gestört hatte.
Die sonnengelben Baumwollgardinen blähten sich sacht im Wind, Morgenröte flutete durch den breiten Spalt in den Raum. Würziger Holzrauch hing in der klaren Luft und die volle Süße von erntereifen Ananas. Ein Hahn krähte, Kühe blökten, leise Stimmen und Lachen wie schläfriges Vogelzwitschern schwebten zu ihr herüber, ein Traktor sprang an und tuckerte davon. Das sagte ihr, dass Nelly und ihre Familie bereits ihren Phuthu, den Maisbrei, gefrühstückt hatten, die jüngeren Frauen auf dem Weg zur Ananasplantage waren und Ben ihnen mit dem Trecker vorausfuhr, dessen Anhänger sie im Laufe des Tages mehrfach mit reifen Früchten füllen würden.
Erleichtert legte sie sich zurück. Es war nichts, alles war, wie es sein sollte. Vielleicht hing der Traum, aus dem sie aufgewacht war, ihr noch nach? Wie Blei lag er auf ihren Gliedern, zog sie seelisch herunter. Immer wenn etwas sie spätabends zu sehr aufwühlte, verfolgte sie das bis in ihre Träume.
Angelica hatte um elf angerufen, ihre Stimme war hoch und dünn gewesen, wie immer, wenn sie erregt war. »Jilly, tut mir Leid, dass ich um diese Uhrzeit anrufe, aber es ist etwas vorgefallen, was mir Angst macht.«
»Ich hab noch nicht geschlafen. Wo bist du?«
»Bei meinen Eltern.«
Angelica lebte mit ihrer Familie nur eine halbe Stunde Autofahrt von ihr entfernt am Nyalazi-Fluss, ihre Ferien verbrachten sie im Haus ihres Stiefvaters am Little Letaba westlich des Krügerparks. Ihre Mutter und er waren dorthin gezogen, nachdem sie ihre Zuckerrohrfarm bei Mtubatuba verkauft hatten. Für ein paar Sekunden hörte Jill nur schweres Atmen am anderen Ende, als würde ihre Freundin nach Worten suchen. Beunruhigt merkte sie auf.
»Popi Kunene ist wieder aufgetaucht«, sagte Angelica, »und wieder kursieren böse Gerüchte um ihn.«
Popi Kunene, Zwillingsbruder von Thandile, Kindheitsfreund. Unruhestifter. Widerstandskämpfer. »Welche Gerüchte sind es diesmal? Von Ben habe ich gehört, dass er nach Simbabwe floh, als ihm die Polizei hier auf den Fersen war. Aber was Popi dort macht, wusste Ben auch nicht. Oder er sagt es nicht, was wahrscheinlicher ist.«
Angelicas Stimme schwankte. »Er peitscht die Massen auf, Jilly, er sagt ihnen, dass Mandela bald frei sein wird, verspricht ihnen, dass sie dann Land bekommen, Häuser, Reichtümer …«
Jill unterbrach sie. »Du meinst, dass Popi, unser Freund, mit dem wir unsere Kindertage verbracht haben, uns von unserem Land verjagen will? Das glaub ich nicht, Angelica, das würde er nie tun. Er kämpft gegen den Staat, nicht gegen uns. Wir sind doch miteinander aufgewachsen, wir waren doch wie Geschwister – unsere Farm ist auch seine Heimat.«
Ihre Heimat war Afrika, die Ostküste der Südspitze Afrikas, das fruchtbare, grüne Natal. Hier in den Hügeln Zululands war sie geboren und aufgewachsen. In dem Land, das Himmel heißt. Hier lebte sie. Sie war Afrikanerin.
Popi Kunene war auch Afrikaner. Er war nur wenige Kilometer von ihrem Geburtsort auf die Welt gekommen, und das Einzige, was sie unterschied, war der Melaningehalt ihrer Haut. Sie hatte wenig, ihre Familie, die Courts aus Cornwall in England und die Steinachs aus Bayern, waren erst vor einhundertfünfzig Jahren in dieses Land gekommen. Sie war weiß. Seine Vorfahren lebten seit Anbeginn der Dinge unter der sengenden afrikanischen Sonne, als Schutz hatte seine Haut viel Melanin ausgebildet. Seine Haut war schwarz.
Sie wartete auf eine Antwort, doch ihre Freundin schwieg. »Angelica, bist du noch da? Er wird unsere Farmen in Ruhe lassen, er ist hier zu Hause.«
»Das sag ich mir ja auch immer … du kennst mich doch, Angelica, die Unerschrockene«, ihr Auflachen klang kratzig, »aber er ist gefährlich, Jill, er ist nicht mehr der Popi unserer Kindheit. Mir zittern die Knie, wenn ich nur daran denke, dass er sich unsere Farm aussuchen und sie seinen Anhängern versprechen könnte.« Wieder schwieg sie, die Leitung rauschte und knisterte, als hielte Jill eine Muschel an ihr Ohr und hörte das Strömen ihres eigenen Blutes. Dann drang Angelicas Stimme wieder durch. »Er peitscht die Leute mit Parolen auf, wirft ihnen Münzen vor die Füße, so dass sie vor ihm auf die Knie fallen müssen, umtanzt sie, hypnotisiert sie mit seinem verdammten Schlangenbeschwörertanz – ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur ein bisschen weiterdenke … Erinnerst du dich noch, wie er die Katze umgebracht hat?«
Oh ja, das würde sie nie vergessen! »Wie« hatte Angelica gesagt, nicht »als«. Popi hatte das grau gestreifte Kätzchen am Hals gepackt und hatte ihm in die Augen gesehen, während er dem jämmerlich strampelnden Tierchen langsam die Luft abdrückte. »Tom hat ihn dabei erwischt und windelweich geprügelt. Kinder sind manchmal grausam. Das heißt noch lange nicht, dass sie zu schlechten Menschen werden …« Sie redete viel zu schnell, das merkte sie. Wie um sich selbst zu überzeugen. »Er war erst zehn und wütend, weil die Katze ihm das Gesicht zerkratzt hatte.« Und seine Augen haben dabei vor Vergnügen geglüht, das hatte sie verdrängt. Sie setzte sich hin. Plötzlich schienen ihre Beine seltsam schwach.
»Er nennt sich jetzt Blackie Afrika …«, fuhr ihre Freundin fort.
»Blackie Afrika?«, unterbrach sie. »Welch ein Quatsch. Für mich ist und bleibt er Popi.« Popi, mit dem sie aufgewachsen war. Der ihr Bruder war, nicht ihres Blutes, wie Tommy, aber trotzdem wie ein Bruder. Der Name, den ihm seine Mutter bei der Geburt gegeben hatte, war Thando – der, der geliebt wird. Doch keiner nannte ihn so. Für seine Freunde war er Popi, und der Name, den ihm das Volk gab, war Inyathi, der Büffel. Inyathi, der die Bäume zum Zittern bringt, die Erde zum Beben, Inyathi, der dunkle Schatten im Grün des Buschs. Inyathi, das angriffslustigste Tier Afrikas.
Die weißen Afrikaner aber nannten ihn den Rattenfänger, denn verführerisch waren seine Worte, mit denen er lockte, süß seine Versprechungen. Und grausam seine Handlungen. Ein Schauer ließ ihr die Haare zu Berge stehen. Schon immer umgaben ihn Gerüchte wie eine stinkende Wolke. Viel wurde darüber gemunkelt, doch keiner wusste Genaues, niemand hatte ihn gesehen. Popi Kunene war ein Trugbild. »Hast du ihn selbst gesehen, oder ist es nur ein Gerücht?«
Angelica atmete heftig. »Ich habe ihn nicht selbst gesehen«, gab sie endlich zu, »aber die Einzelheiten, die ich gehört habe, lassen darauf schließen, dass all dies wahr ist. Marian rief mich an, sie hat es von Freunden, die auf einer Farm am Limpopo sitzen. Popi ist über die Grenze aus Simbabwe gekommen und zieht durch die Dörfer, begleitet von einer johlenden Menge!«
Noch lange, nachdem sie aufgelegt hatte, lag Jill wach. Diese Gerüchte entstanden wie Grasbrände, dachte sie, das war normal. Irgendwo glomm ein winziger Funke, lief von Haus zu Haus, sprang von Farm zu Farm, glühte auf, und schon, genährt von der Angst, die alle Farmer beherrschte, schlugen Flammen hoch und verbreiteten sich zu einem Flächenbrand. Bei jeder anderen hätte sie den Anruf als Wichtigtuerei abgetan, bei Angelica war es etwas anderes.
Der Gedanke an Popi verfolgte sie erbarmungslos, und der Schlaf kam erst nach Stunden. Jetzt aber, im weichen Licht des Tagesanbruchs, verblasste sein Bild, liefen ihre Gedanken in logischen Bahnen, hatte sie Schwierigkeiten nachzuvollziehen, welchen Weg das Gerücht genommen hatte. Leute, die am Limpopo lebten, hatten es Marian erzählt, die es dann an Angelica weitergab? Wer weiß, ob die ihn tatsächlich gesehen hatten oder auch nur von ihm gehört. Blackie Afrika. Das klang wie eine Pop-Gruppe. Sie musste lächeln.
Außerdem hatten sich die Angriffe auf Farmer bisher auf die nördlichen Provinzen und den Oranje-Freistaat konzentriert. Auch in Natal waren einige Farmer überfallen und getötet worden, aber nicht alle zwei Tage, wie im Norden. Die Region um den Little Letaba war mehr als dreihundert Kilometer von ihrer Farm entfernt, und dazwischen lag als Puffer das Königreich Swaziland. Weit weg. Woanders, und nur ein Gerücht. Es war nichts, was sie betraf.
Lustvoll streckte sie sich und erlaubte sich für einen köstlichen Augenblick, mit geschlossenen Augen liegen zu bleiben, nur daran zu denken, dass sie übernächste Woche heiraten würde.
Da spürte sie es. Unten rechts, oberhalb der Leistenbeuge, ein sanftes Flattern, ganz kurz nur, wie der weiche Flügelschlag eines Schmetterlings. Sie legte ihre Hand auf ihre nackte Bauchhaut und wartete, atmete nur ganz sanft. Und da war es wieder, ganz deutlich fühlte sie es unter ihren Fingerspitzen. Das Baby? Sie nahm die Finger zur Hilfe, um nachzurechnen. Anfang sechzehnter Woche. Fühlte man sein Baby schon so früh? Sie musste Angelica fragen, die ihr Kind vor acht Monaten bekommen hatte, als Erste in ihrem Freundeskreis.
Nur einmal hatten Martin und sie nicht aufgepasst, ihr wurde heiß, als sie an den kühlen Juliabend vor dem flackernden Kamin in seinem Elternhaus dachte. Neun Monate hatten sie sich nicht gesehen, an dem Tag war er nach Abschluss seines Studiums endgültig aus Deutschland zurückgekehrt. Sie standen einander gegenüber, ihre Blicke, mit denen sie sich umfingen, spürte sie wie Liebkosungen. Die Luft zwischen ihnen knisterte. Wer wen zuerst berührte, daran erinnerte sie sich nicht, nur an das Feuerwerk, das folgte. Allein der Gedanke ließ eine wollüstige Wärme durch ihre Glieder strömen. Sie räkelte sich träge, dachte daran, dass sie die ersten Anzeichen nur als Unregelmäßigkeit ihres Zyklus eingeschätzt hatte. Erst seit vier Wochen wusste sie es, hatte kaum geschlafen, nachdem sie den zweiten blauen Strich auf dem Teströhrchen entdeckt hatte.
Mit angehaltenem Atem hatte sie es gedreht und gewendet, gegen das Licht gehalten. Es veränderte sich nichts. Zwei deutliche blaue Striche. Aufgelöst war sie hinaus auf die Veranda gerannt und hatte in den afrikanischen Sternenhimmel geschaut. Das raue Terrakottapflaster unter ihren nackten Füßen war feucht vom Tau, Amatungulublüten erfüllten die Luft mit schwerer Parfumsüße, die Paarungsrufe der Ochsenfrösche dröhnten, und das Leben war so schön, dass es kaum auszuhalten war.
Martin wusste noch nichts von ihrem Kind. Sie war allein gewesen, er für ein paar Tage nach Johannesburg gefahren, und irgendwie, vielleicht durch die Hektik der Hochzeitsvorbereitungen, schien es nie der richtige Moment zu sein, es ihm zu erzählen. Morgen, entschied sie, morgen werde ich es ihm sagen.
Ein Hund bellte, ein zweiter fiel ein, und sie schreckte hoch. Die Tauben verstummten, die leisen Stimmen und das Lachen auch, nur ein Schwarm winziger Vögel stob schrill kreischend davon. Mit einem Unmutslaut schlug sie das Laken zurück, schob das Moskitonetz beiseite und setzte die Füße auf den aprikosenfarbenen Teppich, der ihre Betten umrandete. An Ruhe war nicht mehr zu denken. Roly und Poly, ihre beiden Dobermänner, bellten immer noch, ein atemloses Kläffen mit hysterischen Obertönen. Vermutlich hatten sie einen Mungo aufgestöbert, oder Pongo, das winzige Warzenschweinweibchen, das Ben ihr kürzlich gebracht hatte. Es sauste urplötzlich wieselflink heran, zwickte sie in die Hinterbeine und entwischte wieder, trieb die Hunde dabei schier zum Wahnsinn.
Sie streckte sich noch einmal. Es war warm im Zimmer, fast stickig. Wenn Martin nicht über Nacht blieb, schaltete sie die Klimaanlage aus und schlief bei weit geöffneten Fenstern. »Es ist kalt wie ein Eisschrank«, hatte sie protestiert, als er in der ersten Nacht, die er bei ihr verbrachte, Jalousiefenster und Tür verschloss und die Klimaanlage auf kalt stellte.
Aber er konnte anders nicht schlafen, stand mit Kopfschmerzen und schlechter Laune auf. »Du bist wirklich unvernünftig, du weißt, wie gefährlich es ist, nachts die Fenster offen zu haben. Irgendwann wird einer von den Eingeborenen reinkommen und uns beide in Stücke hacken. Ich hab kaum eine Auge zugetan.«
»Hier gibt es weit und breit nur Menschen, die zur Familie gehören, die ich seit meiner Geburt kenne. Keiner wird uns etwas tun.«
»Ich werde viel geschäftlich unterwegs sein, und ich will nicht ständig Angst um dich haben, Liebling. Denk an den Keulen-Mann.«
»Der Keulen-Mann! Das ist mindestens sechs Jahre her, der war verwirrt und hörte Stimmen oder sonst was … Ich mag darüber nicht nachdenken.«
»Das solltest du aber, hör auf, den Kopf in den Sand zu stecken. Der Keulen-Mann war ein Zulu aus dieser Gegend, bösartig, und hasste alle Weißen. Er stieg nachts in die Häuser ein und schlug die Leute im Bett mit seiner Keule zu Brei, schlug zu, bis ihre weißen Gesichter rot waren …« Tiefe Besorgnis schwang in seinen Worten mit.
Unbehagen trippelte wie Millionen Ameisenfüße über ihre Haut, abwehrend hob sie die Hände. »Hier auf Inqaba passiert so etwas nicht, ich bin hier völlig sicher. Deine Angst ist übertrieben.« Doch das Gefühl, dass er sich um sie sorgte, war angenehm und warm, und als er dann seine wirkungsvollste Waffe einsetzte, diesen Blick, der ihr die Knie weich machte, das Blut in den Kopf trieb und den Atem nahm, gab sie willig nach. Die erste Nacht wachte sie jämmerlich frierend auf, aber Martin zog sie fest an sich, wärmte sie mit seinem Körper, und im sicheren Kokon seiner Arme schlief sie wieder ein.
Heute Morgen musste er um halb acht zu Vertragsverhandlungen in Durban sein. Er hatte dort bei Freunden übernachtet, sonst hätte er mitten in der Nacht aufstehen müssen. Ein wichtiger Tag für ihn. Es ging um die Bauleitung des Hauses eines Großreeders im Nobelvorort La Lucia. Sie hatte die Gelegenheit genutzt, alle Fenster auf Durchzug gestellt, nur die leichten Baumwollgardinen vorgezogen. Doch diese Nacht hatte sie vom Keulen-Mann geträumt.
Gähnend zog sie die Gardinen vollends zurück und schaute hinaus in den herrlichen afrikanischen Morgen. Es war klar und still, der Rauch aus Nellys Kochhütte stieg hinter der flachen Anhöhe fadengerade in den perlrosa Himmel. Die Schatten der Nacht lagen noch in den Senken, aber im Osten verwandelte schon ein Strahlen den Morgendunst über dem fernen Meer in Goldgespinst. Andächtig sah sie zu, wie das Strahlen feuriger wurde, die Schatten zerrissen, die Hügelkuppen aufglühten, und dann berührte prickelnde, lebendige Wärme ihre Haut. Aus einem Maisfeld flog ein Schwarm Glanzstare hoch ins Licht, zog als grün schillernde Wolke eine Schleife und fiel schrill zwitschernd in die Guavenbäume ein, die neben dem alten Mangobaum unweit ihres Bungalows wuchsen.
Die Sonne stieg rasch, blendete, und sie wandte sich eben ab, um ins Badezimmer zu gehen, als wieder ein winziger Laut ihr Ohr berührte, ein eigentümliches, trockenes Schaben, wie von einem nackten Fuß, der über die Fliesen schleift. Jetzt wusste sie, dass dieses Geräusch sie geweckt hatte, war sich sicher, nicht mehr allein im Zimmer zu sein. Das Gefühl, beobachtet zu werden, war so intensiv, als hätte sie jemand tatsächlich berührt. Ihr Herz machte einen Satz. Lautlos richtete sie sich auf und schaute sich um.
Die Türen zum Flur und Badezimmer waren geschlossen, niemand konnte hereingekommen sein. Ihr Bungalow war in den Hang gebaut, ruhte vorn auf Stelzen. Ein kurzer hölzerner Steg verband ihn mit dem Weg, der über mehrere Stufen zum Haupthaus führte. Alle Zimmer öffneten sich auf die teilweise überdachte Veranda, auch die Fenster und die doppelflügelige Glastür ihres Schlafzimmers. Sie spürte den schwachen Windhauch im Nacken, der durch die offenen Jalousiefenster strich, fühlte sich aber davon beruhigt, dass die massive Holzkonstruktion, die das Haus stützte, mit Bougainvilleen berankt war, die außer wunderschönen kupferrosafarbenen Blüten auch äußerst wehrhafte Dornen trugen. Davor wucherten hohe Amatungulubüsche, deren Dichte und zwei Zentimeter lange Stacheln einen zusätzlichen Einbruchsschutz bildeten.
Resolut schüttelte sie das unangenehme Gefühl ab. Es war nichts. Außerdem waren die Fenster im Schlafzimmer vergittert, und sie gestand sich ein, dass sie froh darüber war, dass Martin diesen Streit gewonnen hatte. Als kürzlich Gerüchte aufgekommen waren, dass Nelson Mandela in absehbarer Zeit freigelassen und alle verbotenen Parteien, wie der African National Congress und der militante Pan African Congress, legalisiert werden sollten, hatte er nachdrücklich verlangt, Fenster und Türen sofort mit kräftigen Gittern sichern zu lassen.
»Wer soll uns hier überfallen?«, hatte sie ihn gefragt, wie schon zuvor. »Das Haus liegt mehr als zwei Kilometer von der Straße entfernt, und du weißt doch, ich kenne hier jeden. Es sind fast alles Freunde aus meiner Kindheit, die meisten sind hier geboren.«
»Liest du eigentlich nie Zeitung oder siehst dir Nachrichten im Fernsehen an? Unser Land ist in Aufruhr, die Farmer werden abgeschlachtet, und du weigerst dich, es zu sehen.«
Natürlich wusste sie, dass das weiße Südafrika sich hinter meterhohen Zäunen verschanzte, hatte den harmlos aussehenden, feinen Draht gesehen, von dem diese Zäune gekrönt wurden, hatte gehört, dass er angeblich mit neun- bis elftausend Volt geladen war und einen Ochsen umhauen konnte, stufte diese Vorsichtsmaßnahmen jedoch als hysterisch ein. Hier auf Inqaba war das nicht nötig, dessen war sie sich sicher. »Nicht hier, hier ändert sich nichts«, erwiderte sie.
»Das ist doch Quatsch. Da draußen tobt ein Krieg, Jill. Wir werden jetzt Gitter montieren, ich werde das nicht diskutieren.«
Es war sein Ton, der sie in Wut versetzte. »Werden wir nicht«, fauchte sie, »es ist mein Haus!«
»Dann zieh ich hier nicht ein!«
»Sei froh, dass meine Eltern uns erlauben, hier zu wohnen, du weißt genau, dass wir uns von deinem Geld kein eigenes Haus leisten können.« Damit hatte sie ihn stehen lassen. Es war das erste Mal, dass heftige Worte zwischen ihnen gefallen waren.
»Wir werden alle in unserem Blut ertrinken«, hatte er hinter ihr hergebrüllt.
Hitze stieg ihr in die Wangen, als sie daran dachte, wie sie sich, beide gleichzeitig von Reue gepackt, in die Arme gefallen waren und hingebungsvoll den ganzen Nachmittag bei vorgezogenen Gardinen Versöhnung gefeiert hatten. Zwei Tage nach ihrem Streit stürmte er mittags auf die Terrasse des Haupthauses. »Hast du’s gehört?«, verlangte er zu wissen.
Sie sah von ihrem Buch auf. »Nein, was?« Roly und Poly, die rechts und links neben ihrem Liegestuhl lagen, hoben die Köpfe und knurrten warnend. »Ist die Welt untergegangen, und ich habe es nicht bemerkt?« Sie lachte über ihren kleinen Scherz.
»Es hat Malcolm und Jenny erwischt …« Er konnte kaum sprechen.
Sie verstand nicht. »Erwischt? Was meinst du damit?«
»Sie sind heute Nacht überfallen worden. Man hat ihnen die Kehle durchgeschnitten …«
»Oh«, ihre Hand flog zu ihrem Hals. Malcolms und Jennys Farm grenzte im Südosten unmittelbar an Inqaba. »Warum hat man sie umgebracht?«, würgte sie mühsam hervor. »Sind sie ausgeraubt worden? Nicht wahr, das ist es? Ihr Haus liegt ziemlich dicht an der Straße … da ist ja auch diese illegale Siedlung … bestimmt hatten sie es auf Jennys Schmuck und Malcolms Waffen abgesehen … sie hat wunderbaren Schmuck … dieses traumhafte Collier aus Diamanten und Rubinen ihrer englischen Großmutter … und Malcolm ist ein Waffennarr.« Nun sprudelten die Worte aus ihr heraus, als könnte sie mit ihnen einen Wall bauen, der sie vor dem Horror bewahrte.
Er hatte seine Arme um sie gelegt und hielt sie fest in ihrem schützenden Kreis. »Nein«, murmelte er, »nein. Irgendjemand hat seinen Finger in ihr Blut gesteckt und ›Bulala amaBhunu‹ damit an die Wand geschrieben …«
»Tötet alle Farmer.« Sie konnte kaum sprechen, hielt sich an ihm fest wie eine Ertrinkende.
Am selben Tag hatte sie Harry Keating, dem alten Harry, zuständig für die Bewältigung aller Alltagskatastrophen, die die Farm heimsuchten, Bescheid gesagt, und zwei Tage später zerschnitten Gitter die Aussicht aus ihren Schlafzimmerfenstern in saubere Rechtecke. Kategorisch weigerte sie sich, auch die restlichen Fenster vergittern zu lassen. Es gab wieder Streit. »Was soll das hier werden?«, rief sie. »Ein Gefängnis? Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, nie ist mir von irgendjemandem, egal welcher Hautfarbe, auch nur ein Härchen gekrümmt worden.«
»Denk an Jenny«, erwiderte er hitzig.
»Jenny! Wer weiß, vielleicht hatten die Mörder eine Rechnung zu begleichen …« Sie schrie es ganz laut, damit es ihre warnende innere Stimme übertönte.
»Mit Jenny? Das ist doch absurd.« Er zog sie an sich, nahm ihr Gesicht in die Hände. »Wann wirst du endlich begreifen, dass ich Angst um dich habe?« Er küsste sie. »Was soll ich denn ohne dich anfangen mit meinem Leben?« Dann lächelte er dieses Lächeln, seine Lippen wanderten über ihre Haut, als müssten sie unbekanntes Terrain erkunden, ihr wurde heiß, und jeder Widerstand brach in ihr zusammen.
Sie seufzte bei der Erinnerung, während sie sich vergewisserte, dass der kräftige Riegel der Glastür verschlossen war. Leise trällerte sie den Hochzeitsmarsch und überlegte dabei, ob sie jemanden kannte, der mit dem Reeder in La Lucia befreundet war, dessen Auftrag sich Martin erhoffte. Die Einzige, die ihr einfiel, war Tita Robertson. Gesellschaftlich durch ihren Vater die einsame Spitze der südafrikanischen Geldaristokratie, menschlich ein Schatz. Sie könnte helfen. Tita und Neil, ihr Mann, ein bekannter Journalist, waren enge Freunde der Steinachs, solange sie denken konnte.
Neil imponierte ihr. Ständig geriet er wegen seiner flammenden Artikel gegen die Apartheidregierung in Schwierigkeiten und er trug eine geheimnisumwitterte Narbe am Oberschenkel, von der gemunkelt wurde, dass sie von einer Polizistenkugel herrührte, die ihn während einer nächtlichen Razzia mitten im Schwarzen-Township Kwa Mashu erwischt hatte. Martin bezeichnete ihn als Liberalen. Das war das südafrikanische Synonym für den doppelschwänzigen Beelzebub aus dem schwärzesten Sumpf der Hölle. Als liberal gebrandmarkt zu werden bedeutete die gesellschaftliche Katastrophe und den geschäftlichen Tod. Aber Neil war der Mann von Tita, geborene Kappenhofer, der einzigen Tochter Julius Kappenhofers, dem reichsten und einflussreichsten Mann Südafrikas, und somit unantastbar. Belustigt beobachtete Jill, wie es Martin stets in große Konflikte stürzte, wenn er sie auf Partys traf. Nur zu gern hätte er die Robertsons geschnitten, das war sonnenklar, aber Tita und Neil standen stets im Mittelpunkt. Küsschen rechts, Küsschen links, wiegehtesIhremVaterbittegrüßenSieihnvonmir, zuprostend erhobenes Glas, Lächeln mit vielen Zähnen, und die schnellen Blicke über die Schulter, ob alle anderen auch sehen, wie vertraut man mit den Robertsons plaudert.
»Der macht mit Kaffern rum«, hatte Martin gehetzt, als er noch der pickelige Typ beim Schulcricket war, »so einer gehört an die Wand gestellt, und die Kaffern hätten wir damals alle zu Hitler schicken sollen, der wusste, wie man mit so was umgeht …« Martin bezeichnete sich als Deutschen, obwohl seine Familie wie ihre seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Natal siedelte.
»Wovon redet er?«, fragte sie ihren Vater, denn diese Bemerkung hatte sie nicht verstanden.
Phillip Court zog verächtlich seine Mundwinkel herunter. »Hör nicht hin, er ist nur ein dummer Junge, der plappert nur nach, was er in seinem Elternhaus aufschnappt.«
Sie fand es merkwürdig, dass ihr das ausgerechnet jetzt einfiel, wunderte sich, denn schließlich war Martin zu der Zeit praktisch noch ein Kind gewesen, erst zwölf Jahre alt oder so. Noch einmal rüttelte sie energisch an dem Türriegel. Er saß unverrückbar fest. Sie hatte sich getäuscht. Sie wandte sich um und stand sich plötzlich selbst im Spiegel gegenüber.
Die Zeit verschob sich, und nicht die junge Frau Anfang zwanzig im ärmellosen Hemd und knappen Höschen sah sie an, sondern das kleine, siebenjährige Mädchen, das vom Eigentümer des Ladens in Mtubatuba dabei erwischt worden war, als sie sich mit einem Schokoladenriegel in der Faust an der Kasse vorbeidrücken wollte. Es war ihr bisher unangenehmstes Erlebnis gewesen und das Donnerwetter ihres Vater ihre bisher größte Katastrophe.
Ihr Spiegelbild errötete noch nach all diesen Jahren vor Scham. Dann lächelte sie verlegen, und ihr stand wieder die junge Frau in weißem Hemd und Höschen gegenüber, die genauso wenig mit dem kleinen Mädchen von damals zu tun hatte wie Martin mit dem grässlichen Pickeljungen. Im Spiegel hinter sich sah sie das Telefon auf der Kommode stehen und beschloss, auf der Stelle ein kleines Schwätzchen mit Tita zu halten. Sie wählte ihre Nummer.
»Dies ist der Anrufbeantworter von Tita Robertson«, leierte die Ansage, und Jill wollte gerade auflegen, als die Stimme stockte. »Rupert, hör auf, du verdammter Köter«, zischte Tita und lachte dann los. »Also gut, wer ist dran?«, fragte sie, und als Jill sich meldete, lachte sie noch einmal. »Rupert, dieser verrückte Hund, ist ins Badezimmer gerannt, hat sich das Ende von der Klopapierrolle geschnappt, wetzt jetzt im Garten herum und wickelt die Büsche ein. Es ist erstaunlich, wie viele Meter auf so einer Rolle sind.«
Jill stellte sich Titas jungen Beagle vor, der mit wehenden Ohren durch den Garten sauste und alle Büsche mit Klopapier umwickelte. »Mach ein Foto, damit kannst du Christo Konkurrenz machen«, riet sie und trug dann ihr Anliegen vor. Nach wenigen Minuten legte sie höchst zufrieden auf. Tita kannte den Reeder und würde ein paar Worte seiner Frau gegenüber fallen lassen. Beziehungen waren doch mindestens der halbe Erfolg. Gähnend ging sie in Richtung des Badezimmers, freute sich auf eine lange, genussvolle Dusche. Sie war kaum drei Schritte zur Tür gegangen, als sie es wieder vernahm. Sie hielt den Atem an und lauschte. Es war absolut still im Raum, aber sie hatte etwas gehört, ganz deutlich. Sehr langsam wandte sie sich um und erstarrte.
Da war sie – und hatte den Blick unverwandt auf sie gerichtet.
Sie war wunderschön, das musste Jill zugeben. Große, kohlschwarze Augen, eine kurze Nase, schmaler, edler Kopf. Ihr Körper war schlank und elegant, glänzend grün mit goldenen Reflexen und einem Schimmer von Blau. Jill sah genauer hin, entdeckte keine schwarzen Punkte entlang ihrer Seite.
Keine harmlose Grasschlange. Eine grüne Baumschlange. Ihr Gift war tödlich. Aufs Neue wunderte sie sich, wie ein so zerbrechlich wirkendes Wesen die Macht hatte, einen Menschen zu töten. Das Reptil hing, seinen Leib um den blühenden Bougainvilleazweig gewickelt, der ein Stück weit durch das Fenster ins Zimmer ragte und den sie schon gestern hatte abschneiden wollen, wie ein elegant hingewischter grüner Pinselstrich in der Luft. Sie beugte sich vor. Das Tier war kaum eineinhalb Meter entfernt, seine spektakuläre Schönheit verriet ihr, dass es ein Männchen war. Weibchen waren matter gefärbt. Sie rührte sich nicht. Als kleines Mädchen hatte sie von Ben Dlamini, dem Zulu, gelernt, Schlangen zu verstehen. Ben war Nellys Mann und der Häuptling des kleinen Dorfes auf Inqaba, in dem alle Farmarbeiter wohnten. Ein Häuptling niederen Ranges nur, aber sich seiner Würde voll bewusst.
»Wenn du in den Busch gehst, werden viele Augen deinen Weg begleiten, auch wenn du meinst, du wärst allein. Du musst immer genau prüfen, wohin du deine Füße setzt, Intombazani, mein kleines Mädchen. Wenn sie dir feindlich gesinnt sind, zeigen sie sich nicht offen, sie verstecken sich und warten, bis du ganz nahe gekommen bist, und dann schlagen sie zu.«
Sie erinnerte sich noch genau, dass der alte Harry in diesem Moment vorbeiging und laut auflachte. Es klang wie eine Fanfare. »Ausgezeichneter Rat, Ben, hervorragend! Passt in allen Lebenslagen.« Als junger Mann war er Testpilot in der britischen Airforce gewesen, hatte irgendwann mal eine Kaffeeplantage in Angola geleitet und lebte heute in einem Rondavel abseits des Küchentrakts. Er war ein schweigsamer Mann und redete nur in militärisch knappen Sätzen. »Vergiss ihn nie, Jill!«, rief er.
»Du hörst es, kleines Mädchen«, nickte Ben, offensichtlich erfreut über das Lob, »also, geh nie in hohes Gras, ohne dich vorher bemerkbar zu machen.«
Sie lauschte mit großen Augen. »Warum denn das?«
Er lächelte. Nicht wie Daddy, der mit geschlossenen Lippen lächelte und dessen helle Augen oft ernst dabei blieben, auch nicht wie Mama, deren Lächeln fein war, träumerisch, sondern er lächelte mit seinem ganzen Körper. Seine vollen Lippen öffneten sich, zwei Reihen blendend weißer Zähne erschienen, die dunklen Augen begannen zu funkeln, aus jeder Pore strömte seine Fröhlichkeit, und Jill war sich sicher, dass die Sonne plötzlich strahlender schien. Sie liebte sein Lächeln.
»Ho«, rief er, »du musst natürlich anklopfen, wenn du in das Schlafzimmer der Schlange treten willst, sonst wird sie wütend.« Er gluckste vor Vergnügen, hob sie hoch und trug sie zu einem Kaffirbaum, dessen Name von seinem lateinischen Namen abgeleitet worden war, Erythrina Caffra. »Sieh genau hin, kannst du sie erkennen?«
Sie entdeckte nichts außer hellgrünen Blättern. Zwischen dem Grün leuchteten die Blüten, feurige Krönchen mit fedrigen Samenfäden. Endlich zeigte er ihr, wo die Schlange war. Zu einem Knäuel verknotet, lag sie in der Gabel zweier dicker Äste, ihre Schuppen braun wie die Borke des Baumes, den kleinen Kopf mit dem schnabelähnlichen Maul aufmerksam erhoben, die schwarzen Augen glitzerten.
»Was macht sie mit ihrer Zunge?« flüsterte Jill, fürchtend, dass die Schlange sie hören würde. »Will sie mich fressen?«
Ben warf den Kopf zurück und lachte, sein weicher Bauch bebte, und sie hüpfte in seinem Arm im Takt auf und ab. »Sie kann dich nicht hören, sie kann dich aber riechen, und das tut sie mit der Zunge. Sie schmeckt dich. Sie weiß, wie groß du bist und wie weit von ihr entfernt. Sieh, sie hat ihre Zunge geschluckt und legt sich wieder schlafen, weil sie weiß, dass du zu groß für sie bist. Aber vergiss nie, sie ist schnell wie ein fliegender Speer, und ihr Gift kann dich töten. Du musst lernen, wo die Grenze des magischen Kreises ist. Sie wird dich nur angreifen, wenn du diesen verletzt.« Die Stimme des großen Zulu war beruhigend wie das Schnurren einer Katze.
»Aber hüte dich vor der Königsschlange, der schwarzen Mamba. Stehst du je einer gegenüber, stell dich tot. Nicht einmal atmen darfst du. Und dann gibt es noch iVuzimanzi«, fuhr er fort, »sie ist schwarz und glänzend und lebt im Wasser. Sie frisst Fische und Frösche, aber manchmal gelüstet ihr nach anderem. Dann kriecht sie an Land, und wenn sie deinen Schatten beißt und dann Wasser trinkt, wirst du sterben, bevor sie ihren Durst gelöscht hat …«
Das kleine Mädchen schaute verstohlen hinunter, sah den eigenen Schatten auf dem Boden liegen. Schnell machte sie sich so klein es ging, auch der Schatten wurde klein, aber er blieb bei ihr.
»… doch es ist eine sehr langsame Schlange, du kannst ihr davonrennen«, hörte sie Ben. »Das musst du lernen, Intombazani, zu denken wie eine Schlange, dann weißt du schon vorher, was sie tun wird«, sagte er, trat vom Baum zurück und setzte sie ab.
Als sie den Boden berührte, wuchs ihr Schatten plötzlich ins Unermessliche. Sie erschrak fürchterlich, hüpfte hoch, drehte sich, versteckte sich hinter Ben, aber sie wurde den Schatten nicht los. Angst kroch ihr wie eine schleimige Schnecke über die Haut, und sie rannte weg, so schnell sie konnte. Aber nie schaffte sie es, ihrem Schatten davonzulaufen, auch wenn sie nur so dahinflog, als berührte sie kaum den Boden. Bens Rat vergaß sie jedoch nicht, lernte alles über Schlangen, lernte zu denken wie sie, und deshalb hatte sie keine Angst vor den schuppigen Schönheiten.
Ruhig streckte sie jetzt ihre Hand aus, bewegte ihre Finger, und als sie erkannte, dass die Schlange ihre Aufmerksamkeit voll darauf gerichtet hatte, trat sie nach links, zwei Schritte vor und legte sehr langsam die Hand um den Fenstergriff. Der Schlangenkopf folgte ihren Bewegungen ebenso unaufgeregt, und so erreichte sie, dass das Reptil nicht mehr frei hing, sondern der Länge nach auf dem Fenstersegment lag. Sie hob den Griff, kippte die Glasscheiben, die Schlange verlor den Halt und fiel auf die Veranda hinunter.
Sie sah dem Reptil nach, als es mit einer flüssigen Bewegung pfeilschnell über die Fliesen glitt, am seitlichen Geländer hoch und in die überhängenden Zweige des Mangobaums, ohne auch nur ein Blatt zu bewegen. Mit dem Kopf auf einer Frucht ruhend, erstarrte es, war nicht mehr zu unterscheiden von dem flirrenden Grün der Blätter. Die Mango war gelb mit einem roten Bäckchen wie ein Apfel.
Evas Apfel? Eine Schlange im Paradies? Nur flüchtig streiften diese Gedanken Jills Bewusstsein, drangen nicht tiefer. Sie sah nichts weiter als eine Schlange, keine Allegorie einer Bedrohung für ihr Leben, glaubte nicht, wie Nelly es getan hätte, dass einer ihrer Vorfahren sie durch die Schlange vor Unheil warnen wollte.
Eine halbe Stunde später, ihr Haar war noch feucht vom Duschen und ihre Haut glänzte vor Sonnencreme, packte sie ihre Kameratasche. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass auch alle Filter und das große Teleobjektiv an ihrem Platz waren, warf sie rasch ein langärmeliges Hemd und ihre Leinenschuhe in eine geflochtene Tasche, schob sich die Sonnenbrille ins Haar und verließ den Bungalow. Der Duft nach frisch gebackenem Brot zog sie unwiderstehlich zur Küche. Rasch lief sie über den Steg und den kurzen, gepflasterten Weg. Am Swimming-Pool zögerte sie einen Moment, das Wasser lockte, aber sie musste das frühe Licht ausnutzen. Roly und Poly schossen jaulend aus dem Gebüsch, sprangen schwanzwedelnd um sie herum, enthusiastisch verfolgt von der aufgeregt quiekenden Pongo, die ihnen alle paar Schritte in die Beine zwickte.
Eine Unkrautgabel flog aus dem Gebüsch, fiel klappernd vor ihre Füße, Handschaufel, Astschere folgten, und endlich traf ein Bündel abgeschnittener Dornenzweige ihre nackten Beine. Sie schrie auf. Daraufhin raschelte es, und ein Schwarzer, ein breitschultriger, gut aussehender Mann von ungefähr vierzig Jahren, erhob sich im Laub. »Aii, Morgen, Ma’m, tut mir Leid, Ma’m!« Vergnügt lachte er zu ihr auf und kämpfte sich aus dem Gebüsch hervor, sammelte rasch sein Werkzeug ein.
»Dabu, guten Morgen, geht dir es gut? Deinen Kindern und deiner Frau auch?« Eigentlich hieß er Dabulamanzi-John, aber das war einfach zu lang. Sein Name bedeutete, dass er die Wellen des Meeres teilen konnte. Als Erster seiner Familie hatte er Schwimmen gelernt. Jill hatte ihm einmal zugesehen. Mit seinen muskelbepackten Armen, die großen Hände als Schaufelräder nutzend, pflügte er durchs Wasser, seine Beine stampften wie das Kolbengestänge einer Dampfmaschine. Berührte Dabulamanzi mit diesen groben Händen jedoch eine Pflanze, erschien dem Beobachter, dass sie sich aufrichtete, ihm die Blätter zuwandte, glänzte und wuchs. Er war ein begnadeter Gärtner. Morgens zum Sonnenaufgang machte er seinen Kontrollrundgang. Jill hörte ihn dann oft mit den Pflanzen reden, als wären es seine Freunde. Sie dankten es ihm mit üppigem Wachstum. War er einmal krank, schienen auch sie dahinzuwelken, bekamen schlaffe Blätter und ihr Grün verblasste. »Der Bohrwurm frisst unseren Hibiskus, Ma’m, wir müssen die Spritze holen.«
Jill stieß einen unterdrückten Fluch aus und blickte hinüber zu der prächtigen vielfarbigen Hibiskushecke, die am Haus leuchtete. Die Larve des Bohrkäfers höhlte Stamm und Zweige der Hibiskusbüsche aus und brachte sie innerhalb kürzester Zeit um. Die einzige Möglichkeit, den Bohrern auf den Leib zu rücken, war, Gift mit einer Spritze in den Stamm zu injizieren. Aber meist half auch das nicht. »Schneid sie runter bis auf das gesunde Holz, verbrenn die Abschnitte. Ich besorge das Gift und Siegelwachs … Pongo, du Mistvieh, lass das!«, quietschte sie. Das Warzenschwein hatte von den Hunden abgelassen und sich auf ihre Fersen gestürzt.
Dabu verschwand im Blättergewirr, sie ging dem Brötchenduft nach. Die Dobermänner trotteten hinter ihr her, Pongo war vorausgerast und kniete sich am Wegrand auf die Vorderbeine, das Hinterteil mit dem dünnen Schwänzchen hoch aufgerichtet, und rupfte Gras. Wie immer reizte sie der Anblick zum Lachen, sie empfand Warzenschweine als völlige Fehlkonstruktion. Am Haus angelangt, schloss sie die Eingangstür auf. Die Hunde setzten sich leise fiepend auf die Hinterbeine, legten die Köpfe bittend schief.
»Ihr bleibt draußen«, beschied sie ihnen. Pongo war verschwunden. Energisch klappte sie die Tür zu und bog in den langen Gang zur Küche ein. Ihre nackten Füße klatschen leise auf den honigfarbenen Fliesen. Trotz des frühen Morgens waren sie warm, jetzt im Sommer kühlten sie auch nachts kaum ab. Jill stieß die Schwingtür zum Küchentrakt auf, der in einem Anbau untergebracht war. Nelly stand über den Tisch gebeugt, der eine Insel in der Mitte der großen Küche bildete und dessen Arbeitsfläche wie die der hellen Holzeinbauküche weiß gefliest war. Mit flinken Händen rollte die alte Zulu deftig aus runden Teigportionen Brotstangen. Fünf lagen schon auf dem Blech vor ihr, sie legte die sechste dazu, schnitt in jede drei Kerben, puderte ein wenig Mehl darüber und schob sie in den Herd.
Unter einem blau karierten Geschirrtuch ruhte eine Teigkugel, ein Korb mit frischen Brötchen stand daneben. Drei dampfende Weißbrote kühlten auf einem Metallrost neben der alten, rußgeschwärzten Feuerstelle, die vor hundertfünfzig Jahren das Herz der Küche gewesen war. Irgendeiner der früheren Steinachs hatte sie gezähmt und einen Schornstein daraufgesetzt. Heute wurde sie in den kältesten Wintertagen manchmal als Kamin benutzt. Die Mahagoni-Anrichte gegenüber zierte eine Schale mit Mangos, Guaven und einer leuchtend gelben Ananas. Die Tür zum Hof war offen, die Sonne strömte durch die Fliegengittertür gefiltert herein. Mehlstaub tanzte in den Strahlen, ihre Hitze mischte sich mit der des Backofens, das Aroma des frischen Brotes mit dem süßen Duft des Obstes.
Sie schnupperte. »Köstlich. Sakubona, Nelly, geht es dir gut?« Eigentlich hieß die Zulu Nelindiwe Dlamini, wurde aber nur Nelly genannt und war ihre Nanny gewesen. Seitdem Jill ihrer Fürsorge entwachsen war, kochte Nelly für die Familie.
Die alte Frau richtete sich auf, ihre rechte Hand in den Rücken gepresst, als hätte sie dort Schmerzen, mit der anderen strich sie sich über die Stirn und hinterließ einen weißen Mehlstreifen auf ihrer dunkelbraunen Haut. »Yebo, Sakubona, Jill!« Sie lächelte breit. »Möchtest du Kaffee? Es ist welcher in der Kanne.« Sie wischte die Hände an der blauen Schürze ab, die sie über einem geblümten Kittel trug. Ihr Atem rasselte in der Lunge.
»Nein, danke, ich will gleich los, aber ich werde mir zwei Brötchen streichen. Warum lässt du dir eigentlich nicht von Thoko oder Bongi helfen? Dein Asthma klingt nicht gut.« Die beiden jungen Mädchen waren Nellys Nichten. Jill stellte die Kameratasche auf dem Tisch ab. Aus dem mannshohen Eisschrank holte sie Butter und Honig heraus, schnitt die Brötchen auf und strich beides dick auf die warmen Hälften.
Nelly stemmte die muskulösen Arme in die Seiten. Sie stand da, breitbeinig, ihre schwere Gestalt massig wie ein verwitterter brauner Monolith. »So, du denkst also, Thokozani kann Brot backen, he? Bin also zu alt. Ha!« Ihre dunklen Augen schossen empörte Blitze. »So was hat Thoko nicht in ihrer Schule gelernt. Und Bongiwe, dieses flatterhafte Ding, sie darf in der Küche nur den Fußboden wischen, sonst nichts.«
Jill unterdrückte ein Lachen. »Nelly, nie wird jemand ein Brot backen, das so gut ist wie deines, aber Thoko könnte dir das Kneten abnehmen, und wenn du ihr das Backen beibringst …«
Nelly ließ ihr keine Gelegenheit, den Satz zu beenden. »Nein!« Das Wort explodierte förmlich aus ihrem Mund.
Jill verkniff sich eine Antwort. Die alte Zulu lebte in ständiger Furcht, im Alter beiseite geschoben zu werden, wollte nicht glauben, dass ihr Platz nie von einer anderen eingenommen werden würde. Die Erfahrung sagte Jill, dass sie diesen Rest von Misstrauen, den Nelly gegen alle Weißen hegte, nie würde aus dem Weg räumen können. Nelly hatte Tommy und sie großgezogen, schon ihre Mutter als Kind betreut. Sie gehörte zur Familie, trotzdem misstraute sie sogar ihr. Die Erkenntnis tat weh, denn als Kind hatte sie die Schwarze Umame genannt, Mutter. »Ich bin glücklich für dich, dass du dich stark fühlst.«
»Hmm«, brummte Nelly und zog das karierte Geschirrtuch von der Schüssel, die vor ihr stand. Der aufgegangene Teig sank mit einem Seufzer in sich zusammen. Die Schwarze schob ihn auf ihr Knetbrett und formte ihn zu einem Kloß.
Die Fliegentür quietschte. Ein Junge in einem rot-weiß geringelten Pullover und kurzen Hosen stand vor Jill. Zwischen seinen Beinen sauste Pongo mit steil aufgerecktem Schwanz in die Küche, drehte eine Runde und entschwand wieder nach draußen, nicht ohne ihn kräftig in den Knöchel zu zwicken. Er schrie auf, offensichtlich mehr vor Schreck als vor Schmerzen. »Guten Morgen, Jonas, was machst du denn hier?«, fragte sie ihn, während sie die Spuren von Pongos Bissen an seinem Bein untersuchte. »Alles in Ordnung. Die Haut ist nicht verletzt.« Sie richtete sich wieder auf. »Musst du nicht zur Schule?« Er war der Sohn von Nellys Tochter Nomusa, die vor elf Jahren bei seiner Geburt gestorben war. Seitdem lebte er bei Nelly und Ben, ein leiser Junge mit wachen Augen.
Er zeigte seine kräftigen weißen Zähne in einem strahlenden Lächeln. »Es ist Sonnabend, Madam, wir haben keine Schule heute.« Der Blick seiner großen braunen Augen unter den aufgebogenen Wimpern lag verlangend auf den Brötchen.
»Nimm dir eins.« Sie schob ihm Butter und Honig hin, bevor Nelly es verhindern konnte. Die Zulu achtete strikt darauf, dass jeder den Platz einnahm, der ihm zustand, und Jonas’ Platz war ihrem Verständnis nach unten in den Hütten. »Raus mit dir«, knurrte sie jetzt, »hilf Ben auf dem Feld. Und du musst die Kühe melken«, schrie sie hinter ihm her, als er gehorchte.
Im Hintergrund lief leise ein Radio. Es stand neben dem Herd. Jill vernahm noch die letzten Worte der Nachrichten. »Zeit für den Wetterbericht«, murmelte sie und drehte es lauter.
»Heute ist wieder ein herrlicher Tag in Südafrika«, verkündete der Wetteransager, »und so wird es bleiben. Sonne, Sonne, Sonne.«
Nellys Augen weiteten sich. In sich versunken, als lauschte sie einer inneren Stimme, starrte sie auf etwas, das Jill nicht sehen konnte. »Es wird heute regnen«, bemerkte sie düster und klatschte einen Teigkloß auf ihr Knetbrett.
»Sprechen da mal wieder deine Knochen?« Jill schmunzelte belustigt. Nelly und ihre Knochen hatten einen direkten Draht zum Wettergott, und ihre Vorhersagen trafen meist zu.
»Es wird regnen«, wiederholte die Zulu und funkelte sie aus kohlschwarzen Augen an, drückte und quetschte den Teig, bis er zwischen ihren kräftigen Fingern hervorquoll, »das Unwetter wird an diesem Tag den Fluss überschreiten, aus einem Himmel von höllischer Schwärze werden krachender Donner und todbringende Blitze herniederfahren, und Regenmassen werden das Land verwüsten.« Ihre aufgerissenen Augen schienen auf einen Punkt gerichtet, der in der Zukunft lag. »Das Glück wird Inqaba verlassen und ein Schatten wird auf unserem Land liegen. Für sehr lange Zeit«, wiederholte sie leise ihre Worte vom Abend vorher.
Verblüfft starrte Jill sie an, öffnete ungläubig die Fliegentür und blinzelte in den sonnenüberfluteten blauen Himmel über Zululand. »Unsinn, es ist keine Wolke zu sehen.« Sie zuckte die Schultern. Nelly neigte zu dramatischen Aussagen.
»Ich kann es riechen. Es riecht nach Tod«, antwortete die Schwarze in einem Ton, der ein unmissverständliches Ausrufungszeichen hinter ihre Worte setzte.
»Red nicht von Tod«, rief Jill, aber Nellys düstere Worte kratzten nicht einmal die Oberfläche ihrer Selbstgefälligkeit an.
Das war die zweite Warnung. Auch die begriff sie nicht.
»Nelly, du nervst«, fuhr eine laute Frauenstimme dazwischen, »wir können keinen Regen gebrauchen, ich werde depressiv, wenn es regnet.« Irma, Mamas ältere Cousine.
Der Augenblick war vorbei, das Gefühl des Unbehagens verschwand. Jill drehte sich um. Irma, wie immer rundlich und prall wie ein Apfel, dabei zu einem appetitlichen Karamell gebräunt und dadurch jünger aussehend als ihre dreiundsechzig Jahre, nahm sich ein knuspriges Brötchen. Erst strich sie großzügig Butter darauf, dann fingerdick Honig und biss mit allen Anzeichen von Hingabe hinein. »Ich halte nichts von Diäten«, verkündete sie, »ich polstere meine Falten von innen aus, das schmeckt gut und spart den Schönheitschirurgen … sieh hier, alles noch ganz knackig.« Sie kniff sich in ihre vollen Wangen.
Es stimmte. Jill nahm sich vor, an diese Theorie zu denken, wenn die Zeit da war. »Wie geht’s, Irma?«
Irma kaute den Happen herunter. »Schrecklich. Bin im Stress. Ich fliege heute zurück, und du weißt, dass ich das Fliegen hasse, wie deine Mutter.« Das schwarze, mit gelben Zetteln gespickte Notizbuch, das sie immer mit sich herumtrug, hatte sie auf den Küchentisch gelegt, ihre Umhängetasche aus knautschigem Leder daneben.
»Warum fährst du nicht mit dem Zug, da könntest du die Zeit sogar nutzen, um zu schreiben?«
»Ach, um Himmels willen, ausgeschlossen«, rief ihre Tante, offenbar ehrlich entsetzt, »zu laut, zu viel Volk – ja, ich weiß, ich bin ein Snob –, außerdem ist die Fahrt zu lang, da kriege ich Hühneraugen auf dem Hintern. Nein, nein, ich muss zurück nach Hause. Für die nächsten Wochen werde ich Telefon und Fax abstellen, mich von tiefgekühlten Pizzas ernähren und schreiben, schreiben, schreiben.« Gedankenverloren drehte sie eine glänzend blonde Haarsträhne. Aschblond, aus der Tube, wie Jill wusste. Ein Blusenärmel fiel zurück. Kleine weiße Narben leuchteten auf der tiefen Bräune der Handrücken und Arme. Irmas Haut, in vielen Jahrzehnten von der gnadenlosen afrikanischen Sonne verbrannt, hatte begonnen sich zu rächen. Regelmäßig musste Irmas Arzt verdächtige Hautveränderungen herausschneiden, regelmäßig erwiesen sie sich als bösartig. Zum Schutz trug sie langärmelige, dünne Leinenblusen im Stil eines Kosakenhemdes. »Wie geht es deinem Zukünftigen?«
»Gut, denke ich. Er ist heute in Durban und verhandelt wegen eines Auftrages für ein Haus in La Lucia.« Jill hockte sich auf die Tischkante. Irma liebte es zu schwatzen.
»Läuft nicht so gut, nicht wahr?« Irmas babyblaue Augen blinzelten arglos.
Jill kannte den Trick und ließ sich davon nicht täuschen. Irma war alles andere, nur nicht arglos. Sie kultivierte das Image der lustigen, runden Matrone, die ein wenig verrückt war, ein bisschen fahrig, und beim Sprechen riss sie ihre Augen meist weit auf, was ihrem apfelbäckigen Gesicht einen naiven Ausdruck gab. Es veranlasste ihre Gesprächspartner, jegliche Vorsicht außer Acht zu lassen und freiwillig ihre tiefsten Geheimnisse auszuplaudern. Manch einer von ihnen meinte später, sich als Figur in einem ihrer populären Romane wiedergefunden zu haben. Irma allerdings verneinte das immer vehement. »Warte ab, Martin fängt ja erst an. Er ist gut, er wird sich durchsetzen«, antwortete Jill ihr jetzt kurz.
»Könnte es an seinen überkandidelten Entwürfen liegen, dass es sich so schleppend anlässt?« Irma bestrich ein zweites Brötchen. »Denn wer will sein Haus in der Erde verbuddeln und den Garten auf dem Dach haben? Hat er diese Ideen aus der alten Heimat mitgebracht? Denk bloß mal an das Ungeziefer in diesem Klima. Und die Schlangen. Sollte er mal drüber nachdenken.«
»Davon verstehst du nichts, du bist keine Architektin«, beschied Jill ihrer Tante, die Worte Martins benutzend, als sie ihm genau dasselbe gesagt hatte, »du wirst sehen, bald ist er berühmt, dann werden ihm alle nachlaufen.« Ihr Ton machte klar, dass sie keine weiteren Sticheleien duldete.
»Natürlich, natürlich«, stimmte Irma fröhlich zu und löffelte üppig Honig auf die verbleibende Brötchenhälfte. »Grüße dein Bruderherz von mir, wenn du ihn siehst.«
»Mach ich. Ich werde ihn nachher anrufen, vielleicht können wir uns heute auf einen Kaffee in der Stadt treffen.«
»Charmanter Schlingel, ich bete ihn an«, seufzte Irma und putzte sich lautstark die Nase, »ich hab ihn im letzten Turnier vor acht Wochen in Kapstadt gesehen. Er hat nicht gut gespielt, ist schon in der Vorrunde rausgeflogen – scheint nicht genug zu trainieren, hat weniger Kondition als ich. Irgendwann bricht auch über ihn der Ernst des Lebens herein. Tennisspielen kann er doch nicht ewig. Hat er vielleicht eine neue Freundin, die ihn ablenkt?«
»Keine Ahnung. Außerdem ist er erst sechsundzwanzig und hat mindestens noch vier Jahre als Profispieler vor sich. Du vergisst, dass er auch noch Partner in einer Wirtschaftsprüferkanzlei ist.« Wie brachte es Irma nur fertig, sie immer in die Defensive zu drängen?
»Nun ja, da taucht er aber auch nur sehr selten auf, erzählte mir sein Partner, der, der Ordnung in meine Steuersachen bringt.« Sie kramte in ihrer Tasche herum, brachte ein Tablettenröhrchen zum Vorschein und schüttete zwei Pillen auf ihre Hand. »Nelly, bitte gib mir ein Glas Orangensaft. Ich hab rasende Kopfschmerzen.«
Nelly, die aus dem geschmeidigen Teig kleine Klöße geformt hatte, richtete sich auf, kratzte die klebrige Masse von ihren Händen, wischte sie an der Schürze ab, öffnete den Eisschrank, nahm den Orangensaft heraus, holte ein Glas aus der Anrichte, füllte es, stellte es auf ein kleines Tablett und servierte es Irma. Dann wandte sie sich wieder ihrer Arbeit zu.
Irma spülte die zwei Tabletten mit dem Saft hinunter und stellte das Glas ab. »Danke, Nelly. Übrigens, wenn dir die Arbeit hier zu viel wird, kommst du einfach zu mir nach Kapstadt und sorgst für mich und meine Katze. Dann vergifte ich mich nicht an Tiefkühlpizzas. Was hältst du davon?«
»Hoho«, lachte Nelly aus dem Bauch, »wer sollte dann für Miss Jill und Madam sorgen?«
»Du darfst auch in meinem nächsten Buch vorkommen«, lockte Irma listig.
Schlagartig wurde Nelly ernst, überlegte, schüttelte dann entschieden den Kopf. »Ich kann nicht in Madams Buch vorkommen, ich will hier bleiben. Ich würde sonst verloren gehen«, setzte sie leise hinzu.
»Da hörst du’s«, rief Jill, die genau wusste, dass Irma das Angebot ernst gemeint hatte, »lass die Finger von Nelly, verstanden! Wir brauchen sie. Wovon handelt dein neues Buch?«
»Ach, wie immer, von Menschen. Ein unerschöpfliches Thema. Liebe, Leidenschaft, Drama, Mord und Totschlag. Wie im richtigen Leben.« Sie fummelte einen Schlüssel aus den Tiefen ihrer geräumigen Umhängetasche und reichte ihn Jill. »Hier, mein Liebes, wenn ihr mal Ruhe haben wollt, könnt ihr im Spatzennest wohnen. Sicherlich wollt ihr auch einmal in die Zivilisation hinabsteigen, euch unter Menschen mischen, einen Film oder so ansehen, dann braucht ihr nicht nachts zurückzufahren – die Nacht kann man auch für angenehmere Sachen ausnutzen …« Ihr Schmunzeln war sehr anzüglich.
»Oh ja, allerdings«, lachte Jill und küsste sie. Spatzennest, so hieß Irmas Haus in Umhlanga Rocks, dem kleinen Ort, der fünfzehn Kilometer nördlich von Durban am Indischen Ozean lag, knapp zweihundert Kilometer von Inqaba. Es war eines der letzten Wochenendhäuser, die ursprünglich vor dem Ersten Weltkrieg in den Dünen von Umhlanga gebaut worden waren. »Vielen Dank, das ist sehr großzügig von dir.« Der Weg, der durch die Felder von der Hauptstraße zur Farm führte, war normalerweise eine steinharte Sandpiste. Doch nach jedem Regen bekam sie eine schmierseifenglatte Oberfläche und verwandelte sich bei einem anständigen Wolkenbruch in grundlosen Morast. Die Hauptstraßen im ländlichen Zululand waren zwar geteert, aber von Schlaglöchern in Badewannengröße durchsetzt. Man konnte nur in vorsichtigem Slalom vorankommen, lief Gefahr, mit einem platten Reifen liegen zu bleiben, und das war nachts nicht ratsam. Nicht auf diesen einsamen Landstraßen. Nicht in Natal, Südafrika.
Irmas Haus war das letzte vor der Umhlanga-Lagune, lag eingerahmt vom dichten Grün des Küstenurwalds auf dem Dünenrücken, der sich in wechselnder Höhe die gesamte Natalküste entlangzog, und bot einen atemberaubenden Blick über den Ozean, den Strand hoch nach Norden, nach Süden auf Umhlanga Rocks mit seinem rot-weißen Leuchtturm. An klaren Tagen glänzten Durbans Gebäude wie eine weiße Perlenkette in der Ferne. Es war nicht groß, nur ein Ferienhaus, aber der Name umschrieb seine wunderbare Atmosphäre. »Danke«, wiederholte sie.
»Ich muss mich sputen«, rief Irma und stob hinaus.
Nelly sah Irma nach. »Hoho, Tiefkühlpizzas«, gluckste sie. »Fährst du in die Stadt?«, fragte sie dann Jill. »Wir brauchen Tee.«
»Gut, ich bringe welchen mit. Ich muss zum Sharksboard, dem Hai-Institut. Sie zerlegen heute einen Hammerhai, ein Weibchen, und ich brauche noch ein paar Fotos für meine Unterlagen, danach sause ich in die Stadt, kläre noch etwas mit dem Blumenladen, der den Tischschmuck liefert, fahre beim Schneider vorbei, und dann hole ich meinen Verlobten ab. Heute ist Sonnabend, er wird früh fertig sein.« Sie biss von dem Honigbrötchen ab, nahm sich kauend noch eins, bestrich es und wickelte es in Butterbrotpapier ein. »Wegzehrung«, erklärte sie. »Ist Mama schon auf?«
»Glaube, ja«, brummte Nelly, »wozu musst du dir ansehen, wie so ein Monster, das Menschen verschlingt, von innen aussieht, möchte ich wissen?«, fragte sie mit gerunzelter Stirn.
»Weil ich in der Uni einen Vortrag über den Einfluss der Umweltverschmutzung auf die Sterblichkeitsrate der Haie halten muss.«
Nelly verzog das Gesicht. »Kannst du nicht über Vögel reden? Die sind hübscher und stinken nicht so.«
»Kann ich nicht, war kein anderes Thema frei. Außerdem stinken Haie nicht.«
»Der Teufel wohnt in ihnen«, wich die Schwarze aus und zog das karierte Geschirrtuch von der Schüssel, die vor ihr stand. Der aufgegangene Teig sank zusammen. Sie walkte ihn durch und formte ihn zu einem Kloß.
»Ach, Nelly«, lachte Jill, »es gibt keinen Teufel, keinen, der Weißen etwas antut. Eure Teufel haben alle Angst vor uns, das weißt du doch.« Sie öffnete die Fliegentür, wollte sich verabschieden.
Nelly klatschte den Teigkloß auf ihr Knetbrett. »Du wirst deinem Baby schaden«, bemerkte sie.
Jill fuhr herum, fing einen listigen Blick aus dunklen Augen auf, starrte Nelly völlig überrumpelt an. »Du kannst das nicht wissen«, stotterte sie endlich und verriet sich dabei, »ich habe es noch niemandem gesagt.«
»Ich weiß es«, wiederholte die Zulu und setzte ein überhebliches Gesicht auf.
Das Teströhrchen trug Jill noch immer in ihrer Handtasche herum. »Hast du in meinen Sachen geschnüffelt?«, platzte sie heraus und bereute es sofort. »Entschuldige, das hab ich nicht so gemeint …«
»Phhh«, machte Nelly verächtlich und schob die Unterlippe vor, »ich kann es hören, es spricht zu mir. Ich bin eine Zulu, ich habe die Gabe.«