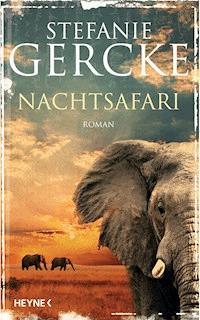6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Sehnsucht stärker ist als alle Vernunft... Vor Jahren mussten Henrietta und ihre Familie aus dem von Rassenhass zerrissenen Südafrika fliehen. Doch dem Ruf des Schwarzen Kontinents kann sich Henrietta nicht entziehen, und immer stärker wird in ihr der Wunsch, das Land wiederzusehen, das in ihrem Herzen ihre Heimat geblieben ist. Henriettas Mann Ian plagen dagegen noch immer Alpträume von seiner Flucht aus Afrika. Als er aber sieht, wie sehr seine Frau unter ihrem Heimweh leidet, wagen die beiden einen Neubeginn. Und Südafrika wird – trotz aller Angst und aller Sorgen um die eigene Sicherheit – wieder das Land ihrer Herzen. Eine dramatische und gefühlvolle Saga von der Autorin der Bestseller »Ich kehre zurück nach Afrika« und »Ein Land, das Himmel heißt«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Stefanie Gercke
Ins dunkle Herz Afrikas
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vor Jahren mussten Henrietta und ihre Familie aus dem von Rassenhass zerrissenen Südafrika fliehen. Doch dem Ruf des Schwarzen Kontinents kann sich Henrietta nicht entziehen, und immer stärker wird in ihr der Wunsch, das Land wiederzusehen, das in ihrem Herzen ihre Heimat geblieben ist. Henriettas Mann Ian plagen dagegen noch immer Alpträume von seiner Flucht aus Afrika. Als er aber sieht, wie sehr seine Frau unter ihrem Heimweh leidet, wagen die beiden einen Neubeginn. Und Südafrika wird – trotz aller Angst und aller Sorgen um die eigene Sicherheit – wieder das Land ihrer Herzen.
Eine dramatische und gefühlvolle Saga von der Autorin der Bestseller Ich kehre zurück nach Afrika und Ein Land, das Himmel heißt.
Inhaltsübersicht
März 1968 – Ein ausgetrampelter Nashornpfad im Busch von Zululand
Mittwoch, den 8. November 1989 – einundzwanzig Jahre später in Hamburg
Die Jahre dazwischen – Afrika
September 1972 – Afrika!
Juni 1976 – Natal
März 1985 – Hamburg
Mittwochabend, den 8. November 1989 – in Hamburg
Donnerstagabend, den 9. November 1989 – in Hamburg
Sonntag, den 10. Dezember 1989 – in Hamburg
Freitag, den 22. Dezember 1989 – Flug nach Durban
Sonnabend, den 23. Dezember 1989 – Landung in Durban
Umhlanga Rocks – kurz nach Weihnachten 1989
Montag, den 31. Dezember 1989 – im Haus Robertson
1. Januar 1990 – in Marys Umuzi
2. Januar 1990
3. Januar 1990
4. Januar 1990 – auf Jill Courts Gästefarm
Januar 1990 – Hamburg
Januar 1991, Hamburg
Frühjahr 1994 – Hamburg
Das letzte Kapitel
März 1968Ein ausgetrampelter Nashornpfad im Busch von Zululand
Die Sommerregen waren spärlich gefallen dieses Jahr, und flirrende Hitze lag über dem weiten Tal. Die brutale afrikanische Sonne versengte Grasspitzen zu stumpfem Gold, sog den Saft aus Bäumen und Blättern, entzog der Haut aller Lebewesen auch noch den letzten Rest von Feuchtigkeit. Der glühende Himmel erstickte jedes Geräusch. Das hohe Sirren der Zikaden, das sanfte Gurgeln des Flusses, das Knistern des trockenen Buschs verstärkten nur die Stille. Die Vögel duckten sich in den tiefen Schatten, Reptilien suchten Kühlung in ihren Löchern unter den Felsen, zwei Flusspferde trieben reglos in einem Wasserloch, Augenhöcker und Nüstern aufmerksam aus dem Wasser gestreckt. Der Schlamm auf ihren massigen Rücken war zu einer gelben Kruste getrocknet.
Die beiden Männer gingen hintereinander auf dem schmalen Sandweg, der sich zwischen Dickicht und Felsvorsprüngen an dem abfallenden Ufer des träge fließenden Flusses dahinschlängelte. Der hintere trug die Kakiuniform eines Wildhüters, die Maschinenpistole hing am Riemen über seine rechte Schulter, in seiner linken Faust hielt er einen Strick, mit dem die Handgelenke des anderen Mannes auf dem Rücken gefesselt waren. Blut tropfte dem Mann, der fast einen Kopf größer war als der Wildhüter, aus einer Halswunde, trocknete auf Schulter und Rücken seines T-Shirts zu einer steifen, rostroten Fläche. Schweiß rann ihm in Strömen aus den schwarzen Haaren, lief ihm in die Augen, die er gegen die gleißende Helligkeit zu Schlitzen geschlossen hielt. Als ein Sonnenstrahl sie traf, blitzten sie in einem ungewöhnlich intensiven Violettblau auf.
Die Entzündung der Wundränder, die bereits die Haut rot färbte, verursachte ihm erhebliche Schmerzen, und der Schock über seine Gefangennahme verlangsamte noch immer seine Reaktionen. Innerlich flüchtete er sich zurück in die Arme der Menschen, die sein Leben bedeuteten, seine Frau, seine Kinder. Seine Familie. Vor vier Tagen war er geflohen, um sein Leben zu retten, und er hatte sie allein zurückgelassen. Wo mochten sie jetzt sein? Die Sonne stand noch nicht im Zenit. Etwa zehn Uhr, schätzte er es. Hatten sie die Tage ohne ihn wie immer verbracht? Hatten sie gegessen, geschlafen, waren an den Strand gegangen, hatten Freunde getroffen?
Nein, dachte er, das konnte nicht sein, es war unmöglich, dass das Leben einfach so weiterging, seit er ihr die letzten Worte zugeflüstert hatte. Ich liebe dich, Honey, mehr als mein Leben.
Ihre Antwort war nur ein Hauch gewesen, aber sie hallte in ihm nach wie Kirchengeläut. Ich liebe dich, mein Herz, ich liebe dich.
In einer Woche ist alles vorbei, hatte er ihr versprochen, warte auf mich im »Belle-Epoque«.
In einer Woche! Vier Tage ab heute gerechnet, die tiefer schienen als jede Schlucht, höher als jeder Berg, weiter als jeder Ozean. Das Seil schnitt in seine Handgelenke, er fühlte den Lauf der Maschinenpistole im Rücken. Er musste sich befreien! Ihretwegen musste er es schaffen. In vier Tagen würde sie im »Belle-Epoque« sitzen, dem Hotel am Genfer See, die Arme schützend um die Zwillinge gelegt, und warten. Jede Faser ihres Körpers würde auf ihn warten. Sie würde sich mit den Kindern beschäftigen, sich ablenken, für sie würde sie fröhlich sein, sich nur jede Stunde erlauben, auf die Uhr zu sehen. Aber die Zeit würde verrinnen wie Wasser im Sand, und sie würde warten. Wann würde sie unruhig werden? Wann würde sie wissen, dass er nicht mehr kommen würde – nie mehr kommen würde?
Plötzlich, aus weiter Ferne, irgendwo aus dem Hitzeschleier über dem Busch, klang schwach das aufgeregte Kläffen mehrerer Hunde herüber, die offenbar seine frische Fährte gefunden hatten.
Der Mann mit den gefesselten Händen zuckte zusammen, alle seine Sinne vibrierten. Hunde! Polizisten suchten ihn, Agenten des Büros für Staatssicherheit, im Volksmund BOSS genannt. Schon seit Tagen waren sie hinter ihm her. Aufs Höchste gespannt lauschte er auf das aufgeregte Gebell der Hunde.
»Die Hunde sind am schlimmsten, riesige, gelbe Viecher – Ridgebacks, für die Löwenjagd gezüchtet. Die haben ein Gebiss wie eine Hyäne und sind angriffslustig wie ein Hai im Blutrausch«, hatte Vilikazi, sein schwarzer Freund, ihn gewarnt. »Sie mischen ihnen etwas ins Futter, es macht sie rasend. Die springen dich an und reißen dir glatt die Kehle raus!« Seine Grimasse war überdeutlich gewesen. »Dann kannst du nur hoffen, dass sie dich erschießen, bevor die Hunde dich zerfleischen!«
Wurde das Gebell lauter? Kamen die Hunde näher? Vor Jahren, nachts im Busch, hatte er jene entsetzlichen Laute gehört: Knurren, Grollen, Jaulen, dazwischen jämmerliches Blöken, dann ein Schrei, der sich ins Kreischen steigerte und in einem langen Seufzer erstarb. Danach nur noch Schmatzen, Knacken von Knochen, Schlürfen von Blut. Im Scheinwerferlicht hatte er sie dann entdeckt: eine Meute von Hyänen, die eine zierliche Impala gerissen hatten. Ihre Gesichter waren nass vom Blut der Gazelle, es tropfte ihnen von den Lefzen, färbte ihre Brust und ihre Läufe. Kurz hatten sie in das Licht gestarrt, dann machten sie sich wieder über ihre Beute her.
Würde er bald die Beute der Ridgebacks sein, würden sie sein Blut trinken?
Halt die Klappe, du Bastard, schrie er sich innerlich an, du musst für sie und die Kinder am Leben bleiben!
Die Polizei war längst bei ihr aufgetaucht, dessen war er sich sicher, die Agenten, die Männer mit den kalten Augen und harten Gesichtern. Sie würden fragen, fragen, fragen, immer wieder fragen. Wo ist Ihr Mann, raus mit der Sprache, wo ist Ihr Mann?
Und dann schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, den er bisher nicht zugelassen hatte. Was würden diese Männer einsetzen, um sie zu einer Antwort zu zwingen?
Er stöhnte auf. Wie habe ich sie allein lassen können, was habe ich ihr angetan? Er sah sie vor sich. Sie war so schmal geworden in den letzten zwei Wochen, ihre blauen Augen hatten ihren Glanz verloren, ihr Lachen, dieses strahlende Lachen, war verschwunden, hatte einer marmornen Versteinerung Platz gemacht,
Er stolperte, fühlte den Schlag der Waffe des Wildhüters im Kreuz, und das riss ihn aus seiner Verzweiflung, seine Kraft kehrte wieder. Ich bringe dir dein Lachen zurück, Liebes, ich verspreche es! Er richtete sich auf. Seine Häscher würden leer ausgehen.
Kleine Fliegen krochen ihm in Nase und Ohren, saßen auf seiner Wunde, bissen schmerzhaft zu, sobald sie einen Tropfen Feuchtigkeit fanden, winzige Zecken überfielen ihn, hingen mittlerweile in Trauben an seinen Beinen. Die Stellen, wo sie ihre Kieferklauen tief in seine Haut geschlagen hatten, juckten zum Rasendwerden, aber das ließ seinen Widerstand nur umso größer werden.
Das Gebell erstarb, die Hunde schienen die Fährte wieder verloren zu haben. Sein Herz schlug wieder normal. Sie gingen weiter.
Der schlammige Fluss neben ihnen gurgelte leise, der Pegel in der Sommerhitze war so weit abgesunken, dass sich Sandinseln in seinem Bett gebildet hatten. Weiße Reiher und Pelikane standen in Gruppen, putzten ihr Gefieder oder verschliefen den heißen Tag mit dem Kopf unter den Flügeln. Ein Nashornvogel quorrte. Auf den abgeschliffenen Felsen in Ufernähe lagen übereinander fußballgroße Halbkugeln.
Schildkröten, dachte der Gefangene und wünschte sich, sie seinen Kindern zeigen zu können, wie er es ihnen schon so lange versprochen hatte. Aber immer war »morgen« noch Zeit dazu gewesen. Bis zum letzten Donnerstag, als es diese Zeit plötzlich nicht mehr für ihn gab.
Vielleicht sind es ja nur Hyänen, hoffte er, und nicht die Polizisten mit ihren Löwenhunden. Gab es hier überhaupt Hyänen? Er rieb seine Handgelenke aneinander, versuchte, den Knoten zu lösen, der sie fesselte, doch der Wildhüter hielt den Strick straff. Jede Bewegung zog ihn enger zu, schnürte ihm das Blut in den Händen ab. Mistkerl!
Eines Tages werde ich sie hierher führen, schwor er sich und schätzte die Breite des Flusses ab und ob er es schaffen würde, ihn zu überqueren, bevor ihn die Kugeln des anderen trafen. Unmerklich ging er langsamer, der Strick hing durch, und mit einem heftigen Ruck gelang es ihm, die Schlinge um seine Handgelenke etwas zu lockern. Sofort drehte er sie so, dass der Wildhüter es nicht bemerkte.
Die rote Erde unter seinen Füßen war von vielen Hufen zu feinem Staub gemahlen. Kaum merklich war die Luft weicher geworden, leichter zu atmen als dieser glühend heiße Hauch, der geradewegs aus einem Hochofen zu entweichen schien. Auch die Pflanzen wuchsen üppiger, ihr Grün war saftiger als in der ausgetrockneten Savanne. Es musste ein größeres Wasserloch in der Nähe sein.
Ein lianenumrankter Ast bog sich über den Weg, Blattranken griffen nach ihm, Dornen wie große Widerhaken rissen an seiner Kleidung. Eben wollte er ihn mit den Schultern aus dem Weg schieben, als er die grüne Baumschlange entdeckte. In graziösen Schlingen hing sie im Astgewirr. Er duckte sich, wich ihr gerade noch aus. Hätte sie ihn erwischt, direkt in die Arterie getroffen, wäre er tot gewesen, bevor er den Boden berührt hätte, das wusste er von seinem Freund, der Schlangen fing, um sich sein Studium als Zoologiestudent zu verdienen – Schlangenland nannte er diese Gegend.
Der Mann war jetzt hellwach, sein Organismus arbeitete auf Hochtouren. Ich werde es schaffen, mein Liebling, ich lass euch nicht allein! Sorgfältig achtete er auf jeden seiner Schritte, aufmerksam suchte er Pfad und Buschrand mit den Augen ab, hielt nach einer Möglichkeit Ausschau, dem Mann, der ihn wie einen Hund an der Leine führte, zu entkommen. Der Weg wand sich unter ein paar Bäumen entlang, vertrocknete Blätter raschelten unter ihren Schritten.
Sie döste ein paar Meter vor ihm, das braungelbe Diamantmuster ihrer Schuppen vermischte sich so vollständig mit dem sonnengesprenkelten, toten Laub, dass er sie nur durch Zufall entdeckt hatte. Er erschrak. Eine Gabunviper.
Der Mann hatte eine solche Schlange erst einmal gesehen. Sein Freund, der seine Doktorarbeit über diese Schlangenart schrieb, hatte sie gefangen. Er hielt die Viper am Kopf, zwang ihr Maul auf, und die fast fünf Zentimeter langen Giftzähne waren wie gebogene Injektionskanülen aus ihrem Ruheplatz im oberen Kiefer heruntergeklappt. Er massierte ihre Giftdrüsen, bis das Gift der Viper in einem scharfen Strahl herausspritzte und im Nu ein halbes Sektglas füllte.
Ohne sie aus den Augen zu lassen, ging der Gefesselte auf die perfekt getarnte Schlange zu, wich ihr nur knapp aus, wusste, dass die Gabunviper friedfertig war und sich auf ihre Tarnung verlassen und nicht rühren würde, hoffte, dass sein Hintermann sie zu spät bemerken und auf sie treten würde. Sein Herz hämmerte, als er auf den Aufschrei des Mannes hinter ihm wartete, und er dachte nicht eine Sekunde darüber nach, dass er ihn zu einem qualvollen Tod verurteilte.
Trockenes Auflachen antwortete ihm. »Lass das, Bürschchen«, sagte der Wildhüter, »ich hab sie lange vor dir gesehen.« Er zerrte an dem Strick, riss die Arme des anderen höher.
Der Gefangene stöhnte vor Schmerz, als sich durch die Bewegung seine Wunde am Hals ruckartig dehnte. Die Enttäuschung sickerte wie Gift in seine Knochen, machte ihm die Knie weich, er fühlte seinen Widerstand nachlassen. Mühsam zwang er sich weiterzumarschieren. Sein Puls blieb hart und schnell.
Immer war er ihnen Stunden voraus gewesen, durch den Busch geführt von kundigen Männern aus dem Stamm der Zulus, namenlosen Begleitern, die jeden Schritt in dieser wilden Gegend im Norden von Zululand kannten, jeden Wildpfad abseits der Straßen. Sie lasen in den Sternen, benutzten Sonne und Mond als Kompass, geknickte Zweige, abgerissene Blätter als Wegweiser. Nachts verschmolzen sie mit den Schatten, tagsüber waren sie der trockene Holzstumpf dort oder Teil jenes umKhulu-Baums, nicht zu unterscheiden von dessen braun gefleckter Borke. Sie hielten geheime Zwiesprache mit der Natur, verstanden, was der Honigvogel ihnen zurief, wenn er aufgeregt flatternd den Weg zum Bienennest wies, antworteten dem höhnischen Gelächter der Hyänen. »Ha, du Aasfresser, yebo, mpisi – ja, Hyäne, lach nur, wir fürchten dich nicht!«
Jeder der Männer begleitete ihn ein Stück des Weges, reichte ihn dann weiter an den Nächsten. Der letzte war ein älterer Mann mit ergrauten Pfefferkornhaaren und überaus lebendigen Augen gewesen. Kein Gramm Fett polsterte seine Knochen unter der ledrigen Haut. Barfuß lief er vor ihm durch den Busch, seinen Blick fest auf den Boden geheftet. Außer einer kurzen Begrüßung wechselte er kein Wort mit seinem Schützling. Nur als der überhitzt und müde auf einer Rast bestand und den dichten Schatten des Mdhlebe-Baums suchte, hielt ihn der Zulu davon ab.
»Der Baum beherbergt das Böse, er spricht zu dir und macht dich verrückt, bis du hin und her schwankst und vergisst, wer du bist.« Damit rannte er weiter, leichtfüßig, kein Schweiß verfärbte sein verblichenes Kakihemd. Manchmal sang er, eine seltsame Weise, zart wie der Windhauch, der durch die Blätter strich, beruhigend wie das Murmeln eines Bächleins, verführerisch wie die Töne einer Sirene, und ließ den Mann, der Mühe hatte, ihm zu folgen, obwohl er Jahrzehnte jünger sein musste, vergessen, dass er um sein Leben rannte.
Nachts schlief der Zulu eingerollt in seine Grasmatte, und vorgestern war er nicht wieder aufgewacht. Herzinfarkt, nahm der an, den er über den Fluss bringen sollte, weil er keine andere Erklärung hatte. Die aufgehende Sonne färbte eben die höchsten Hügelkuppen feurig orange, als er ihn fand. Der alte Mann war schon kalt und starr. Betroffen verweilte er ein wenig neben dem Alten, wachte über seine letzte Reise, gefangen in einem Gefühl, das nichts mit dem alten Mann, mit dem er nur einen Tag und eine Nacht zusammen gewesen war, zu tun hatte, nur mit Abschied und Alleinsein. Für eine Weile lauschte er dem werdenden Tag, dem Konzert der Waldvögel und dem Wind in den Akazien, fand für diese kurze Zeitspanne Frieden.
Er verscharrte den toten Zulu so gut es ging, rollte ein paar Felsbrocken darüber, um seinen Leichnam vor wilden Tieren zu schützen. Er prägte sich die Lage ein und machte sich allein auf den Weg.
Alles, was er über das Leben im Busch während seiner Jahre in Afrika gelernt hatte, kratzte er zusammen. Aber die großen Wildreservate hatte er mit seiner Familie in klimatisierten Autos durchquert, nachts in komfortablen Safaricamps geschlafen, wo es fließend heißes und kaltes Wasser gab und schwarze Kellner ihnen das Vier-Gänge-Menü servierten. Sieben Meter hohe Zäune schützten sie gegen das wilde Afrika, die Nacht hatte nichts Bedrohliches. Wenn mpisi, die Hyäne, lachte, Warzenschweine grunzten und das tiefe Gebrüll der Löwen die Erde unter ihren Füßen erzittern ließ, erschraken sie nicht. Der lang gezogene Todesschrei einer Antilope, das scharfe Knacken von Zweigen unter den vorsichtigen Tritten großer Tiere – alles gehörte zur Theaterkulisse Afrika und weckte sie nicht aus ihrem Schlaf, den sie von wachsamen Begleitern beschützt wussten.
So war es dem weißen Wildhüter ein Leichtes gewesen, ihn im Schlaf zu überraschen. Das war gestern Nacht gewesen, und seitdem hatten seine Verfolger aufgeholt.
Hinter sich hörte er, wie der Wildhüter seine Maschinenpistole spannte. »Die scheinen jemanden zu suchen – dich vielleicht? Wer bist du, he? Weswegen sind die hinter dir her?« Er stieß ihm den Lauf in den Rücken. »Raus mit der Sprache, ich will wissen, welches Vögelchen ich hier gefangen habe!«
Der Puls des Gefangenen schoss wieder in die Höhe. Er hat keine Ahnung, wer ich bin, und das heißt, die Kerle mit den Hunden haben noch nicht erfahren, dass ich in ihrer Nähe bin! »Ich bin Tourist aus Deutschland, und mein Auto ist zusammengebrochen, das hab ich doch schon gesagt. Ich hab mich im Busch verlaufen!« Er legte Empörung in die Worte.
»Erzähl weiter, ich liebe Märchen! Wo ist dein Fotoapparat, he? Und all das Zeug, was Touristen so mit sich herumschleppen? Außerdem rennen die meisten Touristen, die ich kennen gelernt habe, nicht in Tarnfarben herum.« Der Wildhüter zog ihm mit dem Waffenlauf das olivgrüne T-Shirt aus der Hose, lachte dabei unangenehm. »Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du bist einer von den Schweinehunden, die mit dem ANC gemeinsame Sache machen, das glaube ich! Meine Nase trügt mich nie. Ich kann riechen, wenn ein Elefant tückisch geworden ist oder ein Löwe zu alt, um zu jagen, und sich auf Menschenfleisch verlegt hat. Und Schweinehunde«, er rammte dem Mann die Maschinenpistole in den Rücken, »Schweinehunde, die riech ich aus jedem Misthaufen raus. Vielleicht hast du ja sogar eine Bombe gelegt? Antworte!« Der heftige Stoß mit dem Pistolenlauf traf den Mann an den Nieren. »Ich werd mal einen Schuss loslassen, das wird die mit den Hunden im Galopp hierher bringen, dann werden wir ja sehen, was los ist.«
Mit einem Klicken entsicherte er seine Waffe. In derselben Sekunde stolperte er plötzlich, knickte um und strauchelte. Der Kolben schlug auf den Boden, eine kurze Schussfolge löste sich, traf ihn am Kinn und riss seinen Körper herum. Die Finger seiner linken Hand öffneten sich, der Strick fiel heraus, und er verlor den letzten Halt, rutschte rückwärts über die glitschige Uferböschung und klatschte ins lehmgelbe Wasser. Die Maschinenpistole versank sofort.
Der gefesselte Mann wurde nach hinten gerissen, fiel hart auf den Rücken. Blitzschnell rollte er sich auf den Bauch, bog seine Hände auseinander, ruckte, drehte, zog, die Schlinge lockerte sich, und er bekam seine Hände frei. Er sprang auf, sah hinunter auf den Mann im Wasser.
Der Wildhüter lag mit dem Oberkörper im Uferschlamm, die Beine im Wasser. Er versuchte zu sprechen, aber die kurze Salve aus der Maschinenpistole hatte ihm den Unterkiefer zertrümmert, und die Worte quollen als blutige Blasen unter seiner Nase hervor.
Instinktiv streckte der Mann im olivgrünen T-Shirt ihm beide Hände entgegen, machte einen Schritt die Böschung hinab, als er aus dem Augenwinkel, keine zehn Meter entfernt, Schlamm aufspritzen sah. Er hielt inne, wandte den Kopf.
Eine feine, pfeilförmige Welle teilte die lehmgelbe Wasseroberfläche. Das Krokodil hob seine lange Schnauze, sog den Blutgeruch ein und schwamm dann in gerader Linie auf den Mann im Wasser zu.
Dieser schien die Gefahr zu spüren, strampelnd suchte er Halt im weichen Uferschlamm, ein Schwall von Blutblasen brach aus ihm heraus, aber alles, was der andere hörte, war unverständliches Gurgeln.
Mit einem grässlichen Schmatzen klappte das Krokodil sein zähnestarrendes Maul auf, erwischte das rechte Bein des Wildhüters, riss es mit einem mächtigen Ruck seines Saurierkopfes ab und warf es hoch. Das Blut spritzte in weitem Bogen. Das Reptil fing das Bein im weit geöffneten Rachen auf und verschlang es mit wenigen Kaubewegungen. Der Fuß mit dem braunen Feldstiefel verschwand als Letztes.
Der Verfolgte am Ufer hörte die Knochen krachen. Unter ihm schlug der Verletzte verzweifelt um sich, durchpflügte mit den Händen den nassen Sand nach Halt. Seiner entsetzlichen Verletzung war er sich offensichtlich nicht bewusst. Er erwischte eine Baumwurzel, zog sich hoch und hakte den Arm darüber. Blut pumpte aus seinem Beinstumpf, sprudelte hellrot über den ockerfarbenen Schlamm, wurde von dem trüben Flusswasser zu einem hellen Orange verdünnt. Aber allmählich nahm seine Haut die Farbe von Roggenteig an, Schock weitete seine Pupillen. Sein Arm geriet ins Rutschen.
Der andere Mann zögerte. Lass ihn, der schafft`s sowieso nicht, sieh zu, dass du davonkommst! Es ist deine einzige Chance!
Die Hunde schienen ihre Fährte wieder aufgenommen zu haben, ihr Gebell war deutlich zu hören, noch gedämpft von dem dichten Busch, der das flache Tal bedeckte und um die Hügelkuppen wuchs, aber es schien näher zu kommen.
Alarmiert sah der Flüchtling hinüber und dann unentschlossen auf den Schwerverletzten. Bloß weg hier, die bringen dich um, wenn sie dich finden. Wie willst du beweisen, dass du ihn nicht angeschossen hast?
Adrenalin schoss ihm durch die Adern, weckte den Fluchtinstinkt. Mit einem Satz sprang er auf den Weg hinauf, rannte zehn, zwanzig Meter, doch der Blick des verletzten Wildhüters schien sich schmerzhaft in seinen Rücken zu bohren. Noch ein paar Meter rannte er, dann blieb er stehen. Nach einem kurzen inneren Kampf siegten Jahrhunderte von Zivilisation in ihm, und er zwang sich zurück zum Ufer.
Als er sich zu dem Verletzten hinunterbeugen wollte, nun bereit, sein eigenes Leben zu riskieren, um den Mann zu retten, der ihn seinen Häschern ausliefern wollte, war dieser verschwunden. Einfach weg. Wäre da nicht das in dem jetzt einsetzenden heftigen Regen rasch versickernde Blut gewesen, der Mann am Ufer hätte an eine Illusion glauben können.
Ein Hund jaulte auf, Männerstimmen brüllten Unverständliches. Der Mann fuhr zusammen.
Er erinnerte sich an das Krachen der Knochen, als das Reptil das Bein des Wildhüters zermalmte. Für einen flüchtigen Moment hoffte er inständig, dass das Krokodil den Rest seiner Beute gefunden hatte. Es würde nicht genug von der Leiche übrig lassen, als dass man die Identität und Todesursache feststellen könnte! Ein letztes Mal strich sein Blick über die vom Regen zerhämmerte Flussoberfläche, dann hetzte er über das aufgeweichte Ufer davon und verlor sich bald in der dampfenden Regenwelt.
Er lief durch Regen und tanzende Nebelschwaden, durch hohes Gras und Sumpf, durchquerte schmale, liliengesäumte Wasserarme und das Wurzelgewirr der Mangroven. Moskitos tranken sein Blut, Egel saugten sich an seinen Waden fest, und Fliegen legten Eier in die Halswunde, aus denen später Maden hervorkriechen würden. Es kümmerte ihn nicht. Er sah nur ihre Augen vor sich und hörte ihr Lachen und lief ihr entgegen.
Er lief den Rest des Tages, die Nacht und den nächsten Tag hindurch, immer nach Norden, entlang dem Pongolafluss. Seine Sinne schärften sich. Tagsüber orientierte er sich am Sonnenstand, nachts leuchtete ihm der Mond. In der zweiten Nacht begleitete ihn der dumpfe Rhythmus von Trommeln einen Teil des Weges, unheimlich, beängstigend, und er erinnerte sich, dass die Tsonga hier am Fuß der Ubombo-Berge lebten. Friedliche Menschen. Er schlief kaum, ernährte sich von wilden Feigen, trank Flusswasser und überlebte.
Als er gegen Morgen des zweiten Tages Gemurmel hörte und den Rauch eines Lagerfeuers roch, erstarrte er in der Bewegung. Erst nach einer halben Stunde, in der er die Geräusche um sich herum identifiziert hatte, das Rascheln eines Tieres durch das Unterholz, Knacken von trockenen Ästen unter Hufen, schläfrige Vögel, die für ihren Gesang zum Sonnenaufgang übten, wagte er sich wieder zu bewegen und schlich vorwärts. Er lauschte mit jagendem Puls, und dann verstand er ein paar Worte.
Kein Englisch, kein Afrikaans, sondern Portugiesisch. Er hatte die Grenze überquert, er stand auf dem Boden Mosambiks, er hatte es geschafft!
Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne vergoldeten die Kronen der höchsten Bäume, die Vögel schüttelten ihr Gefieder und erhoben ihre Koloratursopranstimmen zum Himmel, Ochsenfrösche sangen die Bässe, Zikaden strichen die Saiten, und die tiefen, dröhnenden Rufe der Hornraben waren wie Paukenschläge. Die gewaltige Melodie ihrer Sinfonie stieg auf und erfüllte die Welt, erfüllte das Herz eines jeden, der ihr lauschen durfte. Der Mann sank auf einen Stein am Wegesrand, legte den Kopf auf seine Arme und überließ sich dem Sturm, der ihn schüttelte.
Als sein Blick wieder klar war, ließ er ihn noch einmal zurück über das Land schweifen, das nun unter düsteren Wolken lag. Der Horizont zerfloss hinter einem silbrigen Regenvorhang. Er stand im Sonnenlicht und konnte nicht mehr erkennen, woher er gekommen war.
Hoch über ihm zog ein Flugzeug seine Bahn, malte einen glänzend weißen Kondensstreifen an den durchsichtigen Morgenhimmel. Es flog nach Norden, und der Mann sah ihm nach. Hören konnte er es nicht, dafür flog es zu hoch. Es blinkte in der Sonne, erschien ihm als Symbol für Freiheit, Losgelöstheit von aller Erdenschwere, für Zukunft.
Er folgte dem Flugzeug auf seinem Weg, und plötzlich fing sein Herz an zu hämmern. Welcher Tag war heute? Rasch rechnete er nach, musste die Finger dazu nehmen, so aufgeregt war er. Dienstag musste es sein, Dienstagmorgen! Der Tag, an dem seine Familie das Land verlassen würde. Die Tränen rannen ihm über das Gesicht. Er hob die Arme, als wollte er ihnen zuwinken, blinzelte nicht einmal, ließ das Flugzeug nicht aus den Augen, bis es zu einem silbern blitzenden Punkt wurde und dann ganz im Dunst über Afrika verschwand. Sie waren in Sicherheit.
Warte auf mich, rief er ihr hinterher, ich bringe dir dein Lachen zurück.
Er fand seine Kontaktpersonen, verließ von Lourenço Marques aus mit dem Flugzeug das Land und war zur verabredeten Zeit in dem kleinen Hotel am Ufer des Genfer Sees und schloss nach einer Woche, die ihm länger erschienen war als die Ewigkeit, seine Familie in die Arme.
Doch der Blick des Sterbenden hatte sich in seine Haut geätzt, brannte unerträglich, und er wusste, dass er diesen Blick nie vergessen würde. Bis ans Ende seines Lebens würde er den Schmerz fühlen, die Augen des sterbenden Wildhüters sehen und sich erinnern, dass er gezögert hatte und deswegen ein Mensch gestorben war.
Auch als er längst zurück in seinem Land war, in Sicherheit, als er das Lachen wieder in ihrem Gesicht gesehen hatte, hörte er noch das Splittern der Knochen als Hintergrundgeräusch, und das blutüberströmte Gesicht des Wildhüters verfolgte ihn jede Nacht in seine Träume. Das Jagdgeläut der Hunde und die drohenden Rufe der Männer, die ihm so nahe gekommen waren, hallten in ihm nach, und im Traum wandte er sich wieder ab von dem Sterbenden und floh. Er rannte und rannte und rannte, mit hämmerndem Herzen und ohne Atem, bis er wusste, dass er es geschafft hatte. Nur sich selbst gestand er im Moment des Aufwachens ein, dass er immer wieder so handeln würde.
Tagsüber verachtete er sich dafür, doch der Konflikt wirkte noch lange in seinem Unterbewusstsein nach, und dann war er sich sicher, dass er nicht zurückkehren würde, dass er seinen Kindern nie die Schildkröten auf den Felsen im Fluss zeigen würde.
Das Leben ging weiter. Die Wunde an seinem Hals verschorfte, neue Haut bildete sich, und der Schorf fiel ab. Die rosa Narbe verblasste, und er vergaß sie bald. Nach und nach änderten sich auch seine Träume, bis er eines Tages aufwachte und endlich sicher war, dass er keine Schuld an dem Tod des Wildhüters trug. Nur das diffuse Gefühl von Bedrohung blieb, irrational, gedanklich nicht zu entwirren, und er merkte, dass er mit keinem über diese Tage im Busch reden konnte, nicht einmal mit dem Menschen, der ihm am liebsten war, ihm so nahe stand, dass er ein Teil von ihm geworden war, seiner Frau.
Mittwoch, den 8. November 1989 – einundzwanzig Jahre später in Hamburg
Als Henrietta Cargill am Morgen aus dem Haus trat, war der Herbst endgültig vorbei. Ein kräftiger Wind trug den ersten Hauch von Winterkälte aus Russlands Steppen mit sich, es roch nach Frost, und sie dachte an ihren Garten in Afrika.
Dort, an dem schmalen Küstenstreifen Natals in Südafrikas heißem Osten, wurde es jetzt Sommer, schäumten Bougainvilleas wie rote Wasserfälle über Mauern und Wände, und die Jakarandas trugen hellblaue Schleier zwischen frischem Grün. Nie war es wirklich kalt gewesen dort, und das rührte nicht nur von der Sonnenhitze her.
Sie war glücklich gewesen in ihrem Garten in Afrika, aber das war lange her, und seitdem hatte sie Afrika in ihrem Kopf eingemauert und lebte hier. Das Verlangen nach Licht und Wärme blieb, aber das war ja nichts Besonderes.
Ihr Garten lag jetzt in Norddeutschland, in Hamburg, ganz in der Nähe der Elbe, wo es viele Gärten gab, mit hohen Bäumen, sauber geschnittenen Rasenkanten und Beeten ohne Unkraut. Ihr Garten allerdings war anders. Prächtige rote Kletterrosen, sonnenhungrig wie sie, ersetzten ihr die Bougainvilleas, Kapuzinerkresse mit Blüten wie flammende Orchideen gaukelten ihr tropische Farbenpracht vor, großblättrige Bergenien, immergrün wie der Gartenbambus, erfreuten ihre Seele, wenn totes Laub die Erde bedeckte und die Bäume ihre blätterlosen Äste in einen kalten Himmel streckten. Die Kletterrose trug jetzt nur noch braunes, von Rosenrost geflecktes Laub, und die späten Dahlien, die Hibiskusbüschen ähnelten, faulten von innen her. Doch sie wusste, mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne würde ihr Garten sich wieder regen, und an Sommertagen, wenn er sonnenüberschüttet vor ihr lag, war sie in Afrika, erinnerte sich, wie sie sich fühlte, wenn sie glücklich war.
Entfernt, ganz entfernt tanzte dann diese Melodie in ihrem Kopf, eine hingehauchte Tonfolge, flüchtig, lockend, wie eine dahinwirbelnde Elfe. Papa hatte sie oft gesummt, nur wenige Takte, und sie hatte gewusst, dass auch er dann wieder in seinem Afrika war.
»Bald gehen wir wieder rüber«, sagte er jedes Mal, wenn sie sich sahen, und meinte auf seine Insel nach Afrika. So lange sie sich zurückerinnern konnte, träumte er davon. Dann stand er am Fenster, etwas schief auf seine Krücken gelehnt, da ein Bein verkrüppelt und deutlich kürzer war. Seine wasserblauen Augen auf den südlichen Horizont gerichtet, hinter dem Afrika lag, presste er die Töne durch die Zähne, klanglos, heiser, immer und immer wieder, und wurde dabei von Minute zu Minute vergnügter. Er sehnte sich mit solcher Kraft und Leidenschaft nach seinem Afrika, dass sich in dunklen Tagen seine Lebensflamme davon nährte.
Dann erzählte er, der die Gabe besaß, mit Worten Bilder zu malen, von der Insel, wo er mit Mama so lange gelebt hatte und sie geboren wurde, und seine Worte machten sie zu einem magischen Ort, wo das Leben einfach war und schön, wo Mensch und Tier miteinander in Frieden lebten und reife Früchte an den Bäumen hingen, wo das Wasser klar war und rein und die Luft von unvergleichlicher Süße. So wie im Paradies.
Mama, die sich Schicht um Schicht mit Schweigen zudeckte, wollte nichts mehr von Afrika hören. Sie zog sich in eine innere Welt zurück, von der sie alle ausschloss, sogar Papa.
Er sah sein Afrika nie wieder. Mama könne er das nicht antun. Dann starb Mama im November 1984, ganz schnell, eigentlich ohne Grund. So als hätte sie einen Blick in ihre Zukunft getan und nichts gesehen, wofür sich die Anstrengung zu leben gelohnt hätte. Ihr Herz hörte einfach auf zu schlagen, und Papa war allein.
Sie erwartete, dass er nun seine Koffer packen und das nächste Schiff nach Afrika nehmen würde, aber er tat es nicht.
»Ein wenig Zeit benötige ich noch«, sagte er und begann sein Haus zu renovieren, »es ist noch zu früh nach Mamas Tod.«
Dann war es die falsche Jahreszeit. Zu heiß, zu nass, oder sein verkrüppeltes Bein spielte sich auf. Nach einer Weile hörte sie auf zu fragen.
Er verbrachte viel Zeit, Fahrpläne von Frachtdampfern zu studieren, die seine Insel anliefen, stellte lange Listen auf von allem, was er mitzunehmen gedachte, aber dann war es schon wieder Winter. Die Winterstürme auf der Biskaya sind entsetzlich, ich warte besser bis zum Frühjahr, überlegte er, außerdem muss ich den Garten winterfest machen. Er legte Fahrpläne und Listen beiseite und vergrub einhundertfünfzig Narzissenzwiebeln in der herbstkalten Erde. »Schön wird es hier im April aussehen«, murmelte er zufrieden.
Wenige Tage nach seinem 78. Geburtstag schlenderte er durch den Weihnachtsmarkt im Museum für Kunst und Gewerbe. Er wollte eben die lange, geschwungene Treppe hinuntergehen, als ein Schwindelanfall ihn stolpern ließ. Sein krankes Bein knickte ein, und er stürzte die einundzwanzig Stufen hinunter.
Als man ihn nach vier Wochen, querschnittsgelähmt von der Taille abwärts, aus dem Krankenhaus in ein Leben im Rollstuhl und in völliger Abhängigkeit entließ, hörte er auf, von Afrika zu träumen. »Ich bin wie ein Vogel im Käfig«, sagte er traurig und sprach nicht mehr davon, auch hörte man ihn niemals wieder sein Lied summen.
Als er zusammenbrach, ganz leise, merkte es keiner.
Am Abend vor der Trauerfeier öffneten sie die koffergroße Kirschbaumtruhe, in der Papa seine Papiere aufbewahrte. Alte Geschäftspapiere, säuberlich geführte Haushaltsbücher, entwertete Pässe, deren Stempel von dem rastlosen Wandern seiner frühen Jahre zeugten. Ian zog einen Umschlag hervor. »Das Testament.« Er überflog es. »Wie zu erwarten war, du und Dietrich erbt das Haus je zur Hälfte.«
»Das gibt ein Problem. Ich weiß nicht einmal, ob das Telegramm zu Mamas Tod ihn erreicht hat. Die letzte Adresse, die ich von ihm habe, ist ein Postfach in Coober Pedy in Australien. Er soll dort nach Opalen geschürft haben, so schrieb er zumindest. Nach Mamas Tod hab ich Tage am Telefon verbracht, um ihm auf den verschlungenen Pfaden seines Lebens zu folgen, aber die Spur, die von Coober Pedy nach Bangkok führte, verlief sich auf einer der idyllischen kleinen Inseln vor Thailand. Seit 1979 habe ich nichts von ihm gehört.« Frustriert knabberte sie am Fingernagel. »Ich wette, er sitzt unter irgendeiner Palme am Meer, in jedem Arm ein hübsches Mädchen, und genießt das Leben. So war es immer.« Bitterkeit färbte ihre nächsten Worte. »Er flatterte davon, für Probleme war ich zuständig.« Sie lachte auf. »Beruflich machte er dies und das und alles höchst erfolgreich. Der schwatzt einem Eskimo eine Tiefkühltruhe auf, ohne Problem.«
»Du magst ihn, nicht wahr?«
»Oh ja, sehr, und ich vermisse ihn. Als er dreißig wurde, erklärte er uns, dass er von jetzt ab gedenke, sein Leben zu genießen. Er stand da, Hände in den Hosentaschen, ließ Papas Globus unter seiner Hand herumwirbeln und verkündete, dass er sich jetzt die Welt ansehen werde. Und das tat er«, sagte sie. »Hier!« Sie warf einen Stapel bunter Postkarten auf den Tisch. »Aus Thailand, Sumatra, Abidjan, dem Jemen – was um alles in der Welt wollte er nur im Jemen? Das Postfach seines Freundes in Sydney, das er als Adresse benutzte, ist aufgelöst. Ich weiß nicht, wo ich ihn noch suchen soll!« Abwesend baute sie ein Haus aus den Karten. »Er hat Mama das Herz gebrochen, als er verschwand.« Ungeweinte Tränen, deren Ursprung bis in ihre Kindheit zurückreichten, brachen ihre Stimme. »Und was mach ich nun? Allein krieg ich keinen Erbschein!« Ihre heftige Bewegung fegte das Kartenhaus vom Tisch. »Ich werde ihn suchen lassen. Ich will jetzt nicht darüber nachdenken.«
Sie blätterte in Papas Unterlagen. Aus den Seiten eines alten Schulheftes fiel ihr ein sepiafarbenes Foto entgegen.
Eine junge Frau, eigentlich noch ein Mädchen, kniete lachend, den Kopf in den Nacken geworfen, die Arme weit ausgebreitet, vor dem Hintergund eines Palmenhains auf dem flachen Bug eines kleinen Schiffes. Der leichte Wind hatte ihre halblangen, dunklen Haare hochgewirbelt und die Ärmel des weißen Kleides zu Flügeln gebauscht. Das Meer war glatt, die Morgensonne umgab ihre Figur mit einem Strahlenkranz.
»Meine kleine Taube« stand darunter – unverkennbar in Papas schwungvoller Handschrift.
»Die Taube. La Paloma«, hauchte sie. Einzelne Töne formten sich in ihrer Kehle, wurden zu einer Melodie voller Sehnsucht und Verlangen. Papas Melodie.
»Wer ist das? Wie hübsch sie ist, so voller Leben – sie sieht dir ähnlich, bis auf die dunklen Haare.« Ian schaute ihr über die Schulter.
»Das ist Mama«, sagte sie langsam, Erstaunen in ihrer Stimme, »ich wusste nicht, dass sie je – so jung war. Sie hat Papas Lied gehasst. Immer wenn er es summte, spielte sie Wagner«, seufzte sie leise und kramte weiter in der Truhe. »Sieh mal, hier sind einige Briefe.« Sie legte den mit einem Gummiband zusammengehaltenen Packen auf den Tisch, entfaltete den obersten Brief.
›Mein geliebtes Täubchen‹, begann sie halblaut, verstummte dann. Es war ein bezaubernder Brief, einer der schönsten Liebesbriefe, den sie je gelesen hatte. Plötzlich schwebte ein Klingen durch den Raum, und ganz entfernt meinte sie ein junges Mädchen lachen zu hören.
»Sie haben sich geliebt! – Sie haben sich nicht sehr häufig berührt, weißt du. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass sie sich je auf den Mund geküsst haben.« Mit beiden Händen wischte sie sich das Gesicht trocken. »Sie haben sich wirklich geliebt«, lächelte sie versonnen und fühlte sich unerklärlich beschwingt.
Lange saßen sie eng umschlungen auf der Couch. Sie lauschte Ians Herzschlag, dachte an das junge Paar, das ihre Eltern gewesen war. »Was ist später nur mit ihnen passiert? Was hat ihre Schultern so gebeugt, Mama so bitter gemacht?«
»Eine Liebe kann sterben, kann im Alltag versinken wie ein Mensch im Treibsand«, murmelte er, seinen Mund in ihren Haaren, »Wir müssen sehr vorsichtig mit unserer umgehen. Wir müssen immer Freunde bleiben.« Leise summte er ein paar Takte von Papas Lied.
Die wehmütige Weise umwehte sie wie ein leichter, weicher Wind.
»Verlass mich nie – bitte, lass mich nie allein.«
»Dann müsste ich aufhören zu atmen.« Er öffnete wortlos seine Arme, und sie schmiegte sich in die vertraute Wärme, formte eine Schale mit seinen Händen und legte ihr Gesicht hinein. Eine Berührung, intimer als ein Kuss, eine Geste in der dreiundzwanzig Jahre gemeinsames Leben lagen.
Sein Mund streichelte ihren. Sie schmeckte das Salz auf seinen Lippen. Waren es ihre Tränen oder seine? Unter seinen zärtlichen Händen lösten sich ihre verspannten Muskeln, sie versank in dem Violettblau seiner Augen, und die Zeit setzte aus.
Papa starb im März 1986, acht Jahre nachdem sie Südafrika zum zweiten Mal verlassen hatten. Der Himmel war hoch und von durchscheinendem Frühlingsblau, als sie seine Asche von einem Fischkutter aus in die Nordsee streuten. Sie warf ihm Blumen hinterher. Die Blüten hüpften und drehten sich, die munteren Wellen trugen sie fort nach Süden, der Sonne entgegen. Nach Afrika.
»… wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein …«, sang sie leise und sah ihrem Vater nach.
Seitdem kam sie nicht mehr zur Ruhe. In einem ständigen innerlichen Kampf zermürbte sie sich zwischen Herz und Vernunft. Das Wetter in Hamburg erschien ihr schlechter, das Licht trüber, die Menschen kühler. Sie buchte Ferien auf Mallorca und brach beim Anblick einer mickrigen Jakaranda in Tränen aus.
An einem regnerischen Abend ein paar Monate nach Papas Tod lud Ian sie ins Kino ein. Es gab »Jenseits von Afrika«. Bei dem ersten Satz – diesen berühmten Worten: »Ich hatte eine Farm in Afrika« – blieben ihr die Kekse, die Ian gekauft hatte, in der Kehle stecken.
Auf der Leinwand wurde Afrika zelebriert, doch sie sah weder die Bilder, noch verstand sie die Worte. Sie war in Afrika. Noch nie hatte sie in einem Film geweint, konnte immer Wirklichkeit und Schein auseinander halten, doch jetzt saß sie neben Ian im Dunkeln des Filmtheaters, aufgewühlt, zerrissen, und erstickte fast an ihren Tränen.
Als sie es nicht mehr aushalten konnte, bahnte sie sich blindlings einen Weg nach draußen. Ziellos lief sie durch den feuchten Septemberabend, Ian immer ein paar Schritte hinter ihr.
»Ich weiß, dass es albern ist, dass ich immer noch Afrika hinterherweine. Ständig versuche ich, mir klarzumachen, dass unser Leben jetzt hier ist, hier in Deutschland. Die Kinder studieren hier, wir haben Freunde – wenigstens ein paar.«
Er nahm sie wortlos in den Arm, doch sie entwand sich ihm. »Ich muss mich bewegen, ich werde sonst verrückt.« Mit weit ausgreifenden Schritten lief sie vor ihm her, quer über den Jungfernstieg zwischen hupenden Autos hindurch zur Binnenalster hinunter. Sie bröselte die Keksreste aus ihrer Tasche ins Wasser. Neugierig schwammen ein paar Enten heran. Der Regen hatte aufgehört, die Nässe tropfte von den Bäumen, ein hell erleuchteter Alsterdampfer, geschmückt mit Lichtgirlanden, glitt an die Anlegerstelle. Die Menschen, die ausstiegen, schienen gut gelaunt. Ihr Gelächter schwebte zu ihr herauf.
»Henrietta, schau dich um, auch hier ist es schön!«
Sie wich seinem Blick aus. »Ja, ich weiß, es ist schön, wir sind hier sicher, niemand bespitzelt uns.« Es klang trotzig. »Wenn wir etwas gegen die Regierung haben, können wir uns auf den Rathausplatz stellen und es herausschreien, es geht uns gut, nichts und niemand trachtet uns nach dem Leben, wir leben in Frieden und Freiheit …!« – ihre Stimme war immer leiser geworden, und die nächsten Worte waren nur noch ein Flüstern – »… und trotzdem kann ich Afrika nicht vergessen!« Schweigend beobachtete sie die tanzenden Lichter auf dem schwarzen Wasser. »Fast acht Jahre ist es her, dass wir Umhlanga Rocks verlassen haben«, wisperte sie und sah es vor sich, Umhlanga, wo ihr Garten lag, sah das Meer, den Himmel, »ich muss es vergessen …«
Plötzlich ging ein Ruck durch sie hindurch, und als sie sich zu Ian umdrehte, leuchtete ihr Gesicht, als hätte sich eben das Paradies vor ihr aufgetan. »Warum muss ich es vergessen? Die Kinder sind einundzwanzig, auch nach südafrikanischem Gesetz volljährig. Verstehst du, es kann uns keiner mehr mit Jan erpressen! Die Kerle in Pretoria können ihn nicht mehr einziehen und in ihren Krieg zwingen!« Ihre Stimme kletterte, Aufregung rötete ihre Wangen. »Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. – Liebling, wir sind frei! Jetzt hält uns doch eigentlich nichts mehr davon ab, wenigstens Urlaub in Umhlanga zu machen«, sprudelte sie, warf ihm die Arme um den Hals, bedeckte ihn mit Küssen.
Ians Gesicht verlor jeden Ausdruck, wurde zu der Fassade, hinter der er sich seit ihrer Flucht aus Südafrika so häufig zurückzog, unerreichbar für sie. Reglos stand er in ihrer Umarmung, die Arme schlaff, die Haut klamm und kalt.
»Ian! Ist etwas?« Sie trat zurück, wartete auf eine Antwort. Sie kam nicht.
Er schien sie weder zu hören noch wahrzunehmen. Blicklos starrte er vor sich hin, sah offenbar etwas, was ihr verborgen blieb.
Aufgeschreckt packte sie ihn an den Schultern, rüttelte ihn.
Als käme er nach einer Narkose zu sich, sah er sie für Sekunden verwirrt an, dann glitt sein Blick zur Seite. Er lehnte seine Unterarme auf das eiserne Geländer, starrte ins Wasser. Seine Finger verschlangen sich ineinander, kneteten und drückten sich, bis die Knöchel weiß waren. Als er endlich redete, verursachte sein kalter Ton ihr eine Gänsehaut. »Warum suchst du dir hier nicht irgendeine Tätigkeit? Zeit genug hast du wirklich, und dann würdest du nicht dauernd von Afrika träumen.«
Tief getroffen, berührte sie dennoch seine Schulter, aber nur mit den Fingerspitzen. »Ian, Liebes, was ist?« Wie konnte er das sagen, was war in ihn gefahren?
Er blieb unerreichbar. »Wolltest du nicht ursprünglich Medizin studieren?«
Sie zuckte zusammen. »Mit neunundvierzig – mach dich nicht lächerlich!«
»Eröffne doch eine Boutique.«
Zielsicher traf er einen bloßliegenden Nerv. »Du weißt genau, dass ich das Geld dazu nicht habe …«
»In Südafrika hast du sogar eine Strickfabrik aufgebaut, ganz allein und ohne Geld, nur mit deinem Talent.« Er benutzte seine Stimme wie eine Keule.
Ein Geschwür in ihr brach auf, Eiter quoll hervor, das Zersetzungsprodukt vieler Jahre. »Und wenn der Herr von Burgar vom Star Investment Holding nicht mit fast unserem gesamten Geld abgehauen wäre«, platzte sie heraus, »und sich damit jetzt ein sorgloses Leben irgendwo unter der karibischen Sonne machen würde, wäre das alles kein Problem. Dann hätte ich das Startkapital, das hier nötig ist, und würde dir nicht auf die Nerven gehen.« Sie biss sich auf die Lippen, schluckte den Rest ihrer Worte hinunter.
Und wenn du dich nicht von dem geschniegelten Kerl und seinen vielen hochtrabenden Worten hättest täuschen lassen, hätte sie am liebsten herausgeschrien, von den schönen großen Büros mit den reizenden, hochglanzlackierten Damen und den dynamischen jungen Herrchen, der Penthauswohnung, dem Ferrari und dem vielen Champagner, wenn du auf mich gehört hättest, weil ich den wirklichen Menschen hinter seiner Maske erkannt hatte, dann hätte er nicht auch noch den letzten Penny aus uns herauswringen können – aus mir, denn es ist mein Erbe von Onkel Diderich, das der Kerl jetzt verprasst!
Aber sie brachte es nicht fertig.
Sie standen sich gegenüber, keine zwei Schritte voneinander entfernt, aber zwischen ihnen war der Abgrund so tief, dass sie sich kaum erkennen konnten, und keiner von beiden streckte die Hand nach dem anderen aus, um ihm hinüberzuhelfen. Sie fühlte sich, als taumelte sie durch die Kälte einer Weltraumnacht, so einsam war sie in diesem Moment.
Ian wandte sich ab. Mit hochgezogenen Schultern, den Kopf gesenkt, stand er da. »Entschuldige«, sagte er endlich tonlos, »es ist spät, wir sollten nach Hause fahren, ich bin ziemlich müde.«
Die Worte zwischen ihnen fielen danach nur noch als schwere Tropfen in ein immer dichter werdendes Schweigen, bis sie schließlich ganz versiegten.
Irgendwann in der Nacht fühlte sie seine Hand, die nach ihrer suchte. Sie zog ihre nicht weg und erwiderte seinen Druck. Seine Hand löste sich, glitt zu ihrer Schulter, verharrte dort, wartete auf ihre Reaktion. Sie spürte ihn, warm und vertraut. »Oh, mein Herz«, flüsterte sie und drehte sich zu ihm.
Als sie tags darauf über den Auslöser der Szene nachdachte, fand sie keine Erklärung. Sie beschloss, das ungute Gefühl, das sich als heiße Säure in ihrem Magen sammelte, zu ignorieren. Jetzt ist Winter in Südafrika, dachte sie, im Januar und Februar ist es sowieso viel schöner, es ist noch viel Zeit, ich rede später mit ihm.
Bei jeder noch so beiläufigen Erwähnung Südafrikas hatte sie dieses Versteifen seiner Muskeln, das Versteinern seiner Gesichtszüge beobachtet. »Gibt es da etwas, was ich nicht weiß? Sag es mir bitte, wie soll ich dich sonst verstehen?«, hatte sie mehr als einmal gefragt, aber er war ihren Fragen auf das Geschickteste ausgewichen, lenkte ab. Sie fand keinen Weg zu ihm, und irgendwann hatte sie aufgegeben.
Sie schrieb sich in der Volkshochschule für den Spanischkurs für Anfänger ein und zwang sich zu einem Aerobic-Lehrgang, obwohl ihr ständig übel wurde von den Ausdünstungen der enthusiastisch herumturnenden Matronen, die durchweg Ende fünfzig waren und sie mit neidischen Blicken auf ihren straffen Körper ausgrenzten. Im Umkleideraum drehten sich die Gespräche um Männer, Geld und Männer, meist allerdings nicht um die eigenen. Außerdem wurde sie von der Anstrengung so hungrig, dass sie zwei Kilo zunahm. Entsetzt gab sie auf und hob stattdessen einen Teich im Garten aus, arbeitete sich körperlich müde bis zum Umfallen. Um ihre rotierenden Gedanken auszuschalten, ließ sie die Kassette mit Spanischlektionen laufen, betete die unregelmäßigen Verben wie eine Litanei herunter.
Es half nichts. Afrika ließ sie nicht los. In den düsteren Spätherbsttagen, wenn die Blätter von den Bäumen fielen, die Nebel wie Leichentücher die sterbende Natur bedeckten, wenn die bleiche Sonne ihren Kampf gegen den ersten Ansturm von Winterkälte verlor, hielt sie es kaum noch aus, dann erwischte sie sich dabei, dass sie die ersten Takte von »La Paloma« summte, durch die Zähne, immer und immer wieder – und sie fühlte sich so unendlich allein, dass es ihr die Luft abdrückte.
Ihre Fröhlichkeit verschwand, sie verkroch sich, wurde zu einer Schneckenhausbewohnerin, und sie verlor ihre Wut, diese Wut, die ihr bisher immer zur Hilfe gekommen war, stets ihre letzten Kraftreserven mobilisiert hatte. Nun war kein Sturm mehr stark genug, sie aufzupeitschen.
Äußerlich war ihr nichts anzumerken, sie lachte, machte Scherze oder weinte. Der Haushalt lief geräuschlos weiter. Aber irgendwie war alles eingeebnet. Und dann war da dieser Abstand, dieser winzige, abgrundtiefe Abstand zu Ian. Sie vermied jeden Gedanken daran, zuckte davor zurück, als berührte sie rot glühendes Eisen.
Sonnabends studierte sie die Stellenanzeigen im »Hamburger Abendblatt«, und im Dezember, ein paar Wochen nach ihrem Streit, trat sie eine Stellung als Sekretärin und Übersetzerin in einem Zweimannunternehmen an. Ihre Chefs waren zwei Brüder, und ihre Pflichten schlossen Kaffeekochen, Botengänge, Lügen am Telefon, wenn die Gattinnen sie suchten, und Blitzableiterdasein für wütende Kunden ein. Dann entdeckte sie Ungereimtheiten, beobachtete, dass der ältere Bruder den jüngeren betrog.
Nach fünf Wochen kündigte sie.
Danach verlor Ian kein Wort mehr über eine Berufstätigkeit von ihr. Eines Tages kam er mit einem großen Paket nach Hause, das ein umfangreiches Sortiment Ölfarben, Pinsel in jeder Stärke und ein paar schöne Leinwände, einen großen Skizzenblock und mehrere weiche Bleistifte enthielt. »Bitte«, sagte er, und es war klar, dass er meinte: Bitte, entschuldige … bitte, es tut mir so Leid … bitte, lass uns wieder richtig miteinander reden. Er liebte die Bilder, die sie malte, die Farben, leuchtende, ungebrochene Farben – die Farben Afrikas, ein Ausdruck ihrer Sehnsucht, Ventil ihres inneren Drucks.
Sie verlor sich in seiner Umarmung, atmete seine Wärme, hörte nichts außer den kräftigen Schlägen seines Herzens. Als sie später im Bett lagen, den Kopf in seiner Halsgrube, die Beine umeinander verschlungen, waren sie sich näher, als sie für viele Monate gewesen waren. Der Abstand war kaum noch fühlbar.
Gleich am nächsten Tag begann sie ein Bild zu skizzieren. Aber nicht Afrika, eine Winterlandschaft.
Als sie an diesem 8. November 1989 aus der Stadt zurückkehrte und vor ihrem Haus aus dem Auto stieg, sah sie hinauf in den stürmischen Novemberhimmel. Die Sonne sank schon dem Abend zu, es blieben noch ein, zwei Stunden Zeit zum Laubfegen. Sie schloss die Haustür gegen den kalten Wind und brachte ihre Einkäufe in die Küche. Im Wohnzimmer lief der Fernseher. Er lief fast immer. Er gab ihr die Illusion, nicht allein zu sein. Sie hörte dem Sprecher kaum zu, der Klang seiner Stimme genügte ihr.
Rasch zog sie ihre Jeans an, öffnete die Terrassentür zur Südseite und erstarrte. Hinter dem dreißig Meter langen Zaun, der in drei Meter Entfernung von der Fensterfront ihres Wohnzimmers den Garten begrenzte, erhob sich eine drei Meter hohe, düstere Fichtenwand. In der einzigen Lücke, durch die ein schmaler Streifen weißen Sonnenlichts fiel, richtete sich gerade, wie von Zauberhand geführt, eine letzte Fichte auf, dann lag ihr Garten in tiefem Schatten. Als sie heute Morgen in die Innenstadt gefahren war, um sich ein Kostüm zu kaufen, konnte sie noch ungehindert Nachbar Kraskes Karottenfeld betrachten.
Herr und Frau Kraske bewohnten ein winziges, spitzgiebeliges Haus, das Letzte seiner Art in dieser Gegend, und pflanzten Unmengen von Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln an. Herrn Kraskes Hätschelkind war der Tabak, aus dem er sich, nachdem er ihn über den Winter auf seinem Dachboden getrocknet hatte, entsetzlich stinkende Zigaretten drehte, die er dann auf seiner Terrasse paffte und deren Rauch Cargills von ihrer Terrasse vertrieb.
Frau Kraske war eine große, eingetrocknete Frau, dürr, mit wirren, grauen Haaren, die sie in einem Zopf um ihren Kopf gewunden trug. Jetzt kniete sie zu Füßen ihres Mannes und schaufelte auf sein Geheiß Erde über die Fichtenwurzeln. Doch wie immer konnte sie ihm nichts recht machen. Er stieß sie mit dem Fuß zur Seite, nahm die Zigarette aus dem Mund und brüllte sie in einem Ton an, der Henrietta Herzrasen bescherte und Erinnerungen beschwor: Bilder von bedrohlichen schwarzen Gestalten, das Poltern klobiger Stiefel und das Stakkatohämmern an der Tür.
Frau Kraske stand mit hängenden Armen da, starrte ihren Mann stumm aus flackernden Augen an, und Henrietta ahnte, welche Antwort nun folgen würde, denn Frau Kraske besaß eine überraschende Gabe. Sie konnte mitreißend tanzen. Manches Mal sah sie sie in der Mittagssonne über ihren schnurgeraden Steinplattenweg wirbeln, mit fliegenden grauen Haarsträhnen und leicht wie eine Feder. Es schien das Einzige zu sein, was sie nach all den Ehejahren von ihrer Persönlichkeit bewahrt hatte: die Sprache ihres Körpers.
Statt den Mund zu öffnen, hob Frau Kraske einen Fuß, schlug einen aufsässigen Trommelwirbel, tanzte trotzig, stampfte ihren Zorn auf die Steinplatten. Ihr Mann hieb ihr unvermittelt die Schaufel über den Rücken, sie stolperte, fiel in sich zusammen und war wieder die dürre, graue Frau Kraske ohne Worte, huschelig und gebeugt, so dass Henrietta glaubte, einer Sinnestäuschung aufgesessen zu sein.
Herr Kraske hasste alles Wilde, Ungezügelte. Seine Karotten standen, stramm ausgerichtet in Viererreihen auf erhöhten Beeten, die mit ihren präzisen Kanten an Gräber erinnerten. Wühlmäuse und Ratten, die sich von seinem Komposthaufen ernährten, erweckten in ihm martialische Gelüste. Mit reichlich Gift und Fallen rückte er ihnen zu Leibe, brachte sie dutzendweise zur Strecke. Triumphierend drapierte er die kleinen Kadaver um den Komposthaufen. »Das schreckt ihre Kollegen ab!«, freute er sich.
Herüberhängende Zweige, Margeriten und liederliche Gänseblümchen, die von ihrem Grundstück herüberwucherten, und der leuchtende Sommermohn, der seine Samen auf sein Land verstreute, lösten in ihm einen Vernichtungsimpuls aus. Er hackte alles heraus, und als sie einmal mehrere Tage abwesend war, sogar auch auf ihrer Seite des Zauns.
Eiszeit brach über die Nachbarschaft herein.
Heute nun hatte Herr Kraske ihr mit einem Streich das Lebenselixier genommen. Sie brauchte die Sonne, sie konnte ohne ihre Wärme nicht leben, sie brauchte sie wie die Luft zum Atmen. Diese Fichtenwand – es waren schnell wachsende Omorikafichten – würde bald nie wieder einen Strahl Sonne auf ihr Grundstück lassen. Noch in Strümpfen rannte sie über den feuchtkalten Rasen zum Zaun.
»Sind Sie vollkommen verrückt geworden?«, schrie sie. »Was fällt Ihnen ein, entfernen Sie diese Fichten auf der Stelle, sonst hole ich die Polizei!« Als Ian vor einiger Zeit ein paar alte Baumstämme verbrannte, es war ein munteres kleines Feuer, und er erfreute sich an den sprühenden Funken, rief Herr Kraske die Polizei. Daraus folgerte sie, dass diese Institution für ihn die massivste Drohung darstellte.
Herr Kraske strich sich mit erdverschmierten Fingern über seinen grau melierten roten Haarkranz, hinterließ dabei schwarze Bahnen auf seinem eiförmigen, kahlen Schädel und lächelte gemein. »Das tun Sie denn man, das wird Ihnen gar nichts nützen.« Die selbst gedrehte Zigarette mit dem selbst gezogenen Tabak wippte in seinem Mundwinkel, mit jedem Wort stieß er Rauchwölkchen aus.
»Zum letzten Mal«, zischte Henrietta durch zusammengebissene Zähne, »nehmen Sie diese Fichtenhecke hier weg!«
»All dieses Unkraut«, seine blassen Augen wanderten über ihre abgeblühte Wildblumenwiese, »man könnte ja meinen, dass hier sonst wer haust. In dieser Gegend hat man einen ordentlichen Rasen, ohne Unkraut.« Er hackte ein erfrorenes Gänseblümchen um. »Wir schützen uns nur gegen die Verunreinigungen, die von Ihrem Grundstück ausgehen.« Es klang, als lese er einen Gesetzestext ab.
Herr Kraske klopfte die Erde um die letzte Fichte fest. »Frieda, dreh den Schlauch an«, kommandierte er, und dann stand er da, ein zufriedenes Lächen auf seinem rot geäderten Gesicht, und wässerte die Bäume.
Sie lief ins Haus, holte das tragbare Telefon und rief ihren Sohn Jan in München an. Jan studierte Jura und war dank seiner Leidenschaft, immer Recht haben zu wollen, schon jetzt ein guter Jurist. Seine Zwillingsschwester Julia studierte Medizin – auch in München. Glücklicherweise nahm Jan nach dem zweiten Klingeln ab.
Schweigend hörte er sich ihre Tirade bis zum Ende an. »Die Bepflanzung mit den Fichten stellt eine geschlossene Hecke dar, und die darf in Hamburg nicht mehr als zwei Meter in der Höhe betragen. Sag ihm, er soll sie beseitigen, sonst verklagen wir ihn! Das wird ihn ordentlich erschrecken.«
Sie informierte das Ehepaar Kraske, Jan hörte mit.
»Dann verklagen Sie uns mal schön«, grinste Herr Kraske tückisch und entfernte sich. Er wirkte keineswegs beeindruckt.
»Ich hab’s gehört«, sagte Jan, »Mistkerl. Der muss sich informiert haben. Klagen dauert ewig, kostet ein Vermögen, und vor deutschen Gerichten und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Außerdem habe ich schon von sehr eigenartigen Urteilen in Hamburg gehört. Eure Grünen sind sehr aktiv! Du musst dir etwas anderes einfallen lassen.« Damit legte er auf.
Sie bewahrte ihre Beherrschung, bis sie im Haus war. »Das lass ich mir nicht gefallen!«, schrie sie die Wände an. Weinend schleuderte sie ihre herumstehenden Schuhe durchs Zimmer. Die Fichten würden unaufhörlich wachsen, ihr Himmel immer kleiner werden. Herr und Frau Brunckmöller auf ihrer Nordseite liebten Wald. Nachbar Schubert im Westen war alt und saß schon morgens auf seiner Gartenbank, mit dem Kinn auf seinen Stock gestützt, und hing nur noch seinen Gedanken nach. Seine Buchenhecke war längst zu einer haushohen grünen Wand verwildert. Im Osten grenzte das Grundstück an die Straße. Die Eichen, die sie säumten, waren uralt und fast zwanzig Meter hoch.
Allmählich würde ihr Garten zu einer Lichtung im Wald werden, moosüberwachsen, immer feucht, bald würde ihr Himmel nur noch ein handtuchschmales Rechteck sein.
Außer sich rief sie ihre Telefonfreundin Monika Kaiser an.
»Ich könnte die Kraske umbringen«, kreischte sie, als Monika sich meldete. »Nichts wird in meinem Garten mehr wachsen, meine Margeriten, der Mohn, die Rosen, alles wird sterben!«
»Schick nachts den Baummörder rüber.« Sie hörte Monika an ihrer Zigarette saugen. Sie war Kettenraucherin.
»Was heißt das?«
»Säg sie ab oder kipp Gift darüber! Solange du keine Zeugen hast, können die dir nichts.«
Mord! Polizei – Strafe – Gefängnis! Plötzlich war da ein Geruch in der Luft, dumpf und säuerlich. Angst kroch in ihr hoch. Sie sah sich in einem Raum sitzen, hoch über sich ein vergittertes Fenster, die Wände in einem kränklichen Gelb. Sie hörte Stimmen so scharf wie ein Henkersbeil. Wie Raubtiere umschlichen sie die Polizisten, hatten ihre Krallen in sie geschlagen, trieben sie mit ihren Fragen in die Enge, ihre Mündern schnappten zu wie Fallen. Und sie hörte sich lügen, lügen, lügen.
Ihr Herz begann zu rasen, sie japste nach Luft, atmete immer tiefer und schneller. Sie musste sich festhalten, schwarze Flecken schwammen durch ihr Gesichtsfeld.
»Höraufhöraufhörauf«, rief eine schwache Stimme in ihr, »hör auf! Reiß dich zusammen!« Mit dem letzten Rest ihres Bewusstseins gehorchte sie, zwang sich aufzustehen, zwang sich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, in die Küche zu gehen, sich ein Glas Wasser einzugießen. Schweißgebadet von der Anstrengung lehnte sie am Türpfosten, trank das kalte Wasser, atmete kontrolliert, bis ihr Herz langsamer schlug, die schwarzen Flecken verschwanden. Sie wusste, es war ihre eigene Angst, die sie gerochen hatte, die sie dreiundzwanzig Jahre zurück in einen kahlen Raum des Polizeipräsidiums von Durban versetzte, als zwei Polizisten sie beschuldigten, Cuba Mkize, den schwarzen Terroristen, versteckt zu haben. Sie unterdrückte ein Zittern. In diesem Raum waren ihrer Seele Verletzungen zugefügt worden, die nie wieder verheilt waren.
»Verdammt«, knirschte sie, »nicht einmal eine hässliche, zerrupfte, unrechtmäßig gepflanzte Fichtenhecke kann ich verhindern, so klein haben die mich gekriegt!« Sie warf sich aufs Sofa und vergrub ihr Gesicht in den Kissen. Über ihr wanderte der Schatten der Fichtenwand langsam durchs Wohnzimmerfenster und legte sich kalt auf ihren Rücken, als bedecke sie jemand mit schwerer, kalter Erde.
Nach langer Zeit drang die Fanfare der Tagesschau in ihr Bewusstsein. Durch einen Tränenschleier schaute sie flüchtig hin. Auf dem Bildschirm schwenkte die Kamera über eine blutige Szene. Verletzte und Tote lagen verstreut zwischen rauchenden Wrackteilen auf einer Straße. Irgendwo auf dieser Welt war eine Autobombe explodiert. Die tägliche Horrordosis in der Tagesschau. Sie drehte sich weg. Es machte sie krank.
»… in Durban, Südafrikas Hafenstadt am Indischen Ozean«, sagte die vertraute Stimme des Afrikakorrespondenten der ARD, und ihr Kopf ruckte herum.
Durban! Südafrika! Ihr verlorenes Paradies. Sofort drückte sie die Aufnahmetaste des Videorecorders. Alles, was über Südafrika gesendet wurde, nahm sie auf. Es war wie eine Sucht. Über sechzig Stunden Südafrika hatte sie mittlerweile auf Band. Nur wenn sie allein im Haus war, sah sie sich die Aufzeichnungen an. Ian und die Kinder sollten ihre Tränen nicht sehen.
Jan und Julia waren zu Europäern geworden, verbrachten ihre Ferien in Italien und Frankreich, hatten inzwischen mit der Leichtigkeit von Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen waren, die Sprachen dieser Länder gelernt. »Wer sich durch Zulu gekämpft hat, dem perlt Italienisch von der Zunge, ich brauche Herausforderungen«, merkte Julia trocken an und vertiefte sich in Mandarin. Ihr Afrika war das Land ihrer Kindheit, unwirklich wie ein Märchen. Sie schauten vorwärts, die Welt stand ihnen offen. Dieses Gleichgewicht wollte sie nicht zerstören.
Am sorgfältigsten jedoch verbarg sie ihre Tränen vor Ian, zu sehr fürchtete sie seine unerklärliche Versteinerung, den neuerlichen Schmerz. Der feine Haarriss, den ihr Vertrauen erlitten hatte, begann an den Rändern zu verwittern, zu bröckeln, er begann größer zu werden.
Sie fühlte sich wie ein gestrandeter Zugvogel im Winter in diesem Land, sehnte sich nach Afrika, seiner Wärme, dem endlosen Himmel, sehnte sich nach dem Lachen der Menschen, die sie dort zurücklassen musste. Einmal übermannte sie das Heimweh, und sie erwähnte doch einen Besuch in Südafrika. Er fuhr zusammen, als hätte sie ihm körperliche Schmerzen zugefügt. Dieses Thema blieb als scharfkantiger Stolperstein zwischen ihnen. Ian konnte sie davor bewahren, sich daran zu stoßen, aber sie verletzte sich in unachtsamen Momenten immer wieder.
»Zwei Tote, über dreißig Verletzte«, unterbrach der Tagesschausprecher ihre Gedanken. Vor dem Hintergrund des Blaulichtgewitters der Polizeiautos und Ambulanzen, untermalt mit einzelnem Sirenengeheul, bewachten blauuniformierte Polizisten mit Maschinenpistolen die Verletzten, Toten und das zerfetzte Wrack.
Ein giftrosa Schuh lag auf der Straße, eine beringte Hand, zwei Finger nur noch blutige Stümpfe, ragte unter einem Leichentuch hervor. Eine weiße Hand.
Die Kamera glitt über blaues Meer und blühende Bäume. Es musste ein schöner Frühsommertag sein in ihrem Natal, wo ihr Garten lag. Dort, wo ihre Seele wohnte. Die Sonne schien, ein paar Schwarze standen im lichten Schatten einer Jakaranda, unter ihnen eine Frau. Sie lachte – gerade als die Kamera sie erfasste, lachte sie, und dann verschmolz sie mit dem Baumschatten und war verschwunden.