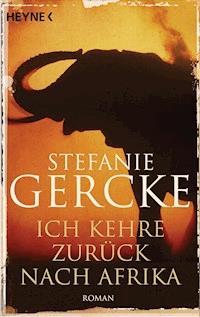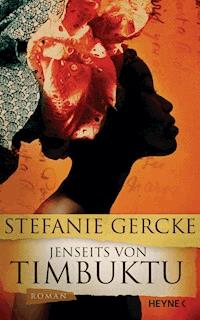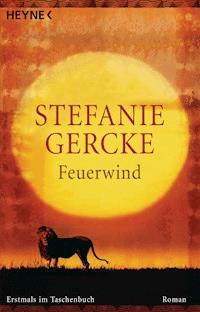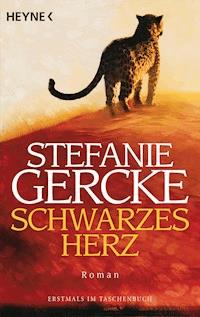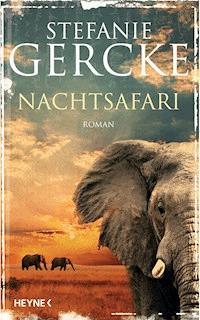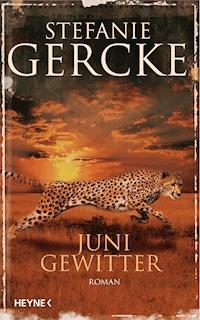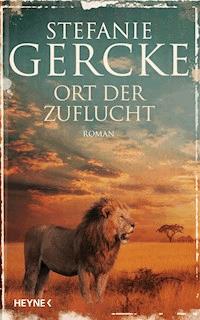
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verbrechen im Vergessenen – der neue große Roman von Stefanie Gercke
Die Deutsche Nina wächst in Südafrika auf. Mit knapp zwanzig wird sie von einem Mann überfallen. Sie verlässt Afrika und geht nach Deutschland. Das traumatische Erlebnis ist durch eine Teilamnesie aus dem Bewusstsein verbannt. Eine Tragödie zwingt sie vierzehn Jahre später zur Rückkehr. Ihr geliebter Vater braucht dringend eine Niere, und sie scheidet als Spenderin aus. Aber er offenbart ihr ein Geheimnis: Er hatte einst in Südafrika eine Affäre, aus der ein weiteres Kind entsprungen ist. Nina überwindet ihre Angst und macht sich auf die Suche. Stück für Stück kehrt ihre Erinnerung an den Schrecken von damals zurück. Viel zu spät erkennt sie, in welcher Gefahr sie schwebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Die Deutsche Nina wächst in Südafrika auf. Mit knapp zwanzig wird sie von einem Mann überfallen. Sie verlässt Afrika und geht nach Deutschland. Das traumatische Erlebnis ist durch eine Teilamnesie aus ihrem Bewusstsein verbannt.
Eine Tragödie zwingt sie vierzehn Jahre später zur Rückkehr. Ihr geliebter Vater braucht dringend eine Niere, und sie scheidet als Spenderin aus. Aber er offenbart ihr ein Geheimnis: Er hatte einst in Südafrika eine Affäre, aus der ein weiteres Kind entsprungen ist. Nina überwindet ihre Angst und macht sich auf die Suche. Stück für Stück kehrt ihre Erinnerung an den Schrecken von damals zurück. Viel zu spät erkennt sie, in welcher Gefahr sie schwebt.
Die Autorin
Stefanie Gercke wurde auf einer Insel des Bissagos-Archipels vor Guinea-Bissau/Westafrika als erste Weiße geboren und wanderte mit 20 Jahren nach Südafrika aus. Politische Gründe zwangen sie Ende der Siebzigerjahre zur Ausreise. Sie liebt ihre regelmäßigen kleinen Fluchten in die südafrikanische Provinz Natal und lebt sonst mit ihrer großen Familie bei Hamburg. Zuletzt bei Heyne erschienen: Junigewitter.
STEFANIE
GERCKE
ORT DER
ZUFLUCHT
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Stefanie Gercke
Copyright © 2019 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung/Artwork: Eisele Grafik·Design, München,
unter Verwendung der Fotos von sichkarenko.com/Shutterstock,
Galyna Andrushko/Shutterstock und FORGEM/Bigstock
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-21916-1V001
www.heyne.de
Prolog
Mit einem arbeitslosen Ingenieur namens Viktor, einer sehr hungrigen Krähe, einem Chefredakteur mit teurem Geschmack und einer gefrorenen Banane begann die Geschichte an einem bitterkalten Tag in Hamburg im November 2015.
Es hätte eine lustige Geschichte werden können, eine, mit der Viktor der funkelnde Mittelpunkt jeder Party gewesen wäre, und es wäre nichts passiert, hätte es nicht geschneit.
Und wäre die Krähe nicht so hungrig gewesen.
Aber es hatte geschneit, und die Krähe war hungrig gewesen.
Viktor verließ seine Wohnung morgens in freudiger, wenn auch gespannter Stimmung. In den letzten Monaten war sein finanzielles Polster in einem Tempo dahingeschwunden, dass ihm regelmäßig schlecht wurde, wenn er seinen Kontostand sah. Aber in wenigen Stunden hatte er mit dem Chefredakteur eines Hochglanzmagazins für Luxusreisen jenen Termin, der über seine finanzielle Zukunft entscheiden würde. Der Redakteur brauchte schöne Fotos aus Südafrika, und die Gage dafür würde sein Konto unvermittelt in die Komfortzone befördern. Außerdem war die Reise dorthin Teil des Angebots.
Seit mehr als zwei Jahren hatten sich die Anzeichen gehäuft, dass die Firma, in der er seit vielen Jahren als Ingenieur arbeitete, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte. Stellen wurden rigoros gestrichen, Mitarbeiter entlassen und Investitionen auf Eis gelegt, was er anfänglich geflissentlich ignoriert hatte. Aber als er die hübsche Angela, die ihm gelegentlich die Einsamkeit versüßt hatte, im strömenden Regen auf der Treppe zur U-Bahn entdeckte und sie ihm unter hemmungslosem Schluchzen erklärte, dass man sie gerade entlassen habe, konnte er sich die Situation nicht mehr schönreden.
Viktor war Ende fünfzig. Seine Tochter Nina war Anfang dreißig und stand als Leiterin eines Forschungslabors längst auf eigenen Beinen. Dass er bei der nächsten Entlassungswelle mit Sicherheit als einer der Ersten dem freien Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden würde, wie es so schön hieß, war er zuvorgekommen, indem er sich vor einem halben Jahr selbstständig gemacht hatte. Nicht als Ingenieur, sondern als Fotograf. Schon davor war aus seinem Hobby eine große Leidenschaft geworden, und er hatte sich einen guten Namen für dramatische Tierfotografien in freier Wildbahn erworben. Angreifende Elefanten zum Beispiel, ein blutiger Kampf zwischen Löwen und Hyänen um Beute und einmal die sensationelle Aufnahme eines Leoparden, der sich mit einer wütenden Kobra angelegt hatte. Die Fotos aus dem Urlaub hatten ihm zu einem netten Nebenverdienst verholfen, den er auf die hohe Kante gelegt hatte. Das hielt ihn momentan noch über Wasser. Aber bestimmt nicht mehr lange. Eigentlich stand ihm das Wasser schon Unterkante Oberkiefer.
Es war ein Schritt über das Kliff ins Leere gewesen, aber er hatte keine Alternative gesehen. Kein Headhunter war aufgetaucht, der ihn mit einer lukrativen Position als Ingenieur gelockt hätte. Er sei einfach zu alt, wie man ihm auf eine seiner Bewerbungen lapidar geantwortet hatte. Zwei große Whisky on the rocks hatte er benötigt, um diese unverblümte Aussage einigermaßen zu verdauen, und die Whiskyflasche leerte sich in gleichem Maß, wie der Stapel an Absagen wuchs. Nina gegenüber tat er immer so, als könnte er sich die Stellenangebote aussuchen.
Der Oktober war golden gewesen, hatte den Norden mit blutroten Sonnenuntergängen und zweistelligen Temperaturen verwöhnt, Rosen trieben späte Blüten, die jungen Mädchen trugen kniekurz, und sogar die Kraniche drehten noch ein paar Runden, ehe sie in Richtung Süden verschwanden.
In den letzten Wochen hatte Viktor nur am Rande mitbekommen, dass die Medien jeden Tag aufgeregt über ein Wetterphänomen berichteten, das auf der anderen Seite des Globus sein Unwesen trieb und weltweit das Wetter durcheinanderbrachte. Seit Menschengedenken trat es zur Weihnachtszeit vor der Küste Perus auf, und die peruanischen Seeleute hatten es einst auf den Namen El Niño getauft.
El Niño, das Christkind.
Schon im Frühjahr hatten nervöse Meteorologen verkündet, dass El Niño bereits da sei und sich als einer der stärksten zu entwickeln drohe, die je beobachtet worden seien. Sie nannten ihn den Hooligan und schwelgten in düsteren Prophezeiungen. Extreme Hitze- und Kälterekorde, Hurrikans, Dürre, sintflutartige Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche ungeahnten Ausmaßes würden das Weltwetter bestimmen. Buschfeuer, Missernten, Hungerepidemien und Ausbrüche von Seuchen seien vorprogrammiert.
Die Öffentlichkeit war alarmiert, und die Medien überschlugen sich mit Sonderberichten. Ein Spaßvogel von der NASA verpasste darauf El Niño 2015 den Spitznamen Godzilla.
El Niño war ein launenhaftes Kind, das wussten und fürchteten alle. Jahrelang konnte er sich ruhig verhalten, aber manchmal begann er sich zu langweilen, und wie ein gelangweiltes Kind fing er an Unfug zu machen und löste in seinem zerstörerischen Übermut Naturkatastrophen auf allen Kontinenten aus. War El Niño seiner Spielchen überdrüssig, gab er für ein paar Jahre Ruhe. Aber niemand, der je seinen Übermut zu spüren bekommen hatte, vergaß, wie es gewesen war und wie es wieder sein könnte.
In diesem Jahr aber narrte das Christkind alle. Es hielt sich nicht an die Regeln. In den ersten Monaten des Jahres rekelte es sich nur kurz und legte sich dann in den schattigen Tiefen des Ostpazifiks vor Peru auf die Lauer.
Die Meteorologen blamierten sich gründlich und ruderten zurück. Die Medien stürzten sich auf andere Themen. El Niño wartete ab. Viktor kümmerte sich um seine Präsentationsmappe.
Und dann schlug der Hooligan zu. Mit unglaublicher Wucht.
Weltweit spielte das Wetter verrückt. Aus allen Regionen der Erde kamen Meldungen von nie vorher da gewesenen Katastrophen. Durch die Karibik tobten noch im Dezember Hurrikans von verstörender Stärke, und in der Südsee wurden vom unaufhaltsam steigenden Meer ganze Inseln verschlungen. In einigen Teilen Afrikas gab es Überschwemmungen von biblischen Ausmaßen, Seuchen brachen aus, in anderen fiel die Regenzeit aus, und tödliche Dürren waren die Folge.
Ausgerechnet das blühende Südafrika wurde von der schwersten Trockenperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen heimgesucht, und neben Kapstadt traf es am schlimmsten das Land der Zulus. Seit mehr als sieben Monaten hatte es praktisch nicht geregnet. Die Stauseen trockneten zu fauligen Schlammpfuhlen ein, an ihren Ufern häuften sich die Kadaver, und der süßliche Gestank nach Verwesung und Tod verpestete die Luft.
Nur die Geier wurden fett und legten mehr Eier als üblich. Auf den vertrockneten Weiden bleichten die Knochen Tausender verhungerter Rinder, und die Zulus besannen sich auf ihre kriegerische Tradition und gingen auf nächtliche Raubzüge durch die Viehgatter ihrer Nachbarn. Wie Eiterbeulen brachen die ersten Stammesfehden wieder auf.
El Niño hatte ganze Arbeit geleistet.
Jill Rogge, die Eigentümerin des berühmten Wildreservats Inqaba, brauchte auf ihren Morgenrunden nur der Nase nach zu gehen, um verdurstete Wildtiere aufzuspüren. Manchmal stieß sie auf eines, das gerade noch lebte, aber keine Kraft mehr hatte, sich zu rühren. Heute war es eine junge Giraffe, die vor Schwäche auf einem Seitenpfad zusammengebrochen war. Als Jill sich näherte, versuchte das Tier panisch, auf die Beine zu kommen, schaffte es aber nicht und sank wieder zurück. Ihr kamen die Tränen. Leise redete sie auf die junge Giraffe ein, bis sie spürte, dass sich das Tier entspannte. Sanft bedeckte sie darauf die vertrauensvoll auf sie gerichteten dunklen Augen mit einem Tuch und lud ihr Gewehr durch.
Als sie später ein wenige Tage altes Elefantenjunges fand, das schon zu schwach war, das Gesäuge seiner toten Mutter zu erreichen, sank sie in die Knie und weinte bitterlich.
Nachdem El Niño zum Entzücken der Touristen die Atacama-Wüste in Chile mit ergiebigen Regenfällen in einen Blumenteppich verwandelt hatte, amüsierte er sich damit, auf drei Kontinenten seinen Schabernack zu treiben.
Als Erstes kühlte er den Golfstrom ab, der Luftdruck über dem Atlantik sank, die Westwinde fielen in sich zusammen und boten der sibirischen Kältewelle, die aus Russland heranrollte, keinen Widerstand. Die Temperaturen in Norddeutschland stürzten in frostige Tiefen. Es hatte vorher tagelang geregnet, die hohe Luftfeuchtigkeit ballte sich in den tief hängenden Wolken zu Kristallen, und innerhalb von Minuten fegte ein für die Jahreszeit völlig untypischer Schneesturm durch Hamburgs Häuserschluchten.
Auf der anderen Seite der Welt, an der Ostküste Indiens, brach über Bombay ein Gewitter herein, wie es die Millionenstadt selten erlebt hatte. Der Boden war ausgedörrt, die Wassermassen konnten nicht ablaufen, und innerhalb kürzester Zeit verwandelten sich Straßen in reißende Flüsse. Auch Pune, etwas über hundert Kilometer Luftlinie entfernt, versank in den Regenfluten.
Fast gleichzeitig schob sich ein schwarzes Ungetüm, ein Gewittersturm, über den Horizont von KwaZulu-Natal in Südafrika, das in jedem die Urangst vor dem Zorn der Götter erweckte. Der Sturm brach los und verwüstete Zululand.
1
Der Himmel über Hamburg an diesem Novembertag war winterlich schwarz, ein eisiger Wind fegte durch die kahlen Bäume und trieb den Schnee in dichten Schwaden über die Straßen. Kein Räumdienst kam durch, auf dem Gehweg blockierten Schneewehen den Weg, und die Straßen waren eisverkrustet. Nur zwei Lebewesen waren an diesem unwirtlichen Abend unterwegs. Ein Mann namens Viktor Rodenbeck – und eine Krähe.
Viktor war glücklich, die Krähe hungrig.
Trotz der arktischen Kälte war Viktor in Hochstimmung. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen pflügte er wie ein kleiner Junge mit den Füßen durch die aufgetürmten Schneewehen und summte dabei vor sich hin. Es war kein Traum, er hatte den Auftrag bekommen. Noch konnte er es kaum glauben, aber der unterschriebene Vertrag für die Fotostrecke knisterte verheißungsvoll in seiner Brusttasche. Tief in angenehme Gedanken versunken, trottete er weiter.
Die Krähe, die lautlos an ihm vorbeistrich, nahm er nicht wahr.
Seit Wochen hatte er sich bei dem Chefredakteur den Mund fusselig geredet, ein umfangreiches Exposé geschrieben, ihm Musterfotografien und Dokumentationen seiner veröffentlichten Arbeiten vorgelegt, die dem Redakteur veranschaulichen sollten, dass er, Viktor, der Richtige für den Auftrag sei.
Letztlich war wohl die Tatsache ausschlaggebend, dass er nicht nur KwaZulu-Natal, die saftig grüne Provinz Südafrikas am Indischen Ozean, wie seine Westentasche kannte, sondern auch alle anderen Provinzen des berückend schönen Landes. Schließlich hatte er dort Jahrzehnte mit seiner Familie gelebt, und in der norddeutschen Kälte lechzte sein Körper nach dem weichen, warmen Atem des Indischen Ozeans.
Es war 1980 auf dem Frankfurter Flughafen gewesen. Sein Flug, mit dem er zu seiner ersten Geschäftsreise in die Vereinigten Staaten starten wollte, hatte sich verzögert, und er schlenderte ziellos durch die Menge der Reisenden, die sich durch die Gänge drängten.
Manchmal waren es die unvorhersehbaren Kleinigkeiten, die die größten Auswirkungen hatten. In Viktors Fall war es eine zusammengerollte Bild-Zeitung. Sie fiel ihm vor die Füße, er strauchelte, stieß gegen eine junge Frau, die einen Kaffee in der einen und ihre offene Handtasche in der anderen Hand hielt – weswegen sie die Zeitung hatte fallen lassen –, der Kaffee ergoss sich über seine neue Hose, und er raunzte die Frau wütend an – wie solle er jetzt, so kurz vor Abflug, noch an eine neue Hose kommen?
Alles hatte er erwartet – dass sie sich entschuldigen würde oder in Tränen ausbrechen, ihn ebenfalls anraunzen –, nur dass sie sich in einem Lachanfall förmlich krümmen würde, damit hatte er nicht gerechnet. Wie vom Blitz getroffen, hatte er sie angestarrt. Blond war sie, strahlend, sprühend vor Lebenslust.
»Sie sehen wahnsinnig komisch aus«, hatte sie zwischen Lachsalven gejapst. »Wie ein kleiner Junge, der sich in die Hosen gepinkelt hat und von der Mama erwischt worden ist …«
Sie hatte englisch gesprochen, mit einem ausgeprägten Akzent. Er öffnete den Mund, um ihr eine passende Antwort vor die Füße zu schleudern, bekam aber keinen zusammenhängenden Satz heraus. Sie schien ihn trotzdem zu verstehen.
»Ja, gerne«, sagte sie. »Mein Abflug ist erst in drei Stunden, da wäre ein Glas Wein sehr willkommen.« Sie warf den leeren Kaffeebecher in einen Papierkorb, schulterte ihre schwere Umhängetasche und lächelte ihn erwartungsvoll an.
Minuten später saßen sie sich in einem Restaurant gegenüber, und innerhalb einer halben Stunde wurde sein Leben völlig umgekrempelt.
Krista war Afrikanerin, und ihrer Familie gehörte, wie sie erzählte, eine idyllische Farm in Zululand.
»Das liegt in Südafrika«, erklärte sie ihm.
Südafrika! Damals hatte er nur vage Vorstellungen von dem Land am anderen Ende der Welt gehabt. Johannesburg, die Stadt des Goldes, Kapstadt am Kap der Stürme und der Krügerpark waren ihm ein Begriff, aber nur von Bildern. Afrika stand nicht auf seiner Sehnsuchtsliste. Er träumte von Amerika und dem Fernen Osten und vielleicht irgendwann von einem Aufenthalt in Australien.
Ihre Erzählungen von der Familienfarm in Afrika weckten jedoch zu seiner Überraschung ein ungeahntes Verlangen in ihm, eines, das er noch nie gespürt hatte. Es riss ihn mit, wirbelte ihn aus dem Alltagstrott, dem Einerlei von Arbeit, Einsamkeit und unerfüllten Träumen, hinaus über die Weiten der Savanne in den brennend blauen Himmel über Afrika.
Er hatte Krista in die Augen gesehen, diese strahlenden, blauen Augen.
»Komm heute mit nach Amerika«, sagte er mit einer Stimme, die er kaum als die eigene erkannte. »Ich habe da noch einiges zu erledigen. Danach heiraten wir und fliegen zusammen nach Afrika.«
»Ja«, hatte Krista zu seiner unendlichen Überraschung gerufen und gelacht und ihn geküsst.
Und so geschah es. Sie flogen zusammen nach Amerika, und kaum dass sie wieder in Hamburg gelandet waren, bot er seine Kündigung an. Sein Chef reagierte allerdings keineswegs ärgerlich, sondern eröffnete ihm, dass die Firma ein Grundstück bei Durban für ein geplantes Zweigunternehmen gekauft habe und dort einen Verkaufsleiter für den gesamten Süden Afrikas brauche.
Mit einem Fünfjahresvertrag in der Tasche reisten Krista und er nach Durban und feierten dort ihre Hochzeit mit Kristas Familie. 1982 wurde Nina geboren, und ihr Glück war perfekt. Als Verkaufsleiter für deutsche Textilmaschinen hatte er klotzig Geld verdient, was ihm und seiner Familie ein äußerst angenehmes Leben erlaubte. Jede Provinz des riesigen Landes und auch die anschließenden Länder hatten sie erkundet, aber das Gebiet nördlich des Tugelaflusses hatte es ihnen besonders angetan. Mindestens ein Mal im Monat fuhren sie mit Freunden ins Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, mieteten eine Lodge im Busch mit einem Koch, der nur für sie da war. Oder sie fingen in den Felsenteichen an der Küste Langusten, die sie am Strand grillten und anschließend mit Zitronenbutter und Baguette verzehrten.
Hluhluwe, Sodwana Bay, Kosi Bay, Lake Sibaya.
Die Namen breiteten sich mitten in der beißenden Kälte als warme Welle in Viktor aus, und er verlor sich in Erinnerungen. Er hatte geglaubt, sie längst besiegt zu haben, diese unvernünftige Sehnsucht. Er blieb stehen und starrte hinauf in die Schwärze des Winterabends. Die Flocken fielen dichter und glitzerten im Licht der Straßenlaterne wie Millionen Sterne.
Sein Blick verschwamm. Er sah blendende Helligkeit, wogende Wellen von endlosen, grünen Zuckerrohrfeldern und meinte, die Sonne Afrikas auf der Haut zu spüren. Er musste sich beherrschen, nicht laut zu juchzen. In etwas mehr als achtundvierzig Stunden würde er auf dem King-Shaka-Flughafen landen. Mit einem gemieteten Landrover plante er, am folgenden Morgen die Küste am Indischen Ozean entlang nach Norden ins Herz von Zululand zu fahren. Eine Rückkehr in sein Paradies. Nach über vierzehn Jahren. Manchmal fragte er sich, warum er immer noch freiwillig die Kälte und Dunkelheit des europäischen Winters ertrug. Er atmete tief durch.
Einmal Afrika, immer Afrika.
Ein schneidender Windstoß fegte die Straße herunter und zerstörte die angenehme Vision. Schneeflocken trafen seine Brille, rannen die Gläser hinunter und machten ihn praktisch blind. Er nahm sie ab, putzte sie und steckte sie in die Brusttasche. Dabei berührte er sein Mobiltelefon, und einem plötzlichen Impuls folgend, zog er es heraus und tippte Ninas Kurzwahl ein. Vielleicht konnte er sie überreden, ihn zu begleiten.
Vielleicht war sie endlich so weit.
»Hallo, Prinzessin«, rief er betont fröhlich. »Wie geht’s?«
»O Dad, hör auf, mich Prinzessin zu nennen. Ich bin erwachsen, falls du das noch nicht gemerkt hast.«
»Und? Du wirst immer meine Prinzessin bleiben …«
Er hörte sie theatralisch seufzen. »Willst du nur klönen, oder ist es unaufschiebbar wichtig? Ich habe ziemlich viel um die Ohren.«
Wichtiger als alles andere, hätte er am liebsten geantwortet.
»Also, es ist so …«, begann er nervös und hetzte dann durch die Sätze, um ihr keine Gelegenheit zu geben, ihn zu unterbrechen. »Ich muss für einen Auftrag nach Südafrika fliegen. Hast du vielleicht Zeit und Lust, mich zu begleiten? Du könntest Heilpflanzen recherchieren und Fotos machen.« Gespannt wartete er auf ihre Antwort.
Die aber kam nicht. Nina schwieg. In der Leitung knackte es, im Hintergrund hörte er Stimmen und das stetige Verkehrsrauschen. Ihr Labor lag mitten in Hamburg.
»Nina?«, sagte er leise. »Es ist über vierzehn Jahre her …«
Vierzehn Jahre, seit das Licht in ihren Augen starb.
Nina war immer sportlich schlank gewesen, aber in letzter Zeit war ihm aufgefallen, dass sie leicht zugenommen hatte. Ihre Haut erschien ihm rosiger und praller, die schönen Linien ihres Gesichts, die hohen Wangenknochen weicher, ihre türkisfarbenen Katzenaugen leuchtender.
Vielleicht steckte ja ein Mann dahinter? Wäre das so, war sie auf dem Weg, endlich ihr Trauma zu überwinden. Ein Freudenflämmchen tanzte in seiner Brust.
»Noch nicht lange genug!« Ihre Stimme war kühl und emotionslos. »Eine Ewigkeit würde nicht reichen.«
Das Flämmchen erlosch.
»Tu dir das nicht an«, sagte er leise. »Sonst hat der Kerl endgültig gewonnen.«
Wer ihr das angetan hatte und was genau vorgefallen war, konnten die ermittelnden Beamten ihr damals nicht entlocken. Auch Viktors und Kristas vorsichtige Fragen hatten keinen Erfolg. Doch gelegentlich trat unvermittelt ein Ausdruck von solch blankem Entsetzen in ihre Augen, dass ihn der Gedanke beschlich, dass sie doch nicht alles vergessen hatte. Aber er hatte nie gewagt, sie danach zu fragen.
»Daran kann ich mich nicht erinnern«, war ihre stereotype Antwort auf die Fragen gewesen. Der Polizei gelang es weder, den Tathergang genau zu rekonstruieren, noch, den Täter zu identifizieren, da Nina sich nicht einmal bei der Hautfarbe des Angreifers sicher war.
»Schwarz, braun, weiß – ich hab das verdammt noch mal nicht mitbekommen«, schrie sie die befragende Polizistin an.
Die hatte unbeeindruckt weitergefragt. Mit freundlicher Miene und ruhiger Stimme.
Konnte sie seine Kleidung beschreiben? Trug er Schmuck? Eine Uhr vielleicht? Lange Hosen, kurze Hosen? Ein Hemd oder vielleicht keines?
Nina, die Augen mit steinerner Miene starr auf ein unsichtbares Bild gerichtet, quittierte jede Frage mit verbissenem Kopfschütteln.
Unvermittelt änderte die Beamtin ihre Taktik. »Wie hatte sich sein Haar angefühlt?«
Nina zuckte zusammen und starrte die Frau überrumpelt an.
»Wie hat er gerochen?«, bohrte die Beamtin weiter.
Nina war schlagartig blass geworden, daran erinnerte sich Viktor genau. Bestimmt verschwieg sie etwas. Aber warum sie das tat, war ihm schleierhaft.
Die Ärzte diagnostizierten retrograde Amnesie, was hieß, dass das eigentliche Ereignis aus ihrem Gedächtnis gelöscht war. Oder Nina wollte sich nicht erinnern, was aufs Gleiche hinauslief. Kurz darauf wurde ihr Fall ad acta gelegt.
Nina war vor jenem Tag damals ein lebenslustiges, kontaktfreudiges Mädchen gewesen, das furchtlos in der Brandung nach Langusten tauchte und allein durch den Busch streifte. Körperlich erholte sie sich relativ schnell, aber ihre Bewegungen waren nicht mehr so lebhaft und energiegeladen, und ihre Schultern krümmten sich nach vorn, als wollte sie sich schützen. Es war, als trocknete ihre Seele ein.
Im Laufe der letzten Jahre hatte sich der Eindruck allerdings etwas verwischt. Das Entsetzen trat nur noch selten an die Oberfläche. Nur ihm fiel wohl noch auf, dass sie, wie er es nannte, in ihrem Schneckenhaus verschwand.
Aber das Funkeln in ihren wunderschönen Augen war erloschen, und ihr mitreißendes Lachen hatte sie verloren. Eine klingende Kadenz von glockenklaren Tönen, die jeden, der sie vernahm, mit seiner Fröhlichkeit ansteckte.
Er packte sein Handy fester. »Nina? Liebes?«
»Nein. Und bitte frag mich nie wieder!«
Er wusste nichts zu antworten.
»Übrigens fliege ich morgen nach Indien, also hätte ich sowieso keine Zeit.« Jetzt war ihr Ton weicher.
Er blieb stehen und kickte mit einem Fuß in eine flache Schneewehe. Eine pudrig weiße Wolke stob hoch, überzuckerte seine Schuhe und durchnässte seine Strümpfe. »Geschäftlich? Hast du wieder einen Forschungsauftrag?«
»Ja«, bestätigte sie. »Wir suchen nach neuen medizinischen Nutzpflanzen. Die Inder haben auf dem Gebiet eine Tradition, die Jahrhunderte zurückreicht. Ihr Wissen ist ein wahrhaftiger Schatz, den ich zu heben vorhabe.«
Er zögerte, konnte aber dann doch nicht an sich halten. »Wir?«
Nina lachte leise. »Konrad begleitet mich.«
Ein Echo ihres früheren Lachens! Mit abwesender Geste wischte er sich die Schneeflocken vom Kragenrand. Sie schmolzen schnell und rannen als eisige Wassertropfen seinen Hals hinunter.
»Konrad-nenn-mich-ja-nicht-Konni-sonst-kriegste-eins-aufa-Glocke? Der Konrad?«
Wieder lachte sie. »Genau der. Du hast seinen Tonfall präzise imitiert. Er tut manchmal gern etwas prollig …«
»Bist du …?«, begann er leise und wunderte sich, dass seine Stimme so brüchig klang. »Ich meine … seid ihr …?«
Für einen Augenblick waren nur die atmosphärischen Geräusche in der Leitung zu hören und Ninas Atmen, und er befürchtete, ihr zu nahe getreten zu sein, sodass sie wieder in ihr Schneckenhaus verschwinden würde.
»Ja«, antwortete sie.
Nichts weiter.
»Aber jetzt muss ich Schluss machen«, rief sie, bevor er etwas sagen konnte. »Ich habe weder meine Sachen gepackt noch die letzten E-Mails beantwortet. In zwei Wochen bin ich wieder zurück. Pass auf dich auf! Tata, Dad!«
»Nina?«, sagte er, aber sie hatte aufgelegt.
Er starrte auf das Telefon in seiner Hand. Tata. Auf Wiedersehen. Ein Wort aus ihrer Kindheit. Ihr kurzes, aber inhaltsschweres Ja. Ein Anlass zur Hoffnung? Sollte er sie nach Nico fragen? Er hatte das schon einmal getan, kurz nachdem sie Südafrika verlassen hatten.
»Wer ist das?«, hatte sie mit abwesender Miene gefragt. »Sollte ich ihn kennen? Daran kann ich mich nicht erinnern.«
Was hätte er ihr darauf antworten sollen? Dass Nicolo dal Bianco der Mann war, in den sie verliebt war? Und der in sie verliebt war? Der sie heiraten wollte? Er schauderte bei der Vorstellung, was ihre Erinnerung an Nico so komplett ausgelöscht hatte.
»Ich bin tot, von hier bis da unten«, hatte sie gewispert und eine Handbewegung vom Nabel über ihren Unterleib gemacht. »Tot. Alle meine Gefühle. An dem Tag habe ich begonnen zu sterben.«
Ihr hilfloser Blick hatte ihn bis ins Herz getroffen, aber er hatte nicht gewusst, wie er ihr helfen sollte. Krista hatte ihn zu der Zeit schon verlassen. Er hatte niemanden, den er hätte fragen können, weil Nina sich nach wenigen Sitzungen bei ihrer Psychotherapeutin weigerte, weiter zu ihr zu gehen.
Danach hatte sie sich wieder in ihrem Schneckenhaus verschanzt. Gerade hatte sie gegen heftige Konkurrenz die Anstellung als Leiterin des Forschungslabors für Heilpflanzen bekommen. Aber der Neid der übergangenen Mitarbeiter war fühlbar, und so saß sie Abend für Abend bis spät in die Nacht vor ihrem Bildschirm, um ihre Forschungsergebnisse vom Tag durchzuarbeiten. Zwischendurch aß sie irgendetwas aus der Tiefkühltruhe oder bestellte eine Pizza beim Pizzaservice, die groß genug war, dass sie am nächsten Abend noch genug davon übrig hatte, wie sie ihm erzählte. Für Freundschaften habe sie vorläufig weder die Zeit noch die Kraft.
Einen Mann, der ihr besonderes Interesse erweckt hätte, hatte er weit und breit nicht ausmachen können.
Er steckte das Telefon ein. Der Umschlag mit dem Vertrag raschelte leise. Es schneite nun heftiger, und der Wind schnitt ihm in die Haut. Rasch ging er weiter. Bald würde er in Südafrika landen und ins unvergleichliche Licht des dortigen Frühlings treten, das immer wie eine schimmernde Schale aus blauem Kristall über Meer und Land lag. KwaZulu-Natal litt unter einer Hitzewelle, wie er im Internet gelesen hatte. Seit Wochen war das Thermometer nicht unter dreißig Grad gefallen. Seine Betriebstemperatur! Ein plötzlicher Windstoß ließ ihn frösteln. Für ihn war Südafrika das schönste Land der Welt gewesen, und es hatte nichts gegeben, was ihn zur Rückkehr nach Deutschland hätte bewegen können.
Bis zu jenem Freitag.
Der Gedanke sprang ihn aus dem Hinterhalt an. Abrupt blieb er stehen, verlor kurz die Balance und wäre um ein Haar ausgerutscht, konnte sich aber im letzten Moment an einem Baumstamm abstützen. Eine Schneekaskade löste sich und fiel auf ihn herab. Er schüttelte sich, spürte jedoch nicht die nasse Kälte der schmelzenden Flocken, sondern war zurück in Natal in der Waschküchenhitze des Hochsommers im Jahr 2002.
Er war dabei gewesen, als Ninas Auto entdeckt wurde. Verschwunden war sie auf der Fahrt die Nordküste hoch, irgendwo zwischen Umhlanga Rocks und Mtunzini, wo sie eine Freundin hatte besuchen wollen. Gefunden wurde sie durch puren Zufall. Ein Kuhhirte, der seine Herde auf einem von Regenfurchen durchzogenen Weg trieb, der durch die Zuckerrohrfelder entlang eines ausgetrockneten Wasserlaufs verlief, verspürte einen plötzlichen Druck auf der Blase und trat ein paar Schritte in die Büsche, um sich zu erleichtern. Sein kräftiger Strahl traf auf Metall, und es gab ein hohl trommelndes Geräusch. Er beendete sein Geschäft, zog die Hose hoch und bahnte sich neugierig den Weg in den Busch.
Das Auto, ein kompakter, weißer Golf mit einer langen Beule über die gesamte linke Seite, wurde von herunterhängendem Buschwerk so verdeckt, dass der Wagen schon aus knapp zwei Metern Entfernung so gut wie unsichtbar war. Der junge Hirte rüttelte vergeblich an der Fahrertür. Sie war abgeschlossen. Auch die anderen Türen sowie die Heckklappe ließen sich nicht öffnen. Mit einem Stein versuchte er, eines der Seitenfenster einzuschlagen, aber auch das gelang ihm nicht. Das dumpfe Stöhnen schrieb er seinen Kühen zu, die ständig irgendwelche Geräusche von sich gaben. Schließlich gab er auf und trieb seine Herde auf die Weide.
Als er mit den Tieren abends in der sinkenden Sonne heimwärts wanderte, stand das Auto immer noch da. Begehrlich starrte er das herrenlose Gefährt an, rüttelte an einem der Außenspiegel und brach schließlich die beiden Scheibenwischer ab und steckte sie in seine rückwärtige Hosentasche. Die konnte man immer zu Geld machen. Dann trottete er zur Hofstätte seiner Familie, trieb seine Rindviecher in ihren Kraal und berichtete anschließend seinem Vater von dem verlassenen Wagen.
Sein Vater war ein Mann fester Prinzipien und genauer Vorstellung von richtig und falsch und anderer Leute Eigentum. Ohne zu zögern, marschierte er eine Stunde durch den Busch zur lokalen Polizeistation und berichtete dem diensttuenden Beamten, der sein Neffe war, von dem Auto. Da es in Kürze stockdunkel sein würde, beschloss der Polizist, sich erst tags darauf darum zu kümmern.
Nachdem der Beamte am nächsten Morgen den demolierten Wagen inspiziert hatte, rief er seine Durbaner Kollegen an mit der Bitte, das Kennzeichen zu prüfen. Schnell wurde festgestellt, dass seit Tagen nach diesem Fahrzeug im Zusammenhang mit einem Schwerverbrechen gefahndet wurde.
Als Viktor eintraf, hatte die Spurensicherung bereits den Kofferraum durchsucht. Die Frage, ob das Auto das seiner Tochter sei, bestätigte Viktor mit einem knappen Nicken. Er beobachtete die Polizisten, die den Bereich der Vordersitze Zentimeter für Zentimeter absuchten. Eine junge, dunkelhäutige Beamtin war dabei besonders gründlich. Sie legte sich auf den Bauch und leuchtete unter die Sitze, löste die Fußmatten und untersuchte den Boden. Anschließend klopfte sie die Rückwand vom Handschuhfach ab.
Verblüfft sah Viktor zu. »Dahinter kann sich doch sicherlich kein Mensch verstecken.«
»Manchmal erlebt man da eine Überraschung. Illegale Grenzgänger verstecken sich gern dahinter.« Sie richtete sich auf. »Wie groß ist Ihre Tochter? Ist sie schlank?«
»Sie ist sehr schlank und rund eins fünfundsiebzig groß.«
»Würde etwas eng für sie werden«, sagte die Polizistin, beugte sich vor und klopfte noch einmal das Handschuhfach ab. »Aber hier ist nichts. Tut mir leid.« Sie wischte sich mit einem Papiertaschentuch über das schweißglänzende, schokoladenbraune Gesicht. »Wir finden Ihre Tochter«, murmelte sie dann und senkte den Blick zu Boden. »Versprochen.«
In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass die Aussicht, Nina lebend wiederzusehen, mit jeder Minute unwahrscheinlicher wurde. »Ich will mir den Innenraum ansehen. Ist das möglich?«
Die Beamtin nickte wortlos und zeigte auf den rückwärtigen Bereich. Viktor öffnete die Tür und sah sich um.
Auf dem Boden lagen zwei Kippen, dabei rauchte Nina gar nicht. Die Kippen und der süßliche Geruch nach verbranntem Gras, ganz unzweifelhaft Cannabis, und als Kopfnote das abstoßend aufdringliche Männerparfüm jagten ihm die Angst durch die Adern.
Die Beamtin schlug das Handschuhfach zu und drehte sich mit einem Kopfschütteln zu ihren Kollegen um.
Viktor blieb mit gesenktem Kopf stocksteif stehen. In das trockene, harte Geräusch, mit dem die Klappe zufiel, mischte sich ein anderer Laut. Einer, den er nicht einordnen konnte. Hohl, dumpf, und es schien ihm, dass er aus dem Kofferraum kam. Er drängte die Uniformierten beiseite und drückte mit zitternden Händen die Entriegelung des Kofferraums.
»Das können Sie sich sparen«, sagte einer der Männer von der Spurensicherung, ein vierschrötiger Schwarzer mit freundlichem Gesicht und Schultern wie ein Preisboxer. »Der ist leer.« Aber er trat zurück und ließ Viktor gewähren.
Angespannt beugte er sich vor, während die Heckklappe langsam nach oben schwang. Ein Gestank nach Fäkalien stieg ihm in die Nase. Die Hand über den Mund gepresst, wandte er sich kurz ab und schnappte dann nach Luft, um sich für das zu stählen, was im Heck auf ihn wartete. Mit angehaltenem Atem inspizierte er den Kofferraum.
Aber er sah nur den Ersatzreifen, Einkaufstaschen, Ninas Laufschuhe und ein angebrochenes Paket Papiertaschentücher. Darüber hinaus war der Kofferraum leer. Er musste sich geirrt haben. Enttäuscht stemmte er sich hoch.
»Hab ich doch gesagt, das Auto ist leer«, sagte der Vierschrötige und packte die Klappe, um sie zuzuwerfen. In diesem Moment ertönte der dumpfe Laut wieder, und jetzt war klar, dass auch er ihn gehört hatte.
Danach ging alles sehr schnell.
»Da ist doch was!«, brüllte der Schwarze. »Wir brauchen eine Säge oder so was! Schnell!«
Niemand hatte eine Säge. Kurz entschlossen packte der Mann einen oberarmdicken Ast, der im Busch lag, und rammte ihn mit aller Kraft gegen die Rückwand des Kofferraums.
Der Ast brach, aber die Wand gab krachend nach. Viktor stieß den Polizisten beiseite, kroch ins Heck, packte die Rückwand mit den Händen und zerrte sie weg.
Nina lag zusammengekrümmt in diesem Loch, das kaum mehr Platz bot als für einen Handgepäckkoffer – Knie bis unters Kinn gedrückt, Mund und Augen mit braunem Packband verklebt und Hände und Füße mit Kabelbindern fixiert.
Als Viktor sie berührte, um die Kabelbinder zu lösen, geriet sie in Panik und schrie. Schreckliche Laute, vom Packband über ihrem Mund abgewürgt. Ihr Gesicht lief krebsrot an, die Adern an ihrem Hals standen wie Stränge hervor.
Hände und Füße waren stark angeschwollen und blauviolett verfärbt. Viktor redete behutsam auf sie ein, während er sich daranmachte, die Fesseln an ihren Handgelenken mit seinem Taschenmesser zu durchtrennen. Nina wich vor ihm zurück und schrie vor Angst. Ihm wurde ganz anders dabei, aber er fuhr fort.
»Der Hubschrauber mit dem Notarzt wird in etwa einer halben Stunde eintreffen«, informierte ihn die Polizistin. »Er wird ihr ein Schmerzmittel spritzen können. Sie sollten lieber warten.«
Viktor schüttelte den Kopf. »Das hält sie nicht aus«, knurrte er.
Er biss die Zähne zusammen, schob die Messerklinge unter den Kabelbinder und ertrug Ninas dumpfes Schreien, bis die Plastikstreifen herunterfielen und ihre Hände frei waren. Die Fesselung hinterließ tiefe, blutende Furchen. Nina riss die Arme hoch, stieß dabei gegen die Kofferraumwand und stöhnte auf. Viktor fing ihre Hände ein und hielt sie fest.
»Hat jemand Verbandsmaterial dabei?«, rief er.
Die Polizistin lief zu ihrem Dienstwagen und kam kurz darauf mit einem Erste-Hilfe-Kasten zurück. Geschickt umwickelte sie Ninas Handgelenke mit Mullbinden, während Viktor weiter beruhigend auf seine Tochter einredete.
»Sei ganz ruhig, Prinzessin«, murmelte er und hielt ihre Hand. »Du bist in Sicherheit …«
»Fertig«, verkündete die Beamtin und trat zurück.
Viktor beugte sich vor. »Ich werde jetzt erst das Klebeband von deinen Augen lösen«, sagte er. »Und danach das von deinem Mund … Es wird nicht wehtun.«
Mit einer Hand hielt er ihren Kopf still, mit der anderen zog er millimeterweise das Klebeband von ihren Augen. Nina reagierte nicht. Ihr Blick war starr, und sie bebte am ganzen Leib.
»Und nun ziehe ich das Packband von deinem Mund. Halt ganz still, Prinzessin, gleich ist es vorbei …«
Kaum war ihr Mund frei, schrie sie los.
»Nicht schreien, Prinzessin«, murmelte Viktor. »Ganz ruhig, ich bin bei dir … Niemand kann dir etwas tun …« Er hielt kurz inne, weil er merkte, wie läppisch das klang. Er räusperte sich. »Ich schneide jetzt die Fesseln von deinen Beinen los, das wird vielleicht wehtun, aber dann bist du frei, und ich kann dich herausheben.«
Ihr Schreien ging in leises Gewimmer über und verstummte schließlich. Krampfhaft schnappte sie ein paarmal nach Luft, dann nickte sie kurz. Als Viktor das Messer unter die Fesseln schob und dabei die tiefe Wunde berührte, verzog sie vor Schmerzen das Gesicht, gab aber keinen Laut von sich.
Viktor durchschnitt die Kabelbinder. »Es ist vorbei, Prinzessin, ich hol dich jetzt da raus.« Er beugte sich über sie, um sie hochzuheben.
In diesem Augenblick entdeckte er die Schlange. Es war ein schönes Tier, von reinem Grasgrün, nicht ganz einen Meter lang. Sie hatte es sich in Ninas Kniekehlen bequem gemacht. Jetzt drehte das Tier seinen Kopf minimal und fixierte ihn mit unergründlich schwarzen Augen. Ihm stockte der Atem.
»Eine Schlange«, flüsterte er und wagte es nicht, sich zu bewegen, weil er das Reptil nicht aufscheuchen wollte. »Da, in ihren Kniekehlen. Ist das eine Grüne Mamba?« Nina zuckte zusammen, und Viktor spürte, dass sie wieder zu zittern anfing. »Ruhig, Prinzessin …«
Der vierschrötige Schwarze sah genauer hin. »Es ist eine Grüne Baumschlange«, murmelte er. »Sehr giftig. Tödlich, wenn sie die richtige Stelle trifft.« Er wandte sich Nina zu. »Rühren Sie sich nicht. Verstehen Sie mich? Keine Bewegung.«
»Okay«, wisperte sie.
»Tretet alle zurück«, befahl er seinen Kollegen. »Keiner darf den Wagen berühren. Und ruft die Rettung an, sagt Bescheid, dass wir mit einem Biss einer Baumschlange rechnen müssen.« Er wandte sich wieder an Viktor. »Ich werde sie am Kopf packen, und wenn ich sie habe, heben Sie Ihre Tochter heraus. Aber nicht einen Augenblick vorher, verstanden? Brauchen Sie Hilfe?«
»Nein«, krächzte Viktor.
»Okay«, murmelte der Zulu.
Mit einer langsamen, gleichmäßigen Bewegung hob er die rechte Hand und näherte sich millimeterweise dem Schlangenkopf.
Die junge Polizistin zog ihre Pistole, ging in zwei Metern Entfernung in Schussposition und ließ das Reptil nicht aus den Augen. Niemand rührte sich, niemand gab einen Laut von sich.
Später konnte Viktor sich nicht daran erinnern, dass der Polizist sich überhaupt bewegt hatte.
»Hab sie!«, brüllte der Zulu und sprang ein paar Schritte zurück.
Triumphierend hielt er die sich heftig windende Baumschlange hoch, die er mit sicherem Griff hinter dem Kopf gepackt hatte. Er lief ein Stück ins Gebüsch und entließ das Reptil in die Freiheit. Nach kurzem Zögern glitt die Schlange senkrecht an einem Baumstamm hoch, und ohne auch nur ein Blatt zum Zittern zu bringen, verschwand sie im grünen Blätterdach.
Viktor befreite Nina mit unendlicher Vorsicht aus ihrem Gefängnis, und als sie ihm die Arme um den Hals schlang, strömten ihm die Tränen übers Gesicht. Die Polizistin half ihm, Nina hochzuheben, und führte ihn zum Streifenwagen.
»Der Hubschrauber landet gleich«, sagte sie. »Setzen Sie sich so lange in den Wagen.« Sie nahm eine Flasche Wasser aus der Seitentasche und öffnete sie. »Hier, sie wird sehr durstig sein.« Sie winkte einem Kollegen, und gemeinsam markierten sie auf dem abgeernteten Zuckerrohrfeld nahebei einen geeigneten Landeplatz.
Viktor setzte die Flasche an Ninas Lippen und spürte, wie sie sich entspannte. Er murmelte Koseworte aus ihrer Kindheit und wiegte sie auf dem Schoß, wie er das früher mit der kleinen Nina getan hatte. So saß er da, mit seiner Tochter im Arm, und vergaß die Welt um sich herum.
Bald kündigte das unterschwellige Wummern von Rotoren den Rettungshubschrauber an, und innerhalb von Minuten setzte er auf dem markierten Platz auf. Zwei Sanitäter und ein Notarzt kletterten heraus und bahnten sich den Weg durch das Stoppelfeld.
»Haben wir es mit einem Schlangenbiss zu tun?«, rief der Arzt der Polizistin zu.
»Glücklicherweise nicht«, antwortete sie. »Aber mit einem schweren Schock und vermutlich inneren Verletzungen.«
Der Arzt begrüßte Viktor mit einem kurzen Nicken und stellte seine Tasche ab. »Können Sie mir schildern, was genau ihr zugestoßen ist? Ich weiß nur, dass sie Opfer einer Entführung geworden sei.«
Viktor beschrieb ihm, wie er Nina vorgefunden hatte. »Der Kerl hat sie wie ein Paket verschnürt und ihr als Gesellschaft eine Grüne Baumschlange zwischen die Beine gesetzt. Ob sie innere Verletzungen hat, weiß ich nicht.«
»Übel«, murmelte der Arzt. Er ergriff eines ihrer Handgelenke und löste die Mullbinde, um sich die Wunde näher anzusehen, aber Nina riss ihre Hand weg. Der Arzt ließ sie sofort los.
»Wir bringen sie in die Klinik«, sagte er zu Viktor. »Bitte halten Sie ihren Arm fest. Ich möchte ihr etwas gegen die Schmerzen und den Schock geben und einen Tropf anlegen.« Er nahm eine Spritze aus seiner Tasche.
»Wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus«, flüsterte Viktor ihr zu. »Keine Angst, ich bleibe bei dir. Keiner wird dir etwas antun. Alles wird gut, Prinzessin.«
Wie angewiesen, hielt er ihren Arm ruhig, während der Arzt ihr das Medikament in die Vene spritzte. Mit einem leisen Seufzer schloss Nina die Augen.
»Okay, jetzt spürt sie erst mal nichts mehr«, sagte der Arzt und richtete sich auf. »Ab mit ihr in den Helikopter.«
Die Sanitäter betteten Nina auf die Trage und hoben sie in den Hubschrauber. Viktor setzte sich neben sie und hielt ihre Hand, bis sie im Krankenhaus in den Operationssaal geschoben wurde.
Krista, die Freunde in den Midlands besucht hatte, erreichte die Klinik erst, als Nina schon auf ihrem Zimmer lag.
Viktor und sie wechselten sich am Bett ihrer Tochter ab. Nach nur drei Tagen bestand Nina darauf, nach Hause entlassen zu werden. Sie fühle sich in der Klinik nicht sicher. Auf der Heimfahrt starrte sie schweigend aus dem Fenster. Ihr Gesicht war ausdruckslos, ihre Augen leer, und Viktor, der sie im Rückspiegel beobachtete, schien es, dass sie sich in eine Welt zurückgezogen hatte, in die ihr keiner folgen konnte. Es machte ihm Angst.
Als Nina aus dem Auto stieg, verkündete sie ihren Eltern mit steifen Lippen, dass sie Südafrika verlassen werde. Auf der Stelle. Und für immer.
Und das tat sie, und seitdem hatte sie nie wieder südafrikanischen Boden betreten.
Krista und er bemühten sich nicht, sie umzustimmen. Es war klar, dass es zwecklos sein würde. In jener Nacht redeten sie bis in die frühen Morgenstunden miteinander. Schließlich stand ihr Entschluss fest. Nina war ihr einziges Kind. Ihre Tochter brauchte ihre Eltern zum Überleben.
Innerhalb von Wochen verkauften sie praktisch ihren ganzen Besitz, packten das, was von ihrem südafrikanischen Leben übrig war, in vier Koffer, und dann verließen auch sie für immer das Land, in dem sie so glücklich gewesen waren.
Eine eisige Bö trieb ihm Schneeschwaden ins Gesicht und erinnerte ihn an die jetzige Wirklichkeit. Er zog den Mantelkragen unterm Kinn fest und machte sich – immer noch gedanklich bei jenem Freitag vor vierzehn Jahren – auf den Heimweg.
Die Krähe hockte zehn Meter vor ihm auf dem Ast eines kahlen Baumes. Es war bitterkalt, und ihr Körper verlangte nach Nahrung. Mit ihren schwarzen Knopfaugen hatte sie eine halb gegessene Banane erspäht, die auf dem Bürgersteig im trüben Lichtkreis einer Straßenlaterne lag. Nach wenigen Flügelschlägen landete sie auf der verschneiten Laternenkuppel, streckte den Kopf vor und äugte gierig auf die gelbe Frucht hinunter, ehe sie die Fittiche anlegte und sich in die Tiefe fallen ließ. Elegant fing sie den Fall mit ausgebreiteten Schwingen ab und hüpfte hinüber zu der Banane. Sie packte die Frucht mit dem Schnabel und wollte mit ihrer Beute davonfliegen, aber die Schale war am Boden festgefroren. Mit aller Kraft zerrte und zog sie, und weil sie damit nicht zum Ziel kam, hackte sie mit ihrem scharfen Schnabel in das frostverkrustete Fleisch, bis sie den weichen Kern erreichte.
Hätte Viktor beim nächsten Schritt aufgepasst und seinen Fuß nur zwei Zentimeter weiter links aufgesetzt – sein Leben wäre seinen gewohnten Gang gegangen. Er wäre durch die frostige Nacht nach Hause gelaufen, hätte seine Koffer gepackt und in zwei Tagen die lange Reise nach Südafrika angetreten. Vierundzwanzig Stunden später wäre er am Ziel seiner Träume gewesen.
Er bemerkte die Krähe erst, als er nur eine Schrittlänge von ihr entfernt war. Der Vogel ließ ärgerlich krächzend von seiner Beute ab, flatterte hoch und landete auf der Laterne. Abgelenkt blickte Viktor zu dem Tier hinauf und hob den Fuß, übersah dabei die Banane, die gelblich im Laternenlicht glitzerte, trat hinein, rutschte aus und fiel mit Schwung rückwärts. Geistesgegenwärtig streckte er beide Arme nach hinten, um den Fall abzufangen, aber der Aufprall war so heftig, dass sein linkes Handgelenk mit einem hörbaren Knacks splitterte und er ungebremst mit großer Wucht auf die rechte Seite fiel.
Das eigentliche Verhängnis aber lauerte unter dem Schnee.
Es war der Rest eines Holzbretts, in das jemand einen Zimmermannsnagel geschlagen hatte und das vom Sperrmüll eines Anwohners heruntergefallen war. Der Nagel stand senkrecht hoch. Er war elf Zentimeter lang, und nur die geschliffene Spitze ragte aus dem Schnee.
Der Nagel war scharf und glitt widerstandslos in den Muskelstrang neben Viktors Rückgrat, verfehlte knapp die Wirbelsäule, durchbohrte aber die Niere. Mit einem Schrei sackte er seitwärts, was zur Folge hatte, wie später im Krankenhaus festgestellt wurde, dass die Niere durch den Ruck fast zweigeteilt wurde.
Viktor brüllte vor Schmerz. Er wollte sich aufrichten, konnte sich aber nicht rühren. Mit der gesunden Hand tastete er seine Taillenlinie entlang, spürte warme Nässe und zu seinem Entsetzen auch die Spitze des Nagels, die aus der Bauchdecke stach. Er krümmte sich zusammen, um zu sehen, was ihm da wie rotglühendes Eisen in der Seite steckte.
»Lieber Gott, lass es nicht meine Niere sein«, war alles, was er noch denken konnte, als ihn der Schmerz wie ein Blitz traf.
Durch den schwarzen Fleckenwirbel vor seinen Augen untersuchte er im Laternenlicht seine verletzte Hand, die zusehends anschwoll. Die Wunde in seiner Seite konnte er nicht sehen, aber umso mehr fühlen. Eine Kette saftiger Flüche brach aus ihm heraus, als ihm klar wurde, was das bedeutete. Eine Operation, und obendrein würde er seine Reise absagen müssen und damit seinen Auftrag verlieren. Alles war umsonst gewesen. Den Abgabetermin würde er auf keinen Fall einhalten können.
Die Einzige, die ihm helfen könnte, war Nina. Sie hatte ein wunderbares Auge für Fotomotive. Nina, die das Schlimmste durchgemacht hatte, was einer Frau zustoßen konnte, die geschworen hatte, nie wieder einen Fuß auf südafrikanische Erde zu setzen.
Nichts auf der Welt würde ihn dazu bringen, sie darum zu bitten. Bevor sie in zwei Wochen aus Indien zurückkam, hoffte er, das Krankenhaus verlassen zu haben. Dann würde er ihr nicht einmal von dem Unfall erzählen müssen. Irgendwie würde er das schon überleben. Irgendwie.
Er langte mit der unverletzten Hand in die Brusttasche, um das Mobiltelefon herauszuholen, aber die Hand gehorchte ihm auf einmal nicht mehr.
»Verflucht!« Mit zusammengebissenen Zähnen schob er zwei Finger in die Tasche und zog das Gerät hervor. Es rutschte ihm prompt aus der Hand und fiel in den Schnee. »Mist, verdammter!«
Die Krähe über ihm krächzte böse und schlug mit den Flügeln.
»Blöder Vogel«, ächzte er. Ihm wurde schubweise schlecht. Mühsam zog er das Telefon heran und quälte sich ab, bis es ihm schließlich gelang, den Notruf einzutippen. Der Rettungsdienst meldete sich nach wenigen Sekunden, und er keuchte heraus, was ihm zugestoßen sei.
»Ja, ein Nagel! Fingerdick …« Ihm wurde schlecht. Das Telefon fiel ihm wieder aus der Hand und dieses Mal auf die Banane. Die Krähe starrte mit schief gelegtem Kopf auf das Telefon hinunter und kreischte aufgebracht.
»Wir kommen sofort«, hörte er den diensthabenden Beamten noch rufen. »Versuchen Sie, sich warm zu halten.«
Viktor ließ sich zurücksinken und bettete den verletzten Arm in den Schnee, um eine noch stärkere Schwellung zu unterbinden. Die Kälte, die ihm durch die Kleidung in den Körper kroch, betäubte das unerträgliche Pochen in seiner Seite etwas. Immer wieder versank er in einem schwarzen See von Bewusstlosigkeit. Ab und zu tauchte er wieder auf, bis er durch den feuerroten Nebel aus Schmerzen endlich die heulenden Sirenen des Rettungswagens vernahm. Der Wagen bog um die Ecke und fuhr langsam die Straße herunter, bis die Scheinwerfer Viktor erfassten.
Der Notarzt, ein drahtiger, gebräunter Mittfünfziger in einer dicken, roten Daunenjacke, sprang heraus. Zwei Sanitäter folgten ihm mit der Ausrüstung. Selbst einen Defibrillator hatten sie dabei.
Viktor machte Anstalten, sich aufzustützen, vergaß aber, dass ihn der Nagel festhielt. Er schrie auf.
»Bleiben Sie ruhig liegen, bewegen Sie sich nicht.« Der Arzt kniete sich neben ihn und untersuchte die stark geschwollene Hand, während einer der Sanitäter eine Goldfolie über Viktors Beine breitete.
»Gebrochen«, murmelte der Arzt und legte die Hand zurück in den Schnee. »Dann wollen wir mal weitersehen. Wo genau haben Sie Schmerzen?«
»Rechts«, knurrte Viktor. »In der Nierengegend …«
»Schere«, sagte der Notarzt und streckte die Hand aus.
Der jüngere der Sanitäter reichte ihm das Gewünschte. Der Arzt schob Viktors Mantel und Jackett zur Seite und schnitt ihm dann Pullover, Hemd und Unterhemd auf. Als er die Spitze des Nagels in dem stark blutenden Riss in der Bauchdecke erblickte, pfiff er durch die Zähne.
»Ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze, und dann bringen wir Sie ins Krankenhaus«, teilte er Viktor mit, während er ihm den linken Arm abband. Er köpfte eine Ampulle, zog die Spritze auf und injizierte ihm den Inhalt.
Viktor schwebte auf einer weichen, lichten Wolke davon und nahm die Fahrt und die Untersuchungen in der Klinik nur durch einen gnädigen Nebel wahr. Er bekam aber mit, dass ihm jemand sagte, dass er sofort operiert werden sollte, und grunzte seine Zustimmung. Solange der glühende Schmerz in seiner Seite danach behoben sein würde, war ihm alles egal.
Das Erste, was er wieder mitbekam, war ein merkwürdiges Geräusch, wie von einer leise laufenden Maschine. Er öffnete die Augen und blickte in das Gesicht eines Mannes, der einen weißen Kittel mit Goldknöpfen trug. Der Mann beugte sich über ihn.
»Gut, dass Sie wieder bei uns sind«, sagte der Mann. »Ich bin Doktor Kroetz und habe Sie operiert.«
»Und, wie sieht’s aus?«, presste Viktor mühsam hervor. »Wann kann ich wieder nach Hause?« Sein Mund war wie ausgetrocknet. »Wo bin ich eigentlich?«
Der Chirurg richtete sich auf. »Im Universitätskrankenhaus Eppendorf, und es sieht nicht so gut aus. Sie werden noch eine Weile bei uns bleiben müssen. Erinnern Sie sich daran, dass Sie einen Unfall hatten?«
Viktor nickte. »Schmerzhaft«, sagte er. »Aber ich vertraue darauf, dass Sie mich wieder zusammengeflickt haben …«
Der Chirurg betrachtete ihn mit mitleidiger Miene. »Ihre Niere ist von dem eingedrungenen Nagel so zerfetzt worden, dass sie nicht mehr funktionsfähig ist. Und da Sie von Geburt an nur eine Niere besitzen, brauchen Sie eine Spenderniere.«
Viktor schloss die Augen und entschied, dass er gerade einen besonders grauenvollen Albtraum durchlebte. Als er durch die Lider blinzelte, war der Chirurg immer noch da und schaute ziemlich ernst drein. Neben dem Bett stand ein großes Gerät mit einem Monitor und vielen Schläuchen, das das schwirrende Geräusch verursachte. Einer der Schläuche steckte in seiner Armbeuge.
»Was ist das?« Viktor deutete auf die Maschine.
»Ein Dialysegerät.«
Viktor wurde schlecht. Er wusste, was das bedeutete.
»Wir haben Sie sofort auf die Liste der Eurotransplant gesetzt«, sagte der Chirurg. »Aber um ehrlich zu sein, sieht es nicht gut aus, um nicht zu sagen, eher schlecht.«
Viktor starrte durch den schwarzen Sternenwirbel vor seinen Augen an ihm vorbei. »Heißt was?«
»Die Liste ist fast endlos. Ihre Chancen, rechtzeitig eine passende Niere zu bekommen, stehen nicht gut.« Er räusperte sich. »Haben Sie einen nahen Verwandten, der Ihnen eine Niere spenden würde?«
Nina! Viktor hob abwehrend die rechte Hand. Halb ausgegorene Gedanken schossen in seinem Kopf umher wie Querschläger.
Eine Spenderniere. Eine endlose Liste. Keine Chance. Nina!
Langsam, aber entschieden schüttelte er den Kopf. »Nein, hab ich nicht.«
Nie würde er Nina fragen. Unter keinen Umständen. Er wandte das Gesicht zur Seite und wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden, um sich zu fassen und Ordnung in sein Gedankenchaos zu bringen. Um zu begreifen, dass er wohl am Ende seines Weges angelangt war.
Der Chirurg betrachtete ihn nachdenklich. »Als Sie eingeliefert wurden, waren Sie nicht ansprechbar. Wir haben in Ihrer Brieftasche nachgesehen, wen wir im Notfall benachrichtigen könnten, und Namen und Telefonnummer Ihrer Tochter gefunden …«
Viktor schreckte hoch. »Sie haben sie doch nicht etwa angerufen?«
»Doch, aber nicht erreicht. Sie sollten sich mit ihr in Verbindung setzen. Möglichst umgehend.«
»Ich denk drüber nach«, murmelte Viktor. »Jetzt möchte ich bitte einen Augenblick allein sein.«
»Natürlich. Aber Sie haben nicht viel Zeit. Es tut mir leid, Ihnen die krasse Wahrheit so unverblümt sagen zu müssen.«
Viktor knurrte eine unverständliche Antwort und schloss die Augen.
2
Obwohl es in Pune noch früher Vormittag war, wälzte sich in der drückenden Hitze eine lärmende Menschenmenge durch die Lakshmi Road. Händler schoben ihre Verkaufskarren geschickt zwischen den Passanten hindurch und priesen lautstark Haushaltsgeräte, Blumenkränze und Schmuck an. Es roch würzig nach Curry und Kräutern, und der Geräuschpegel war ohrenbetäubend. Vor den dunklen, oft halb zerfallenen Häuserfassaden hingen farbenfrohe, mit glitzernden Borten verzierte Prachtsaris zum Verkauf. Die Blumenstände, die die Straße säumten, leuchteten im Sonnenlicht.
Mit einer müden Geste wischte Nina sich den Schweiß von Gesicht und Hals. Die Hitze, der Staub, der wie eine gelbe Decke auf der Stadt lag, und der Lärm setzten ihr beachtlich zu. Ihr luftiges Oberteil und die weiten Sommerhosen waren nass geschwitzt. Ihr Kreislauf spielte verrückt, und das Atmen fiel ihr schwer. Aber nach ein, zwei Tagen würde sie sich daran gewöhnt haben, das wusste sie von ihren früheren Besuchen in diesem faszinierenden Land.
»Wir haben schon an die vierzig Grad, wenn nicht mehr«, knurrte Konrad Friedemann neben ihr grantig.
Nina verdrehte die Augen, aber so, dass Konrad es nicht bemerken konnte. »Du als halber Sizilianer solltest dich doch bei solchen Temperaturen richtig wohlfühlen«, flachste sie und fuhr ihm über sein raspelkurzes, schwarzes Haar.
Sie machte das oft, es fühlte sich so gut an. Wie ein weicher, dichter Pelz. Für gewöhnlich schnurrte er dann vor Behagen, aber heute machte ihr seine stürmische Miene klar, dass er es offenbar nicht gerade witzig fand, an sein sizilianisches Erbe erinnert zu werden. Sein Vater war ein wortkarger, blonder Hüne von der Nordseeküste gewesen, aber seine Großeltern und seine Mutter stammten aus einem Dorf im Südosten Siziliens. Von seinem Vater hatte Konrad die beachtliche Körpergröße geerbt, von Großvater Luca Santino nicht nur seinen zweiten Vornamen Santino, sondern auch das explosive Temperament. Bisweilen kam der heißblütige Santino hinter Konrads norddeutscher Fassade hervor. Heute schien der Ausbruch kurz bevorzustehen.
»Ich verdurste gleich!«, sagte er finster und schraubte den Deckel von seiner mitgeführten Wasserflasche ab.
Bevor er jedoch trinken konnte, rempelte ihn jemand im Gedränge an, und das Wasser ergoss sich über sein Hemd. Er fluchte und schüttelte die Flasche, aber es kam kein Tropfen mehr heraus. Als nun eine Handvoll zierlicher Inderinnen in bunten Saris, die mitten auf der Straße ein Schwätzchen hielten, seinen Weg blockierten, benutzte er seine muskulösen Schultern wie einen Wellenbrecher und pflügte durch die Gruppe.
»Das war ziemlich unfreundlich«, sagte Nina in leicht tadelndem Ton. »Hast du das beim Wehrdienst in der italienischen Armee gelernt?«
»Ich lös mich gleich auf!«, war die knappe Erklärung.
»Wir schwitzen alle«, erwiderte sie. »Es ist viel zu heiß für die Jahreszeit, aber das konnte ich schließlich nicht ahnen. Hier!« Sie streckte ihm ihre Wasserflasche hin. »Ich will ja nicht, dass du verdurstest.«
»Danke«, brummte er. Er trank ein paar tiefe Züge, wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab und gab ihr die Flasche dann wieder zurück. »Das Wasser ist piehwarm.«
»Es kocht zumindest nicht. Wir sind bald am Fruit Market, da gibt es immer ein paar Stände, die gekühlte Getränke verkaufen. Überlebst du bis dahin?«
Konrad grunzte, sagte aber nichts.
Sie warf ihm einen Seitenblick zu. Irgendwie knirschte es fast jedes Mal zwischen ihnen, wenn er sie auf einer ihrer Forschungsreisen ins Ausland begleitete. Auf ihrer letzten gemeinsamen Reise nach Südamerika hatte er sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen und eine Nacht auf der Toilette verbracht. Ein Arzt war nicht aufzutreiben gewesen, also hatte sie ihn mit Mineralwasser versorgt und mit Kohletabletten gefüttert.
Irgendwann war sie vom Jetlag todmüde ins Bett gefallen und eingeschlafen. Morgens fand sie ihn, kniend vor der Toilette zusammengesunken, den Kopf auf einen Arm gebettet, mit dem anderen umarmte er die Schüssel. Tagelang war er nicht einsatzfähig, was seine Geduld aufs Äußerste strapazierte, und das hatte sich massiv auf seine Laune ausgewirkt.
In Indien war die Wahrscheinlichkeit, einen derartigen Infekt zu bekommen, groß. Besonders für Europäer. Vielleicht ging es ihm nicht gut? Das könnte durchaus ein Grund für sein grantiges Verhalten sein.
Während sie den Rest aus ihrer Wasserflasche in einem Zug leer trank, musterte sie ihn verstohlen.
Er war unbestreitbar attraktiv. Breitschultrig, durchtrainiert, fast eins neunzig groß, blaue Augen unter grau meliertem, schwarzem Haar, und ein Lächeln, das bei Frauen seelische Verwüstungen anrichtete. Ein Playboy, ein Leichtgewicht, hatte sie anfangs geurteilt, ein rücksichtsloser Frauenheld. Vorschnell, wie sie später herausfand. Äußerlich war er der harte Kerl, aber unter seiner ruppigen Art, die er gern kultivierte, verbarg er eine mitfühlende Seele und ein butterweiches Herz. Bei ihrem ersten Treffen, das sie nie vergessen würde, war davon allerdings nichts zu merken gewesen. Gar nichts.
Sie saß in ihrem Labor, eine Tasse Kaffee in der Hand, und brütete über einer sehr schwierigen Versuchsreihe, als die Tür aufgestoßen wurde und sie als Reflexion in der Glastür ihres Laborschranks bemerkte, wie ein ihr völlig unbekannter Mann hereinstürmte. Er ließ die Faust auf den Tisch krachen, dass die Versuchsröhrchen tanzten.
»Welcher mörderische Mensch hat meine Boophone disticha ersäuft?«, knurrte er in einer Tonlage, die so rau und tief war, dass die Frage zu einer massiven Drohung wurde.
Nina wirbelte herum und starrte in wutsprühende, tiefblaue Augen.
»Hallo, ich freue mich auch, Sie kennenzulernen«, sagte sie trocken, nahm betont gelassen einen Schluck Kaffee und musterte den Eindringling.
Ziemlich groß, muskulös, schwarzes Haar, mit Grau durchzogen, Jeans, ein dunkelrotes Sweatshirt und Sneaker. Keine Socken.
»Ich will wissen, wer meine Boophone ermordet hat!« Der Mann fletschte seine Zähne, die in seinem sonnengebräunten Gesicht zahnpastaweiß leuchteten. »Die Zwiebel stand kurz vor der ersten Blüte. Nach zehn Jahren! Und jetzt hat sie jemand ertränkt! Bis oben hin stand sie im Wasser.« Er fuhr sich mit dem Zeigefinger über den Hals. »Hat alle Blätter abgeworfen, und die Zwiebel ist matschig.« Mit jedem Wort wurde seine Stimme lauter. Seine dunklen Brauen sträubten sich.
Nina war beeindruckt, zeigte es aber nicht. Eine Boophone disticha zu kultivieren war ungemein schwierig und erforderte jahrelange Geduld. Und war meistens nicht erfolgreich. Die Mischung des Substrats, das Licht und die Wasserzufuhr entschieden über Leben und Tod der Pflanze. Und schlicht auch das Glück.
»Eine Boophone disticha? Wen wollen Sie denn damit ins Jenseits befördern?«
Der Extrakt der Bushman’s Poison Bulb, wie die Pflanzen in Afrika genannt wurden, wurde noch heute von den San als Pfeilgift verwendet, und sie wusste, dass traditionelle Heiler sie hauptsächlich als Halluzinogen benutzten, allerdings auch, so wurde gemunkelt, um sich unliebsamer Personen auf diskrete Weise zu entledigen. Manchmal geschah das offenbar auch ungewollt, denn der Unterschied zwischen einer therapeutischen und der tödlichen Dosis war haarfein. Die Heiler kochten einen Sud aus der Giftzwiebel, und es hing von ihrer Sorgfalt in der Herstellung und der Potenz der gerade genutzten Pflanze ab, ob sie in der Sonne gewachsen war oder im Schatten. Die Giftzwiebel gehörte zu den Traumkräutern, die Patienten in Trance versetzten und lebhafte Klarträume und Visionen herbeiführten.
Von einem dieser Traumkräuter – sie konnte sich an den Namen Uvuma Omhlope erinnern – hieß es, dass es einen Blick ins Leben nach dem Tod ermögliche. Aber wissenschaftlich bewiesen war das nicht. Sie musste unwillkürlich lächeln. Derartige Eigenschaften wären auch in der modernen Welt ein kommerzieller Hit.
Der Mann ging nicht auf ihren Scherz ein. »Das heißt, die zehn Jahre waren völlig umsonst. Wenn ich Glück habe, kann ich gerade noch einen Sud davon kochen.« Wieder ließ er die Faust auf ihren Labortisch krachen.
»Unterlassen Sie das«, sagte sie.
Die Arme vor der Brust verschränkt, das Kinn herausfordernd vorgestreckt, ließ er seinen Blick in aufreizender Manier über ihre Gestalt laufen. Einmal rauf und wieder runter. Ein Blick wie eine körperliche Berührung. Ihr Rückgrat versteifte sich.
In den vergangenen Jahren hatten schon einige Männer vor ihm probiert, sie auf diese Weise anzuflirten, aber sie war immer zurückgeschreckt. Seit jenem Tag. Jetzt stellte sie mit nicht geringer Verwirrung fest, dass ihr die Vorstellung einer Berührung dieses Mannes nicht unbedingt unangenehm war. Im Gegenteil.
Um ihre unerwarteten Gefühle in den Griff zu bekommen, beobachtete sie ihn eine Weile über den Rand ihrer Kaffeetasse. »Muss ich Angst vor Ihnen haben?«, sagte sie schließlich.
Seine Augen funkelten blau. »Nur wenn Sie meine Giftzwiebel umgebracht haben. Haben Sie?«
»Und es ist tatsächlich eine Bushman’s Poison Bulb?«, sagte sie. »Ich bin in Südafrika geboren. In früheren Zeiten wuchsen die bei uns im Garten. Kann ich mir das Exemplar mal ansehen?«
Mit der Frage hatte sie offensichtlich einen Volltreffer gelandet. Immer noch die Arme vor der Brust gekreuzt, starrte er sie an.
»Zweifeln Sie etwa an meiner Fachkenntnis? Glauben Sie, ich habe vielleicht eine Gemüsezwiebel oder eine Narzisse hochgepäppelt?«
Nina wurde für eine Sekunde an einen übel gelaunten Leoparden erinnert. Welch ein unbeherrschter Rüpel! Sie lächelte ihn mit schmalen Lippen an.
»Natürlich nicht. Wie kommen Sie darauf?«
»Was sind Sie eigentlich? Laborassistentin? Oder putzen Sie nur die Versuchsröhrchen?«
Sie setzte ihren Kaffee ab. Was bildete der Kerl sich eigentlich ein?
»Natürlich putze ich die Versuchsröhrchen. Was sonst?« Sie grinste und zog an einer ihrer Haarsträhnen. »Ich bin blond. Das sollte doch einiges erklären.« Sie schlenkerte provozierend mit einem Bein. »Und wer sind Sie? Was wollen Sie hier im Labor? Sind Sie Lieferant oder so etwas?«
Seine Haltung änderte sich subtil, wurde entspannter. Ruhig tastete sich sein Blick über ihr Gesicht und blieb schließlich an ihren Lippen hängen.
Ihr Mund wurde plötzlich papiertrocken. Ihre Blicke verhakten sich. Nina versuchte vergebens, diesen gefährlichen Augen auszuweichen, was er aber zu bemerken schien, denn unvermittelt streckte er ihr die rechte Hand hin.
»Konrad Friedemann«, sagte er und lächelte. »Ich bin Spezialist für die Analyse von Heilpflanzen, und vom nächsten Monat an arbeite ich hier.«
Ein langsames Lächeln, und es begann in seinen Augen. Für Sekundenbruchteile wurden sie schmaler, dann öffneten sie sich weit, und wie der frühe Morgenhimmel kurz vor dem Sonnenaufgang begannen sie von innen zu strahlen, funkelten ihr wie geschliffenes, blaues Kristall aus einem Kranz von Lachfältchen entgegen.
Und sie hing an diesem Lächeln wie ein Fisch am Haken.
Eine tiefe Ruhe breitete sich in ihr aus. Ein warmes Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und der Gewissheit, endlich angekommen zu sein. Dass ihre Suche ein Ende hatte.
In dieser Sekunde verliebte sie sich rettungslos in ihn und wusste ohne jeden Zweifel, dass er der Mann war, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte.
Und wie jedes Mal, wenn sie zurück auf diesen funkelnden Augenblick blickte, durchflutete glühende Hitze ihren Körper. Nie würde sie vergessen, wie sie von ihren tot geglaubten Gefühlen völlig überwältigt wurde. Nie hätte sie für möglich gehalten, dass sie je wieder ein solches Glück verspüren könnte. Dass sie je wieder einen Mann begehren würde.
Auch jetzt lag auf ihren Zügen ein Widerschein seines Lächelns, als sie ihm versöhnlich die Hand hinstreckte. Aber er tigerte mit hochgezogenen Schultern zwei, drei Schritte voraus.
»Musstest du denn deine Recherchen unbedingt in die Woche vor dem Diwali-Fest legen?«, warf er ihr in einem Ton über die Schulter zu, der deutlich machte, wie gereizt er immer noch war.