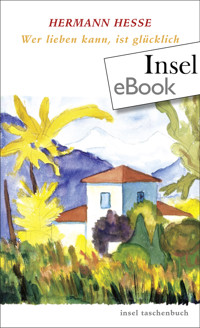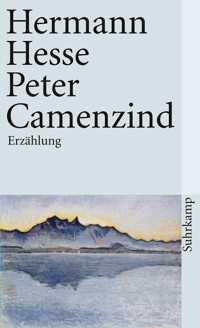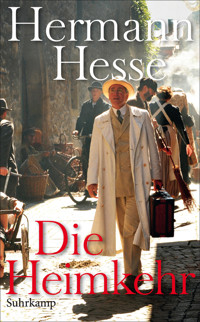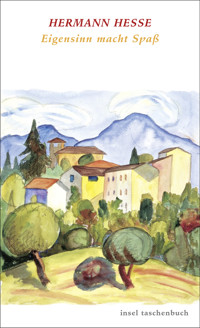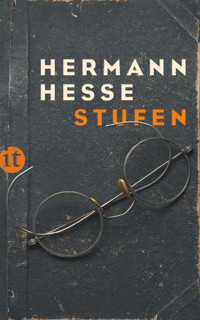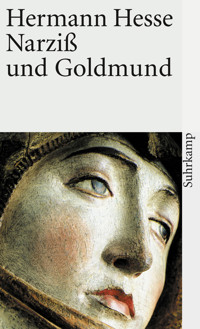
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»In Narziß und Goldmund bekommen die zwei Grundformen des schöpferischen Menschen Gestalt: der Denker und der Träumer, der Herbe und der Blühende, der Klare und der Kindliche. Beide verwandt, obwohl in allem ihr Gegenspiel, beide vereinsamt, beide von Hesse gleich gerecht in ihren Vorzügen und Schwächen erkannt, gleich exakt wiedergegeben.« Max Herrmann-Neiße
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Diese Erzählung über den Gegensatz zwischen Geist- und Sinnenmenschen und ihre produktive Vereinigung im Künstler ist ein Loblied der Freundschaft, voller Abenteuer und romantischer Realistik. Hermann Hesse hat darin, Jahre bevor der Nationalsozialismus die kulturellen Traditionen Deutschlands mißhandelte, die Idee von Deutschland und deutschem Wesen, die er seit seiner Kindheit in sich trug, dargestellt »und ihr meine Liebe gestanden, gerade weil ich alles, was heute spezifisch deutsch ist, so sehr hasse«, schrieb er 1933.
Hermann Hesse, am 2. Juli 1877 in Calw geboren, starb am 9. August 1962 in Montagnola bei Lugano. 1946 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Hermann Hesse
Narzißund Goldmund
Erzählung
Suhrkamp
Umschlagabbildung:
Tilman Riemenschneider. Trauernde Maria aus Acholshausen (Ausschnitt), um 1505. Mainfränkisches Museum, Würzburg.
Foto: Ulrich Kneise, Eisenach
Entstanden 1927–1929. Erste Buchausgabe: Berlin 1930
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Copyright 1930 by Hermann Hesse
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73640-1
www.suhrkamp.de
Erstes Kapitel
Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereinganges von Mariabronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum, ein vereinzelter Sohn des Südens, von einem Rompilger vor Zeiten mitgebracht, eine Edelkastanie mit starkem Stamm; zärtlich hing ihre runde Krone über den Weg, atmete breitbrüstig im Winde, ließ im Frühling, wenn alles ringsum schon grün war und selbst die Klosternußbäume schon ihr rötliches Junglaub trugen, noch lange auf ihre Blätter warten, trieb dann um die Zeit der kürzesten Nächte aus den Blattbüscheln die matten, weißgrünen Strahlen ihrer fremdartigen Blüten empor, die so mahnend und beklemmend herbkräftig rochen, und ließ im Oktober, wenn Obst und Wein schon geerntet war, aus der gilbenden Krone im Herbstwind die stacheligen Früchte fallen, die nicht in jedem Jahr reif wurden, um welche die Klosterbuben sich balgten und die der aus dem Welschland stammende Subprior Gregor in seiner Stube im Kaminfeuer briet. Fremd und zärtlich ließ der schöne Baum seine Krone überm Eingang zum Kloster wehen, ein zartgesinnter und leicht fröstelnder Gast aus einer anderen Zone, verwandt in geheimer Verwandtschaft mit den schlanken sandsteinernen Doppelsäulchen des Portals und dem steinernen Schmuckwerk der Fensterbogen, Gesimse und Pfeiler, geliebt von den Welschen und Lateinern, von den Einheimischen als Fremdling begafft.
Unter dem ausländischen Baume waren schon manche Generationen von Klosterschülern vorübergegangen; ihre Schreibtafeln unterm Arm, schwatzend, lachend, spielend, streitend, je nach der Jahreszeit barfuß oder beschuht, eine Blume im Mund, eine Nuß zwischen den Zähnen oder einen Schneeball in der Hand. Immer neue kamen, alle paar Jahre waren es andere Gesichter, die meisten einander ähnlich: blond und kraushaarig. Manche blieben da, wurden Novizen, wurden Mönche, bekamen das Haar geschoren, trugen Kutte und Strick, lasen in Büchern, unterwiesen die Knaben, wurden alt, starben. Andre, wenn ihre Schülerjahre vorbei waren, wurden von ihren Eltern heimgeholt, in Ritterburgen, in Kaufmanns- und Handwerkerhäuser, liefen in die Welt und trieben ihre Spiele und Gewerbe, kamen etwa einmal zu einem Besuch ins Kloster zurück, Männer geworden, brachten kleine Söhne als Schüler zu den Patres, schauten lächelnd und gedankenvoll eine Weile zum Kastanienbaum empor, verloren sich wieder. In den Zellen und Sälen des Klosters, zwischen den runden schweren Fensterbogen und den strammen Doppelsäulen aus rotem Stein wurde gelebt, gelehrt, studiert, verwaltet, regiert; vielerlei Kunst und Wissenschaft wurde hier getrieben und von einer Generation der andern vererbt, fromme und weltliche, helle und dunkle. Bücher wurden geschrieben und kommentiert, Systeme ersonnen, Schriften der Alten gesammelt, Bilderhandschriften gemalt, des Volkes Glaube gepflegt, des Volkes Glaube belächelt. Gelehrsamkeit und Frömmigkeit, Einfalt und Verschlagenheit, Weisheit der Evangelien und Weisheit der Griechen, weiße und schwarze Magie, von allem gedieh hier etwas, für alles war Raum; es war Raum für Einsiedelei und Bußübung ebenso wie für Geselligkeit und Wohlleben; an der Person des jeweiligen Abtes und an der jeweils herrschenden Strömung der Zeit lag es, ob das eine oder das andere überwog und vorherrschte. Zuzeiten war das Kloster berühmt und besucht wegen seiner Teufelsbanner und Dämonenkenner, zuzeiten wegen seiner ausgezeichneten Musik, zuzeiten wegen eines heiligen Vaters, der Heilungen und Wunder tat, zuzeiten wegen seiner Hechtsuppen und Hirschleberpasteten, ein jedes zu seiner Zeit. Und immer war unter der Schar der Mönche und Schüler, der frommen und der lauen, der fastenden und der feisten, immer war zwischen den vielen, welche da kamen, lebten und starben, dieser und jener Einzelne und Besondere gewesen, einer, den alle liebten oder alle fürchteten, einer, der auserwählt schien, einer, von dem noch lange gesprochen wurde, wenn seine Zeitgenossen vergessen waren.
Auch jetzt gab es im Kloster Mariabronn zwei Einzelne und Besondere, einen Alten und einen Jungen. Zwischen den vielen Brüdern, deren Schwarm die Dormente, Kirchen und Schulsäle erfüllte, gab es zwei, von denen jeder wußte, auf die jeder achtete. Es gab den Abt Daniel, den Alten, und den Zögling Narziß, den Jungen, der erst seit kurzem das Noviziat angetreten hatte, aber seiner besonderen Gaben wegen gegen alles Herkommen schon als Lehrer verwendet wurde, besonders im Griechischen. Diese beiden, der Abt und der Novize, hatten Geltung im Hause, waren beobachtet und weckten Neugierde, wurden bewundert und beneidet und auch heimlich gelästert.
Den Abt liebten die meisten, er hatte keine Feinde, er war voll Güte, voll Einfalt, voll Demut. Nur die Gelehrten des Klosters mischten in ihre Liebe etwas von Herablassung; denn Abt Daniel mochte ein Heiliger sein, ein Gelehrter jedoch war er nicht. Ihm war jene Einfalt eigen, welche Weisheit ist; aber sein Latein war bescheiden, und Griechisch konnte er überhaupt nicht.
Jene wenigen, welche gelegentlich die Einfalt des Abtes etwas belächelten, waren desto mehr von Narziß bezaubert, dem Wunderknaben, dem schönen Jüngling mit dem eleganten Griechisch, mit dem ritterlich tadellosen Benehmen, mit dem stillen, eindringlichen Denkerblick und den schmalen, schön und streng gezeichneten Lippen. Daß er wunderbar Griechisch konnte, liebten die Gelehrten an ihm. Daß er so edel und fein war, liebten beinahe alle an ihm, viele waren in ihn verliebt. Daß er so sehr still und beherrscht war und so höfische Manieren hatte, nahmen manche ihm übel.
Abt und Novize, jeder trug auf seine Art das Schicksal des Auserwählten, herrschte auf seine Art, litt auf seine Art. Jeder der beiden fühlte sich dem andern mehr verwandt und mehr zu ihm hingezogen als zum ganzen übrigen Klostervolk; dennoch fanden sie nicht zueinander, dennoch konnte keiner beim andern warm werden. Der Abt behandelte den Jüngling mit größter Sorgfalt, mit größter Rücksicht, hatte um ihn Sorge als um einen seltenen, zarten, vielleicht allzufrüh gereiften, vielleicht gefährdeten Bruder. Der Jüngling nahm jeden Befehl, jeden Rat, jedes Lob des Abtes mit vollkommener Haltung entgegen, widersprach niemals, war nie verstimmt, und wenn das Urteil des Abtes über ihn richtig und sein einziges Laster der Hochmut war, so wußte er dies Laster wunderbar zu verbergen. Es war gegen ihn nichts zu sagen, er war vollkommen, er war allen überlegen. Nur wurden wenige ihm wirklich Freund, außer den Gelehrten, nur umgab seine Vornehmheit ihn wie eine erkältende Luft.
»Narziß«, sagte der Abt nach einer Beichte zu ihm, »ich bekenne mich eines harten Urteils über dich schuldig. Ich habe dich oft für hochmütig gehalten, und vielleicht tat ich dir damit unrecht. Du bist sehr allein, junger Bruder, du bist einsam, du hast Bewunderer, aber keine Freunde. Ich wollte wohl, ich hätte Anlaß, dich zuweilen zu tadeln; aber es ist kein Anlaß. Ich wollte wohl, du wärest manchmal unartig, wie es junge Leute deines Alters sonst leicht sind. Du bist es nie. Ich sorge mich zuweilen ein wenig um dich, Narziß.«
Der Junge schlug seine dunklen Augen zu dem Alten auf.
»Ich wünsche sehr, gnädiger Vater, Euch keine Sorge zu machen. Es mag wohl sein, daß ich hochmütig bin, gnädiger Vater. Ich bitte Euch, mich dafür zu strafen. Ich habe selbst zuzeiten den Wunsch, mich zu strafen. Schickt mich in eine Einsiedelei, Vater, oder laßt mich niedere Dienste tun.«
»Für beides bist du zu jung, lieber Bruder«, sagte der Abt. »Überdies bist du der Sprachen und des Denkens in hohem Grade fähig, mein Sohn; es wäre eine Vergeudung dieser Gottesgaben, wollte ich dir niedere Dienste auftragen. Wahrscheinlich wirst du wohl ein Lehrer und Gelehrter werden. Wünschest du dies nicht selbst?«
»Verzeiht, Vater, ich weiß über meine Wünsche nicht so sehr genau Bescheid. Ich werde stets Freude an den Wissenschaften haben, wie sollte es anders sein? Aber ich glaube nicht, daß die Wissenschaften mein einziges Gebiet sein werden. Es mögen ja nicht immer die Wünsche sein, die eines Menschen Schicksal und Sendung bestimmen, sondern anderes, Vorbestimmtes.«
Der Abt horchte und wurde ernst. Dennoch stand ein Lächeln auf seinem alten Gesicht, als er sagte: »Soviel ich die Menschen habe kennenlernen, neigen wir, zumal in der Jugend, alle ein wenig dazu, die Vorsehung und unsere Wünsche miteinander zu verwechseln. Aber sage mir, da du deine Bestimmung vorauszuwissen glaubst, ein Wort darüber. Wozu denn glaubst du bestimmt zu sein?«
Narziß schloß seine dunklen Augen halb, daß sie unter den langen schwarzen Wimpern verschwanden. Er schwieg.
»Sprich, mein Sohn«, mahnte nach langem Warten der Abt. Mit leiser Stimme und gesenkten Augen begann Narziß zu sprechen.
»Ich glaube zu wissen, gnädiger Vater, daß ich vor allem zum Klosterleben bestimmt bin. Ich werde, so glaube ich, Mönch werden, Priester werden, Subprior und vielleicht Abt werden. Ich glaube dies nicht, weil ich es wünsche. Mein Wunsch geht nicht nach Ämtern. Aber sie werden mir auferlegt werden.«
Lange schwiegen beide.
»Warum hast du diesen Glauben?« fragte zögernd der Alte. »Welche Eigenschaft in dir, außer der Gelehrsamkeit, ist es wohl, die in diesem Glauben zu Wort kommt?«
»Es ist die Eigenschaft«, sagte Narziß langsam, »daß ich ein Gefühl für die Art und Bestimmung der Menschen habe, nicht nur für meine eigene, auch für die der andern. Diese Eigenschaft zwingt mich, den andern dadurch zu dienen, daß ich sie beherrsche. Wäre ich nicht zum Klosterleben geboren, so würde ich Richter oder Staatsmann werden müssen.«
»Mag sein«, nickte der Abt. »Hast du deine Fähigkeit, Menschen und ihre Schicksale zu erkennen, an Beispielen erprobt?«
»Ich habe sie erprobt.«
»Bist du bereit, mir ein Beispiel zu nennen?«
»Ich bin bereit.«
»Gut. Da ich nicht in die Geheimnisse unserer Brüder ohne deren Wissen eindringen möchte, magst du mir vielleicht sagen, was du über mich, deinen Abt Daniel, zu wissen meinst.« Narziß hob seine Lider und blickte dem Abt in die Augen.
»Ist es Euer Befehl, gnädiger Vater?«
»Mein Befehl.«
»Es fällt mir schwer, zu sprechen, Vater.«
»Auch mir fällt es schwer, junger Bruder, dich zum Sprechen zu zwingen. Ich tue es dennoch. Sprich!«
Narziß senkte den Kopf und sagte flüsternd: »Es ist wenig, was ich von Euch weiß, verehrter Vater. Ich weiß, daß Ihr ein Diener Gottes seid, dem es lieber wäre, Ziegen zu hüten oder in einer Einsiedelei das Glöckchen zu läuten und die Beichten der Bauern anzuhören, als ein großes Kloster zu regieren. Ich weiß, daß Ihr eine besondere Liebe zur heiligen Mutter Gottes habt und zu ihr am meisten betet. Ihr betet zuweilen darum, daß die griechischen und anderen Wissenschaften, die in diesem Kloster gepflegt werden, keine Verwirrung und Gefahr für die Seelen Eurer Anbefohlenen sein mögen. Ihr betet zuweilen, daß Euch gegen den Subprior Gregor die Geduld nicht verlasse. Ihr betet zuweilen um ein sanftes Ende. Und Ihr werdet, so glaube ich, erhört werden und ein sanftes Ende haben.«
Still war es in dem kleinen Sprechzimmer des Abtes. Endlich sprach der Alte.
»Du bist ein Schwärmer und hast Gesichte«, sagte der greise Herr freundlich. »Auch fromme und freundliche Gesichte können täuschen; verlaß dich nicht auf sie, wie auch ich mich nicht auf sie verlasse. – Kannst du sehen, Bruder Schwärmer, was ich über diese Sache im Herzen denke?«
»Ich kann sehen, Vater, daß Ihr sehr freundlich darüber denkt. Ihr denkt das Folgende: ›Dieser junge Schüler ist ein wenig gefährdet, er hat Gesichte, er hat vielleicht zu viel meditiert. Ich könnte ihm vielleicht eine Buße auferlegen, sie wird ihm nicht schaden. Ich werde aber die Buße, die ich ihm auferlege, auch selbst auf mich nehmen.‹ – Dies ist es, was Ihr soeben denkt.« Der Abt erhob sich. Lächelnd winkte er dem Novizen, sich zu verabschieden.
»Es ist gut«, sagte er. »Nimm deine Gesichte nicht allzu ernst, junger Bruder; Gott fordert noch manches andere von uns, als Gesichte zu haben. Nehmen wir an, du habest einem alten Manne damit geschmeichelt, daß du ihm einen leichten Tod versprachst. Nehmen wir an, der alte Mann habe einen Augenblick lang diese Versprechung gern gehört. Es ist nun genug. Du sollst einen Rosenkranz beten, morgen nach der Frühmesse, du sollst ihn mit Demut und Hingabe beten und nicht obenhin, und ich werde dasselbe tun. Geh nun, Narziß, es ist genug geredet.«
Ein andermal hatte der Abt Daniel zu schlichten zwischen dem jüngsten der lehrenden Patres und Narziß, die sich über einen Punkt im Lehrplan nicht einigen konnten: Narziß drang mit großem Eifer auf die Einführung gewisser Änderungen im Unterricht, wußte sie auch mit überzeugenden Gründen zu rechtfertigen; Pater Lorenz aber, aus einer Art von Eifersucht, wollte nicht darauf eingehen, und jeder neuen Besprechung folgten Tage eines verstimmten Schweigens und Schmollens, bis Narziß im Gefühl des Rechthabens nochmals mit der Sache anfing. Schließlich sagte Pater Lorenz, etwas gekränkt: »Nun, Narziß, wir wollen dem Streit ein Ende machen. Du weißt ja, daß die Entscheidung bei mir und nicht bei dir läge, du bist nicht mein Kollege, sondern mein Gehilfe und hast dich mir zu fügen. Aber da die Sache dir gar so wichtig scheint und da ich dir zwar an Amtsgewalt, nicht aber an Wissen und Gaben überlegen bin, will ich nicht selbst die Entscheidung treffen, sondern wir werden sie unserem Vater Abt vortragen und ihn entscheiden lassen.«
So taten sie denn, und Abt Daniel hörte den Streit der beiden Gelehrten über ihre Auffassung des Unterrichts in der Grammatik geduldig und freundlich an. Nachdem sie beide ihre Meinungen ausführlich dargelegt und begründet hatten, blickte der alte Mann sie fröhlich an, schüttelte ein wenig das greise Haupt und sprach: »Liebe Brüder, ihr glaubet ja wohl beide nicht, daß ich von diesen Sachen ebensoviel verstünde wie ihr. Es ist löblich von Narziß, daß die Schule ihm so sehr am Herzen liegt und daß er den Lehrplan zu verbessern strebt. Wenn aber sein Vorgesetzter anderer Meinung ist, so hat Narziß zu schweigen und zu gehorchen, und alle Verbesserungen der Schule wögen es nicht auf, wenn ihretwegen Ordnung und Gehorsam in diesem Haus gestört würden. Ich tadle Narziß, daß er nicht nachzugeben wußte. Und euch beiden jungen Gelehrten wünsche ich, es möge euch nie an Vorgesetzten mangeln, welche dümmer sind als ihr; nichts ist besser gegen den Hochmut.« Mit diesem gutmütigen Scherz entließ er sie. Aber er vergaß keineswegs, während der nächsten Tage ein Auge darauf zu haben, ob zwischen den beiden Lehrern wieder ein gutes Einvernehmen bestehe.
Und nun begab es sich, daß ein neues Gesicht im Kloster erschien, das so viele Gesichter kommen und gehen sah, und daß dies neue Gesicht nicht zu den unbemerkten und schnell wieder vergessenen gehörte. Es war ein Jüngling, der, schon vorlängst von seinem Vater angemeldet, an einem Frühlingstage eintraf, um in der Klosterschule zu studieren. Beim Kastanienbaum banden sie ihre Pferde an, der Jüngling und sein Vater, und aus dem Portal kam der Pförtner ihnen entgegen.
Der Knabe blickte an dem noch winterkahlen Baum empor. »Einen solchen Baum«, sagte er, »habe ich noch nie gesehen. Ein schöner, merkwürdiger Baum! Ich möchte wohl wissen, wie er heißt.«
Der Vater, ein ältlicher Herr, mit einem versorgten und etwas verkniffenen Gesicht, kümmerte sich nicht um die Worte des Jungen. Der Pförtner aber, dem der Knabe alsbald wohlgefiel, gab ihm Auskunft. Der Jüngling dankte ihm freundlich, gab ihm die Hand und sagte: »Ich heiße Goldmund und soll hier zur Schule gehen.« Freundlich lächelte der Mann ihn an und ging den Ankömmlingen voran durchs Portal und die breiten Steintreppen hinauf, und Goldmund betrat das Kloster ohne Zagen mit dem Gefühl, an diesem Ort schon zwei Wesen begegnet zu sein, denen er Freund sein konnte, dem Baum und dem Pförtner.
Die Angekommenen wurden erst vom Pater Schulvorsteher, gegen Abend auch noch vom Abt selbst empfangen. An beiden Orten stellte der Vater, ein kaiserlicher Beamter, seinen Sohn Goldmund vor, und man lud ihn ein, eine Weile Gast des Hauses zu sein. Er machte jedoch nur für eine Nacht vom Gastrecht Gebrauch und erklärte, morgen zurückreisen zu müssen. Als Geschenk bot er dem Kloster das eine seiner beiden Pferde an, und die Gabe ward angenommen. Die Unterhaltung mit den geistlichen Herren verlief artig und kühl; aber sowohl der Abt wie der Pater blickte den ehrerbietig schweigenden Goldmund mit Freude an, der hübsche zärtliche Junge gefiel ihnen sogleich. Den Vater ließen sie andern Tages ohne Bedauern wieder ziehen, den Sohn behielten sie gerne da. Goldmund wurde den Lehrern vorgestellt und bekam ein Bett im Schlafsaal der Schüler. Ehrerbietig und mit betrübtem Gesicht nahm er Abschied von seinem wegreitenden Vater, stand und blickte ihm nach, bis er zwischen Kornhaus und Mühle durch das enge Bogentor des äußeren Klosterhofes verschwand. Eine Träne hing ihm an der langen blonden Wimper, als er sich umwandte; da empfing ihn schon der Pförtner mit einem liebkosenden Schlag auf die Schulter.
»Junges Herrchen«, sagte er tröstend, »du mußt nicht traurig sein. Die meisten haben im Anfang ein klein wenig Heimweh, nach Vater, Mutter und Geschwistern. Aber du wirst schnell sehen: es läßt sich auch hier leben, und gar nicht übel.«
»Danke, Bruder Pförtner«, sagte der Junge. »Ich habe keine Geschwister und keine Mutter, ich habe bloß den Vater.«
»Dafür findest du hier Kameraden und Gelehrsamkeit und Musik und neue Spiele, die du noch nicht kennst, und dies und jenes, du wirst schon sehen. Und wenn du einen brauchst, der es gut mit dir meint, dann komm nur zu mir.«
Goldmund lächelte ihn an. »O, ich danke Euch sehr. Und wenn Ihr mir eine Freude machen wollt, dann zeigt mir bitte bald, wo unser Rößlein steht, das mein Vater hiergelassen hat. Ich möchte es begrüßen und sehen, ob es ihm auch gut gehe.«
Der Pförtner nahm ihn sogleich mit und führte ihn in den Pferdestall beim Kornhaus. Da roch es in lauer Dämmerung scharf nach Pferden, nach Mist und nach Gerste, und in einem der Stände fand Goldmund das braune Pferd stehen, das ihn hierhergetragen hatte. Er legte dem Tier, das ihn schon erkannt hatte und ihm den Kopf lang entgegenstreckte, beide Hände um den Hals, legte ihm die Wange an die breite, weißgefleckte Stirn, streichelte es zärtlich und flüsterte ihm Worte ins Ohr: »Grüß dich Gott, Bleß, mein Tierchen, mein Braver, geht es dir gut? Hast du mich noch lieb? Hast du auch zu fressen? Denkst du auch noch an daheim? Bleß, Rößchen, lieber Kerl, wie gut, daß du dageblieben bist, ich will oft zu dir kommen und nach dir sehen.« Er zog aus dem Ärmelumschlag ein Stück Frühstücksbrot, das er beiseitegebracht hatte, und gab es in kleinen Brocken dem Tier zu fressen. Dann nahm er Abschied, folgte dem Pförtner über den Hof, der breit wie der Marktplatz einer großen Stadt und zum Teil mit Linden bewachsen war. Am innern Eingang dankte er dem Pförtner und gab ihm die Hand, dann merkte er, daß er den Weg zu seinem Schulsaal nicht mehr wisse, der ihm gestern gezeigt worden war, lachte ein wenig und wurde rot, bat den Pförtner, ihn zu führen, und der tat es gerne. Dann trat er in den Schulsaal, wo ein Dutzend Knaben und Jünglinge auf den Bänken saßen, und der Lehrgehilfe Narziß wendete sich um.
»Ich bin Goldmund«, sagte er, »der neue Schüler.«
Narziß grüßte kurz, ohne Lächeln, wies ihm einen Platz in der hintern Bank an und fuhr sofort in seinem Unterricht fort.
Goldmund setzte sich. Er war erstaunt darüber, einen so jungen Lehrer zu finden, kaum einige Jahre älter als er selbst, und war erstaunt und tief erfreut darüber, diesen jungen Lehrer so schön, so vornehm, so ernst, dabei so gewinnend und liebenswert zu finden. Der Pförtner war nett mit ihm gewesen, der Abt war ihm so freundlich begegnet, drüben im Stall stand Bleß und war ein Stück Heimat, und nun war da dieser erstaunlich junge Lehrer, ernst wie ein Gelehrter und fein wie ein Prinz, und mit dieser beherrschten, kühlen, sachlichen, zwingenden Stimme! Dankbar hörte er zu, ohne doch gleich zu verstehen, von was da die Rede sei. Ihm wurde wohl. Er war zu guten, zu liebenswerten Menschen gekommen, und er war bereit, sie zu lieben und um ihre Freundschaft zu werben. Am Morgen im Bett, nach dem Erwachen, hatte er sich beklommen gefühlt, und müde von der langen Reise war er auch noch, und beim Abschied von seinem Vater hatte er etwas weinen müssen. Aber jetzt war es gut, er war zufrieden. Lange und immer wieder sah er den jungen Lehrer an, freute sich an seiner straffen schlanken Gestalt, seinem kühl blitzenden Auge, seinen straffen, klar und fest die Silben formenden Lippen, an seiner beschwingten, unermüdlichen Stimme.
Aber als die Unterrichtsstunde zu Ende war und die Schüler sich lärmend erhoben, schrak Goldmund auf und merkte etwas beschämt, daß er eine ganze Weile geschlafen hatte. Und nicht er allein merkte es, auch seine Banknachbarn hatten es gesehen und flüsternd weitergemeldet. Kaum hatte der junge Lehrer den Saal verlassen, da zupften und stießen die Kameraden Goldmund von allen Seiten.
»Ausgeschlafen?« fragte einer und grinste.
»Feiner Schüler!« höhnte einer. »Aus dem wird ein schönes Kirchenlicht werden. Dachst gleich in der ersten Stunde ein!«
»Bringt ihn zu Bett, den Kleinen«, schlug einer vor, und sie ergriffen ihn an Armen und Beinen, um ihn unter Gelächter wegzutragen.
So aufgeschreckt wurde Goldmund zornig; er schlug um sich, suchte sich zu befreien, bekam Püffe und wurde schließlich fallen gelassen, während einer ihn noch an einem Fuße festhielt. Von diesem trat er sich gewaltsam los, warf sich auf den ersten besten, der sich stellte, und war alsbald mit ihm in einen heftigen Kampf verwickelt. Sein Gegner war ein starker Kerl, und alle sahen dem Zweikampf mit Begierde zu. Als Goldmund nicht unterlag und dem Starken einige gute Fausthiebe beibrachte, hatte er schon Freunde unter den Kameraden, noch ehe er einen von ihnen mit Namen kannte. Plötzlich aber stoben alle in größter Hast davon, und kaum waren sie weg, so trat der Pater Martin herein, der Schulvorsteher, und stand dem allein zurückgebliebenen Knaben gegenüber. Verwundert sah er den Knaben an, dessen blaue Augen verlegen aus dem hochgeröteten und etwas zerschlagenen Gesicht blickten.
»Ja, was ist denn mit dir?« fragte er. »Du bist doch Goldmund, nicht? Haben sie dir denn etwas getan, die Lotterbuben?«
»O nein«, sagte der Knabe, »ich bin mit ihm fertig geworden.« »Mit wem denn?«
»Ich weiß nicht. Ich kenne noch keinen. Einer hat mit mir gekämpft.«
»So? Hat er angefangen?«
»Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, ich habe selber angefangen. Sie haben mich gehänselt, da wurde ich böse.«
»Nun, du fängst ja gut an, mein Junge. Also merke dir: wenn du noch einmal hier im Schulzimmer Prügeleien auskämpfst, gibt es Strafe. Und jetzt mache, daß du zum Vesperbrot kommst, vorwärts!«
Lächelnd sah er Goldmund nach, wie er beschämt davonlief und unterwegs das zerzauste hellblonde Haar mit den Fingern zu strählen bemüht war.
Goldmund war selbst der Meinung, seine erste Tat in diesem Klosterleben sei recht unartig und töricht gewesen; ziemlich zerknirscht suchte und fand er seine Schulkameraden beim Vesperbrot. Aber er wurde mit Achtung und Freundlichkeit empfangen, er versöhnte sich ritterlich mit seinem Feinde und fühlte sich von Stund an wohl aufgenommen in diesem Kreise.
Zweites Kapitel
Wenn er indessen mit allen gut Freund war, einen wirklichen Freund fand er doch nicht so bald; es war keiner unter den Mitschülern, dem er sich besonders verwandt oder gar zugeneigt fühlte. Sie aber waren verwundert, in dem schneidigen Faustkämpfer, den sie geneigt waren für einen liebenswerten Raufbold zu halten, einen sehr friedfertigen Kollegen zu finden, der eher nach dem Ruhm eines Musterschülers zu streben schien. Zwei Menschen im Kloster gab es, zu denen Goldmund sein Herz hingezogen fühlte, die ihm gefielen, die seine Gedanken beschäftigten, für die er Bewunderung, Liebe und Ehrfurcht fühlte: den Abt Daniel und den Lehrgehilfen Narziß. Den Abt war er geneigt für einen Heiligen zu halten, seine Einfalt und Güte, sein klarer, sorglicher Blick, seine Art, das Befehlen und Regieren demütig als einen Dienst zu vollziehen, seine guten, stillen Gebärden, das alles zog ihn gewaltig an. Am liebsten wäre er der persönliche Diener dieses Frommen geworden, wäre immer gehorchend und dienend um ihn gewesen, hätte all seinen knabenhaften Drang nach Devotion und Hingabe ihm als beständiges Opfer dargebracht und ein reines, edles, heiligmäßiges Leben von ihm gelernt. Denn Goldmund war gesonnen, nicht nur die Klosterschule zu absolvieren, sondern womöglich ganz und für immer im Kloster zu bleiben und sein Leben Gott zu weihen; so war es sein Wille, so war es seines Vaters Wunsch und Gebot, und so war es wohl von Gott selbst bestimmt und gefordert. Niemand schien es dem schönen, strahlenden Knaben anzusehen, und doch lag eine Bürde auf ihm, eine Bürde der Herkunft, eine geheime Bestimmung zu Sühne und Opfer. Auch der Abt sah es nicht, obwohl Goldmunds Vater ihm einige Andeutungen gemacht und deutlich den Wunsch geäußert hatte, sein Sohn möge für immer hier im Kloster bleiben. Irgendein geheimer Makel schien an der Geburt Goldmunds zu haften, irgend etwas Verschwiegenes schien Sühne zu fordern. Aber der Vater hatte dem Abt nur wenig gefallen, er hatte seinen Worten und seinem ganzen etwas wichtigtuerischen Wesen höfliche Kühle entgegengestellt und seinen Andeutungen keine große Bedeutung eingeräumt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!