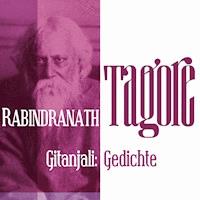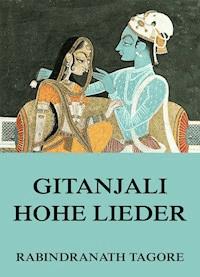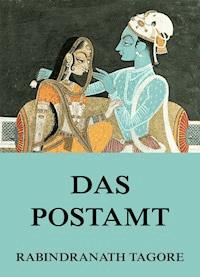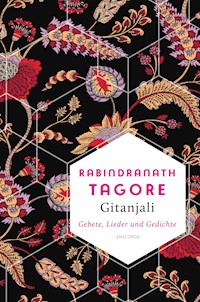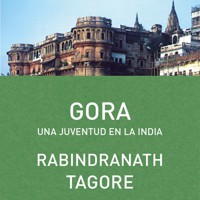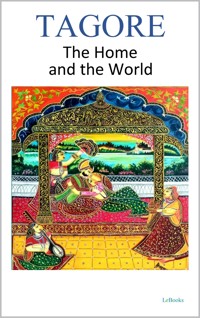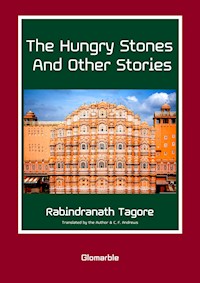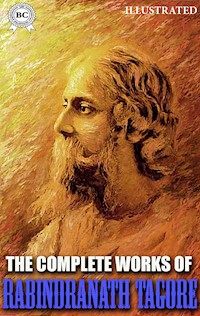1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
In "Nationalismus" untersucht Rabindranath Tagore die komplexen Verflechtungen von Identität, Kultur und Politischem in einer Zeit des imperialen Umbruchs. Tagore, renommiert für seinen lyrischen Stil und seine philosophische Tiefe, offenbart die Gefahren des übersteigerten Nationalismus, der in seiner Wahrnehmung oft zu einem Mittel der Entfremdung und Zwietracht führt. Durch Essays und poetische Reflexionen schafft er ein vielschichtiges Werk, das sowohl die spirituellen als auch die sozialen Dimensionen des Nationalismus beleuchtet und Aufschluss über die Schnittstelle zwischen individueller und kollektiver Identität gibt. Dabei agiert er im literarischen Kontext des indischen Unabhängigkeitskampfes, wo die Frage nach nationaler Zugehörigkeit und Selbstbestimmung von zentraler Bedeutung war. Rabindranath Tagore (1861-1941), der erste nicht-europäische Nobelpreisträger für Literatur, war ein tiefgründiger Denker und Aktivist, der sich intensiv mit den sozialen, kulturellen und politischen Herausforderungen seiner Zeit auseinandersetze. Sein Leben in der kolonisierenden Gesellschaft Britisch-Indiens, gepaart mit seinen Reisen und seinem internationalen Austausch, prägten seine Sichtweise auf Nationalismus als potenziell vereinigende, aber auch trennende Kraft. Tagores erzieherischer Hintergrund und seine Philosophie des Humanismus manifestieren sich in diesem Werk, das einen Dialog zwischen Orient und Okzident anstrebt. "Nationalismus" ist ein dringlicher Appell zur Reflexion über die Konzepte von Identität und Zusammengehörigkeit. Tagores Gedanken regen dazu an, über die Gefahren von Intoleranz und Überlegenheit nachzudenken und eine humanistische Perspektive einzunehmen. Leser, die sich für politische Philosophie, postkoloniale Studien oder die Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft interessieren, werden in diesem zeitlosen Werk wertvolle Einsichten finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Nationalismus
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte der Menschheit gestaltet sich nach den Schwierigkeiten, denen sie begegnet. Diese stellen uns Aufgaben, die wir lösen müssen, wenn wir nicht herabsinken oder zugrunde gehen wollen.
Diese Schwierigkeiten sind verschieden bei den verschiedenen Völkern der Erde, und die Art, wie sie sie überwinden, macht ihren besonderen Charakter aus.
Die Skythen des alten Asiens hatten mit der Kargheit ihrer natürlichen Hilfsquellen zu kämpfen. Als die bequemste Lösung erschien ihnen, daß sie ihre ganze Bevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, zu Räuberbanden organisierten. Und so wurden sie denen unwiderstehlich, deren Hauptleistung die friedlich aufbauende Arbeit bürgerlicher Gemeinschaft war.
Aber zum Glück für den Menschen ist der bequemste Weg nicht der ihm gemäßeste Weg. Wenn er nur seinem Instinkt zu folgen hätte, wie eine Schar hungriger Wölfe, wenn er nicht zugleich sittliches Wesen wäre, so würden jene Räuberhorden schon inzwischen die ganze Erde verheert haben. Aber der Mensch muß, wenn er Schwierigkeiten gegenübersteht, die Gesetze seiner höheren Natur anerkennen, deren Nichtbeachtung ihm zwar augenblicklichen Erfolg bringen kann, aber ihn sicher zum Untergang führt. Denn das, was der niedern Natur nur Hindernis ist, ist der höhern Lebensform eine Möglichkeit zu höherer Entwicklung.
Indien hat vom Anfang seiner Geschichte an seine Aufgabe gehabt: das Rassenproblem. Ethnologisch verschiedene Rassen sind in diesem Lande in nahe Berührung miteinander gekommen. Die Tatsache war zu allen Zeiten und ist noch heute die wichtigste in unserer Geschichte. Es ist unsere Aufgabe, ihr ins Gesicht zu sehen und unsern Menschenwert dadurch zu erweisen, daß wir sie im tiefsten Sinne lösen. Solange wir nicht diese Aufgabe erfüllt haben, wird uns Glück und Gedeihen versagt sein.
Es gibt andere Völker in der Welt, die in der sie umgebenden Natur Hindernisse zu überwinden haben oder von mächtigen Nachbarn bedroht sind. Sie haben ihre Kräfte organisiert, nicht nur so weit, daß ihnen von der Natur und von menschlichen Nachbarn keine Gefahr mehr drohen kann, sondern daß sie selbst durch ihre überschüssige Kraft zu einer Gefahr für andere geworden sind. Aber die Geschichte unseres Landes, wo die Schwierigkeiten innerer Art sind, ist eine Geschichte beständiger sozialer Schlichtung und Anpassung, nicht eine Geschichte zu Verteidigung und Angriff organisierter Macht.
Weder die farblose Unbestimmtheit des Kosmopolitismus noch die leidenschaftliche Selbstvergötterung des Nationalitätskults ist das Ziel der menschlichen Geschichte. Und Indien hat versucht, seine Aufgabe zu erfüllen, indem es einerseits die Verschiedenheiten in eine soziale Ordnung gebracht und andererseits das Bewußtsein der Einheit im Geist entwickelt hat. Es hat schwere Fehler begangen, indem es zu starre Schranken zwischen den Rassen aufrichtete und durch das Kastenwesen gewisse Stände dauernd herabdrückte und zur Minderwertigkeit verurteilte; es hat oft den Geist seiner Kinder verkrüppelt und ihr Leben eingeengt, um sie den sozialen Formen anzupassen; aber Jahrhunderte hindurch hat es immer wieder neue Versuche gemacht und Ausgleichungen geschaffen.
Indiens Aufgabe war die einer Wirtin, die für zahlreiche Gäste zu sorgen hat, deren Gewohnheiten und Bedürfnisse alle voneinander verschieden sind. Dies bringt endlose Schwierigkeiten mit sich, deren Hebung nicht nur Takt erfordert, sondern wahre Teilnahme und das Bewußtsein der Einheit des Menschengeschlechts. Dieses Bewußtsein allgemein zu machen, haben schon seit der frühen Zeit der Upanishads bis in unsere Zeit große religiöse Lehrer geholfen, deren Ziel es war, alle menschlichen Unterschiede auszulöschen im überströmenden Gottesbewußtsein. Unsere Geschichte besteht fürwahr nicht in dem Aufblühen und Zerfallen von Königreichen, in Kämpfen um politische Übermacht. Bei uns sind die Berichte von solchen Ereignissen verachtet und vergessen, denn sie machen keineswegs die wahre Geschichte unseres Volkes aus. Unsere Geschichte berichtet von sozialem Leben und von der Verwirklichung religiöser Ideale.
Aber wir fühlen, daß unsere Arbeit noch nicht getan ist. Die Flut der Welt ist über unser Land hingefegt, neue Elemente sind uns zugeströmt, und Anpassungen größeren Stils sind nötig.
Wir fühlen dies um so mehr, als die Lehre und das Beispiel des Westens dem, was wir für unsere Aufgabe halten, gerade zuwiderläuft. Im Westen wird durch den nationalen Mechanismus von Handel und Politik die Menschheit schön ordentlich in Ballen zusammengepreßt, die ihren Nutzen und hohen Marktwert haben; sie sind mit eisernen Reifen umspannt, mit Aufschrift versehen und mit wissenschaftlicher Sorgfalt und Genauigkeit sortiert. Gott schuf doch wahrlich den Menschen, daß er menschlich sei; aber dieses moderne Produkt ist so wunderbar regelmäßig zugeschnitten und poliert, hat so sehr den Charakter der Fabrikware, daß der Schöpfer Mühe haben wird, es als ein geistiges Wesen zu erkennen, als das Geschöpf, das er nach seinem göttlichen Bilde schuf.
Aber ich greife schon vor. Was ich sagen wollte, ist dies. Nehmt es, wie ihr wollt: dieses Indien hat seit wenigstens fünf Jahrtausenden versucht, in Frieden zu leben, und dies Indien war ohne Politik, ohne Nationalismus; sein einziger Ehrgeiz war, diese Welt als beseelt zu erkennen und jeden Augenblick seines Lebens zu leben in demutsvoller Anbetung und im frohen Bewußtsein der ewigen und persönlichen Verwandtschaft mit ihr. Über diesen abgelegenen Teil der Menschheit, der die Harmlosigkeit des Kindes und die Weisheit des Alters hatte, brach die Nation des Westens herein.
Bei allen Kämpfen und Ränken und Betrügereien seiner früheren Geschichte war Indien selbst unbeteiligt geblieben. Denn seine Heimstätten, seine Felder, seine Tempel, seine Schulen, in denen Lehrer und Schüler in Einfachheit und Frömmigkeit und stiller Arbeit zusammenlebten, seine Dörfer mit ihrer friedlichen Selbstverwaltung und ihren einfachen Gesetzen – alles dies gehörte wirklich zu Indien. Aber nicht seine Throne. Sie berührten es so wenig wie die Wolken, die über sein Haupt hingingen, bald mit purpurner Pracht gefärbt, bald schwarz, gewitterdrohend. Oft hatten sie Verheerungen in ihrem Gefolge, aber sie waren wie Naturkatastrophen, deren Spuren bald verschwinden.
Aber diesmal war es anders. Diesmal war es kein bloßes Dahinjagen über die Oberfläche seines Lebens – ein Dahinjagen von Reitern und Fußsoldaten, von Elefanten mit reichen Schabracken, weißen Zelten und Sonnendächern, von Reihen geduldiger Kamele, die die Lasten des königlichen Hofes trugen, von Flötenbläsern und Paukenschlägern, Marmordomen und Moscheen, Palästen und Gräbern. Dies alles kam und ging sonst wie Perlen von schäumendem Wein, und mit ihm die Geschichten von Verrat und Treue, von plötzlichem Aufstieg und jähem Fall. Diesmal aber trieb die Nation des Westens die Fühlhörner ihres Mechanismus tief in den Boden hinein. Deshalb, sage ich euch, müssen wir selbst Zeugnis ablegen von dem, was unser Volk für die Menschheit bedeutete. Wir hatten die Horden der Mongolen und Afghanen kennengelernt, die in Indien einfielen, aber wir hatten sie kennengelernt als menschliche Rassen mit ihren besonderen Religionen und Sitten, Neigungen und Abneigungen – wir hatten sie nicht als Nation kennengelernt. Wir liebten und haßten sie, wie die Anlässe es ergaben, wir kämpften für oder gegen sie, sprachen mit ihnen in einer Sprache, die sowohl ihre als unsere war, und halfen so an unserm Teile mit, das Schicksal unseres Reiches zu lenken. Aber diesmal hatten wir es nicht mit Königen, nicht mit menschlichen Rassen zu tun, sondern mit einer Nation – wir, die wir selbst keine Nation sind.
Wir wollen jetzt einmal aus unserer eigenen Erfahrung heraus die Frage beantworten: Was ist eine Nation?
Eine Nation im Sinne politischer und wirtschaftlicher Vereinigung eines Volkes ist die Erscheinung, die eine ganze Bevölkerung bietet, wenn sie zu einem mechanischen Zweck organisiert wird. Die menschliche Gesellschaft als solche hat keinen über sie hinausreichenden Zweck. Sie ist Selbstzweck. Sie ist die Form, in der der Mensch als soziales Wesen sich von selbst ausdrückt. Sie ist die natürliche Ordnung menschlicher Beziehungen, die den Menschen die Möglichkeit gibt, in gemeinsamem Streben ihre Lebensideale zu entwickeln. Sie hat auch eine politische Seite, aber diese dient nur einem besonderen Zweck, dem der Selbsterhaltung. Es ist die Seite der Macht, nicht die des Lebensideals. Und so war in früheren Zeiten die Politik nur ein besonderes Gebiet, das Fachleuten vorbehalten war. Aber wenn mit Hilfe der Wissenschaft und der immer vollkommener werdenden Organisation dies Gebiet zu erstarken beginnt und reiche Ernten einbringt, dann wächst es mit erstaunlicher Schnelle über seine Grenzen hinaus. Denn dann spornt es alle seine Nachbargebiete zur Gier nach materiellem Gewinn und infolgedessen zu gegenseitiger Eifersucht an. Und weil jeder den andern fürchten muß, muß jeder nach Macht streben. Die Zeit kommt, wo es kein Halten mehr gibt, denn der Wettbewerb wird hitziger, die Organisation nimmt immer größern Umfang an, und die Selbstsucht wird übermächtig. Indem die Politik aus der Gewinnsucht und Furcht des Menschen Vorteil zieht, nimmt sie in der Gesellschaft einen immer größeren Raum ein und wird zuletzt ihre beherrschende Macht.
Es ist wohl möglich, daß ihr, durch die Gewohnheit abgestumpft, das Gefühl dafür verloren habt, daß heutzutage die natürlichen Bande der menschlichen Gesellschaft zerreißen und rein mechanischer Organisation Platz machen. Aber ihr könnt die Zeichen davon überall sehen. Ihr seht, wie Mann und Weib sich gegenseitig den Krieg erklären, weil das natürliche Band, das sie miteinander in Harmonie verbindet, gerissen ist. Der Mann ist nur noch Berufsmensch, der für sich und andere Reichtümer erzeugt, indem er beständig das große Rad der Macht dreht – sich selbst und der allgemeinen Bureaukratie zuliebe. Die Frau mag hinwelken und sterben oder ihren Lebenskampf allein ausfechten. Und so ist an die Stelle von natürlichem Zusammenwirken Wettbewerb getreten. So wandelt sich sogar die seelische Beschaffenheit von Mann und Weib hinsichtlich ihrer Beziehung zueinander, und ihr Verhältnis wird das roher, kämpfender Elemente, nicht das von Menschen, die in einer auf gegenseitige Hingabe gegründeten Vereinigung ihre Ergänzung suchen. Denn die Elemente, die sich nicht mehr natürlich verbinden können, haben den Sinn ihres Daseins verloren. Wie Gasmoleküle, die in einem zu engen Raum zusammengepreßt sind, sind sie miteinander in beständigem Kampf, bis sie das Gefäß selbst zersprengen, das sie einzwängt.
Und dann denkt an jene, die sich Anarchisten nennen, die den Druck der Macht auf das Individuum in keiner Form dulden wollen. Der Grund ihrer Auflehnung ist, daß die Macht etwas zu Abstraktes geworden ist; sie ist ein wissenschaftliches Produkt, das in dem politischen Laboratorium der Nation erzeugt wird durch Einschmelzung der menschlichen Persönlichkeit.
Und was bedeuten im wirtschaftlichen Leben diese Streiks, die wie Dornsträucher auf unfruchtbarem Boden jedesmal, wenn sie niedergeschlagen sind, mit erneuter Kraft wieder emporschießen? Was anders, als daß der Reichtum erzeugende Mechanismus immer mehr ins Ungeheure anwächst und in keinem Verhältnis mehr steht zu allen andern Bedürfnissen der Gesellschaft – und daß der wirkliche Mensch immer mehr und mehr unter seinem Gewicht erdrückt wird? Solch ein Zustand bringt unvermeidlich beständige Fehden mit sich zwischen den Elementen, die nicht mehr von dem Ideal des vollen Menschentums beherrscht werden, und Kapital und Arbeit sind in ewigem wirtschaftlichem Kampf miteinander. Denn Gier nach Reichtum und Macht kennt keine Grenze, und aus einem Vergleich aus Eigennutz kann nie endgültige Versöhnung werden. Sie müssen bis ans Ende Eifersucht und Mißtrauen brüten, und dies Ende kann nur ein plötzlich hereinbrechendes Verderben sein oder geistige Wiedergeburt.