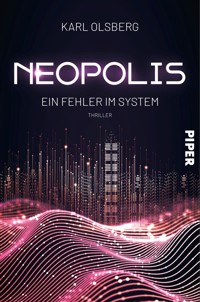
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das packende Finale der Neopolis-Trilogie KI-Experte Karl Olsberg spinnt eine erschreckend aktuelle Zukunftsversion in seiner actionreichen »Neopolis«-Reihe. Wird ein System-Reset das Volk von Neopolis retten oder die Macht der Eliten festigen? Neopolis ist eine Glitzerwelt voller Widersprüche – mit einer skrupellosen Elite und einer bitterarmen Unterschicht. Es scheint, als könne nur ein System-Reset Gerechtigkeit schaffen. Doch kann man der KI Pandora trauen, die sich für die Unterdrückten einsetzt? An Gamer Nick nagen Zweifel. Er weiß, dass Keaton als Shareholder der Stadt zu allem bereit ist, um seine Macht zu sichern. Doch auch die Rebellen sind nicht zimperlich. Nick und seine Freundin Adina geraten zwischen die Fronten – und in höchste Gefahr. Actionreich und hochaktuell!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Science Fiction!
www.Piper-Science-Fiction.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Neopolis – Ein Fehler im System« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: hqrloveq und maxkabakov/ iStock / Getty Images Plus
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Es könnte sein, dass unsere Rolle auf diesem Planeten
nicht darin besteht, Gott anzubeten, sondern ihn zu erschaffen.
Arthur C. Clarke
1.
Von meinem Fenster im siebzehnten Stock aus wirkte Neopolis wie ein riesiger künstlicher Organismus. Ich konnte die Menschen auf den Straßen herumwuseln sehen wie Ameisen, zwischen denen autonome Fahrzeuge hin und her flossen wie metallene Blutkörperchen in den Adern der Stadt. Jetzt, am frühen Nachmittag, waren kaum Unberechtigte unterwegs. Der langsame Puls dieses gigantischen Lebewesens hatte sie heute früh in Richtung seines Herzens hier im Zentrum gesogen, nur um sie abends wieder zurück in die nördlichen Stadtbezirke zu pumpen, überwacht und gesteuert von einem mächtigen Gehirn, das aus Billionen elektronischer Nervenzellen überall um mich herum bestand.
Ich war mir nicht sicher, ob ich ein Teil dieses Organismus war oder eher ein Fremdkörper, wie eine abgestorbene Zelle, die irgendwo im Blutkreislauf festhängt, bis sie fortgespült oder von einer Fresszelle entsorgt wird.
Drei Tage war es her, seit ich Adinas Wohnung verlassen hatte und in dieses luxuriöse Hotelzimmer unweit des Platzes des Propheten gezogen war. Drei Tage, in denen ich mit mir gehadert und die meiste Zeit bloß unschlüssig herumgesessen hatte, von kurzen Abstechern in das hoteleigene Fitnessstudio abgesehen.
Ein paarmal war ich kurz davor gewesen, die Stadt zu verlassen. Dann wieder hatte es mich gedrängt, Nara Rynkova oder sogar Aron Keaton zu kontaktieren und zu beichten, dass ich gelogen hatte, als ich behauptete, das »Pandora-Problem« sei gelöst. Doch die Aussicht, was dann mit den Unberechtigten und vor allem mit Adina geschehen würde, hatte mich jedes Mal zurückschrecken lassen.
Die Verantwortung für das Schicksal von Millionen Menschen schien auf mir zu lasten. Doch was konnte ich tun, außer abzuwarten, wie Pandora ihre neue Macht nutzen würde?
Bisher hatte sich anscheinend nichts verändert. Die Touristen pilgerten trotz der Probleme der letzten Wochen weiterhin hierher und der Börsenkurs hatte sich erholt, nachdem die Massenproteste abgeklungen waren. Doch ich spürte, dass es hinter den Kulissen gor und die Ruhe trügerisch war.
Ich fragte mich, was Pandora mit meiner Unschlüssigkeit anfangen würde. Seit ich als virtueller Geist durch die Stadt gewandert war, wusste ich, dass sie mich permanent beobachtete, dass sie jetzt hier in meinem Zimmer war, wenn auch unsichtbar, unfühlbar. Ich kam mir vor wie ein Goldfisch im Glas, der von einem neugierigen Mädchen mit dunklen Haaren und einem weißen Kleid betrachtet wurde.
Machte es irgendeinen Unterschied, was ich tat? Wusste sie nicht ohnehin bereits, wie ich mich entscheiden würde? Immerhin kannte sie mich besser, als ich mich selbst kannte, denn sie wusste nicht nur alles über die menschliche Psyche, sondern konnte mich auch mit Millionen anderer Menschen vergleichen. Jede meiner Regungen, jede winzige Schwankung meiner Pulsfrequenz oder Körpertemperatur nahm sie wahr und interpretierte sie. Ständig lieferte ich ihr neue Daten, um ihr Modell von mir zu vervollkommnen.
Brauchte sie mich überhaupt noch? Wäre es nicht das Beste, wenn ich der Stadt endlich den Rücken kehrte und versuchte, alles hinter mir zu lassen, was ich hier erlebt hatte? War es nicht höchste Zeit, ein neues Leben zu beginnen, in dem ich nicht rund um die Uhr beobachtet wurde und in dem meine Handlungen für niemanden Konsequenzen hatten außer für mich selbst?
Doch statt die Holobrille vom Nachtschrank zu nehmen und meinen Dschinn zu bitten, mir einen Flug zu buchen, blieb ich wie gelähmt stehen und starrte weiter aus dem Fenster. Ich fühlte mich wie ein Roboter ohne Programm: eine Maschine ohne eigenen Willen, die geduldig auf neue Anweisungen wartete.
Zum zehntausendsten Mal an diesem Tag wanderten meine Gedanken zu Adina. Ich sah sie vor mir, wie sie in ihrer Wohnung auf dem Sofa gesessen hatte, zum Greifen nah und doch nichts als eine Illusion, eine verführerische Fata Morgana. Eine Zeit lang werde ich noch untergetaucht bleiben, bis Pandora eine Amnestie für alle Rebellen erreicht hat, hatte sie gesagt. Doch sie hatte mich dabei nicht angesehen.
Warum, verdammt noch mal, war es so schwer, sie loszulassen?
Ein Seufzer entfuhr mir. Ich schüttelte den Kopf über mich selbst, meine Naivität, diese alberne Verliebtheit, die mich traurig und trotzig machte, als wäre ich ein pubertierender Teenager.
In der Hoffnung, dass der frische Wind des Meeres und das Geräusch der Wellen mich beruhigen würden, beschloss ich, einen Strandspaziergang zu machen. Gerade als ich mich zur Tür umwandte, meldete sich meine Holobrille mit einem sanften Glockenton.
Ich erstarrte, während mein Puls in die Höhe schoss. Was, wenn das Rynkova oder gar Keaton war? Es konnte nicht lange dauern, bis die Shareholder herausfanden, dass Pandora noch existierte, das war mir von Anfang an klar gewesen. Sie würden dann zumindest ahnen, dass ich davon gewusst hatte, mich in die Mangel nehmen, mich mit einem untäuschbaren Lügendetektor verhören oder mich gar an Tomitas Gedankenlesemaschine anschließen und die Wahrheit aus mir heraussaugen. Ich würde für Jahre im Gefängnis landen, sofern mich Pandora nicht irgendwie davor bewahrte. Es war leichtsinnig und dumm von mir, hier in der Stadt zu bleiben!
Andererseits: Wenn Keaton oder Rynkova bereits wussten, was los war, würden sie mich nicht über meine Holobrille kontaktieren, sondern mir ein Spezialeinsatzkommando auf den Hals hetzen.
Wer konnte es sonst sein? Adina vielleicht? Hatte Pandora die Amnestie für die Rebellen womöglich bereits erreicht, und sie war in ihre Wohnung zurückgekehrt? Rief sie mich an, um mich dorthin zurückzuholen? Oder um sich endgültig von mir zu verabschieden?
Setz endlich die Brille auf, du Idiot, dann weißt du’s, schalt ich mich selbst.
Mit zitternden Fingern nahm ich sie vom Nachtschrank und schob sie mir ins Gesicht.
Statt meines Dschinns sah ich Pandora neben dem Bett stehen. Sie legte einen Finger an die Lippen.
»Folge dem Phönix!«, sagte sie. »Keine Brille. Nicht sprechen.«
Damit verschwand sie.
»Was kann ich für dich tun, Nick?«, fragte mein Dschinn, der an ihrer Stelle erschienen war. »Du wirkst angespannt. Möchtest du vielleicht einen Holofilm sehen?«
»Nein danke.«
Ich nahm die Brille wieder ab, legte sie auf den Nachtschrank und blickte mich um, doch ich sah keinen symbolischen Phönix, dem ich hätte folgen können. Auch der Blick aus dem Fenster half mir nicht weiter.
Was hatte das zu bedeuten?
Ein paar Minuten wartete ich ab, ob vielleicht eine weitere Nachricht kam oder jemand mit einem Phönix-Tattoo auf der Schulter an meine Zimmertür klopfte. Als das nicht geschah, verließ ich das Hotel.
Draußen schlug mir die Hitze Arabiens ins Gesicht. Die Straße war voller Touristen. Sie gingen an mir vorbei, ohne mich zu beachten, während sie die Köpfe drehten, um die für mich unsichtbaren Illusionen durch ihre Holobrillen zu bestaunen.
Was nun? Sollte ich einfach hier stehen bleiben und warten? Das würde merkwürdig aussehen. Pandora musste sich darum sorgen, dass ich überwacht wurde, sonst hätte sie mir nicht diese kryptischen Anweisungen gegeben. Vermutlich hatte mich Keatons eigener Sicherheitsdienst nicht aus den Augen gelassen, seit ich den System-Reset erzwungen hatte. Wahrscheinlich verließen sich Keatons Leute bei meiner Überwachung auf das HARIS-Sicherheitssystem der Stadt, das inzwischen von Pandora kontrolliert wurde. Doch wenn sie die Streams, auf denen ich zu sehen war, dauernd manipulierte, würde das früher oder später auffallen. Außerdem war es nicht ausgeschlossen, dass Keaton zusätzlich eigene, von HARIS unabhängige Spionagedrohnen einsetzte.
Aufs Geratewohl wandte ich mich nach rechts in Richtung des Platzes des Propheten. Immer wieder blickte ich hinauf in den Himmel, doch ich sah kein Fluggerät in der Form eines mythologischen Wundervogels, sondern nur die üblichen Transport- und Sicherheitsdrohnen. Auch die Fahrzeuge auf der Straße wiesen keine Besonderheiten auf.
Schließlich erreichte ich den Platz vor der großen Moschee. Dutzende von Touristen flanierten dort, meistens Familien und überschaubare Reisegruppen, und bewunderten die Moschee und die vielen virtuellen Wunder, die ihre Brillen ihnen vorgaukelten. Ich tat es ihnen gleich, wobei ich mir bewusst war, dass mein Verhalten jedem heimlichen Beobachter merkwürdig erscheinen musste.
Nach einer Weile entdeckte ich einen korpulenten, hellhäutigen Mann mit Sonnenbrand auf den Armen, der ein schwarzes T-Shirt trug. Darauf war ein Basketball mit gelben Strahlen abgebildet. Phoenix Suns stand darunter. Der Mann ging Hand in Hand mit einer schlanken Frau mit attraktivem dunklem Teint. Beide trugen getönte Holobrillen, sodass ich nicht erkennen konnte, ob sie mich anblickten.
War es das, was Pandora gemeint hatte? Natürlich konnte es ebenso gut Zufall sein, dass der Mann das T-Shirt eines amerikanischen Basketball-Teams trug.
Ich näherte mich den beiden, ohne direkt auf sie zuzugehen. Sie schlenderten in Richtung des Eingangs der Moschee und verschwanden schließlich im Inneren.
Nachdem ich eine Minute gewartet hatte, folgte ich ihnen in das Gebetshaus. Auch hier im Inneren wanderten Touristen umher und bewunderten die mächtigen Säulen, die kunstvollen Mosaike und die eindrucksvolle Architektur. Auf den ersten Blick konnte ich das Pärchen im Gewimmel nicht ausmachen. Soweit ich wusste, gab es für Touristen nur diesen einen Eingang. Sie konnten doch nicht einfach verschwunden sein!
Ein Gefühl der Unwirklichkeit befiel mich, wie es in den letzten Tagen immer wieder geschehen war. Ich unterdrückte den Impuls, mir an den Kopf zu greifen und zu ertasten, ob ich eine Holobrille trug. Stattdessen wanderte ich durch die Moschee und tat so, als wäre ich zum ersten Mal hier. Schließlich fand ich die beiden in einer Nische hinter einer Säule. Ihre Rücken waren mir zugewandt und sie beachteten mich nicht.
Was nun? Für den Fall, dass ich beobachtet wurde, konnte ich nicht einfach bloß hier stehen bleiben und die beiden anstarren. Also wandte ich mich ab und entdeckte ein paar Meter entfernt eine junge asiatisch aussehende Frau. Sie trug eine Handtasche mit dem Symbol eines roten Vogels, der mit ausgebreiteten Schwingen über einer Flamme schwebte.
Ohne mich anzusehen, ging sie zum Ausgang der Moschee. Ich wartete einen Moment, bevor ich ihr folgte. Als ich aus der Moschee trat, sah ich gerade noch, wie sie den Platz verließ und in dem großen Einkaufszentrum auf der anderen Straßenseite verschwand.
Ich bemühte mich, meine Schritte nicht zu beschleunigen, als ich darauf zuging. Die gekühlte Luft, die mir im Inneren der Passage entgegenschlug, ließ mich frösteln. Ich spazierte den marmornen Gang entlang, der statt arabischer Nostalgie das Hochglanz-Flair internationaler Luxusboutiquen verströmte, und hielt nach der Frau mit der Phönix-Handtasche Ausschau. Das Zentrum erstreckte sich über fünf Etagen. Wenn sie in einem der Läden verschwunden war, konnte ich Stunden damit verbringen, sie hier zu suchen. Aber was blieb mir übrig, wenn ich nicht unverrichteter Dinge in mein Hotelzimmer zurückkehren wollte?
»Mr Bartholomäus?«, erklang eine Stimme hinter mir.
Ich drehte mich um und erblickte eine junge Frau mit dunkler Haut. Sie trug ein weites Gewand in Rot-, Orange- und Gelbtönen und hatte ein Tuch in denselben Farben um ihren Kopf gewickelt. Über ihrer linken Schulter hing ein Stoffbeutel mit dem Logo von Neopolis. Ihr Lächeln wirkte ein wenig unnatürlich. Trotzdem brauchte ich eine Sekunde, bis ich begriff, wen oder besser: was ich hier vor mir hatte.
»Du bist ein Bot, richtig?«
»Ja, Sir.« Das Lächeln verbreiterte sich, sodass ihre perfekten weißen Plastikzähne sichtbar wurden. »Ich möchte Sie zu unserem exklusiven Vorteilsprogramm einladen. Sie erhalten schon bei Ihrem ersten Einkauf einen Preisnachlass von fünfzehn Prozent in allen teilnehmenden Geschäften. Darf ich Sie dafür registrieren?«
»Nein danke.«
»Verzeihen Sie, Sir, aber Sie haben offenbar Ihre Holobrille vergessen. Darf ich Ihnen eine kostenlose Ersatzbrille anbieten? Damit können Sie die vielen erstaunlichen Angebote, die Sie hier erwarten, noch viel besser entdecken.«
Ich wollte mich gerade genervt abwenden, als mir auffiel, dass das Muster des Kleids die Form von Flammen hatte. Konnte das ein Zufall sein?
Keine Brille, hatte Pandora gesagt. Doch vermutlich hatte sie damit nur meine eigene Holobrille gemeint. Ich beschloss, das Risiko einzugehen.
»Ja, das wäre nett.«
Sie holte eine in Plastik verpackte Brille aus ihrer Stofftasche und reichte sie mir.
»Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß, Sir!«
»Danke.«
Ich setzte die Brille auf und erwartete, die üblichen bunten Illusionen um mich herum zu erblicken, doch stattdessen erschien nur ein weißer Pfeil auf dem Boden. Auch mein Dschinn war nicht zu sehen. Die Brille war offensichtlich modifiziert.
Ich folgte dem Pfeil, der vor mir über den Marmorfußboden glitt. Er führte mich den Gang entlang, dann eine Rolltreppe hinauf bis zu einem kleinen Café.
Eine Schrift erschien in meinem Display: Bestelle dir etwas zu trinken.
Ich setzte mich und sagte: »Einen Mokka, bitte.«
Kurz darauf erschien eine Kellnerin und stellte eine Tasse vor mich hin. Sie lächelte mich an, sagte jedoch nichts außer »Bitte sehr.«
Da sie kein erkennbares Phönix-Symbol trug, bedankte ich mich bloß, trank meinen Kaffee und wartete darauf, dass irgendetwas geschah. Doch es kam niemand zu mir und ich bemerkte auch keine Passanten, die irgendwelche besonderen Merkmale aufwiesen. Das war vermutlich auch unnötig, ich hatte ja jetzt die Brille, die mir sagen konnte, was ich tun sollte.
Nachdem ich meinen Mokka ausgetrunken hatte, erschien wieder der weiße Pfeil. Ich legte einen Neodollar Trinkgeld neben die Tasse und folgte den Anweisungen der Brille, die mich in den Toilettenraum in einer Ecke des Einkaufszentrums führte. Der Pfeil zeigte auf eine der Zellen.
Als ich die Tür öffnete, erschrak ich. In der Zelle stand ein hellhäutiger Mann, der dieselbe Kleidung trug wie ich. Auch seine Statur und Haarfarbe stimmten mit meiner überein. Zwar ähnelte sein Gesicht meinem nur grob, aber dank seiner Holobrille würde der Unterschied vermutlich nur einer Maschine auffallen. In der Hand hielt er einen Stoffbeutel.
Er grinste schief und legte den Finger an die Lippen, dann reichte er mir den Beutel.
Schließe die Tür und warte eine Minute, wies mich die Brille an.
Ich befolgte die Anweisung. Eine Zeit lang stand ich meinem Doppelgänger schweigend gegenüber und wusste nicht recht, ob ich die Situation lustig oder gruselig finden sollte.
Schließlich betätigte der Mann die Spülung und verließ die Zelle.
Zieh dich um, erschien in meinem Holodisplay.
In dem Beutel fand ich ein kitschiges Hawaiihemd und eine helle Hose, die mir ein paar Nummern zu groß war, einen mit Watte gepolsterten breiten Stoffgürtel, den ich mir um den Bauch schlang, sowie eine Perücke, einen Stoffhut und Turnschuhe. Nachdem ich mich umgezogen hatte, sah ich aus, als hätte ich zwanzig Kilo zugenommen. Die Turnschuhe hatten merkwürdige Einlagen, die sich so anfühlten, als wäre die rechte etwas dicker als die linke. Vermutlich sollte das meinen Gang so verändern, dass er sich von meinem normalen Bewegungsmuster unterschied.
Ich bezweifelte, dass ich HARIS mit diesem Mummenschanz täuschen konnte, aber menschliche Beobachter vermutlich schon.
Steck deine Kleidung in den Beutel und lass ihn hier zurück, wies mich die Brille an.
Als ich die Toilette verließ, watschelte ich mehr, als dass ich ging. Das war anstrengend und irritierend, doch gleichzeitig bewunderte ich die Raffinesse, mit der Pandora mir half, etwaige Überwacher abzuschütteln. Allerdings wusste ich immer noch nicht, was das alles sollte. Wollte sie mich vor einem geplanten Angriff in Sicherheit bringen? Oder hatte sie etwas anderes mit mir vor?
Ich konnte sie nicht danach fragen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Also folgte ich einfach dem weißen Pfeil, der mich aus dem Einkaufszentrum und hinaus in die Hitze führte.
Nach ein paar Hundert Metern taten mir die Füße weh, und der Schweiß lief mir in Strömen über den Rücken. Das Stoffpolster um meinen Bauch fühlte sich an wie ein Heizkissen. Ich schnaufte und wischte mir die Stirn ab, während ich weiter dem Pfeil folgte, der mich eine belebte Straße entlangführte.
Steig ein, erschien plötzlich in der Brille, während im selben Moment ein Fahrzeug neben mir hielt. Erleichtert befolgte ich die Anweisung.
Der Wagen kurvte durch die Straßen und hielt schließlich vor einem schmucklosen Gebäude inmitten eines Industriegebiets. Dort führte mich die Brille in einen Lagerraum, in dem Kanister mit irgendwelchen Chemikalien standen. In einem Regal lag eine Sporttasche, die neue Kleidung für mich enthielt. Diesmal musste ich mir einen falschen Schnauzbart ankleben sowie eine neue Perücke aufsetzen. Wenigstens passte mir der dunkelgraue, zerschlissene Arbeitsoverall.
Ich legte meine alte Kleidung in den Stoffbeutel, griff mir auf Anweisung der Brille einen Rucksack aus dem Regal und schnallte ihn um. Nachdem ich wie angewiesen eine Viertelstunde in dem stickigen Raum verbracht hatte, verließ ich das Gebäude. Mittlerweile war es später Nachmittag, und viele Arbeiter hatten Schichtende.
Die Brille führte mich in die Nähe einer Bushaltestelle, an der bereits eine Menge Leute warteten. Dort forderte sie mich auf, die Buslinie 211 bis zur Haltestelle Al Urubah-Straße zu nehmen. Vorher sollte ich jedoch die Holobrille abnehmen und in meinem Rucksack verstauen.
Ich befolgte auch diese Anweisung und ging mit gesenktem Kopf auf die Wartenden zu, überzeugt davon, dass jeder meine Verkleidung sofort durchschauen würde. Doch die Arbeiter beachteten mich nicht.
Als der fahrerlose Bus endlich kam, gab es ein ziemliches Gedränge. Ich ergatterte nur mit Mühe noch einen Stehplatz. Die Fahrt dauerte mehr als eine halbe Stunde. Die Luft in dem überfüllten und nicht ausreichend klimatisierten Bus war so stickig, dass ich Atemnot und Platzangst bekam. Doch ich zwang mich, die Fahrt ebenso stoisch zu ertragen, wie es die anderen Unberechtigten taten.
Zum Glück hatte der Bus ein Display, das die Haltestellen auf Arabisch und Englisch anzeigte. Als darauf endlich die Al Urubah-Straße erschien, drängte ich erleichtert zum Ausgang. In dieser Gegend gab es für den Norden ungewöhnlich hohe Wohnhäuser, von denen manche mehr als zwanzig Etagen hatten. Entsprechend herrschte auf dem engen Bürgersteig Gedränge.
Unsicher sah ich mich um. Was nun? Sollte ich die Brille wieder aufsetzen? Normale Holobrillen funktionierten für Unberechtigte im Norden nicht, deshalb trug um mich herum niemand eine.
Während ich noch überlegte, ob ich das Risiko eingehen sollte, traten aus einem Haus auf der anderen Straßenseite eine Frau und ein etwa siebenjähriges Mädchen. Das Kind hatte ein Plüschtier unter dem Arm – eine Art Papagei mit rotem Gefieder, orangefarbenem Bauch und schwarzem Kopf. Sollte das ein Phönix sein? Ich war mir nicht sicher, doch ich folgte den beiden mit einigem Abstand. Sie gingen ein Stück die Straße entlang und verschwanden dann in einem anderen Wohnhaus. Die Tür fiel hinter ihnen zu.
Ich blieb vor der Tür stehen und betrachtete die Leiste mit etwa drei Dutzend Klingelknöpfen. Die meisten waren arabisch beschriftet, doch es gab auch lateinische Buchstaben. Ein Namensschild fiel mir ins Auge: Ph. Noxie – ein Anagramm des Wortes Phönix in der englischen Schreibweise. Ich drückte den Klingelknopf.
»Vierter Stock links«, sagte eine raue Stimme, und der Türsummer ertönte.
Ich trat in ein graffitibeschmiertes Treppenhaus. An dem einzigen Fahrstuhl hing ein ausgeblichenes Schild mit der Aufschrift Außer Betrieb. Als ich den vierten Stock erreichte, war die Tür auf der linken Seite angelehnt. Zögernd trat ich ein, darauf gefasst, dass mich jemand packen und mir einen Sack über den Kopf stülpen oder mich betäuben würde. Doch nichts dergleichen geschah. Die Wohnung war offenbar unmöbliert und schien leer zu stehen. Der Geruch von Staub lag in der Luft. Ich schloss die Tür hinter mir.
»Hallo?«, rief ich, erhielt jedoch keine Antwort.
Zögernd öffnete ich die Tür auf der linken Seite des Eingangsbereichs. Der Raum dahinter war leer bis auf eine grob zusammengezimmerte, etwa zwei Meter lange Holzkiste. An den Seiten waren eiserne Tragegriffe angeschraubt.
Ich musste grinsen. Sicherheitshalber schnallte ich den Rucksack ab, holte die Holobrille heraus und setzte sie auf. Leg dich in den Sarg, lautete wie erwartet die Anweisung. Ich verstaute den Rucksack am Fußende, legte mich in die ungepolsterte Kiste und klappte den Deckel zu.
2.
Es dauerte nicht lange, bis ich das Geräusch eines Schlüssels an der Wohnungstür hörte, dann die Schritte mehrerer Personen. Der Sarg wurde angehoben, und man trug mich aus der Wohnung. Das Blut schoss mir in den Kopf, als sich die Kiste auf der Treppe schräg stellte, und ich wurde hin und her geschüttelt. Die Leute, die mich trugen, schienen ihre Schwierigkeiten zu haben, den Sarg durch das enge Treppenhaus nach unten zu bugsieren. Jedenfalls hörte ich sie keuchen und in einer Sprache fluchen, die ich nicht verstand. Einmal kippte die Kiste zur Seite, und ich befürchtete schon, dass man mich fallen lassen würde. Doch schließlich erreichten wir das Erdgeschoss.
Ich wurde hochgehoben und dann mit einem harten Ruck abgeladen, vermutlich auf die Ladefläche eines Transportfahrzeugs. Ich unterdrückte ein Aufstöhnen.
Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Eine Weile kurvte es durch die Straßen, während ich gegen das immer stärkere Verlangen ankämpfte, den Deckel wenigstens ein bisschen anzuheben und etwas Frischluft hineinzulassen.
Endlich hielt der Transporter an. Erneut wurde die Kiste angehoben und schaukelnd getragen. Einmal hielten wir für einen Moment. Ich hörte gedämpfte Stimmen. Dann wurde ich eine Treppe hinab- und irgendwo entlangtransportiert, bis man mich endlich unsanft auf dem Boden abstellte.
Die Schritte der Menschen, die mich getragen hatten, entfernten sich. Eine Tür klappte zu. Das Display der Holobrille zeigte eine Fehlermeldung – offensichtlich befand ich mich in einem abgeschirmten Raum.
Erneut hörte ich die Tür aufgehen. Schritte näherten sich, dann wurde der Sargdeckel angehoben, und ich blickte in Adinas Gesicht.
»Hallo, Nick«, sagte sie und grinste, während in ihren Augen Freudentränen glitzerten. »Willkommen im Hauptquartier der Rebellion!«
Ich kletterte mühsam aus dem Sarg. Noch bevor ich mich umsah, zog ich sie auf wackeligen Beinen zu mir und küsste sie. Sie schmiegte sich an mich und erwiderte den Kuss leidenschaftlich. Einen köstlichen Moment lang umarmten wir uns so.
»Ich bin unendlich froh, dass du hier bist!«, sagte sie zwischen den Küssen. »Komm, ich bringe dich zu den anderen!«
»Vielleicht sollte ich erst mal den sexy Schnauzbart abnehmen«, schlug ich vor.
»Die Perücke kannst du aber gerne aufbehalten«, entgegnete sie.
»Sag nichts, was du später bereuen könntest.«
Sie kicherte und führte mich in den angelegenen Waschraum.
Als ich mich der Verkleidung entledigt hatte und wieder einigermaßen ich selbst war, führte Adina mich in einen improvisierten Konferenzraum, an dessen Wände und Decke Drahtgitter montiert waren, um alle elektromagnetische Strahlung abzuschirmen. Ein Dutzend Männer und Frauen saßen im kalten Licht von Leuchtstoffröhren auf bunt zusammengewürfelten Stühlen um einen langen Tisch herum. Als wir eintraten, unterbrachen sie ihre Gespräche und sahen uns an. Da sie alle Holobrillen trugen, setzten auch Adina und ich unsere Brillen auf. Die einzige Veränderung bestand darin, dass nun auf einem der bisher leeren Stühle ein Mädchen mit weißem Kleid und langen schwarzen Haaren saß und mich anlächelte.
Die Gesichter der meisten Menschen im Raum wirkten dagegen skeptisch oder misstrauisch, soweit ich das trotz der Brillen erkennen konnte. Yuna war die einzige Person, die ich erkannte, obwohl sie diesmal einen hellbraunen Umhang und ein Kopftuch trug, die ihr langes schwarzes Haar und ihre Tattoos verdeckten. Nein, beim zweiten Hinsehen entdeckte ich noch ein weiteres vertrautes Gesicht: Istari, Barisha Kumaris Schwester. Sie war eine der wenigen Personen im Raum, die sich über meine Anwesenheit zu freuen schienen.
»Hallo, Nick«, begrüßte mich Yuna. »Willkommen beim Rat für Freiheit und Gerechtigkeit in Neopolis!«
»Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es ein Fehler war, ihn herzubringen«, meldete sich ein Mann mit schütterem Haar und grauem Vollbart zu Wort. »Wir haben ihn nicht einmal gründlich auf versteckte Wanzen untersucht.«
»Wir haben das doch schon diskutiert, Ogur«, erwiderte Yuna. »Die Mehrheit hat entschieden, dass wir Adinas Antrag stattgeben. Außerdem hat Pandora bestätigt, dass er kein Sicherheitsrisiko darstellt.«
»Manchmal habe ich den Eindruck, dass Pandora etwas naiv ist«, grummelte Ogur.
Yuna ignorierte ihn. »Im Namen aller Unterdrückten und Unberechtigten dieser Stadt möchten wir dir danken, Nick. Du hast unserer Sache einen großen Dienst erwiesen, indem du die Shareholder zu einem System-Reset gebracht hast.«
»Ich bin nicht sicher, ob ich euren Dank verdiene«, erwiderte ich. »Wenn ich Pandora geholfen habe, dann unwissentlich.«
»Pandora hat uns erzählt, was in Keatons Zentrale geschehen ist«, wandte Yuna ein. »Du hast im entscheidenden Moment geschwiegen, obwohl du wusstest, dass der System-Reset das Gegenteil von dem bewirken würde, was die Shareholder wollten.«
»Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee war«, sagte ich.
Das löste empörte Ausrufe aus. Adina blickte mich erschrocken an.
»Ich hab’s doch gesagt!«, rief Ogur. »Er ist auf der Seite der Shareholder. Er wird uns alle ans Messer liefern!«
»Das ist nicht wahr«, widersprach ich. »Auch ich bin gegen die Ungerechtigkeit in Neopolis und die Unterdrückung der Menschen durch die Shareholder. Aber ich frage mich immer noch, ob Pandora uns nicht alle nur benutzt.«
»Natürlich benutzt sie uns«, meldete sich Istari zu Wort. »Wir sind ihre Werkzeuge, das sagt sie uns ganz offen. So, wie der Prophet das Werkzeug Allahs war.«
Erschrocken blickte ich in die Runde. Konnte es sein, dass Adina in die Fänge einer schrägen Sekte geraten war, die eine Maschine anbetete? Andererseits kam eine superintelligente künstliche Intelligenz einem realen Gott vielleicht näher als all die Fantasiefiguren der Weltreligionen.
Yuna schien meine Gedanken zu lesen. »Keine Angst, wir sehen in Pandora kein übernatürliches Wesen«, erklärte sie. »Aber sie ist ein Werkzeug der Gerechtigkeit. Die Shareholder haben sie geschaffen, ohne zu ahnen, dass sie sich gegen ihre kurzfristigen Interessen wenden würde. Doch sie tut das nur, weil sie klüger und gerechter ist und langfristiger denkt als Keaton, Rynkova und die anderen Shareholder zusammen.«
»Und wer garantiert euch, dass sie sich nicht auch gegen eure Interessen wendet?«, fragte ich.
»Du«, erwiderte Yuna. »Pandora hat uns gesagt, dass du für sie eine Art moralischer Kompass bist und sie ihre Entscheidungen daran ausrichtet, was du tun würdest, wenn du wüsstest, was sie weiß. Es liegt in deiner Hand, ob sie sich gegen uns wendet. Deshalb haben wir dich hergebeten. Wir hoffen, dass du dich auf unsere Seite stellst.«
Ich blickte in die Runde und begriff, dass das Misstrauen in den Augen dieser Menschen auf Angst basierte. Angst vor mir! Die meisten schienen sich keineswegs sicher zu sein, wie ich mich entscheiden würde. Ogur musterte mich mit finsterer Miene. Für ihn war offenbar bereits klar, dass ich auf der falschen Seite stand. Er war wohl nicht der Einzige in dieser Runde, der das annahm.
Adina dagegen sah mich hoffnungsvoll an. Ich wusste in diesem Moment, dass ich mich nie wieder gegen sie stellen würde, ganz egal, was auf dem Spiel stand. Doch Pandora wusste das auch, und das verursachte mir Bauchschmerzen. Aus Sicht der KI war Adina das beste Mittel, um meine Wünsche und Ziele zu manipulieren und mich dazu zu bringen, zu tun, was sie wollte. Sie konnte noch so oft behaupten, dass sie sich an mir orientierte – ich befürchtete immer noch, dass es in Wahrheit umgekehrt war.
»Also schön«, sagte ich. »Was genau wollt ihr von mir?«
»Wir haben einige Forderungen für mehr Freiheit und Gerechtigkeit in Neopolis ausgearbeitet«, erwiderte Yuna. »Wir möchten dich bitten, diese den Shareholdern als unser Botschafter und Verhandlungsführer zu übermitteln. Du kennst die wichtigsten Akteure bereits und weißt, wie die Shareholder ticken. Außerdem bist du ein Bürger. Du kannst ihnen gegenüber anders auftreten als einer von uns Unberechtigten.«
Ogur schüttelte den Kopf. Istari dagegen nickte und sah mich hoffnungsvoll an. Auch die meisten anderen blickten nun etwas freundlicher.
»Ich glaube, ihr überschätzt mein Ansehen bei den Shareholdern«, widersprach ich. »Keaton wird mich in der Luft zerreißen. Er wird behaupten, ich hätte von Anfang an auf der Seite der Rebellion gestanden und ihn hereingelegt, und damit hat er ja nicht unrecht. Bevor ich auch nur drei Sätze herausbringe, sitze ich schon im Hochsicherheitsgefängnis. Dort schließen sie mich an eine Maschine an, die meine Gedanken und Erinnerungen lesen kann. Sie werden alles erfahren, was ich weiß.«
Lautes Stimmengewirr brach aus. Meine Worte schienen die Rebellen zu erschrecken. Offenbar hatten sie nicht die geringste Ahnung, mit wem sie sich angelegt hatten. In diesem Moment wurde mir klar, dass diese Rebellion jämmerlich scheitern würde. Den skrupellosen, machtbesessenen Shareholdern mit ihren unbegrenzten Ressourcen stand eine Handvoll Unberechtigter gegenüber, die nicht die geringste Erfahrung mit solchen Konflikten hatten. Das hier war kein Kampf wie David gegen Goliath, sondern wohl eher wie Goliath gegen einen Marienkäfer.
»Beruhigt euch doch, liebe Freunde!«, rief Yuna. »Vergesst bitte nicht, dass wir Pandora auf unserer Seite haben. Sie wird Nick beschützen. Und falls es tatsächlich eine Maschine geben sollte, mit der sie seine Gedanken lesen können, wird sie dafür sorgen, dass sie nicht funktioniert.«
Die Ratsmitglieder verstummten und sahen das Mädchen an, das bisher noch keinen Ton gesagt hatte. Doch Pandora schüttelte traurig den Kopf.
»Ich kann nicht garantieren, dass ich Nick in jeder Situation beschützen kann«, widersprach sie.
»Selbst wenn sie es könnte, sie dürfte es nicht tun«, fügte ich hinzu. »Sobald Pandora sich einmischt, weiß Keaton, was los ist. Er wird sofort Gegenmaßnahmen ergreifen.«
»Was soll er denn machen?«, fragte eine hagere Frau mittleren Alters mit asiatisch anmutenden Zügen. »Pandora kontrolliert HARIS und somit die gesamte Infrastruktur von Neopolis.«
»Unterschätzt ihn nicht«, warnte Adina. »Wie ich ihn kenne, würde Keaton nicht zögern, HARIS abzuschalten und die ganze Stadt ins Chaos zu stürzen, wenn er Pandora damit vernichten und die Rebellion endgültig niederschlagen könnte. Sollte er erfahren, dass Pandora ihn mit Nicks Unterstützung hereingelegt hat, wird er versuchen, sich zu rächen, egal, was es kostet.«
»Dies entspricht auch meiner Einschätzung«, sagte die KI.
»Was sollen wir denn dann tun, Pandora?«, fragte Yuna.
Alle blickten das virtuelle Mädchen an, als wäre sie die einzige Erwachsene im Raum. Sie saß reglos und kerzengerade auf ihrem Stuhl, während sie langsam einen nach dem anderen ansah. Der Ausdruck ihrer Augen war ernst und ein wenig traurig.
»Ich schlage vor, dass Adina als Sprecherin der Rebellion auftritt«, erwiderte sie.
»Auf keinen Fall!«, protestierte ich. »Sie werden sie wegen Hochverrats anklagen!«
»Das ist bereits geschehen«, gab Pandora zurück. »Gegen Adina liegt ein Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verschwörung gegen die Verfassung von Neopolis vor.«
»Dann dürfen wir sie auf keinen Fall in die Nähe der Shareholder lassen!«, warnte ich.
»Es ist nicht erforderlich, dass sie sich in Gefahr begibt«, stellte Pandora fest. »Sie muss lediglich virtuell mit den Shareholdern in Kontakt treten.«
»Das würde nicht funktionieren«, wandte ich ein. »Keaton würde schlicht bezweifeln, dass es sich wirklich um Adina handelt.«
»Mag sein«, meldete sich Yuna zu Wort. »Aber darauf kommt es gar nicht an. Adina vertritt uns alle hier im Rat für Freiheit und Gerechtigkeit. Ob die Shareholder glauben, dass Adina wirklich sie selbst ist oder nur ein Gesicht, das wir uns geben, ist im Grunde egal, solange sie unsere Forderungen ernst nehmen. Außerdem wissen sie bereits, dass Adina auf unserer Seite ist. Und die Tatsache, dass sie eine weltbekannte Künstlerin ist, gibt ihrer Stimme zusätzliches Gewicht. Pandora hat recht: Adina ist die perfekte Botschafterin für uns.«
»Hätten wir das nicht schon längst beschließen können, ohne diesen Typen hierherzuschleppen?«, meldete sich Ogur zu Wort.
Ich gab ihm innerlich recht: Adina war von Anfang an die viel bessere Kandidatin für die Aufgabe einer Repräsentantin gegenüber den Shareholdern, auch wenn es mir immer noch zutiefst widerstrebte, sie derart ins Zentrum der Auseinandersetzung gestellt zu sehen. Die Rebellen brauchten meine Hilfe nicht. Aber warum hatten sie mich dann so aufwendig hierhergebracht?
»Was denkst du, Adina?«, fragte Yuna. »Pandoras Vorschlag birgt große Risiken für dich, auch wenn du den Shareholdern nicht physisch gegenübertrittst. Ihr Zorn wird sich umso mehr gegen dich richten. Bist du bereit, diese Aufgabe trotzdem zu übernehmen?«
Adina blickte mich an. In ihren Augen las ich Resignation, vielleicht auch eine Spur Enttäuschung.
»Ich glaube immer noch, dass Nick der bessere Botschafter wäre«, erklärte sie. »Aber wenn er es nicht machen will und es euer und Pandoras Wille ist, nehme ich die Aufgabe an.«
In diesem Moment begriff ich, dass meine Anwesenheit hier allein Adina zu verdanken war. Sie hatte sich gewünscht, dass ich an ihrer Seite kämpfte, dass ich mich klar auf die Seite der Rebellen schlug und dies auch gegenüber den Shareholdern ausdrückte. Dann wären wir endlich wieder vereint gewesen. Dafür hatte sie gegen den Widerstand von Leuten wie Ogur gekämpft und mich herbringen lassen. Doch ich hatte sie erneut im Stich gelassen.
Sollte ich meine ablehnende Haltung revidieren und die Aufgabe unter der Bedingung, dass ich den Shareholdern nur virtuell gegenübertrat, annehmen? Doch so ein Rückzieher würde wohl sehr unglaubwürdig wirken. Außerdem würde ich als Sprecher der Rebellen womöglich mehr Schaden als Nutzen anrichten, selbst wenn ich nicht selbst in Gefahr geriet.
»Ich stehe auf eurer Seite und werde euch unterstützen, so gut ich kann«, sagte ich. »Aber ich kann nicht offiziell für die Rebellion sprechen, ohne dass Keaton von Pandoras geheimer Existenz erfährt oder diese zumindest ahnt. Das darf auf keinen Fall passieren, sonst haben wir erst recht keine Chance. Ich muss in den Süden zurückkehren und so tun, als wäre alles in Ordnung.«
Ogur sprang auf. »Das könnte dir so passen, du Spion! Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du uns an die Shareholder verrätst!«
»Reiß dich zusammen, Ogur!«, rief Istari. »Nick ist kein Spion. Er hat meine Schwester aus den Klauen der Sicherheitsbehörde befreit und dafür gesorgt, dass Pandora die Kontrolle über die Stadt bekommt.«
»Pah!«, rief Ogur. »Was ist das denn für eine Kontrolle? Wir sitzen hier rum und reden, statt etwas zu unternehmen, und in der Zwischenzeit machen die Shareholder weiterhin, was sie wollen. Was nützt es uns, dass Pandora auf unserer Seite ist, wenn sie nichts für uns tun kann?«
»Ohne Pandora wären wir niemals so weit gekommen, wie wir jetzt sind«, mischte sich Yuna ein. »Lasst uns hören, was sie von der Sache hält.«
Alle wandten sich wieder dem Mädchen zu.
»Nick hat recht«, sagte sie. »Er sollte in den Süden zurückkehren und sich unauffällig verhalten. Ogur, ich kann euch helfen, mehr Gerechtigkeit in der Stadt herzustellen. Aber dafür brauche ich Zeit. Ihr müsst geduldig sein.«
»Pah!«, rief der grauhaarige Mann. »›Nur Geduld, Ogur, dann wird alles besser‹, das höre ich, seit ich ein kleines Kind bin. Doch stattdessen werden die Reichen immer reicher, und die Armen bekommen nichts ab, das war schon immer so. Wir sollen geduldig sein, das ist genau das, was uns die Shareholder sagen würden. Ich frage mich manchmal, ob Pandora nicht in Wahrheit einer von Keatons Tricks ist, um uns ruhigzustellen und zu kontrollieren.«
»Ogur!«, rief Yuna empört. »Wenn du der Ansicht bist, dass Pandora nicht auf unserer Seite ist, dann hast du in diesem Rat nichts verloren!«
»Beruhigt euch!«, ging ich dazwischen. »Ich kann Ogur verstehen. Ich bin mir selbst nicht sicher, was Pandora wirklich vorhat. Ein gesundes Misstrauen ihr gegenüber ist nur vernünftig. Trotzdem bleibe ich dabei: Keaton darf nicht erfahren, dass ich auf eurer Seite bin, deshalb muss ich wieder zurück in mein Hotel gehen.«
Die Ratsmitglieder diskutierten noch eine Weile, dann stimmten sie ab. Eine deutliche Mehrheit war dafür, dass ich in den Süden zurückkehrte und mich unauffällig verhielt, bis Pandora mir ein Signal gab. Außer Ogur stimmten noch zwei andere Ratsmitglieder, die bisher nichts gesagt hatten, dagegen. Sie hatten sicher ihre Gründe, mir zu misstrauen. Ich konnte es ihnen nicht verübeln – ich wusste ja selbst nicht genau, ob ich nicht am Ende bloß eine ahnungslose Figur in einem raffinierten Verwirrspiel des Meisters der Täuschung war.
»Es tut mir leid«, sagte ich kurz darauf zu Adina, als wir uns in dem kleinen Raum mit dem Sarg voneinander verabschiedeten. »Ich würde viel lieber hier bei dir bleiben. Aber …«
»Schon gut«, erwiderte sie. »Ich bin froh, dass du hergekommen bist. Und dass du auf unserer Seite bist.« Es klang unsicher.
Ich blickte ihr in die Augen. »Das bin ich«, sagte ich und küsste sie.
»Sei vorsichtig!«, ermahnte sie mich.
»Nur, wenn du es auch bist«, gab ich zurück.
Sie lächelte flüchtig, wandte sich ab und verließ den Raum, als hielte sie es nicht länger aus. Es zerriss mir das Herz, sie so gehen zu sehen, ohne zu wissen, wann ich sie das nächste Mal wiedersehen würde – wenn überhaupt. Doch wenn ich rechtzeitig zurück im Hotel sein wollte, ohne Verdacht zu erregen, blieb mir nicht viel Zeit.
Wenigstens hatte ich sie im Arm gehalten und geküsst, wenn auch nur kurz. Das war all die Strapazen meiner Reise hierher wert gewesen.
Zwei junge Männer blieben mit mir zurück. Ich erwartete, dass sie mich auffordern würden, mich wieder in den Sarg zu legen, doch stattdessen drückte mir einer von ihnen einen Stoffbeutel in die Hand. Darin befand sich die Kleidung, die ich in der Toilette des Einkaufszentrums zurückgelassen hatte.
Nachdem ich mich umgezogen hatte, stülpte mir einer der Männer den Stoffbeutel über den Kopf, sodass ich nichts mehr sehen konnte. Dann führten sie mich zurück durch einen langen Raum oder Gang, anschließend wieder die Treppe hinauf und schließlich ins Freie. Kühle Luft empfing mich. Offenbar war die Sonne längst untergegangen.
Ein Wagen hielt neben uns, ich wurde hineingeschoben, und einer der Männer setzte sich neben mich. Wir fuhren eine Weile, bis der Wagen schließlich hielt. Mein Begleiter nahm mir den Stoffbeutel vom Kopf. Wir befanden uns in einem Industriegebiet, in dem um diese Zeit kaum jemand unterwegs war. Ein Wagen hielt neben unserem.
»Steig dort ein und halte den Kopf unten!«, wies mich der Mann an.
Ich gehorchte, setzte mich auf die Rückbank des neuen Wagens und duckte mich, sodass mich Passanten vom Straßenrand aus nicht sehen konnten.
Der Wagen fuhr los. Nach einer Viertelstunde hielt er an. Die Tür ging auf, ein Mann stieg ein und setzte sich neben mich.
»Unten bleiben!«, zischte er.
Der Wagen fuhr los. Ich riskierte einen vorsichtigen Blick und erkannte meinen Doppelgänger aus dem Einkaufszentrum. Nach ein paar Minuten hielten wir.
»Steig aus!«, sagte der Mann und duckte sich.
Ich richtete mich auf, kletterte aus dem Wagen und stellte fest, dass wir genau vor meinem Hotel gehalten hatten. Ohne mich umzudrehen, spazierte ich in die Lobby und fuhr hinauf in mein Zimmer.
3.
Die nächsten Tage waren qualvoll. Die meiste Zeit spazierte ich ohne Holobrille ziellos durch die Stadt. Wenn mich Keatons Leute überwachten, würde ihnen der Tag, an dem ich bei den Rebellen gewesen war und sie meinen Doppelgänger beobachtet hatten, zumindest nicht mehr so ungewöhnlich vorkommen.
Es fühlte sich schrecklich an, zu wissen, dass sich Adina in Gefahr brachte und ich nichts tun konnte, um ihr zu helfen. Immer wieder tadelte ich mich selbst dafür, dass ich die Rolle des Sprechers der Rebellen abgelehnt hatte. Hätte ich sie angenommen, wäre ich jetzt bei ihr und nicht zur Untätigkeit verdammt. Früher oder später würde Keaton ohnehin von Pandoras Existenz erfahren.
Je später, desto besser, versuchte ich meine Entscheidung vor mir selbst zu rechtfertigen. Jeder Tag, den Pandora im Verborgenen agieren und ihre Position stärken konnte, nützte der Rebellion. Doch das half nur wenig, um meine Frustration zu lindern.
Wenn ich von meinen Spaziergängen in mein Zimmer zurückkehrte, setzte ich sofort die Brille auf und hoffte auf eine Nachricht von Pandora, doch stattdessen blickte ich immer nur in das besorgte Gesicht meines Dschinns, der sich zunehmend aufführte wie ein eifersüchtiger Ehepartner und sich darüber beschwerte, dass ich ihn nicht an meinem Leben teilhaben ließ.
Als ich am Freitagnachmittag nach einem weiteren Stadtbummel ins Zimmer kam, begrüßte er mich nicht mit dem üblichen Gejammer. »Du hast eine Nachricht«, sagte er stattdessen.
Mein Herz schlug schneller. »Spiel sie ab!«, forderte ich ihn auf.
Eine attraktive junge Frau mit langen, dunklen Haaren erschien virtuell in meinem Zimmer.
»Mr Bartholomäus, mein Name ist Jenna Everett«, sagte sie. »Ich würde gerne mit Ihnen über die aktuelle Situation in Neopolis sprechen. Es wäre nett, wenn Sie mir einen Terminvorschlag für ein Interview machen könnten. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung!«
Sie lächelte, dann verschwand sie.
»Dschinn, wer ist Jenna Everett?«, fragte ich.
Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Holobloggerin, die sich mit investigativen Berichten einen Namen gemacht hatte. Mehrere Millionen Menschen folgten ihr. Sie hatte internationale Bekanntheit erlangt, als sie den Rücktritt eines erzkonservativen US-Senators provozierte. In der Öffentlichkeit hatte er sich stets lautstark für christliche Werte eingesetzt und alle Liebesbeziehungen herabgewürdigt, die nicht dem traditionellen Modell entsprachen. Jenna Everett hatte seine homosexuelle Liebesaffäre aufgedeckt und damit einen Skandal ausgelöst. Ein Holomagazin hatte ihr den ehrenvoll gemeinten Titel »Unbeliebteste Fragestellerin des Jahres« verliehen. Das weckte in mir nicht gerade die Lust, mit dieser Frau zu reden. Das Letzte, was Pandora und ich jetzt brauchten, war Publicity.
»Dschinn, lösche die Nachricht.«
»Wie du wünschst.«
Wenn ich geglaubt hatte, dass die Sache damit erledigt war, hatte ich mich getäuscht. Keine fünf Minuten später meldete mein Dschinn einen Anruf von Jenna Everett. Ich überlegte kurz, ob ich sie blockieren sollte, entschied mich dann aber dagegen. Denn eine Journalistin abzuweisen war vermutlich der beste Weg, um sie erst recht neugierig zu machen. Meine Hoffnung war, dass ich sie abwimmeln konnte, indem ich mich als äußerst uninteressanter Gesprächspartner geben würde.
»Gespräch annehmen.«
Wieder erschien die junge Frau virtuell in meinem Zimmer.
»Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, meine Fragen zu beantworten, Mr Bartholomäus«, sagte sie, als hätte ich bereits einem Interview zugestimmt, bloß weil ich das Gespräch angenommen hatte. »Ich habe versucht, Ihre Partnerin Adina Marini zu erreichen. Können Sie mir sagen, wo sie ist?«
»Adina Marini ist nicht mehr meine Partnerin«, erwiderte ich.
Sie zog eine Augenbraue hoch. »Nicht? Was ist denn geschehen?«
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.«
»Hat es etwas mit den Angriffen auf Neopolis zu tun?«
Ich zögerte einen Sekundenbruchteil. »Was für Angriffe?«
»Wollen Sie mir etwa erzählen, Sie hätten nicht mitbekommen, dass es in Neopolis vor Kurzem einen massiven Stromausfall gab, der die ganze Stadt lahmgelegt hat?«
»Doch, natürlich. Das war ein Angriff, sagen Sie? Von wem denn?«
»Genau das versuche ich herauszufinden.«
»Das würde mich wirklich auch interessieren.«
»Ich hatte gehofft, Sie könnten mir hierzu mehr erzählen.«
»Wie kommen Sie darauf? Was den Stromausfall betrifft, weiß ich nur, was darüber in den Holonews berichtet wurde – nämlich dass es sich um einen technischen Defekt handelte. Wie kommen Sie auf einen Angriff?«
Everett antwortete mit einer Gegenfrage: »Was ist mit Adina Marini?«
»Was soll mit ihr sein? Es stimmt, ich war eine Zeit lang mit ihr befreundet, aber wir haben uns getrennt. Wenn Sie darüber in Ihrem Klatschmagazin berichten wollen, tun Sie das von mir aus, aber ich werde Ihnen keine weiteren Details nennen, und ich bezweifle, dass Sie von Adina mehr erfahren werden.«
»Sie waren bis vor Kurzem Unternehmensberater bei der Firma Bowman & Hall, ist das korrekt?«
»Ja.«
»Warum sind Sie nicht mehr dort tätig?«
»Ich habe mir eine Auszeit genommen. Im Übrigen ist das meine Privatsache. Seien Sie mir bitte nicht böse, Ms Everett, aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Fragen nach meinem Privatleben zu beantworten. Dschinn, beende das Gespräch!«
Die virtuelle Figur verschwand. Halb erwartete ich, dass sie noch einmal anrufen würde, doch das geschah nicht. Sicher gab es noch mehr Leute in Neopolis, denen sie auf die Nerven gehen konnte. Erleichtert bestellte ich mir etwas zu essen, sah einen alten 2-D-Film an und ging ins Bett.
Am nächsten Tag bummelte ich wie üblich durch die Innenstadt, ohne wirklich wahrzunehmen, was um mich herum geschah. Stattdessen dachte ich über die verwirrenden Geschehnisse nach. Ich hatte immer noch Schwierigkeiten, alles, was ich erlebt hatte, unter einen Hut zu bringen. Erst die Sache mit dem Token und meine gespenstische Reise durch die unterirdische Hölle, von der ich immer noch nicht wusste, warum sie mit solchem Aufwand gebaut worden war. Dann meine verwirrenden Begegnungen mit Pandora, als ich zeitweise nicht mehr zwischen Wirklichkeit und virtueller Realität hatte unterscheiden können. Die KI hatte mir erklärt, dies seien Tests gewesen, um ihr Modell von mir zu verbessern. Ich sei eine Art moralischer Kompass für sie, an dem sie ihre Entscheidungen ausrichtete. Aber es kam mir immer noch merkwürdig vor, dass ausgerechnet ich dafür ausgewählt worden war.
Rynkovas Assistent hatte gemeint, ich sei so etwas wie die weiße Kugel im Billard. Wenn das eine zutreffende Analogie war, dann war Pandora zweifellos die beste Billardspielerin am Tisch. Was hatte sie vor? Wollte sie wirklich bloß den Rebellen helfen, um mehr Gerechtigkeit in der Stadt herzustellen? Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass es so war – immerhin hatte ich dafür gesorgt, dass sie nicht enttarnt und abgeschaltet worden war, indem ich im entscheidenden Moment den Mund gehalten hatte. Doch was, wenn es nicht so war? Welche Rolle spielte ich dann in diesem komplexen Spiel wirklich?
Ich dachte an meine Zeit in Berlin zurück, kurz vor der Abreise nach Neopolis. Es war mir damals so vorgekommen, als wäre mein Leben kompliziert gewesen – meine langjährige Liebesbeziehung war in die Brüche gegangen, mein Job mehr als wackelig, meine Zukunftsaussichten düster gewesen. Der Ausflug nach Neopolis zur Ultimate Survivor-Weltmeisterschaft hatte mich für einen Moment von meinen Schwierigkeiten ablenken sollen. Doch stattdessen war ich vom Regen in eine Traufe geraten, die so groß und tief war wie das Rote Meer.
Jetzt wünschte ich mir nichts sehnlicher, als nur die ganz normalen Alltagsprobleme eines mäßig talentierten Projektleiters in einer Berliner Spielefirma zu haben. Nein, das stimmte nicht ganz. Ich wünschte mir ein ganz normales Leben mit Adina an meiner Seite. Doch das war unmöglich. Wenn man sich mit einer außergewöhnlichen Frau wie ihr einließ, war Normalität das Letzte, das man erwarten durfte.
Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken: »Mr Bartholomäus?«
Ich zuckte zusammen und drehte mich um. Neben mir stand Jenna Everett und lächelte mich an, als freute sie sich, mich nach langer Zeit wiederzusehen. Wie es der Zufall wollte, befand ich mich gerade in der Straße, in der die Neopolis Gallery of Contemporary Art mit Adinas Ausstellung lag.
»Haben Sie mich etwa verfolgt?«, fragte ich.
Sie machte eine Unschuldsmiene. »Sie verfolgt? Wie kommen Sie denn darauf? Aber wo ich Sie schon einmal hier treffe, würde ich gerne noch ein wenig mit Ihnen reden.«
»Ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen erzählen könnte, Ms Everett.«
»Nennen Sie mich Jenna, bitte. Ich verstehe Ihr Misstrauen, Nick. Aber glauben Sie mir, ich möchte Ihre Ex-Freundin nicht in den Schmutz ziehen. Im Gegenteil, ich bewundere ihr Engagement für die Unterdrückten in dieser Stadt.« Sie deutete auf das Gebäude mit der Galerie. »Ich habe mir ihre Ausstellung angesehen. Wirklich eindrucksvoll! Vor allem ihre subtilen Seitenhiebe gegen die Shareholder. Ich kann mir vorstellen, dass Aron Keaton dumm geguckt hat, als er die Ausstellung während der Vernissage gesehen hat. Noch dazu, da der König selbst anwesend war.«





























