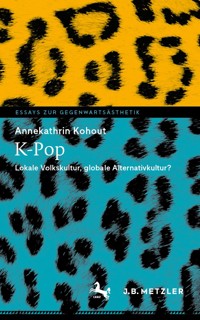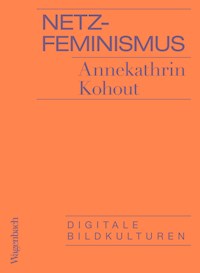
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rosafarbene Slips, babyblau gefärbtes Achselhaar, Schmollmünder auf Selfies: Was sich nach Männerphantasien anhört, ist bei Netzkünstlerinnen feministisches Statement. Sie betreten damit den Kampfplatz um das »richtige« Bild der Frau, das in den Sozialen Medien nicht nur metaphorisch zur Debatte steht. Handelt eine Frau emanzipatorisch, wenn sie sich beim Stillen zeigt – oder reduziert sie damit sich selbst und andere Frauen auf die Mutterrolle? Bestätigt ein "Girl Power"-T-Shirt die Rolle des naiven kleinen Mädchens – oder stellt es sie infrage? Die Medienwissenschaftlerin Annekathrin Kohout hat eine ebenso kurze wie prägnante Kultur- und Diskursgeschichte der weiblichen Bildpolitik verfasst, die von den Emanzipationsbewegungen im frühen 20. Jahrhundert bis zum netzfeministischen Bilderstreit der Gegenwart alle wesentlichen Phänomene weiblicher Bildpolitik in den Blick nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIGITALE BILDKULTUREN
Durch die Digitalisierung haben Bilder einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Dass sie sich einfacher und variabler denn je herstellen und so schnell wie nie verbreiten und teilen lassen, führt nicht nur zur vielbeschworenen »Bilderflut«, sondern verleiht Bildern auch zusätzliche Funktionen. Erstmals können sich Menschen mit Bildern genauso selbstverständlich austauschen wie mit gesprochener oder geschriebener Sprache. Der schon vor Jahren proklamierte »Iconic Turn« ist Realität geworden.
Die Reihe DIGITALE BILDKULTUREN widmet sich den wichtigsten neuen Formen und Verwendungsweisen von Bildern und ordnet sie kulturgeschichtlich ein. Selfies, Meme, Fake-Bilder oder Bildproteste haben Vorläufer in der analogen Welt. Doch konnten sie nur aus der Logik und Infrastruktur der digitalen Medien heraus entstehen. Nun geht es darum, Kriterien für den Umgang mit diesen Bildphänomenen zu finden und ästhetische, kulturelle sowie soziopolitische Zusammenhänge herzustellen.
Die Bände der Reihe werden ergänzt durch die Website www.digitale-bildkulturen.de. Dort wird weiterführendes und jeweils aktualisiertes Material zu den einzelnen Bildphänomenen gesammelt und ein Glossar zu den Schlüsselbegriffen der DIGITALEN BILDKULTUREN bereitgestellt.
Herausgegeben von
Annekathrin Kohout und Wolfgang Ullrich
#brelfie vs. #bressure: Ein Bilderstreit im Social Web
Kaum wurde das Foto auf Instagram hochgeladen, schon hatten es die Nutzer*innen zum Symbolbild erklärt und als Ausdruck eigener Wünsche und Empfindungen verwendet. »Ich als Mutter.«, »Ikonisch!«, »Herausforderungen einer Mama«, »Wenn ich mal ein Kind bekomme…«, »Legendär!«, »Eine echte Inspiration!« lauteten erste euphorische Kommentare. Auf dem im Dezember 2013 veröffentlichten Foto sieht man Supermodel Gisele Bündchen im weißen Bademantel und mit übereinandergeschlagenen Beinen. (# 1) Sie hat den Kopf leicht nach hinten geneigt, die Augen sind geschlossen, denn ein Make-up-Artist macht sich gerade an ihrem Lidstrich zu schaffen. Zwei andere Stylisten wenden sich ihren Nägeln und ihren Haaren zu, im Schoß der Umringten liegt ihr Baby Vivian, das gerade gestillt wird. Doch auch Bündchens Tochter ernährt sich eher passiv und spielt mit der Kette ihrer Mutter, während sie an deren Brust saugt.
# 1
Die Beiläufigkeit, mit der sich Bündchen für ein Shooting zurechtmachen lässt und mit der ihr Baby trinkt, suggeriert Alltäglichkeit. Hier wurde – so die Aussage des Bildes – nicht viel gestellt, sondern genauso sieht eine berufstätige Mutter aus. Ja, so sieht eine Frau aus, die ihren Job keinesfalls aufgeben muss, nur weil sie ein Kind bekommen hat, selbst dann nicht, wenn der eigene Körper das Arbeitsmittel ist. Es ist demnach ein »Alles-ist-möglich«– oder »Lebe-Deinen-Traum«-Bild und soll ermutigend wirken. Wer unsicher ist, ob sich Karriere mit Mutterschaft vereinbaren lässt, dem antwortet das Bild mit einem entschiedenen ›ja‹.
Es überrascht daher nicht, dass es in den folgenden Jahren immer wieder Nachahmer*innen fand oder persifliert wurde, auch von prominenten Kolleginnen wie Alyssa Milano oder Tess Holliday. 2014 avancierte es zum Aufmacherbild einer Kampagne in den Sozialen Medien, die sich gegen Bestimmungen von Facebook richtete, wonach Bilder stillender Frauen gelöscht werden. Die Beteiligten, feministisch motiviert, interpretierten die Löschung als Tabuisierung stillender Frauen im öffentlichen Raum, auch wenn sie von der Plattform nur deshalb entfernt wurden, weil Bilder von Nacktheit dort generell nicht erlaubt sind. 2015 etablierte sich schließlich der Hashtag #normalizebreastfeeding und dann die verkürzte Version #brelfie, unter der zahlreiche Frauen ›Selfies‹ beim ›Breastfeeding‹ veröffentlichten. Als auf dem Cover der australischen Modezeitschrift Elle im Juni 2015 das Supermodel Nicole Trunfio beim Stillen abgebildet wurde, schien die in den Sozialen Medien initiierte Bewegung ihrem Ziel, öffentliches Stillen zu normalisieren, näher gekommen zu sein. Sosehr einige Betrachterinnen von dem Bild inspiriert waren und sich begeistert mit der berufstätigen Mutter identifizierten, so viele – ihrerseits feministisch motivierte – Kritiker*innen rief es auf den Plan. Richteten sich diese zunächst gegen die privilegierte Situation eines superreichen Topmodels, das sich genügend Unterstützung bei Arbeit wie Kindererziehung leisten kann und demnach unrealistische Vorstellungen einer berufstätigen Mutter vermitteln würde, fühlten sich schließlich auch jene ›diskriminiert‹ (so die in zahlreichen journalistischen Beiträgen verwendete Formulierung), die aus gesundheitlichen Gründen nicht stillen können oder nicht stillen wollen. Für sie seien derartige Bilder ein Affront, wiesen sie die Betroffenen doch auf ihre körperlichen oder moralischen Schwächen hin: Gilt eine stillende Mutter nicht als liebe- und hingebungsvoller, das Stillen selbst nicht als gesünder?
Unter dem Hashtag #bressure – ähnlich wie bei ›brelfie‹ ein Wortspiel, diesmal aus ›breastfeed‹ (Stillen) und ›pressure‹ (Druck) – initiierten betroffene Mütter eine Gegenaktion, mit der sie auf ihr Beschämtsein aufmerksam machten sowie unrealistische Vorstellungen vom Stillen anprangerten. Während sich die #brelfie-Kampagne aus der Dokumentation der Sache selbst, aus dem fotografisch festgehaltenen Augenblick des Stillens ergab, musste für die #bressure-Aktion erst ein Bildprogramm entwickelt werden, das zum Nach- und Mitmachen motiviert. Mit diesem Ziel organisierte der Instagram-Account »Channel Mum« eine Selfie-Protestaktion und leitete Frauen dazu an, auf einem weißen Blatt Papier (mit dem Logo der Community) in einem Wort zu beschreiben, wie sich das Stillen ›wirklich‹ anfühlt, um anschließend damit für ein Bild zu posieren. Von ›befriedigend‹ bis ›quälend‹ wurden sehr unterschiedliche Emotionen versammelt, und anders als die ›Brelfies‹ wurden sie nicht (überwiegend) mit Humor, sondern mit großer Ernsthaftigkeit vermittelt. (# 2) Dieser Ernst kam nicht zuletzt wegen des Bildmotivs zustande, das an die Ästhetik von Demonstrationen erinnerte, bei denen ebenfalls Schilder mit Statements ein wichtiges Ausdrucksmittel sind.
Damit wurden die soeben noch als inspirierend wahrgenommenen ›Brelfies‹ zum Politikum; ein Kampf um das, was gezeigt werden soll und was nicht gezeigt werden darf – ein Streit um das ›richtige‹ Bild der Mutter, der Frau, der Weiblichkeit im Allgemeinen brach aus. Verschiedene Auffassungen von Feminismus gerieten in einen offenen Konflikt miteinander. Solche Auseinandersetzungen haben heute vornehmlich in den Sozialen Netzwerken ihren Ort. Dabei werden längst etablierte feministische Diskurse – und das ist historisch neu – mehr denn je mithilfe von Bildern anstatt von Texten oder gar Manifesten fortgeführt.
# 2
Wenn vom Netzfeminismus die Rede ist, muss, wie auch beim Feminismus, immer von einem Plural gesprochen werden: von (Netz-)Feminismen. Dass es unterschiedliche und nicht klar voneinander abzugrenzende Feminismen gibt, liegt daran, dass sie sich einerseits in verschiedenen historischen Kontexten, andererseits in verschiedenen Gesellschaften herausgebildet haben. Zudem stoßen in der globalisierten Netzkultur stärker als bisher verschiedene Feminismen aufeinander, die sich nicht nur auf unterschiedliche Geschlechterkonzepte, sondern auch auf verschiedene gesellschaftliche Grundfragen und Theorien beziehen.1 Dadurch werden globale Netzaktionen anfälliger für inhaltliche Widersprüche oder unauflösbare Kontroversen, wie beispielsweise die #metoo-Kampagne, an der, ausgehend von den USA, weltweit partizipiert wurde. Im Zuge dieses Hashtags hatten sich vor allem Diskussionen darüber entzündet, was als sexueller Missbrauch gilt: neben Übergriffen wurden auch von manchen als sexistisch empfundene Komplimente mit #metoo verschlagwortet.
Je nach Kultur, Milieu, Situation kann ein Kompliment mehr oder weniger als sexueller Missbrauch gedeutet werden. Für viele Kritiker*innen waren und sind diese Erfahrungen jedoch nicht mit strafbaren Handlungen gleichzusetzen.
Netzfeminismus ist daher inhaltlich kaum konkret zu definieren. Deshalb soll im Folgenden die Form, oder besser: das Werkzeug, mit dem feministische Anliegen kommuniziert oder sogar praktisch umgesetzt werden, in den Mittelpunkt rücken. Mit dem Netzfeminismus assoziiert man häufig vor allem schriftliche Äußerungen und Aktionen (abwertend »Hashtag-Feminismus«2 genannt), doch formulieren Aktivistinnen ihre Haltung mittlerweile ebenso oft mit Bildern und Videos. Eine feministische Bildpolitik ist in dieser Form erst durch die Sozialen Medien möglich geworden, obwohl es im Bereich der Kunst Vorläufer gegeben hat. Was aber können visuelle Medien politisch leisten?
#visibilitymatters: Kampf um Sichtbarkeit
Wie beim ›Brelfie‹ geht es vielen (feministischen) Social-Media-Aktionen oder Hashtags gezielt um Sichtbarmachung und Repräsentation. Was bisher noch nicht oder nur in idealisierter Gestalt in den Massenmedien vertreten ist, seien es das Stillen oder – ein anderes Beispiel – vom Ideal abweichende Körperformen und Hautfarben, soll in der gesamten Breite seiner Existenz sichtbar gemacht werden. Für viele Menschen bieten die Sozialen Medien in dieser Hinsicht bisher nicht gekannte Möglichkeiten. Zuvor waren es vor allem Vertreter der etablierten Medien, die darüber bestimmten, was in der Öffentlichkeit Präsenz erlangte. Heute wird der Kampf um Sichtbarkeit und Repräsentation, wird also Bildpolitik vor allem im Social Web ausgetragen. So artikulieren sich hier oftmals Milieus und Randgruppen, die nicht selbstverständlicher Teil der medialen Öffentlichkeit sind und die nicht den gesellschaftlichen Idealen entsprechen. Dies ist besonders für feministische Themen maßgeblich: Welche Rolle spielen schwarze und weiße Frauen, Männer und Transgender in der Gesellschaft, der Familie, in Beziehungen? Wie sehen Geschlechterklischees gegenwärtig aus – und wie kann man mit neuen Bildern zu ihrer Überwindung beitragen?
#penisneid: Das ›Loch‹ als Sprachbild der Unsichtbarkeit
Fehlende Sichtbarkeit ist vor allem im metaphorischen Sinne ein tief im Feminismus verankertes Thema. Denn nichts Geringeres als die Beschreibung des weiblichen Geschlechts als ›Loch‹ und Leerstelle – die im Gegensatz zum männlichen Geschlechtsorgan nicht sofort sichtbar sei – diente der Begründung und Legitimation männlicher (phallozentrischer) und patriarchaler Dominanz. Populär wurde die Vorstellung vom weiblichen Geschlecht als ›Loch‹ bekanntlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts: In den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie spricht Sigmund Freud 1915 vom »verlorengegangenen Penis des Weibes«,3 womit er dem weiblichen Geschlecht, insbesondere der Vulva, die Existenz und eigene, gleichermaßen äußerlich sichtbare Formen absprach sowie einen anatomischen Mangel konstatierte. Doch Freud ging noch weiter und attestierte Mädchen den vielzitierten »Penisneid«,4 der einer Kompensation bedürfe. Diese erkannte er in den fetischisierten Schönheitspraktiken der Frau.
Die Vorstellung vom fehlenden Geschlecht – vom Loch – wurde bei Feminist*innen zwar zur Metapher für die Grundsätzliche Unsichtbarkeit von Frauen in vielen öffentlichen und gesellschaftlichen Bereichen, lange Zeit aber brachten sie keine expliziten Gegenbilder oder alternative Metaphern hervor.