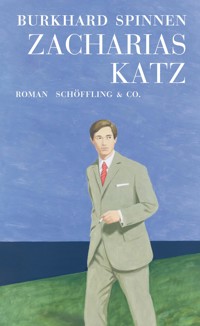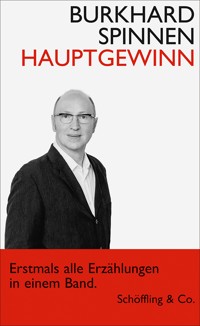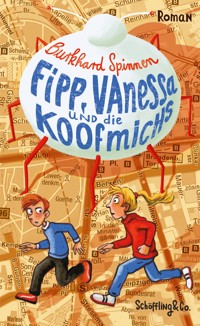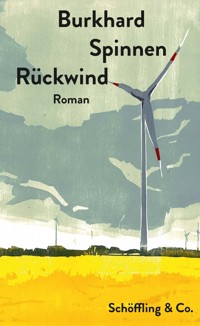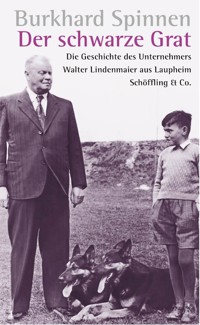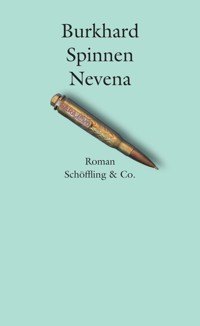
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henner hat seinen Sohn an ein Internet-Computerspiel verloren. Jedenfalls denkt er das manchmal. Patrick, siebzehn Jahre alt, sieht das völlig anders. Seit Monaten verbringt er als die Zornelfe Pocahonta jede freie Minute mit Mr. Smith, dem Barbar. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Und vielleicht sogar mehr.Denn Mr. Smith ist Nevena, ein siebzehnjähriges Mädchen, das angeblich in Belgrad lebt. Sie ist ebenso quirlig wie nachdenklich, dazu der Kummerkasten und der gute Geist ihrer leicht verrückten Großfamilie. In immer neuen Mails schildert sie ihre Welt aus Betriebsamkeit und Miteinander, eine Welt, die für Patrick mit dem Tod seiner Mutter untergegangen ist.Als Nevena von einem Tag auf den anderen aus dem Spiel und aus dem Netz verschwindet, ist Patrick verzweifelt. Über die wirkliche Nevena weiß er nur wenig, er kennt nicht einmal ihre Adresse. Da bietet ihm Henner an, Nevena gemeinsam zu suchen. Im Wohnmobil der verstorbenen Mutter beginnen sie eine Reise, die sie durch die schreckliche Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens führt und unversehens eine spannende Reise zur eigenen Identität wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Titel
Nevena
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Dank
Impressum
Kurzbeschreibung
Autorenporträt
Nevena
1. Kapitel
Patrick loggt sich ein. Als Erstes wird seine Figur sichtbar, dann bauen sich um ihn herum sehr langsam die Häuser und Straßen von Themara auf. Das Warten nervt, aber Patrick wohnt gerne in der Hauptstadt, auch wenn sein PC dafür ganz schön arbeiten muss. Er fühlt sich wohl im Herzen der Spielwelt. In Themara gibt es alles zu kaufen, was Pocahonta, seine Zornelfenzauberin, für ihre Reisen in die entlegenen Territorien braucht. Hier kann sie ihren Drachen unterstellen, hier gibt es die Läden, in denen man ihre komplizierten Heilzauber mixt. Allerdings bilden sich in Themara auch die großen Schlachtzuggruppen, zu denen sich Dutzende von Spielern zusammenschließen, um besonders schwierige Aufgaben zu lösen. Deshalb ist Patrick hier nicht allein, im Gegenteil, er muss sich die Stadt zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Hunderten anderer Spieler teilen. Kein Wunder also, dass sein Computer so viel zu tun hat. Schon nach zwei, drei Minuten schaltet sich der zusätzliche Lüfter ein.
Nevena sagt, dass Patricks Vorliebe für die Metropole ein Fehler sei. Sie selbst hat sich eine andere Heimat gesucht, die Stadt D’ub am Rande der Terrakonischen Wüste. Die ist zwar deutlich kleiner und hat nur bescheidene Läden, dafür ist sie nicht so überlaufen. Das sei besser für ihre serbische Grafikkarte, hat sie einmal gesagt. Und dann hat sie noch gesagt: »You get lost in the city, Patti-Baby.« Provinz hingegen bedeute Identität. Am letzten Satz hing der Zwinkersmiley, den nur Nevena benutzt. Sie hat ihn selbst gezeichnet, ein gutmütiger einäugiger Pirat.
Die Computerwelt ist noch immer im Aufbau, da blinkt schon eine Chatnachricht. Natürlich stammt sie von Nevena; sie lässt sich automatisch melden, wenn Patrick sich einloggt. Er stellt sich dann immer vor, dass in ihrem Haus eine alte Klingel rasselt, die nur mit ihren elektrischen Drähten an der Wand hängt. Das ist natürlich Unsinn. Patrick hat keine Ahnung davon, wie es bei Nevena zu Hause aussieht.
Die beiden haben sich auf einem der großen internationalen Server kennengelernt. Man trifft hier die interessanteren Leute, also die besseren Spieler. Ein Zufallsgenerator hatte sie in dieselbe Schlachtzuggruppe gesteckt, und die wurde allmählich so überschaubar, dass man miteinander ins Reden kam. Die Umgangssprache ist natürlich Englisch. »Hi, Patti«, schreibt Nevena jetzt. »See you in Hell’s Gate Mountains. Waiting for you at Sunsnapper’s Point! Hurry!«
Die Höllentorberge sind eine felsige Einöde, die aus einer der frühen Programmierphasen des Spiels stammt. Es ist eines dieser alten Länder, die längst aus der Mode gekommen sind. Als einzige Attraktion gibt es dort mehrere Niederlassungen einer besonderen Rasse von computergesteuerten Orks, die mit den spielbaren Orks auf Kriegsfuß steht.
Patrick wundert sich. Die Höllentorberge sind zwar nicht weit von Nevenas Wahlheimat entfernt, aber die Anforderungen für dieses Gebiet liegen weit unter dem Level seiner Zauberin, immerhin stattliche 56. Was soll einer wie er dort tun? Man kann wehrlose Wildschweine jagen, ein paar langweilige Kräuter sammeln oder sich mit den ungelenken Orks herumprügeln. Aber es gibt nichts, was seine Figur weiter aufsteigen ließe: keine seltenen Pflanzen, keine Bodenschätze,keine wertvollen Artefakte. Dennoch holt Patrick sofort seinen Flugdrachen aus dem Stall. Auf Nevena ist immer Verlass. Womöglich hat sie ausgerechnet in dieser Pixelwalachei eine lohnende Quest aufgetan.
Quests, das sind eigentlich nur Aufgaben. Aber Quest klingt cooler als Aufgabe, und auch cooler als Task, Mission oder Job. Es gibt unendlich viele von diesen Aufgaben, und sie bestimmen das Leben fast aller Spieler. Kaum einer treibt sich bloß so in der Spielwelt herum, die allermeisten sind vielmehr auf einer Quest, so wie man außerhalb des Spiels in der Schule oder bei der Arbeit ist. Für eine erfüllte Quest gibt es eine Belohnung; Ausrüstungsstücke, Kleidung, Waffen. Man steigt im Rang, oder man darf hoffen, es demnächst zu tun. So einfach ist das.
Oft allerdings besteht die Belohnung darin, dass man gleicheine neue Quest bekommt. Einmal sollte Patrick ein gut behütetes Artefakt besorgen. Zwei Tage hatte er gebraucht, es ausfindig zu machen, zwei weitere Tage, um es dem Dämon, der es bewachte, zu stibitzen. Doch kaum hatte er das erledigt, bat ihn der freundliche Troll, der als Questgeber fungierte, das Teil doch bitte auf einem speziellen Opferaltar zu vernichten. Sehr komisch! Unter den Leuten, die das Spiel konstruieren, müssen etliche mit schrägem Humor sein.
Manchmal reihen sich solche Quests zu Geschichten, ähnlich wie die in den Fantasyromanen. Sie haben dann regelrecht Anfang, Mitte und Ende. Wenn man will, kann man sich wie ein Held fühlen, wie einer, der dauernd verzweifeln möchte, weil alles gegen ihn ist, der aber Mut besitzt und am Ende etwas Großes leistet. Leider ist das die Ausnahme. Meistens rennt man bloß von hier nach da und von da nach dort und wieder zurück, wie der Laufjunge vom Botendienst. Oder man schlägt sich mit mehr oder weniger interessanten Gegnern. Man könnte das langweilig finden; doch solange das Questen die einzige Möglichkeit ist, ein höheres Level zu erreichen, kommt man nicht darum herum.
WENN DAS TOR AUFGEHT, aktiviert es den Bewegungsmelder. Die zwei Leuchten flackern ein paar Sekunden, dann ist alles hell. Henner wartet so lange, dann fährt er vorsichtig in die Garage. Über einen Punkt am unteren Rand der Windschutzscheibe peilt er die Markierung auf der hinteren Wand an. Nur wenn er seinen Kombi so eng wie eben möglich und leicht schräg neben das Wohnmobil setzt, bekommt er die Fahrertür weit genug auf; dann kann er ohne Verrenkungen aus dem Wagen steigen.
Henner schließt den Kombi ab, was ihm, wie immer, überflüssig erscheint. Dann überlegt er wieder, ob er die Garage nicht verlassen und das Haus durch die Tür betreten soll, so wie er das früher getan hat. Tür aufschließen, Tür öffnen, eintreten. Den Schlüssel in die kleine Holzschale auf der Ablage über dem Heizkörper legen. Und dann diesen Satz rufen, über den er jedes Mal stolperte: »Ich bin’s!«
»Ich bin’s.« Natürlich. Wer sollte man sonst sein?
Aber der Satz funktionierte ja. Und wenn, wie meistens, jemand zu Hause war, denn Henner kam oft spät, dann antwortete auch keiner: »Wer ist das, ich?« Nein, dann kam ihm Astrid aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche entgegen, oder Patrick beugte sich über das Geländer im ersten Stock, und schon begannen sie, einander dies und das zu fragen.
Das Garagentor hat sich automatisch geschlossen, das Licht geht wieder aus. Die Stromphase des Bewegungsmelders ist sehr kurz eingestellt. Henner hebt eine Hand und winkt, augenblicklich ist es wieder hell. An der Stirnwand der Garage führt eine Wendeltreppe nach oben in sein Studio. Es war die engste Treppe, die sie einbauen durften, ohne gegen die Bauvorschriften zu verstoßen. Man kann auf ihr nicht fallen, man steckt darin wie in einem Schlauch. Spätestens wenn man auf der siebten Stufe ist, geht automatisch das Licht im Studio an.
Der Zugang von der Treppe zum Studio ist offen. Der Raum nimmt fast die ganze Fläche der Garage ein, etwa sechs an acht Meter. Nur zum Garten hin springt der Aufbau ein wenig zurück. So lässt sich die Glastür inmitten der rückwärtigen Fensterfront nach außen öffnen. Der Balkon dahinter ist allerdings so schmal, dass gerade mal ein Stuhl darauf Platz hat. Der Garten liegt nach Norden; das ist eigentlich ein Nachteil, doch Henners Arbeit kommt es entgegen. An den Werkbänken rechts und links von der Balkontür hat er immer gleichmäßiges und niemals grelles Licht.
Er stellt seine Tasche ab. Gleich neben der Wendeltreppe führt eine Tür durch die Außenwand ins Haus. Henner öffnet sie und lauscht. Dann tritt er die zwei Stufen hinab in den oberen Flur. Im Zimmer rechts hat Patrick gelebt, fünfzehn Jahre lang, bis zu dem Tag, als Astrid zum letzten Mal aus dem Krankenhaus kam. Er ist dann unters Dach gezogen, in Henners alten Arbeitsraum, der seit dem Bau des Studios leer stand. Und dort ist er auch geblieben.
Gleich links führt die Treppe hinunter ins Parterre. Dort unten im Flur klirrt immer, wenn man eine Tür schließt, die lockere Scheibe in der alten Kommode. Eine neue Leiste würde das abstellen, aber Henner hat sich noch nicht dazu aufgerafft.
Er hält die Luft an. Wie immer braucht er ein paar Sekunden, bis er es hört: das Geräusch des Spiels. Seit Astrids Maschinen abgestellt sind, ist es das Geräusch des Hauses. Aber es ist sehr leise, und er muss sich jedes Mal anstrengen, um es überhaupt wahrzunehmen. Das Geräusch ist aus ganz Verschiedenem gemischt; aus einer Hintergrundmusik, die beständig etwas anzukündigen scheint, aus Naturlauten wie Wind oder Grillengezirpe, aus dem Klang, mit dem Metall auf Metall schlägt. Eine Filmszene könnte so unterlegt sein. Aber im Film würden die Geräusche wechseln, die Musik würde anschwellen oder aussetzen. Das Spielgeräusch hingegen ändert sich nie. Es ist, als stände man im Freibad am Beckenrand, wo hundert Geräusche zu einem einzigen verschmelzen, das ganz präsent und unverwechselbar ist, aber ohne Botschaft.
Jetzt hört er es. Patrick stellt die Lautsprecher an seinem PC noch immer so leise wie früher, als sie nie wussten, ob Astrid wach lag oder schlief. In ihrem letzten Jahr zu Hause schlief sie zu ganz verschiedenen Tages- und Nachtzeiten. Sie kannte keinen Rhythmus mehr. Je nachdem, wie sehr sie kämpfen musste, um zusammen mit ihren Maschinen zu atmen und ihr Herz in Bewegung zu halten, wachte oder schlief sie. Sie schlafe gerne, sagte sie. Albträume habe sie nie.
Doch wenn sie wach war und sich um jeden Atemzug und jeden Herzschlag mühte, hatte sie Angst vor dem Tod. Sie wünschte sich dann Gesellschaft, aber sie rief nur selten. Eigentlich rief sie nur, wenn sie etwas Konkretes brauchte, eine Hilfestellung, eine Veränderung an den Geräten oder ein Medikament. Und immer zögerte sie mit dem Rufen. Denn oft wurde ihr ganz plötzlich alles wieder leicht, das Herz schlug von selbst, und dann schlief sie meistens ein. Manchmal, sagte sie, schlafe sie ein, wenn sie sich gerade entschieden habe zu rufen. Deshalb zögere sie damit. Allerdings war ihr Schlaf sehr leicht. Betrat man ihr Zimmer, ohne dass sie gerufen hatte, lief man daher immer Gefahr, sie zu wecken.
Das Schlafzimmer liegt jenseits der Treppe und steht jetzt leer. Um Astrid dort pflegen zu können, mussten sie alle Möbel herausschaffen. Das Spezialbett stand in der Mitte des Raumes, rundherum war Platz für die Apparate. Kurz bevor alles geliefert wurde, hatte Henner das Zimmer noch neu gestrichen, in einem warmen Gelbton.
»Ah!«, sagte Astrid, als die Träger sie ins Zimmer brachten. Das also sei das Letzte, was sie sehen werde von dieser Welt, so eine fette Farbe. Vielleicht sei ihr letztes Wort dann Sonne. Oder Butterblume. Oder nur: Gelb?
Henner hatte damals nichts gesagt. In gewisser Weise war er vorbereitet, im Hospiz hatte er einen Kurs für Angehörige besucht. Ja, hatte es dort geheißen, man könne einem Sterbenden durchaus helfen. Aber man könne es ihm nicht recht machen. Das dürfe man nie vergessen. Es ihm recht zu machen, hieße ihn gesund zu machen. Eine ältere Frau war in Tränen ausgebrochen. Henner wäre beinahe aufgestanden und gegangen. Später begriff er, dass die Hospizleute recht hatten, auch wenn sie nie die richtigen Worte fanden.
Gleich neben dem Schlafzimmer liegt Astrids Arbeitszimmer, der kleinste Raum im ersten Stock. Als endgültig feststand, dass sie nie wieder arbeiten würde, kam jemand von der Schule und holte ab, was sie ausgeliehen hatte. Das war zwei Jahre vor ihrem Tod; danach hat Henner lange nichts angerührt. Erst vor ein paar Monaten hat er alle Bücher und Papiere in Kartons verpackt und das Zimmer gründlich geputzt. Jetzt sieht es aus wie der Raum einer Tochter, die in Übersee studiert und nicht einmal mehr zu Weihnachten nach Hause kommt.
Er ist schon auf der Treppe nach unten, da macht Henner wieder kehrt. Er hat gar keinen Hunger. Wenn er sich jetzt in der Küche ein paar Brote schmieren und sie mit ins Studio nehmen würde, dann nur, weil er das früher so gern getan hat. Noch schöner war es allerdings, wenn Astrid ihm unaufgefordert etwas zu essen brachte. So als wäre er ein alter Handwerksmeister und sein Studio die Werkstatt, in der er das Geld für die Familie verdient. Und als wäre sie die Meisterin, die sich ums Haus und um die vielen Kinder und Gesellen kümmert. Im Studio schließt Henner die Tür hinter sich. Es ist noch hell draußen, und das will er nutzen.
Auf der Werkbank steht ein hölzerner Schreibkasten, wahrscheinlich spätes 18. Jahrhundert. Gewissermaßen die Urform des Laptops, hatte Henner zu Patrick gesagt. Sie trafen sich zufällig im Flur, als der Postbote das Paket brachte. Man verwahrte damals Papiere, Tinte und Feder in solchen Kästen. Dann baute man sie auf und hatte überall einen Platz zum Schreiben. Henner hatte es demonstriert.
Patrick war mit einem Glas Orangensaft in der Hand auf dem Weg in sein Zimmer. »Ja, cool.« Mehr hatte er nicht gesagt. Ein kurzer Blick auf den abgestoßenen und fleckigen Kasten, dann war er schon wieder auf der Treppe.
Früher hat Henner ganze Tage auf Flohmärkten verbracht, um nach solchen Stücken zu suchen, aber diese Zeiten sind vorbei. Heute bieten die Leute alles, was sie für halbwegs wertvoll halten, lieber im Internet an. Henner hat sich umgestellt. Er kauft jetzt im Netz, was auf den Fotos so beschädigt aussieht, dass niemand sonst es will. Auch der Schreibkasten hat nicht viel gekostet. An mehreren Stellen ist Tinte ins Holz gezogen; und wie soll man die wieder herausbringen?
Henner weiß, wie. Essigessenz, Salmiakgeist und Wasserstoffperoxyd stehen bereit. Er zieht einen Arbeitskittel an, dann testet er jedes Mittel an einer möglichst unauffälligen Stelle, in sehr kleinen Mengen, um den Vorgang kontrollieren zu können. Zwischen jedem neuen Versuch muss er lange warten. Darüber wird es dunkel, er schaltet das Licht über den Werkbänken ein. Es sind zwei Reihen kräftiger Leuchtstoffröhren, die ein warmes Licht geben. Was für ein großartiger Arbeitsplatz das hier ist, denkt Henner. Und was für ein lausiges Leben.
AM SONNENHÄSCHERSTÜTZPUNKT ist Nevena nirgends zu finden. Patrick schreibt ihr eine kurze Nachricht und erhält als Antwort kommentarlos das offizielle Gruppenformular. Das ist wieder eine dieser langweiligen Routinen. Verfolgt man nämlich zu mehreren ein Quest-Ziel, so bekommt nur einer die Belohnung, auch wenn alle geholfen haben. Nur wenn man eine offizielle Kleingruppe bildet, wird die Beute geteilt; man kann einander dann auch über die Landkarte orten.
Im Spieljargon heißen die Kleingruppen Dungeonteams. Sie sind überhaupt nicht beliebt, schon weil beim Teilen der Beute manchmal das Meiste verloren geht. Patrick findet nur den Ausdruck grässlich. Keine Sorge, hat Nevena einmal gesagt, wir sind kein Team; wir sind siamesische Zwillinge. Tatsächlich sind die beiden seit Monaten fast nur noch als Dungeonteam unterwegs.
An dem blinkenden Punkt auf der Karte sieht Patrick, dass Nevena bereits unterwegs ist. »Sorry, honey«, schreibt sie. »I’ve already started.« Die erste Aufgabe sei sowieso nur ein simpler Botendienst, wenngleich über Langstrecke. »Miles and more.« Zwinkersmiley. Aber am Ende warte eine echte Überraschung!
Patrick zieht nach. Vom Questgeber, einem ungehobelten Ork, lässt er sich ebenfalls mit einer Botschaft losschicken. Dann besteigt er wieder seinen Flugdrachen und gibt dem Tier die Richtung an. Wie jedes Mal beschwert sich der Drache, indem er seinen Kopf am Ende des langen Halses schüttelt, doch dann spreizt er seine nackten Flügel und hebt mühelos vom Boden ab.
Patrick arretiert die Flugtaste. Und während seine Zauberin knapp über den Spitzen der höchsten Bäume dahinrauscht, holt er sich aus der Küche ein Glas Orangensaft. Die Spielwelt wird beständig größer, da werden die Reisezeiten entsprechend länger. Anfangs hat Patrick bei solchen Flügen noch die aufwändig programmierten Landschaften studiert, aber mittlerweile kennt er auf den üblichen Reiserouten jeden Pixel.
Als er an seinen Computer zurückkehrt, ist der Drache bereits ein wenig über ihr Ziel hinausgeflogen. Patrick korrigiert den Kurs und trinkt dann den ersten eiskalten Schluck, auf den er sich zwei Treppen lang gefreut hat. Nevena hat eine weitere Nachricht geschrieben. Da er ja offensichtlich nicht an der Tastatur sitze, sondern vermutlich menschliche Bedürfnisse befriedige, werde sie schon mal weitermachen. »See you!«, schreibt sie.
Das erste Ziel ist eine kleine Stadt am Meer. Dort gelandet, bekommt Patrick von einem Zombie den nächsten Teil der Aufgabe. Aha! Es geht zurück nach Themara. Patrick verdreht die Augen. Warum in aller Welt lässt sich Nevena dermaßen herumscheuchen? Natürlich ist sie längst wieder auf und davon, und so macht sich auch Patrick auf dem schnellsten Weg zurück in die Hauptstadt. Wenigstens muss er dazu nicht den Drachen nehmen. Seit ihrer vorletzten Quest besitzt er nämlich einen Ruhestein. Den kann er alle halbe Stunde einmal verwenden, um sich zusammen mit seinem Flugtier in seine Heimatstadt zu teleportieren. Es reicht jetzt ein Klick auf das Icon; und während seine Zornelfe mit den üblichen Gesten den Zauber vorbereitet, trinkt Patrick den zweiten Schluck Orangensaft. Leider ist der schon nicht mehr so kalt wie der erste.
Wieder baut sich Themara Stück für Stück auf. Zur Sicherheit lässt sich Patrick die Questbeschreibung noch einmal anzeigen. Nevena kann sehr streng sein, wenn er nicht ganz auf der Höhe ist. Also: Von dem Zombie hat er einen Schlüssel bekommen, der zu einer geheimen Pforte in den unterirdischen Gängen von Themara passt. Patrick grinst den Monitor an. Die wievielte geheime Pforte mag das wohl sein? Allmählich wiederholt sich doch einiges.
Der Himmel über der Hauptstadt hat sich gerade geschlossen, da ist Pocahonta schon unterwegs. In die Unterwelt kommt sie, indem sie einen der rostigen Deckel mit den markierten Griffen zur Seite schiebt. Die Geheimtür ist dann dank des Quest-Navis schnell erreicht. Patrick öffnet sie. Drinnen wird er schon erwartet.
»Hi!«, schreibt Nevena. Der schnelle Patti auch schon da? Alle Achtung! Sie lässt ihren Mr. Smith, einen Barbar auf Level 58, eine Auslachbewegung machen. Patricks Zornelfe Pocahonta antwortet mit einer Verbeugung. Nevena schreibt etwas, das sinngemäß »Du mich auch« bedeutet, dann spricht der Barbar einen Troll an, der auf einem Schemel sitzt und nach Trollmanier mit dem Kopf wackelt. »Listen to him!«, schreibt sie, und der Troll wiederholt seine Botschaft.
Dies, sagt er, sei eine besondere Herausforderung. Man könne sich ihr nur zu zweit stellen, nicht allein und nicht zu vielen. Aber Vorsicht! Kaum ein Paar habe sich dieser Aufgabe bislang würdig und gewachsen gezeigt.
Jetzt ist Patrick ganz bei der Sache. Vor ein paar Wochen ist das Spiel aktualisiert worden. Seitdem gibt es eine neue Art von Questen: sehr selten, spektakuläre Belohnungen und – nur für Spielerpaare. Das ist vollkommen neu! Bislang gab es neben den normalen Quests für jedermann nur die Spezialaufgaben für die großen Schlachtzuggruppen. Und jetzt diese Couple-Quests, wie sie gleich genannt wurden.
Die ganze Spielwelt ist seitdem in Aufruhr. Und sie ist überfordert. Geschickte Einzelkämpfer gibt es eine Menge. Auch schlagkräftige Armeen, organisiert von Spielern, die selbst schon alles erreicht haben. Aber kompetente Paare zu bilden, ist offenbar besonders schwierig. Vermutlich ist es genau das gleiche Problem wie im Leben: Eine Massenparty kann man über Twitter und Facebook aus dem Boden stampfen. Aber wer schafft es, einen Abend zu zweit zu verbringen?
In den Blogs hört sich das natürlich anders an. Niemand will zugeben, dass er einfach nicht den richtigen Partner findet. Stattdessen heißt es, die Couple-Quests seien viel zu schwer! Nicht zu schaffen, auch nicht von Leuten, die auf Level 60 plus spielen, also noch ein paar Stufen höher als Patrick und Nevena. Einige der Spieler, die gerne den Ton angeben, haben sogar vermutet, es handle sich um einen Gag der Spielleitung.
Und jetzt packt dieser Troll tatsächlich eine solche Couple-Quest aus! »Wow!!«, schreibt Patrick. Und das sollen ausgerechnet sie beide schaffen?
»Yep. If not us who else, darling?«
Patrick merkt, wie er vor dem Monitor rot wird. Er verbirgt sein Gesicht, indem er einen langen Schluck Orangensaft nimmt. »Sure?«, fragt er, mit einer Hand.
Ob er einen Heiratsantrag brauche?
Patrick möchte antworten, weiß aber nicht, was er sagen soll. Natürlich sind sie ein perfektes Team, exakt aufeinander abgestimmt. Der Barbar und die Zauberin. Einer, der kämpft, und eine, die ihn heilt. Mittlerweile hat Patrick seine Figur komplett auf diese Funktion hin umgebaut. Allerdings ist es ihm peinlich, darüber zu reden. Endlich setzt er zu schreiben an, doch da kommt Nevenas Zeichen für: Moment mal, bin gleich wieder da.
Für ein paar Minuten ist es still im Chatkanal, während die beiden Figuren weiter untätig vor dem nickenden Troll in der Unterwelt von Themara stehen. Dann meldet sich Nevena wieder. »Sorry. Trouble in real live Serbia.« Ihr kleiner Cousin übergebe sich gerade auf den Teppich, und der sei ein Erbstück, an dem die ganze Familientradition hänge. Jedenfalls wenn man Tante Lo glauben dürfe, die gerade hysterisch werde.
Patrick schreibt etwas, das Mitleid ausdrücken und möglichst nicht ironisch klingen soll.
»ThankU.« Ob er eine Vorstellung davon habe, wie egal ihr der Teppich und die Tradition seien? Aber außer ihr ist leider niemand der anwesenden Familienmitglieder an den Spezialwaffen Lappen und Lauge ausgebildet. »I call U.« Damit löst der Barbar sich auf.
Patrick lässt den Troll die Couple-Quest erklären. Die Sache klingt in der Tat groß und schwierig. Dann verlässt auch er das Spiel. »See you«, sagt er zu dem Foto, das mit einer Sicherheitsnadel am Vorhang hinter dem Monitor hängt.
IN DER LUFTLINIE GEMESSEN, ist Henners Platz an der Werkbank im Studio vielleicht fünf Meter entfernt von Patricks PC-Tisch. Wenn er sich ein wenig vorbeugt, kann er das kleine Fenster im Giebel sehen. Es ist Tag und Nacht von innen verhängt. Patricks Monitor steht direkt davor, daher stört ihn das Licht.
Über das Spiel weiß Henner, was man weiß, wenn man beinahe fünfzig ist und nicht hinter dem Mond lebt. Weltweit spielen es acht Millionen Menschen. Das heißt, acht Millionen waren es vor zwei Jahren, als Patrick zu spielen begann und Henner sich erkundigte. Jetzt werden es neun Millionen sein oder neunzehn. Oder sein Sohn ist der letzte, und das ganze Spiel nur noch die Simulation einer Simulation, die einzig für Patrick Ehling in Gang gehalten wird.
Henner hasst das Spiel. Nicht, weil man dort mit waffenstarrenden Märchengestalten durch eine Art Hi-Tech-Mittelalter zieht und Monster tötet. Das könnte ihn selbst noch reizen, für ein oder zwei Stunden an einem Samstagnachmittag, wenn auf einer seiner Antiquitäten der Lack trocknet. Nein, Henner hasst das Spiel, weil es ihm Patrick weggenommen hat.
Ein einziges Mal hat er das laut gesagt. Das war am Abend nach Astrids Beerdigung. Sein Bruder Peer war aus Brasilien gekommen, wo er seit Jahren für eine deutsche Firma Turbinen baut. Sie hatten bis früh am Morgen in der Küche gesessen und getrunken, und Henner hatte Peer die Geschichte des letzten Jahres noch einmal erzählt. Wie sie so zusammensaßen, war es eine andere Geschichte als die, die in seinen Mails nach Brasilien gestanden hatte. Dort hatte Henner seinen Sohn nur immer gelobt, mit Sätzen, die ihm vorkamen, als hätte er sie irgendwo ausgeschnitten: »Der Junge hält sich fabelhaft.« »Auf Patrick ist immer Verlass.« »Wer weiß, wie ich reagiert hätte, wenn unser Vater damals …« Und so weiter. Aber in dieser Nacht sagte Henner andere Sätze. Darunter den, dass er das Spiel hasse, weil es ihm Patrick genommen habe.
Henner sieht Peer nur noch alle paar Jahre, aber das ändert nichts an ihrer Beziehung. Peer bleibt der große Bruder aus dem Bilderbuch, freundlich, kompetent und unbedingt loyal. Als ihr Vater starb, urplötzlich, ohne vorher jemals krank gewesen zu sein, war Peer vierundzwanzig und Henner neunzehn. Fünfzehn Jahre lang hatte Peer den Vater vertreten, dann starb die Mutter, und er ging nach Brasilien.
»Liegt das wirklich an diesem Spiel?« Dabei hatte Peer sich ächzend nach einer Flasche gebückt.
Spätestens da wusste Henner, dass er Unsinn geredet hatte. Natürlich lag es nicht an diesem Spiel, dass Patrick seit zwei Jahren jede freie Minute vor dem PC verbrachte. Man musste kein Psychologe sein, um zu begreifen, warum ein Junge, der mit seiner sterbenden Mutter in einem Haus lebte, sich gern in eine andere Welt versetzte. Henner hatte seinen Satz bedauert, aber er nahm ihn nicht zurück; und das war auch nicht nötig. Peer verstand ihn, außerdem war es spät. Henner hatte dann noch gesagt: »Willst du mal wissen, was logisch ist?« Und als Peer ihm zunickte: »Jetzt, wo hier niemand mehr stirbt, kommt es mir vor wie im Grab.«
Zwei- oder dreimal in den letzten Monaten ist Henner nach oben gegangen und hat sich neben Patrick vor den PC gesetzt. Das Geschehen auf dem Monitor sprach ihn nicht an, kein Wunder, er wusste ja gar nicht, worum es ging. Zudem irritierten ihn die vielen Symbole, die alles einrahmten, so dass man wie aus einem Cockpit auf die Spielwelt sah. Aber egal, er war ja nicht die Treppe hochgestiegen, um das Spiel zu verstehen. Es war ihm nur darum gegangen, mit Patrick ins Gespräch zu kommen.
Und genau das war jedes Mal gescheitert. Zwar hatte sich Patrick über sein Interesse gefreut und gleich begonnen, ihm die Situation zu erklären. Doch er holte sehr weit aus, und er benutzte seltsame Fachbegriffe. Henner konnte beim besten Willen nicht folgen; und so zu tun, als ob, das lag ihm einfach nicht. Sattdessen stellte er Fragen, die offenbar die falschen waren. Schon da wurde es schwierig. Erst recht brach alles zusammen, als Patrick über seinen Erklärungen die Konzentration verlor, die das Spiel verlangte. Einmal wollte er eine Kampfszene vorführen, da scheiterte etwas und konnte nicht gleich wiederholt werden. Patrick ärgerte sich sehr. Henner hatte das Gefühl, als sei etwas Wichtiges für immer verloren, aber er wagte nicht mehr zu fragen.
»Na, dann Waidmannsheil noch!«, sagte er schließlich und ging wieder hinunter in sein Studio, wütend auf das Spiel und noch wütender über seine Ohnmacht.
Auch jetzt würde er gerne mit Patrick reden. Aber seit Astrid tot ist, haben sie kein gemeinsames Thema mehr; es gibt nichts Selbstverständliches und nicht einmal Probleme. Henner gäbe sonst was darum, hätte er einen siebzehnjährigen Sohn, der ganz normale Interessen hat. Einen Jungen zum Beispiel, der sich für Fußball begeistert und am Freitagabend vor dem Spiegel steht, bevor er ausgeht, um seine Freunde und natürlich um Mädchen zu treffen. Henner könnte sich dann ein bisschen über ihn lustig machen, als Mann, der all das hinter sich hat. Oder sie tauschten ein paar Sätze darüber, was ein Witwer um die Fünfzig mit seinem Leben noch anstellen sollte.
»Lass doch mal deine Werkstatt«, könnte Patrick zum Beispiel sagen. »Und komm mit. Muss ja nicht unbedingt dieselbe Disko sein.«
Oder er sagte: »Bleib ruhig hier! Ich such mir eine mit einer alleinerziehenden Mutter.« Henner würde ihm einen Geldschein zustecken, dann könnte er in sein Studio gehen, weiter an seinen Sachen werkeln und sich dabei sagen, dass sein Leben nun wirklich noch nicht zu Ende ist. Vielleicht würde das ja schon helfen. Oder sogar genügen. Aber so wirdes nicht sein. Und deshalb wird Henner auch heute nicht hinaufgehen.
Es gilt nämlich, Enttäuschungen zu vermeiden, wo immer das möglich ist. Sie haben das in den letzten Jahren gelernt: möglichst viele Enttäuschungen vermeiden, denn davon hatten sie immer mehr als genug. Praktisch jede Untersuchung, jede Therapie brachte eine neue. Jede Hoffnung wurde enttäuscht.
Anfangs war es die große Hoffnung auf eine schnelle Heilung nach der Operation und der Chemotherapie. Dann die kleinere Hoffnung auf einen Stillstand der Krankheit. Und schließlich die ganz kleinen Hoffnungen auf eine Verlangsamung, auf Ruhepausen, Erleichterungen oder Aufschübe. Und alle wurden enttäuscht. Egal, was getan wurde, die Krankheit schritt voran, als gäbe es einen Plan, an den sie sich unbedingt halten musste.
Nur am Ende erlaubte sie sich eine Abweichung. Die letzte Phase, in der Astrid zu Hause auf den Tod warten sollte, ohne weitere Therapie, künstlich ernährt und künstlich beatmet, dauerte nicht wie vorhergesagt drei bis vier Monate, sondern fast ein ganzes Jahr. Auch das, denkt Henner manchmal, war eine enttäuschte Hoffnung, die letzte von allen.
PATRICK SPÜRT, dass sie es dieses Mal schaffen werden. Die Hydra auf seinem Bildschirm sieht zwar noch nicht so aus, als würde sie bald das Handtuch werfen, ihre verbliebenen Köpfe schnappen und hacken stattdessen mit unverminderter Härte nach Nevenas Barbar Mr. Smith. Und trotzdem spürt Patrick dieses wohlbekannte und so überaus angenehme Gefühl eines sicheren Sieges.
Es ist jetzt Freitagabend. Am Montag haben sie ihre Couple-Quest übernommen, und seit Dienstag arbeiten sie sich an ihrem ersten Gegner ab. Wer auch immer gesagt hat, diese neuen Quests hätten es in sich, war einwandfrei im Recht. Drei lange Nächte haben sie verschiedene Strategien erprobt. Aber egal, wie sehr sich die Zauberin auch anstrengte, den Barbar am Leben zu halten, wurde er doch je nach Laune des Zufallsgenerators von der Hydra zerstampft oder zerbissen und als Bonus sogar gefressen.
Jeder Kampf war eine Sisyphosarbeit. Verlor die Hydra einen bestimmten Prozentsatz ihrer Energie, fiel einer ihrer Köpfe ab. Allerdings wuchsen nach zehn Sekunden an seiner Stelle zwei neue. Gleichzeitig wurden ihre Lebenspunkte um das Doppelte des Verlustes erhöht. Mit anderen Worten: Je mehr Schaden man ihr zufügte, desto stärker wurde sie.
Auf der Suche nach irgendeiner Idee hat Patrick dann heuteMorgen während einer Freistunde das Stichwort »Hydra« auf dem Schul-PC in eine Suchmaschine gegeben. Ganz oben auf der Ergebnisliste standen ein paar Artikel aus den Netzenzyklopädien. Während er sie lustlos überflog, blieb er bei der Sage von Herakles hängen: Der Held habe die Stümpfe der abgeschlagenen Hydraköpfe mit Feuer versengt um zu verhindern, dass sie nachwachsen. Patrick spürte einen wohligen Schauer. Das war die Lösung.
Er hat es dann kaum abwarten können, endlich nach Hause zu kommen. Nichts ist schöner, als Nevena zu überraschen. Tatsächlich wartete sie schon auf ihn. Ohne lange Vorrede hat er sie aufgefordert, direkt nach dem Abfallen eines Kopfes einen Feuerzauber auf die Hydra zu bewirken.
»Are you kidding?« Nevenas Barbar ist nicht auf solche Zauber spezialisiert. Der Schaden, den sein bescheidener Feuerball der Hydra zufügen würde, wäre daher nur minimal.
»Trust me«, hat Patrick zusammen mit einem Zwinkersmiley geantwortet. Wenn er richtig liege, werde das Spiel sogar ein Streichholz gelten lassen, solange in der Kampfmatrix »Elementarschaden: Feuer« steht.
Und er hat recht behalten. Seiner Zauberin gehen jetzt zwar langsam die Reserven aus, und bald kann er Nevenas Barbar nicht mehr heilen. Aber die Hydra hat mittlerweile nur noch einen Kopf. Es ist bloß eine Frage der Zeit; sie können nicht mehr verlieren. Da bleibt der Barbar plötzlich regungslos stehen.
Zuerst vermutet Patrick einen Übertragungsfehler. Aber würde dann die Hydra weiter angreifen, so wie jetzt? Die Lebensleiste des Barbars fällt rasch, während das einköpfige Monster sich sogar ein wenig erholt. Patrick aktiviert an Heilenergie, was seine Zauberin noch zusammenbekommt, aber bald schon kann er nichts mehr tun. Ohne sich zu wehren, sackt der Barbar zusammen. Die Hydra produziert eine Art mehrstimmiges Siegesgeheul und verschwindet in ihrer Höhle. Ohne einen kompletten Satz neuer Köpfe wird sie bestimmt nicht wieder zum Vorschein kommen. Eine Minute lang starrt Patrick bloß auf den Monitor, dann klickt er das Spiel weg und macht sich an ein paar Schulaufgaben.
Es dauert fast eine Stunde, bis Nevena sich wieder im Chat meldet, allerdings nur mit dem Zeichen für Sorry.
»What’s up?«, schreibt Patrick.
»You don’t want to know.«
Er tippt ein paar Fragezeichen.
»Family«, schreibt Nevena. Und schlechte Nachrichten. Man wolle am Wochenende ins Grüne. Und wenn sie nicht aufpasse, sitze sie dann offline irgendwo in der Pampa. Da habe sie mal eben die Interessen des Dungeonteams Alpha vertreten müssen.
Ob man sich denn jetzt die Hydra schnappen könne?
»Tomorrow«, schreibt Nevena. Nebenan werde noch diskutiert. »And don’t forget: we are the Balkans.«
AM NÄCHSTEN MORGEN wird Henner von der Klingel im Flur geweckt. Es ist taghell im Studio. Er erschrickt, dann fällt ihm ein, dass Samstag ist und er gar nicht ins Museum muss. Ein Blick auf die Armbanduhr, es ist kurz vor neun; wer jetzt schon etwas von ihm will, soll gefälligst warten.
Eigentlich schläft Henner in Patricks ehemaligem Zimmer. Er war dort eingezogen, um so nah wie möglich bei Astrid zu sein. Aber in letzter Zeit bleibt er immer öfter über Nacht im Studio. Zwischen den beiden Fenstern zur Straßenseite steht ein riesiges altes Sofa. Henner liegt darauf, wenn er abends noch liest. Und oft schläft er beim Lesen ein, so wie gestern. Vor Jahren hatten Nachbarn das Sofa zum Sperrmüll gegeben, gerade als das Studio auf die Garage gebaut wurde. Mit dem Kran haben sie es mitten in die Baustelle gehoben, das Studio wurde dann buchstäblich darum herumgebaut. Anschließend hat Henner es restauriert. Um es wieder aus dem Raum zu bekommen, müsste man es zersägen.
Beim dritten Klingeln ist er unten an der Haustür. Den Arbeitskittel hat er ausgezogen, das Hemd darunter ist zerknittert. Draußen steht ein Mann in seinem Alter, er hält einen Zettel in der Hand. Henner ist knapp davor, etwas Unfreundliches zu sagen, dann ist er endlich im Bilde. Er streckt dem Mann eine Hand hin. »Sie sind pünktlich«, sagt er. Es soll freundlich klingen.
»Natürlich«, sagt der Mann.
Henner greift hinter sich in den kleinen Korb auf der Ablage über dem Heizkörper, dann weist er zur Garage. »Gleich um die Ecke.« Er geht voran. Mit der Fernbedienung öffnet er das Tor, dann fährt er den Kombi heraus und parkt ihn auf der Straße. Als er aussteigt, steht der Mann noch oben in der Einfahrt. »Nur keine Scheu«, sagt Henner. »Sie dürfen ihn sogar berühren. Das hält er aus.«
Der Mann saugt hörbar Luft ein. »Donnerwetter! Und der ist wirklich Baujahr 79?«
Henner öffnet die Tür des Wohnmobils, steigt hinein und nimmt einen Ordner vom Tisch. »Allerdings«, sagt er. »Die erste Serie. Aber hier steht alles drin. Zweiunddreißig Jahre, lückenlos dokumentiert.« Er steigt wieder aus, drückt dem Mann den Ordner in die Hand und macht eine einladende Bewegung. »Gehen Sie an Bord. Sehen Sie sich in aller Ruhe um. Machen Sie alles auf, schauen sie überall rein. Ich bin in ein paar Minuten wieder da.«
Im Haus wechselt Henner seine Sachen. Er lässt sich dabei viel Zeit. Wer einen Wagner Globetrotter Baujahr 1979 kauft, muss ein echter Liebhaber sein, auch bei dem bescheidenen Preis, für den Henner ihn inseriert hat. Soll der Mann sich also erst mal alleine darin umsehen.
Lange Zeit war das Wohnmobil Astrids einziger nennenswerter Besitz. Auf einem der Fotos, die Henner vergrößert, gerahmt und in das gelbe Zimmer gehängt hat, sitzt sie neben der offenen Klappe des Motorraums. An ihrem Blick ist zu erkennen, dass sie nicht ganz freiwillig auf diesem Rastplatz angehalten hat; es gab Probleme mit der Lichtmaschine. Außerdem sieht man, dass sie nicht so gerne fotografiert wird, erst recht nicht von diesem seltsamen Fremden.
Henner war damals sechsundzwanzig und stand kurz vor seinem Examen. Nach dem Abitur hatte er eine Schreinerlehre absolviert; es folgten ein Studium der Kunstgeschichte und gleichzeitig eine Weiterbildung zum Restaurator. Seit er ein Junge war, träumte er davon, alte oder beschädigte Kunstwerke wieder so aussehen zu lassen, als wären sie gerade erst fertig geworden. Wenn er sich selbst als Held sah, dann nicht mit einer Waffe, einem Ball oder einer Gitarre, sondern als Mann mit einem Koffer voller Chemikalien, den man gerufen hat, damit er ein wertvolles Bild rettet, das jemand mit Säure bespritzt hat.
Diesen letzten Sommer seiner Studienzeit hatte Henner in Italien verbracht, um Kirchen und Museen zu besuchen. Trotzdem war er braun gebrannt, zwischen seinen Besichtigungen hatte er praktisch auf der Straße gelebt. Er war dünn geworden, trug lange Haare und einen Bart; er sah aus wie ein mittelalterlicher Pilger. Gerade hatte er der Reihe nach die Besitzer der parkenden Autos gefragt, ob jemand ihn Richtung Norden mitnehmen könne, aber ohne jeden Erfolg.
»Mich fragst du wohl nicht?«, hatte Astrid gesagt. Sie saß in der offenen Tür des Wohnmobils und putzte mit ölverschmierten Fingern ein Metallteil. Auf dem Boden vor ihr lagen weitere Teile.
»Ich will schon ganz gern nach Hause.« Henner hatte gleich gesehen, dass das Wohnmobil in seiner Heimatstadt zugelassen war. »Aber wenn’s eben geht, dann bitte lebendig.«
Astrid hatte etwas geantwortet wie: Hippie und Angsthase, das passe ja wunderbar zusammen. Er war dann neben dem Wohnmobil sitzen geblieben, während sie das Teil säuberte und wieder einbaute. Dabei hatte er sie fotografiert. Dann waren sie zusammen nach Hause gefahren, gelegentlich zeigte eine Warnlampe an, dass die Akkus nicht mehr geladen wurden.
Astrid hatte von sich erzählt. Sie war damals dreiundzwanzig. Das Wohnmobil hatte ihr vor fünf Jahren ein Onkel geschenkt, als er krank geworden war und nicht mehr reisen konnte. Sie besaß da erst seit wenigen Wochen einen Führerschein, und folgerichtig waren ihre Eltern strikt dagegen, sie fahren zu lassen, erst recht alleine. Es gab Streit darüber, so wie es dauernd Streit gab, über alles Mögliche. Da hatte Astrid ihre Sachen gepackt und war in das Wohnmobil gezogen. Solange sie noch zur Schule ging, stand es auf der Straße vor dem Elternhaus. Nach ihrem Abitur fuhr Astrid damit in die Universitätsstadt. Die ersten zwei Semester lebte sie weiter darin, dann ließ sie sich von einer Freundin überreden, ein kleines Zimmer in deren WG zu nehmen. In den Semesterferien war sie allerdings vom ersten bis zum letzten Tag mit dem Wohnmobil unterwegs, immer allein und immer ohne festes Ziel, einfach der Nase nach, wie sie es nannte. Inzwischen war der Onkel gestorben; was er ihr noch an Geld hinterlassen hatte, verbrauchte sie ausschließlich fürs Benzin und die anstehenden Reparaturen.
Henner erzählte von seiner Ausbildung und seinem Studium. Das hatte Astrid beeindruckt. Ob er auch ein Getriebe restaurieren könne? Nein, hatte Henner gesagt. Definitiv nein. Bei ihm gehe es um Kunst. Ausschließlich um Kunst und um sonst gar nichts! Spät in der Nacht kamen sie an. Astrid parkte das Wohnmobil da, wo sie es meistens abstellte, auf einem freien Grundstück im Studentenviertel. Und dann war es das erste Mal, dass sie nicht alleine darin schlief.
Als sie kurz vor Weihnachten wieder losfuhr, war Henner dabei. Doch ihre Art, planlos zu reisen, gefiel ihm gar nicht. Wenn er irgendwohin wollte, dann zu Orten, an denen es Kunst zu sehen gab, Kunst, die ihn interessierte. Wie er dort wohnte, war ihm gleich, am besten mitten zwischen den Museen und Kirchen, aber natürlich wollte er keine Minute seiner kostbaren Zeit mit Dingen wie Abwasch, Filterwechsel oder Parkplatzsuche vergeuden.
Astrid hingegen liebte es, einfach loszufahren. Wohin, war ihr fast egal; es ging ihr nur darum, unterwegs zu sein, zu halten, wo sie wollte, und gleich aufzubrechen, von einer Sekunde auf die andere, wenn ihr das in den Sinn kam. Eine Straßenkarte kaufte sie nur, wenn sie das Gefühl hatte, im Kreis zu fahren.
Sie hatten es dann ein einziges Mal mit einem Kompromiss versucht. Im nächsten Frühjahr fuhren sie durch Burgund. Henner hatte seine Kunstreiseführer dabei, einen Karton voller Bücher, gespickt mit Lesezeichen, dazu die Kamera und den Skizzenblock. Ab Dijon ging es über schmale Landstraßen. Wenn es Astrid an einer Kreuzung rechts besser gefiel als links, bog sie nach rechts ab. Das war allein ihre Entscheidung. Henner griff dann zur Karte. Vielleicht führte die Route durch einen Ort, der eine Besichtigung lohnte. Tatsächlich war das manchmal der Fall. Sie kamen nach Autun, wo es eine Kathedrale mit frühen Bildhauerarbeiten gab, und nach Vézelay, von wo im Mittelalter die Kreuzzüge aufgebrochen waren. Allerdings musste Henner seine Besichtigungen immer im Eiltempo erledigen, weil Astrid weiter wollte. Sie blieb dann im Führerhaus sitzen, während er um eine Kirche lief und beinahe im Gehen fotografierte. Eigentlich hätten sie Grund genug gehabt, sich dauernd furchtbar zu streiten. Aber sie stritten nicht, dazu waren sie viel zu verliebt.
Dennoch beschlossen sie nach der Burgundtour eine Regelung für ihre Fahrten. Es sollte keine Kompromisse mehr geben, sondern den Wechsel. Und genau so geschah es auch. Mal fuhren sie dahin, wo Henner Kunst sehen wollte, natürlich nur kurz, eine Woche vielleicht, mehr brauchte er nicht. Das nächste Mal begleitete er Astrid, wenn sie sich und ihr Wohnmobil treiben ließ, wohin auch immer. Besuchte er seine Kirchen und Museen, so kam sie nicht mit, um kein Interesse heucheln zu müssen. Im Gegenzug musste sich Henner bei den Fahrten im Wohnmobil um gar nichts kümmern. Er wurde einfach mitgenommen wie ein Gepäckstück. Meistens saß er inmitten von Büchern auf dem großen Bett in der hinteren Koje, dort las er oder schrieb seine Aufsätze, auf den Knien den Spiralblock. Allmählich lernte er, sich auch während der Fahrt ganz auf seine Arbeit zu konzentrieren. Wenn sie abends anhielten, wusste er so wenig wie Astrid, wo genau sie waren.
Meistens standen sie ja auch irgendwo in der freien Natur, wenn möglich etwas abseits der Straße. Das war Astrid am liebsten. Nur um den Wassertank zu füllen und die Toilette zu leeren, fuhr sie auf spezielle Plätze. Doch das war selten nötig; der Globetrotter war für sechs Personen konstruiert und hatte Platz für große Reserven an Strom und Wasser. Man erregte immer noch Aufsehen damit. Anfangs hatte er als der Mercedes unter den Wohnmobilen gegolten, jetzt war er eine Legende.
Als Henner die Garage wieder betritt, sitzt der Interessent sehr aufrecht hinter dem Lenkrad. Henner macht ihm ein Zeichen, den Motor zu starten, und der Mann tut es. Beim zweiten Versuch springt der schwere Diesel an. »Fahren Sie ihn raus!«, sagt Henner.
Der Mann kurbelt die Seitenscheibe herunter. Ob er das nicht lieber selbst tun wolle?
»Sie müssen doch wissen, wie er sich fährt.« Henner macht eine aufmunternde Geste. Er selbst hat in dreiundzwanzig Jahren keine fünfzig Kilometer am Steuer gesessen. Von der Bedienung des Wohnmobils und all den Wartungsarbeiten weiß er so gut wie nichts; und was er vielleicht gewusst hat, das hat er wahrscheinlich wieder vergessen.
Der Mann hingegen scheint sich auszukennen. Er findet auch gleich den kleinen Bildschirm, der ein Rückwärtsbild zeigt, aufgenommen von einer Kamera im Heck. Astrid hat solche Extras gebraucht gekauft und selbst eingebaut. Sauber lenkt der Mann den Globetrotter auf die Einfahrt. Er zieht die Handbremse, steigt aus und öffnet die Klappe zum Motor. »Noch genau ein Jahr TÜV.«
Das ist keine Frage, aber Henner nickt. Vor genau einem Jahr war Astrid nur noch wenige Minuten am Tag ansprechbar. Den Rest der Zeit lag sie unter der weichen Decke ihrer Medikamente. Sie hatte nicht nach der TÜV-Prüfung gefragt, aber Henner wusste, dass sie daran dachte. Wenn überhaupt noch an etwas, dann bestimmt daran. Das Wohnmobil war für sie wie ein Haustier gewesen, etwas, um das man sich gerne kümmert, weil es einem genau das gibt, was man braucht. Astrid nannte es Erich, nach dem Onkel, der es ihr überlassen hatte.
Rechtzeitig hatte Henner jemanden von der Autowerkstatt gebeten, den Globetrotter abzuholen, durchzusehen und zur Prüfung vorzustellen. Wenn Reparaturen nötig seien, solle man sie durchführen, egal was es koste. Er wollte um jeden Preis die Prüfplakette. »Mit Ach und Krach«, sagte der Mann von der Werkstatt, als er den Globetrotter zurückbrachte; er präsentierte eine lange Rechnung. Henner hatte sie in den Ordner geheftet, dann war er zu Astrid ins Zimmer gegangen.
Sie war wach, vielleicht hatte sie das Motorengeräusch gehört. »Der Erich ist wieder einsatzbereit«, sagte Henner. Astrids Blick war fest und klar wie selten in diesen Tagen. »Dann wird er mich genau zwei Jahre überleben«, sagte sie leise. »Der alte Bock.« Sie weinte; zum letzten Mal, wenn Henner sich richtig erinnert.
»Sieht wirklich anständig aus.« Der Mann lässt die Klappe wieder ins Schloss fallen.
»Darf ich mal fragen, was Sie damit vorhaben?«
Der Mann zieht die Stirn in Falten. »Trau ich mich gar nicht zu sagen. Eigentlich brauchen wir nur einen günstigen Wagen für eine Band. Vier Leute, das Equipment, na ja, war so eine Idee, um Reisekosten zu sparen. Vom Platz käme er natürlich hin, vom Preis auch. Aber eigentlich ist er zu schade, der gehörte besser in ein Museum.«
Als wenn der Erich nicht längst ein Museum wäre! Allerdings eines, von dem Henner sich jetzt trennen will. »Sind Sie Manager oder etwas in der Art?«
Der Mann lacht. »Nein nein. Ich bin bloß der Vater. Von Zweien der Vier. Schlagzeug und Gitarre.« Er schüttelt den Kopf. »Gestern habe ich noch Legosteine zusammengeräumt, und heute bin ich der Roadie einer Metal-Band.«
»Man kann es wesentlich schlechter erwischen.« Kaum hat er das gesagt, bedauert Henner seinen Tonfall.
Der Mann schaut überrascht. »Natürlich«, sagt er schnell. »Da haben Sie recht.«
»Und?« Henner fühlt sich müde. Er sollte sich vornehmen, nicht wieder auf dem Sofa zu schlafen. Und erst recht nicht in Kleidern.
»Darf ich es mir noch überlegen?«
»Selbstverständlich.« Sie geben einander die Hand.
Als der Mann gegangen ist, fährt Henner den Globetrotter wieder in die Garage, sehr langsam und sehr vorsichtig. Dabei sieht er sich selbst auf dem Beifahrersitz, damals in Burgund, den Reiseführer auf dem Schoß, wie er sich vorbeugt und Ausschau nach einem Wegweiser hält. Und er hört, wie Astrid sagt: »Vergiss Cluny. Das ist doch bloß eine Ruine.«
PATRICK WEISS VON NEVENA, dass sie am Wochenende lange schläft, viel länger noch als er. Es hat also gar keinen Zweck, so früh ins Spiel zu gehen, es sei denn, er wollte sich eine eigene Quest holen, die ihn in die finsteren Viertel von Themara oder in eine von Monstern starrende Wildnis führt. Allerdings ist das wirklich kein Zeitvertreib für eine Zornelfenzauberin, die kaum Angriffskräfte besitzt und sich selbst nicht heilen kann.
Also räumt Patrick sein Zimmer auf. In der nächsten Woche wird Astrids erster Todestag sein. Das Datum könnte er nie vergessen; aber bislang sieht es nicht so aus, als würde Henner irgendetwas planen. Vor sechs Wochen war es ein Jahr her, dass er Nevena kennengelernt hat. Den Tag hätte er gerne gefeiert, aber er hat sich nicht einmal getraut, es zu erwähnen. In solchen Dingen kann Nevena ziemlich streng sein. Überhaupt ist sie streng für ein Mädchen, jedenfalls soweit Patrick das beurteilen kann.
Viel Erfahrung hat er nicht. Er könnte das auf Astrid schieben. Er könnte sich sagen: Man macht keine Verabredungen mit Mädchen, wenn man eine sterbende Mutter zu Hause hat. Aber das wäre nicht die ganze Wahrheit. Und weil Patrick nicht weiß, wie die ganze Wahrheit aussieht, und weil er niemals wissen wird, was heute wäre, wenn Astrid noch lebte, deshalb denkt er so wenig wie möglich daran. Außerdem gibt es im Moment genug, auf das er sich freuen kann. Heute werden sie die Hydra besiegen, und dann wartet der nächste Gegner ihrer Couple-Quest.
Außerdem ist sich Patrick sicher, dass er es heute schaffen wird, Nevena um neue Fotos zu bitten. Natürlich welche von ihr. Die Fotos, die er schon besitzt, hat sie einmal gepostet, um der Schlachtzuggruppe zu beweisen, dass sie wirklich ein Mädchen ist. Weibliche Spieler sind selten; und outet sich einmal eine, dann findet sich sofort jemand, der das nicht glauben will. Auf diesen Fotos hält sie daher ein Schild in der Hand, das genau den Text und die Zeichen trägt, die der Zweifler damals sehen wollte.
Patrick aber hätte gerne ein Foto von Nevena nur für sich. Sie muss darauf nichts tun oder ihm irgendetwas beweisen. Am liebsten wäre ihm so ein Schnappschuss, den sie gar nicht bemerkt hat. Er hat sich eine Strategie zurechtgelegt: Er wird die Zornelfenzauberin den Barbar im Spiel danach fragen lassen. Notfalls muss es klingen wie ein Witz.
Bei solchen Dingen muss Patrick besonders vorsichtig sein. Seit über einem halben Jahr ist Nevena nur noch mit ihm zusammen im Spiel unterwegs. Sie sagt das, und er glaubt es ihr. Und wenn das so ist, dann sicher nicht, weil er sie dauernd anbaggert. Im Gegenteil. Wenn sie reden, dann über das Spiel und über alles Mögliche sonst, nur nicht über diese Du-und-Ich-Themen.
Außerdem hat Patrick keine Ahnung, was für einen Antrag man einem Mädchen machen soll, das ungefähr eintausenddreihundert Kilometer entfernt lebt. Klar würde er sie sehen wollen, lieber heute als morgen. Aber was soll er sagen? Gehen wir mal zusammen ins Kino? Oder in den Zoo? Nein, für eine halbwegs normale Verabredung wohnt Nevena mindestens zwölfhundert Kilometer zu weit weg.
Dabei denkt er daran, sie zu treffen, jeden Tag einmal, wenn nicht öfter. Er stellt es sich vor: wie er aus dem Flugzeug oder aus der Bahn steigt und sie ihn abholt, vielleicht wieder mit so einem Schild vor der Brust, dessen Text sie vorher besprochen haben. Oder er ist der, der wartet, am Bahnhof und auf dem Flughafen. Mit einem Blumenstrauß in der Hand? Nein, das sicher nicht.
Patrick hat sich aufs Bett gelegt, so, dass er Nevenas Foto neben dem Monitor sehen kann. Da hört er ein Geräusch. Vorsichtig, um das Foto nicht zu knicken, zieht er den Vorhang beiseite. Tatsächlich, der Erich wird aus der Garage gefahren. Patrick kann nicht sehen, wer das macht. Henner ist es jedenfalls nicht, der steht daneben. Und dann fällt es Patrick ein: Der Erich soll ja verkauft werden. Das ist traurig, aber was soll man machen? Henner wird freiwillig keinen Meter damit fahren. Und er selbst? Soweit er sich erinnert, hat er es immer schön gefunden, mit Astrid durch die Weltgeschichte zu kutschieren. Das war wohl ihre große Freiheit. Seine ist es eher nicht.
Er schaut auf die Uhr. Noch immer eine Ewigkeit, bis er es wagen kann.
HENNER MACHT FRÜHSTÜCK. Seit Astrid künstlich ernährt wurde, haben sie nur noch Sachen im Haus, die praktisch unbegrenzt haltbar sind. Käse und Aufschnitt, jede Scheibe einzeln verpackt, Marmelade und Butter in winzigen Portionen, Müslis, Brot zum Aufbacken und natürlich tiefgefrorene Fertiggerichte. Im großen Eisschrank unten im Keller ist so viel davon, dass Henner nur alle paar Wochen Nachschub besorgen muss. Er darf bloß nicht vergessen, regelmäßig etwas davon aufzutauen. Aber er gibt sich Mühe, und meistens sieht es im Kühlschrank so aus, als würde jemand täglich die Einkäufe besorgen.
Jetzt deckt er für zwei in der Küche, an dem kleinen Tisch, der zwischen Fenster und Kühlschrank steht und an dem er früher nur saß, wenn er Astrid beim Kochen half. Den Esstisch im Wohnzimmer benutzen sie nicht mehr, so wenig wie das ganze Zimmer, das mit Fenster und Tür an den Garten grenzt. Wenn Henner hinausgeht, dann fast immer durch den Keller.
Es ist kurz nach halb zehn. Henner weiß, dass Patrick am Wochenende gerne etwas länger schläft, aber das tägliche gemeinsame Frühstück ist eine eiserne Regel, an der sie schweigend festhalten. Als Astrid noch lebte, brauchten sie ein morgendliches Treffen, um alles für den Tag abzusprechen: wer welche Besorgung machte, wer den Wachdienst übernahm, wer dem Pflegepersonal oder dem Arzt die Tür öffnete. Zwischen den Frühstückssachen lag ein Klemmblock, obenauf das Tagesblatt, wie sie es nannten, in Stunden unterteilt und mit je einer Spalte für Henner und Patrick. Am Ende des Frühstücks musste es vollständig ausgefüllt sein. Sie beherrschten diese Übung, ohne noch reden zu müssen. Es gab ja auch nichts zu diskutieren. Was zu tun war, musste getan werden. Geblieben davon ist das gemeinsame Frühstück.
Henner ruft hinauf ins Treppenhaus; eine Minute später ist Patrick in der Küche. Auch das gilt noch immer: Kommen, wenn man gerufen wird, ohne Verzögerung, ohne Einspruch. Es konnte ja immer um Sekunden gehen. Dann sitzen sie einander gegenüber, Henner am Kühlschrank und Patrick am Fenster, jeder hantiert mit seinen Frühstückssachen. Bis auf die Butter gibt es heute Morgen wieder nichts, von dem sie beide essen; und eigentlich würde Henner auch lieber Margarine nehmen, aber die ist noch gefroren.
»Schule?«
»Alles okay«, sagt Patrick. Mehr nicht.
Eigentlich könnte die Schule ein Gesprächsthema sein, in den meisten Familien ist sie es. Immerhin wird es demnächst das Versetzungszeugnis geben, und ab dem nächsten Schuljahr zählt jede Note fürs Abitur. Aber seit Jahren sorgt Patrick dafür, dass die Schule kein Thema ist. Seine Noten sind in sämtlichen Fächern gleichbleibend gut. Es ist fast ein Wunder, dass nichts von allem auf seine Leistungen durchgeschlagen hat. Das haben auch Patricks Lehrer gesagt. Der Junge habe einen starken Charakter, hieß es immer, wenn Henner die Sprechtage besuchte. Der halte sich großartig, Respekt. Dabei wurde Patrick vermutlich nicht besser behandelt als seine Mitschüler. Er konnte, wenn man ihm entgegenkam, sehr abweisend sein. Henner wusste das, aber mit den Lehrern redete er nicht darüber.
»Was geplant für heute?«
»Und du?«
Henner würde gerne sagen, dass er sich eine Antwort auf seine Frage wünschte. Aber das geht nicht. Streit oder was wie Streit aussehen könnte ist immer noch tabu. Streit hatten sie sich nicht leisten können, ganz zu schweigen davon, dass sie es Astrid nicht antun durften. Es kam darauf an, dass alles funktionierte, reibungslos. Wir können uns später streiten, hatte Henner einmal gesagt, als es um etwas ging, über das man streitet, wenn man Vater und Sohn ist. Patrick hatte das verstanden, und sie hatten die Sache einfach vertagt. Doch dabei ist es geblieben. Sie streiten nicht.
»Ich mach weiter an dem Kasten«, sagt Henner.
»Und? Kriegst du die Tinte raus?«
Henner ist ein bisschen verwundert. Er hätte nicht gedacht, dass Patrick sich überhaupt an das Teil erinnert. Um Zeit zu schinden, erklärt er umständlich, welcher seiner verschiedenen Versuche bislang am erfolgreichsten war. Läge noch ein Tagesblatt auf dem Tisch, würde er den chemischen Prozess aufschreiben, der sich jetzt im Holz vollzieht.
»Cool«, sagt Patrick. »Und wenn er fertig ist, was tust du damit?«
Jetzt ist Henner regelrecht perplex. Eigentlich müsste er sagen, dass er sich darüber noch keine Gedanken gemacht hat. Aber dann wäre das Gespräch womöglich schon zu Ende.
»Vielleicht ein Geschenk für Jutta?« Die war Astrids beste Freundin, eine Kollegin aus der Schule.
»Super Idee.« Patrick hebt seinen Becher Kakao, als wollte er anstoßen. »Die wird allerdings irgendwas reinlegen, das bestimmt nicht reingehört. Ich tippe mal auf Schokolade.«
Die beiden lachen, dann unterhalten sie sich ein paar Minuten über Jutta. Sie ist eigentlich eine unerträgliche Person, darüber herrscht Einigkeit. Aber dafür, wie sie sich verhalten hat, als Astrid krank war, müsste sie einen Orden bekommen. »Großes Freundinnenverdienstkreuz am Band«, sagt Patrick. »Verziert mit Cognacgläsern und Kirschtörtchen.«
Henner hat Mühe mitzuhalten. So gesprächig war Patrick lange nicht mehr. Und ganz plötzlich, ohne Überleitung, sagt er: »Der Typ heute Morgen war wegen dem Erich da?« Es ist allenfalls eine halbe Frage.
Henner macht eine Handbewegung. Ausgerechnet jetzt muss dieses Thema zur Sprache kommen. Im Gegensatz zu ihm hat Patrick die Fahrten mit dem Wohnmobil wohl ziemlich gemocht. Anfangs hat er geglaubt, Erich sei ein Name wie Golf oder Corsa. Sie haben ihn lange in dem Glauben gelassen. Vielleicht, denkt Henner, werden wir jetzt wenigstens streiten. Aber da sagt Patrick schon: »Glaubst du denn, jemand kauft ihn? Der ist doch echt nicht mehr state of the art.«
»Es geht ja nicht bloß ums Geld.« Henner wischt ein paar Brösel vom Tisch. »Ich dachte, vielleicht findet sich jemand, der so viel Freude daran hat wie Astrid.«
Patrick schweigt sehr lange. »Nicht genau wie sie«, sagt er endlich. »Ich glaube, das gibt’s nur einmal. Aber es sollte unbedingt einer sein, der den Erich so mag, wie er ist.«
Henner ist erleichtert. »Unbedingt«, sagt er.
»Du hast in der Zeitung inseriert?«
Henner nickt.
»So finden wir nicht den richtigen.«
»Wie denn sonst?«
»Das kann nicht so schwer sein. Soll ich mich drum kümmern?«
»Das kannst du?«
»Nicht ich, Paps«, sagt Patrick. »Aber das Netz. Du weißt doch: Das Netz besorgt dir Sachen, von denen du immer dachtest, die gibt es nicht.« Er lacht, dann stellt er seinen Teller in die Geschirrspülmaschine und räumt seinen Teil des Frühstücks in den Kühlschrank. Er winkt und verlässt die Küche. Seit er groß genug dafür ist, hat er die Angewohnheit, zwei Stufen auf einmal zu nehmen. Henner hört jetzt die verzögerten Schritte auf der Treppe. Es ist lange her, dass Patrick ihn zuletzt Paps genannt hat.
AM VORMITTAG erledigt Henner ein paar Besorgungen, am Nachmittag kümmert er sich um den Garten. Als sie vor fünfzehn Jahren das Haus kauften, war es einer von diesen Gärten, die Astrid und Henner spießig nannten. Eine Rasenfläche in der Mitte und drum herum hauptsächlich Nadelbäume. Astrid war entschieden dagegen. In einem Garten müsse es im Frühling blühen, und im Herbst solle gefälligst Laub von den Bäumen fallen. Aber dann konnten sie sich nicht einigen, was zu tun war. Außerdem fehlte das Geld. Die Raten waren hoch, später kam noch der teure Anbau des Studios dazu. So blieb der Garten sich selbst überlassen. Die Kiefern, Tannen und Fichten wurden ein Wald, der jedes Jahr ein Stück weiter Richtung Haus wuchs. Wenigstens brauchte der Garten kaum Pflege, es reichte schon, das immer kleiner werdende Rasenstück zu mähen und die toten Äste von den Stämmen zu brechen. Genau das tut Henner jetzt, und da er es lange nicht mehr getan hat, ist es doch eine Menge Arbeit.
Am späten Nachmittag ist er wieder in seinem Studio. Tatsächlich hat sein Kasten jetzt keine blauschwarzen Flecken mehr, dafür ist das Holz an diesen Stellen blass, fast weiß. Als nächstes gilt es, alles zu schleifen. Das ist eine langwierige und anstrengende Handarbeit; aber ohne sie geht es nicht.Als Restaurator hat Henner gelernt, niemals auf schnelle Erfolge zu hoffen.
Das bewies schon sein erster großen Fall. Das Museum hatte ein Bild angekauft, weil sich unter der amateurhaft gemalten Landschaft etwas Wertvolles verbergen sollte. Es hieß, das Bild sei in den dreißiger Jahren übermalt worden, weil der Künstler auf einer schwarzen Liste stand. Es gab etliche Hinweise darauf, dass die Geschichte stimmte, also würde sich die Freilegung des ursprünglichen Gemäldes womöglich lohnen. Doch dann stellten sie fest, dass die Farbe der Übermalung besonders robust, ja regelrecht wehrhaft war. Im Krieg hatte man Schiffe damit lackiert.
Henner hatte sich mit einem ehemaligen Lehrer besprochen und Fachliteratur gewälzt, bevor er sich an die Arbeit machte. Dann beträufelte er tagelang die Oberfläche des Bildes möglichst gleichmäßig mit einem speziellen Lösungsmittel; dabei hatte er dauernd zu überwachen, wie es mit der Farbe reagierte. An einem bestimmten Punkt musste der Vorgang eingestellt werden, und dieser Punkt war nicht