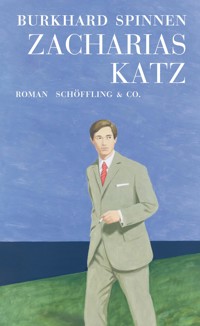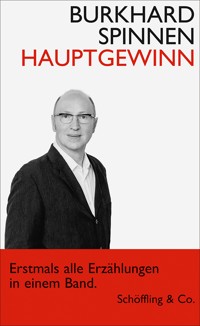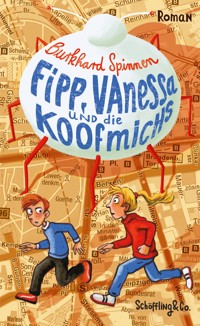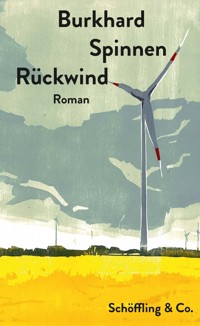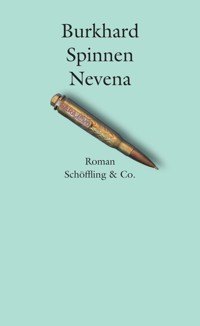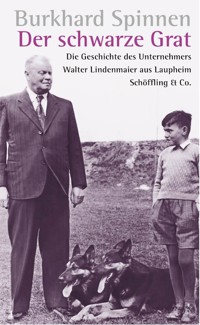19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeitenwende erreicht Vorstadtbungalow: Auf rätselhafte Weise erhält der Unternehmer Richard Morjan Splitter aus seiner eigenen Vergangenheit. Ein Unbekannter verkauft ihm unter dem Namen Time Tunnel Videoclips und Fotos, die Szenen aus seiner Kindheit und Jugend zeigen. Morjans Zeitreise versetzt ihn in einen Taumel der Selbsthinterfragung: Weshalb hat er seine hoffnungsvolle Karriere als bildender Künstler aufgegeben und in eine Spedition eingeheiratet? Warum hat er es hingenommen, dass seine Ehefrau ihn mit der gemeinsamen Tochter ohne jede Erklärung verlassen hat? Und wer in aller Welt bietet ihm seine Erinnerungen als Waren an? Zugleich schieben sich mit Vehemenz die Krisen der Gegenwart in sein Leben: Eigentlich will Morjan sich, gut situiert, zur Ruhe setzen, doch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der lukrative Deal zum Verkauf seiner Spedition in Gefahr. Als er die aus Kiew geflüchtete Alisa und ihre zwei Kinder in seinem Bungalow aufnimmt, fällt ihm der Rückzug in seine traurigen Komfortzonen immer schwerer. Und es droht ihm, dass er mit fast sechzig sein Leben noch einmal von Grund auf ändern muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Burkhard Spinnen
Vorkriegsleben
Roman
Schöffling & Co.
Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Dank
1.
Montag, 14. Februar2022. Die Mutter sitzt in ihrem Sessel, den Rücken zum Fenster. Sie trägt keine Maske, und sie wird keine aufsetzen; die Pandemie hat sie von Anfang an nicht verstanden. Seine eigene Maske hat Morjan schon abgenommen. Ein Besuch damit ist völlig undenkbar.
Jetzt muss er es sagen, und er tut es: »Hallo, Mama!«
Der Text könnte kaum simpler sein, aber er muss den richtigen Ton treffen. Es muss klingen, als käme er gerade von der Schule nach Hause. Ein freundlicher Gruß, aber eigentlich die Aufforderung, heiter zu sein, von Sorgen nicht zu reden und nicht danach zu fragen.
»Hallo«, antwortet die Mutter.
Es fehlt der Name. Kein Richard, das ist ein schlechtes Zeichen. Womöglich hält sie ihn heute wieder für ihren Vater oder ihren Ehemann oder ihren Bruder, alle tot seit vielen Jahren. Morjan setzt sich ihr gegenüber. Zwischen ihnen steht der runde Tisch, der noch aus dem Elternhaus stammt. Soffy legt sich darunter, den Blick zur Tür gerichtet. Sie meidet die Mutter; vielleicht weiß sie auf ihre Art, dass etwas mit der alten Frau nicht stimmt. Die Mutter ihrerseits nimmt niemals Notiz von der Hündin. Sie meidet Themen, in denen sie sich nicht auskennt, und die gibt es wahrlich zur Genüge.
Morjan trägt Anzug mit Hemd und Krawatte, weil er gleich noch einen offiziellen Termin hat. Jeans, kariertes Hemd und Parka wie damals zu Schulzeiten wären besser. Manchmal helfen sie der Mutter, ihn als den zu erkennen, der er ist: ihr einziges Kind. Doch wichtiger ist sein Gesichtsausdruck. Der muss unbedingt zum Tonfall der Begrüßung passen: ein unironisches, entspanntes Lächeln. Die Mutter missversteht die ganze Welt, aber Gesichter kann sie noch lesen, natürlich nur ohne Maske. Morjan beherrscht dieses Lächeln, aber es fühlt sich falsch an.
»Ach«, sagt die Mutter. »Gut, dass du kommst.«
Das sagt sie immer. Was dahintersteckt, hört Morjan an der Melodie. Sie kann es sagen, als käme jemand, von dem sie einen guten Rat erhofft. Heute sagt sie es so, als hätte man sie in der Wildnis ausgesetzt.
»Was gibt es denn?«, sagt Morjan durch sein Lächeln hindurch.
»Die«, sagt die Mutter. Aber schon ist da eine Lücke. Man hat ihr etwas angetan, aber sie weiß nicht mehr, wer das war.
»Die haben mich –«
Weiter kommt sie nicht. Sie hat die Täter vergessen und die Tat. Aber dass man sie verletzt oder missachtet oder beleidigt hat, das weiß sie, und davon wird sie sich nicht abbringen lassen, erst recht nicht durch Sätze wie den, etwas könne nicht schlimm sein, wenn man es so schnell vergessen habe. Früher sagte sie selbst solche Sätze, besonders zu ihrem Sohn, doch das hat sie ebenso vergessen wie ihr Muttersein.
Morjan könnte jetzt viel Zeit damit vertun, nach irgendwelchen Vorfällen zu forschen. Vielleicht Probleme mit dem Pflegepersonal. Die Mutter beschwert sich permanent darüber, dass sie nicht versteht, was die Leute ihr sagen, aber niemals fragt sie nach. Sie will sich keine Blöße geben, sie will keine schwerhörige oder vergessliche alte Frau sein. Also grübelt sie, was man ihr gesagt haben könnte, und schon bald geht das Grübeln alleine seinen Weg wie ein Pferd, dessen Reiter eingeschlafen ist. Nur führt dieser Weg nicht nach Hause, sondern in die Verzweiflung.
Hinter seinem Lächeln entscheidet Morjan wieder einmal, nicht den Detektiv zu spielen, sondern die Mutter auf andere Gedanken zu bringen. Man hat ihm dazu geraten; nur fällt es ihm schwer, seine eigene Mutter wie ein Kind zu behandeln.
»Wie geht es eigentlich dem Richard?«, sagt er in einem übertrieben interessierten Ton.
Die Mutter ist verblüfft. Jemand hat ihr Grübeln verscheucht, und jetzt ist da nichts als dieser Name, der ihr bekannt vorkommt.
Morjan hilft ein wenig nach. »Dem Richard, deinem Jungen.«
»Ach der«, sagt die Mutter. »Lass mich mit dem in Ruhe.«
Es scheint zu funktionieren. Morjan stellt sich überrascht. »Warum denn das? Ist was mit ihm?«
Die Mutter winkt ab. »Was soll mit dem schon sein? Nichts ist mit dem.«
Es braucht offenbar mehr, um das Gespräch in Gang zu halten. »Kommt er dich nicht mehr besuchen?«
»Weiß ich nicht. Der macht doch, was er will.«
»Ach. Und was ist mit der Schule? Hat er schlechte Noten?«
»Ja«, sagt die Mutter.
»Wieder in Kunst?«
»Weiß ich nicht. In allem. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Und faul wie die Sünde.«
Morjan nickt. Er ist nicht mehr überrascht, aber es schmerzt ihn jedes Mal. Die Mutter hat schon mehrmals gesagt, dass ihr Sohn ein schlechter Schüler sei. Das war nicht der Fall; umso mehr interessiert ihn, was hinter ihrem Reden steckt. Doch wenn er nachfragt, weicht sie ihm jedes Mal aus. Er tue gut daran, hat er in Büchern über Demenz gelesen, sie nichts zu fragen. Die Krankheit beschädige Erinnerungen, werfe sie durcheinander, und dabei gehe jeder Sinn verloren. Doch er kann seine Neugier nicht bezwingen. Vielleicht bekommt er irgendwann Bilder von früher, die er noch nicht kennt. Es wäre ein Ausgleich dafür, dass große Teile seiner Kindheit in der Krankheit der Mutter verschwinden.
»Faul?«, sagt er jetzt. »Der Richard? Ist der wirklich faul?«
»Faul wie die Sünde«, wiederholt die Mutter. »Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste.«
Ihr Tonfall hat jetzt etwas Verschwörerisches, und das gibt Morjan Hoffnung.
»Was ist denn das Schlimmste an ihm?«
»Dass er sich für gar nichts interessiert«, sagt die Mutter und kneift dabei die Augen zusammen. »Gibt nichts, was er mit Freude tut.« Sie tippt sich an die Stirn. »Ich hab mein Lebtag lang gewusst, was mir Freude macht. Keine Minute hab ich rumgesessen und die Wände angestarrt.«
»Das macht er? Er starrt die Wände an? «
Die Mutter schweigt und blickt zur Tür, als müsste dort jemand mit der Antwort erscheinen.
Morjan ist enttäuscht. In Wahrheit hatte er als Junge mehr Hobbys, als in sein Leben passten, und mehr, als seine Eltern bezahlen wollten, obwohl sie nicht arm waren. Dauernd brauchte er Geld für alles Mögliche. Und er war nicht faul! Er mähte bei Nachbarn den Rasen, pflückte Äpfel in den Obstgärten zwischen den Bauernhöfen und half beim Getränkeverkauf im Schützenzelt. Später gab er Nachhilfestunden.
»Faul ist wirklich schlimm«, sagt er jetzt. »Man muss für irgendetwas brennen. Was soll sonst aus einem werden?«
»Aus dem wird jedenfalls nichts, aus dem –« Wieder fehlt der Mutter ein Name.
»Dem Richard«, souffliert Morjan.
»Ja«, sagt die Mutter. »Der endet noch unter der Brücke.«
Plötzlich ändert sich ihr Gesichtsausdruck. Statt Verachtung zeigt sich jetzt Angst; das eben verscheuchte Grübeln hat zu ihr zurückgefunden. »Die haben mir«, sagt sie und sucht nach Worten. Sie sitzen dann minutenlang einander schweigend gegenüber, bis Morjan sich mit einem knappen Gruß verabschiedet.
Auf dem Flur schiebt das Pflegepersonal eine Rollstuhlkolonne zu den Aufzügen. Den meisten Alten sitzt die Maske zu tief, bei einigen verdeckt sie fast die Augen. Morjan nimmt die Treppe, Soffys Krallen machen auf den Stufen ein Geräusch, als würden in rasender Geschwindigkeit Perlen aufgefädelt. Er nimmt sich wieder einmal vor, die Mutter nicht mehr auszufragen. Er sollte die Dinge auf sich beruhen lassen. Dass ihm das so schwerfällt, beschämt ihn.
Unten im Foyer hängt seit ein paar Wochen ein gerahmtes Foto vom Eiffelturm. Er hat fragen wollen: Warum ausgerechnet Paris, hier im Pflegeheim? Aber er hat nicht gefragt. Heute hängt eine Luftschlange um den Rahmen, es ist Karnevalszeit. Draußen öffnet Morjan den SUV und lässt Soffy in den Heckraum springen. Mit der Zündung schaltet sich das Radio ein. Es geht gerade um den Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze. Ein Fachmann für Osteuropa wird interviewt. Er ist der Ansicht, der Westen müsse mit einer Invasion rechnen. Womöglich werde es bald um Sanktionen gegen Moskau gehen, zum Beispiel um die Gaslieferungen durch die neue Pipeline in der Ostsee.
Die Moderatorin will offenbar nicht, dass solche Sätze über den Sender gehen. Sie korrigiert den Fachmann: Man dürfe nicht fahrlässig von Krieg reden oder von aggressiven Akten gegen Russland. Der Mann reagiert verwirrt. Er habe doch nur gesagt, was geschehen könne. Doch die Moderatorin verabschiedet ihn rasch mit einem Tadel. »Nicht mit dem Feuer spielen!«, sagt sie. Und selbstverständlich dürfe von deutschem Boden kein Krieg ausgehen. Dann kündigt sie den nächsten Musiktitel an. Auf die Musik folgen Nachrichten. Die Inzidenzzahlen sind noch immer nicht gefallen, anders als erhofft. Der Gesundheitsminister wird mit einem O-Ton eingespielt: Wenn die Boosterimpfung nicht von genügend Menschen angenommen werde, könne die vierte Welle länger anhalten als alle bisherigen.
Zwanzig Minuten später betritt Morjan die Kanzlei. Den Anwalt Reiners begrüßt er mit Handschlag, den Käufer und seine Leute mit Faust und Ellenbogen. Der heutige Termin musste mehrmals verschoben werden, weil in der Frankfurter Zentrale das Virus grassierte. Daher gelten für die Spedition schon seit Beginn des Jahres de facto die neuen Besitzverhältnisse, die sie heute legitimieren werden. Alle nehmen Platz, nachdem sie vereinbart haben, Masken zu tragen. Nur Reiners trägt keine. Ohne Vorrede beginnt er, den Kaufvertrag vorzulesen. Der ist ausgiebig besprochen und geprüft und in Teilen bereits unterschrieben, aber jetzt müssen sie ihn alle noch einmal Wort für Wort hören. So wollen es die Regeln, und es wird dauern, denn hier wechselt ein umfangreiches Objekt seinen Besitzer. Soffy rollt sich unter Morjans Stuhl zusammen. Gleich wird sie einschlafen. Sie kann das, jederzeit; er beneidet sie darum.
Ab jetzt noch eine Viertelstunde vielleicht, dann ist Richard Morjan seine Spedition endgültig los: die Fahrzeughallen, die Lagerhallen, den neuen Logistikbereich für den Lieferdienst, den Bürotrakt, die großen Lastwagen und ihre Anhänger, die rot-gelben Kleintransporter der Küchenpost, die tausend Werkzeuge und Geräte und dazu die Dienstherrschaft über das Personal. Der Frankfurter Käufer hatte vorgeschlagen, er solle die Spedition noch ein oder zwei Jahre leiten, aber er selbst wollte den scharfen Schnitt. Ute Schütters, seit Jahren seine Stellvertretung, fungiert bereits als neue Geschäftsführerin. Der Käufer hat alle Angestellten übernommen. Das war keine freundliche Geste; tatsächlich werden alle gebraucht, neue Leute werden dringend gesucht. Irgendwann wird es Veränderungen geben, da heißt es dann: Synergien nutzen, um marktfähig zu bleiben. So macht man das als großer Fisch, wenn man einen kleineren schluckt.
In den letzten Wochen des alten Jahres hat Morjan den Übergang so unauffällig wie möglich gestaltet. Hätte er die Spedition an ein Familienmitglied übergeben, dann wären Feierlichkeiten unumgänglich gewesen, Festtagsreden über Lebenswerk und Generationenwechsel, Kontinuität und Zeichen der Zeit. Aber seine Tochter Sophia oder ein Schwiegersohn werden seine Nachfolge nicht antreten; also hat er sich aus der Spedition herausgeschlichen, wie man dem Körper unauffällig ein Medikament entzieht. Nur einen Generalschlüssel hat er behalten, als symbolische Geste, denn der Verkauf wird erst abgeschlossen sein, wenn die letzte Rate bezahlt ist.
Draußen quietschen Reifen. Der Anwalt unterbricht seinen Vortrag, und alle schauen zum Fenster, dankbar für die Ablenkung. Morjan fragt sich, wie er sich jetzt nennen soll. Ein Spediteur ist er nicht mehr, denn er hat seine Firma verkauft. Er ist auch kein arbeitsloser Speditionskaufmann, denn er sucht keine Anstellung. Und Rentner wäre er nur, wenn er eine Rente bekäme, aber die zahlt ihm niemand. Und das ist auch nicht nötig. Er muss nur halbwegs vernünftig mit dem Geld umgehen, das er jetzt bekommt, dann wird es für sein Leben reichen. Also wie soll er sich nennen? Am besten wohl einen, der in aller Ruhe darüber nachdenken kann, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen soll. Denn dafür hat Richard Morjan noch keinen Plan.
Der Anwalt fährt fort. Zum wiederholten Male nennt er den Namen der Spedition: Kleinert, Angelas Mädchenname. Der Käufer wird ihn vorerst beibehalten, denn die Firma hat einen guten Ruf in der Region. Morjan wünschte sich das anders, denn seit Angelas Verschwinden hat es ihm immer einen Stich versetzt, den Namen zu sehen, auf den Briefbögen der Firma und auf den Seitenwänden der Laster. Und bis zum Schluss gab es Leute, die glaubten, er heiße wie seine Firma.
Als Morjan Angela kennenlernte, wusste er nichts über sie. Es war im Juli 1992 in Hannover, auf dem Sommerfest der Betriebswirtschaftler, am Ende seines vierten Fachsemesters und kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag. Das Fest war gut besucht; hier trafen die BWLer ausnahmsweise Leute aus anderen Fakultäten, darunter solche, die sie Hippies nannten. Es war spät, längst schon dunkel, da kippte Angela ihm einen Becher Bier über die Hose. Sie entschuldigte sich, dann machte sie mit ihm Konversation, in der Hoffnung, er würde das als Entschädigung akzeptieren. Sie sah gut aus, und das wusste sie.
»Bist du auch BWLer?«, fragte sie.
Er bejahte das knapp.
»Macht dir das Studium Spaß?«
»Nein«, sagte Morjan. Und wie denn auch. Es sei eine Strafe, die er sich selbst auferlegt habe.
»Ach«, sagte Angela. Gerade wurde hinter ihr ein Scheinwerfer eingeschaltet. Sie warf ihre langen blonden Haare zurück und stand sekundenlang in einem Strahlenkranz wie die Figur auf einem Heiligenbild. Dann erlosch das Licht, und Morjan sah mit geschlossenen Augen bunte Flecken.
»Eine Strafe wofür?«
»Dafür, dass ich jahrelang in einer Verkleidung herumgelaufen bin. Ich wollte etwas sein, das mir wahrscheinlich nicht angemessen war.« So hatte Morjan das noch nie gesagt, und er wusste nicht, ob er log. Er schämte sich. Womöglich war das Gespräch gleich zu Ende.
Aber Angela war interessiert. »Und das BWL-Studium, das ist dir angemessen?« Sie fiel sich selbst ins Wort. »Nein, kann ja nicht, ist ja eine Strafe. Oder hab ich das falsch verstanden?«
»Nein. Das ist korrekt.« Morjan versuchte etwas komödiantisch, das durchnässte Hosenbein von seiner Wade zu ziehen.
»Und was ist dir angemessen?«
»Ich weiß es nicht. Leider. Aber ich fühle mich immer noch von der Sehnsucht beflügelt, es herauszufinden.«
»Wow«, sagte Angela. »Beflügelt! Ich weiß nicht, ob ich so was hier schon mal gehört habe.« Mit hier meinte sie: unter BWLern.
Morjan verstand sie. Seine Wade wurde rasch kalt. »Und was beflügelt dich?« Er hob beide Hände. »Wenn ich fragen darf.«
Sie warf noch einmal ihre Haare zurück. Sie waren weizenblond mit einem leichten rötlichen Schimmer, lang und dicht, und es schien, als wären sie elektrisch geladen. Ging jemand nahe an ihnen vorbei, sprangen sie ihn an und blieben haften. Morjan hatte es an diesem Abend beobachtet. Es war so faszinierend wie die elektrischen Versuche damals in Schalcks Physikunterricht. Als er es endlich selbst probieren wollte, bekam er das Bier über die Hose. Manchmal verlaufen Experimente anders als gedacht und bringen dabei bessere Ergebnisse. Schalck hatte das über Physik gesagt und einer der Lehrer an der Hamburger Kunsthochschule über Performances.
»Beflügeln«, sagte Angela noch einmal. Das Wort ließ sie nicht los. »Mich beflügelt gar nichts. Ich studiere Romanistik auf Lehramt, weil mir nichts anderes eingefallen ist.«
Morjan nickte nur. Das konnte jetzt ein Scherz sein oder ein intimes Bekenntnis. Er zog einen Notizblock aus dem Hosenbund, das letzte Relikt aus seiner Zeit an der Kunsthochschule. »Hier«, sagte er. »Schreib auf die letzte Seite, wo du ab morgen am liebsten wärst. Dann schlag den Block zu und gib ihn mir zurück.«
»Warum?«
»Nur so. Ich schreibe auf die vorletzte Seite, wo ich ab morgen am liebsten wäre. Und dann vergleichen wir.«
Angela lachte, nahm den Block, wandte sich ab und schrieb, dann gab sie ihn zurück. »Aber nicht reingucken!«
Morjan schrieb »Kalifornien« und hielt ihr die Seite hin.
»Nicht sehr originell«, sagte Angela. »Meins aber auch nicht.« Sie schlug die letzte Seite auf: »Australien«. Sie erklärte es. Da lebe ihre Schulfreundin Ulrike.
»Und was machen wir jetzt?«
»Na was schon?«, sagte Morjan. »Das liegt doch in der Natur der Sache. Wir verbinden Australien und Kalifornien mit einer Linie, und wo die Mitte ist, da fahren wir zusammen hin.«
Angela lachte. »Okay. Und wann?«
»Du kannst fragen! Natürlich morgen. Aber jetzt brauchen wir eine Weltkarte. Im Flur von unserem Institut hängt eine.« Sie maßen die Entfernungen auf der Karte mit ihren Händen. Danach lag die gesuchte Mitte im Tschad. Drei Tage später brachen sie auf. Sie trampten, doch das lief schlecht, und sie mussten die Bahn nehmen. Sie schafften es noch mit der Fähre bis Syrakus, aber dann ging ihnen das Geld aus. Doch sie gaben nicht auf. Morjan fand einen Job in einem Hotel. Sein Lohn bestand darin, dass Angela und er in einer winzigen Abstellkammer schlafen durften. Außerdem bekam er Frühstück und eine warme Mahlzeit pro Tag, die sie sich teilten.
Angela traf es besser. Sie besorgte einen Reiseführer und bot sich deutschen Touristen vor ihren Hotels als Guide an. Um Probleme mit den einheimischen Fremdenführern zu vermeiden, bat sie, man möge sie notfalls als Familienmitglied ausgeben. Das funktionierte sehr gut. Sie trug abgeschnittene Jeans und eine weiße Bluse. Ihr Haar, das in der Sonne noch mehr strahlte, hatte sie zu einer Hochfrisur aufgesteckt, aus der sich in der Meeresbrise einzelne Strähnen lösten. Wenn es möglich war, blieb Morjan bei ihren Führungen in der Nähe, ohne sich zu zeigen.
Nach zwei Wochen hatten sie zusammen, was sie für die Überfahrt brauchten. Weiter wollten sie nicht denken. Morjan trug alles Geld ständig in einem Brustbeutel bei sich, und genau das war ein Fehler. Spät in der Nacht, auf dem Weg vom Hafen, wo sie mit anderen Trampern gefeiert hatten, wurde er ausgeraubt. Damit war ihr Abenteuer zu Ende; darüber mussten sie nicht diskutieren. Sie arbeiteten noch ein paar Tage, bis es für ein Zugticket nach Deutschland reichte. Damit fuhren sie beide, indem sie die Kontrolleure nach Kräften täuschten. In München wurden sie erwischt, einer hätte den Zug verlassen müssen. Sie taten es beide und brauchten noch zwei weitere Tage, um zurück nach Hannover zu trampen.
Die Reise war ein Desaster, und es wäre kein Wunder gewesen, hätten sie sich danach getrennt und sogar vermieden, sich überhaupt noch einmal zu sehen, um bloß nicht an ihre Verrücktheit erinnert zu werden. Doch das Gegenteil war der Fall. Denn jetzt glaubten sie beide zu wissen, was sie beflügelte. Es war weder Australien noch Kalifornien oder etwas dazwischen. Es war vielmehr: zusammen zu sein, so oft und so lange wie möglich. Auf der Rückfahrt hatten sie es beschlossen. Sie wollten ab sofort einander in der Nähe wissen, sie wollten über alles reden, an einem Tisch sitzen und in einem Bett schlafen.
Allzu schwierig war das nicht. Sie waren keine Königskinder, die ein tiefes Wasser trennte. Sie hätten sich ein Zimmer in derselben WG oder eine kleine Wohnung suchen können. Morjan war sechs Jahre älter als Angela, aber wegen seiner Zeit in Hamburg würden ihre Abschlüsse ungefähr zusammenfallen. Mit etwas Glück bekäme er einen Job in derselben Stadt, in der Angela ihr Referendariat machte. Allerdings würde es Jahre dauern, bis ihr Ideal des ständigen Miteinanders vollständig erreicht wäre. In der Zwischenzeit könnte es Probleme geben, und mit einem Scheitern musste man immer rechnen.
Also nahmen sie eine Abkürzung. Kaum wieder zu Hause, rief Angela bei ihren Eltern in Unna an und teilte ihnen mit, sie wolle ihr Studium aufgeben und Speditionskauffrau werden, natürlich mit der Perspektive, später die elterliche Firma zu übernehmen. Der Vater fiel aus allen Wolken. Natürlich hatte er sich sein einziges Kind als Erbin für die Firma gewünscht, aber Angelas Interesse an der Spedition war immer gleich null gewesen. Alles Reden über eine Nachfolge hatte in Streit geendet, schließlich war er still geworden. Und nun sollte doch alles in seinem Sinne geschehen? Er konnte es kaum glauben. Angelas einzige Bedingung war, dass Richard sofort in der Firma angestellt würde, vielleicht als Fahrer. Noch am Telefon erklärte sich der Vater einverstanden.
Sie heirateten im Spätsommer 1992, noch in Hannover. Die standesamtliche Trauung war knapp und sachlich, ohne Feier und ohne Gäste, nicht mehr als ein notwendiger Schritt zum eigentlichen Ziel ihrer Wünsche. Als die Standesbeamtin fragte, welchen Namen sie nach der Trauung annehmen wollten, war Morjan überrascht. Darüber hatten sie gar nicht geredet. Da sagte Angela, sie wolle Morjan heißen; das sei doch irgendwie besser als Kleinert. Es klang wie ein Scherz. Später einmal nannte sie ihren wahren Beweggrund: Sie wollte ihren Eltern nicht noch weiter entgegenkommen.
Am Morgen nach der Hochzeitsnacht in Angelas Studentenwohnheim packten sie ihre Habe in einen geliehenen Bulli und fuhren nach Unna. Dort zogen sie in eine kleine Wohnung, ganz in der Nähe der Spedition. Das schlichte Mehrfamilienhaus gehörte der Firma, sie zahlten eine geringe Miete. Um der Familie eine Freude zu machen, heirateten sie ein paar Wochen später kirchlich. Angela trug zur Trauung ein langes weißes Kleid, ihre Haare waren zu einer kunstvollen Frisur arrangiert, in der kleine farbige Blüten steckten. So sahen Morjans Eltern ihre Schwiegertochter zum ersten Mal, als das Brautpaar an der Kirche ankam. Seine Mutter weinte während der ganzen Zeremonie, seinem Vater war das peinlich.
Morjan schaut auf die Uhr. Im Vortrag des Anwalts geht es gerade um die Modalitäten des Geldtransfers, also ist ein Ende abzusehen. Soffy schnarcht leise, er weckt sie mit einer sanften Berührung.
Vierzehn Jahre lang funktionierte das Projekt des totalen Miteinanders, bis auf die kurze Krise vor Sophias Geburt. Mehr noch, es wurde ein großer Erfolg. Nach weniger als einem halben Jahr als Lkw-Fahrer begann Morjan ebenfalls eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. Angelas Vater war begeistert vom Elan seines Schwiegersohns und half ihm, wo er konnte. Allmählich und ohne jeden Konflikt übernahmen Morjan und Angela die Leitung der Spedition. Der Vater zog sich schrittweise und unauffällig aus dem Tagesgeschäft zurück. Sein größter Wunsch war erfüllt worden, jetzt wollte er nichts verderben. Außerdem war er gesundheitlich angeschlagen.
In Angelas Familie und in der Spedition erfuhr niemand etwas über Morjans Zeit an der Hamburger Kunsthochschule. Hier war und blieb er der BWL-Student, der seiner Liebe wegen eine Karriere im Management aufgegeben hatte, um Lastwagenfahrer in einer kleinen Stadt am Rande des Ruhrgebiets zu werden. Dazu passte, dass er und Angela ein ungewöhnliches Paar waren: miteinander so eins wie mit ihrem Betrieb. Nie hatten sie Streit, immer ging es um die beste Lösung, und wichtig war nicht, wer recht bekam, sondern, dass es voranging. Und das tat es; das Unternehmen veränderte sich rasch. Sie erweiterten es um eine Umzugsfirma, die eine neue Art von Service anbot. Wer mit Kleinert umzog, mietete nicht bloß einen Lastwagen und ein paar starke Männer. Vielmehr gab er sein Projekt in die Hände von Logistikexperten, die alles minutiös planten und durchführten. Es gab Spezialisten für den Ab- und Aufbau von Möbeln und fürs Verpacken von empfindlichen Sachen. Ständig war ein Teamchef vor Ort, der die Kunden über alles informierte.
Einen besonderen Coup landeten sie, als sie junge Frauen in Fitnessstudios im ganzen Ruhrgebiet anwarben. Bei den Umzügen wurden sie so eingesetzt, dass sie die körperliche Anstrengung als bezahltes Krafttraining auffassen konnten. Die Geschäftsidee dahinter ging auf. Wenn das Umzugsteam anrückte und es war eine Frau dabei, entspannten sich die Kunden vollends. Ihre Mundpropaganda war unbezahlbar. Unter den jungen Frauen waren einige Spätaussiedlerinnen aus Osteuropa. Eine von ihnen, Anastasia, wechselte später in eine Festanstellung als Teamleiterin. Mit rauchiger Stimme und schroffem Akzent gab sie ihre Anweisungen; womöglich aber spielte sie nur in der Spedition und für die Kunden die Russin. Schließlich waren Kleinert die Ersten in der Stadt, die privaten Lagerraum auf Zeit anboten. Den Text der Werbespots, die im Lokalradio liefen, schrieben Morjan und Angela selbst. Für die Kinowerbung gingen sie vor die Kamera und spielten ein komisches Scheidungspaar, das nicht weiß, wohin mit seinen Möbeln.
Das Wort, das auf dem Sommerfest der BWLer gefallen war, hatte es getroffen: Vierzehn Jahre lang lebten Morjan und Angela wie von Flügeln getragen. Am Anfang hatten sie noch geglaubt, sie arbeiteten nur für die freie Zeit, die sie miteinander verbringen wollten. Also machten sie, in Erinnerung an ihren ersten, gescheiterten Trip, fantastische Reisepläne, darunter die Wiederholung ihrer Reise zur Mitte zwischen Australien und Kalifornien. Aber dazu kam es nie. Vom ersten Tag an waren sie völlig zufrieden, wenn sie abends zusammen in ihrer kleinen Küche saßen, Angela aus dem Büro berichtete und Morjan von der Arbeit auf der Straße. Als das Umzugsgeschäft hinzukam, traf er ständig auf Menschen, deren Leben sich gerade veränderte, manchmal sehr radikal. Seine Erzählungen am Küchentisch handelten von kuriosen Zufällen, von Schicksalsschlägen und oft genug vom Tod. Angela stellte ihm Fragen. Wenn sie schon nicht dabei war, wollte sie sich alles so genau wie möglich vorstellen können. Oft genug vergaßen sie darüber, dass sie eigentlich hatten ausgehen wollen. Meistens lagen sie nicht lange nach zehn zusammen im Bett. Und wenn nicht einer von ihnen krank war, schliefen sie miteinander, mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit und ohne besondere Ansprüche.
Endlich ist Reiners am Ende des Vertrags angekommen. Er betont noch einmal die speziellen Regelungen für den Geldtransfer, dann sieht er sich um, als erwartete er Beifall. Morjan und der Käufer nicken lebhaft, als Ersatz für das dankbare Lächeln, das man hinter den Masken nicht sieht. Ein Anwaltsgehilfe breitet die Papiere aus, sie unterschreiben in der angegebenen Reihenfolge. Soffy steht bereits an der Tür. Morjan verabschiedet sich von allen mit der Faust. Den Satz, der Käufer könne sich jederzeit an ihn wenden, wenn es Probleme gebe, schenkt er sich. Man wird ohne ihn zurechtkommen, egal, was die Pandemie noch bringt.
Der Weg zum Parkhaus führt durch die Einkaufsstraßen. Noch immer drückt die Seuche auf die Stimmung, die das A und O des Wirtschaftslebens ist. Vor ein paar Wochen hatte der Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft kommentiert; von Katastrophe war die Rede und von flächendeckender Existenzvernichtung. Einen Moment lang fühlt Morjan das Glück, nach dreißig Jahren aus dem Wirtschaftsleben entlassen zu sein, aber sofort fällt ihm ein, dass er ohne dieses Wirtschaftsleben nicht wäre, was er jetzt ist: ein freier Mann.
Er schaut sich um. Er kennt diese Stadt besser als die meisten, die hier geboren sind. In Hunderten von Häusern und Wohnungen ist er schon gewesen. Gleich hier, in bester Lage, war früher eine Kunsthandlung. Die Spedition hat sie nach dem Tod des Besitzers ausgeräumt. Bis zuletzt war der alte Mann bei seinen Bildern geblieben, weil er sich ohne seine Frau zu Hause einsam fühlte. Jetzt ist hier ein Burgerladen. Es geht auf sechs Uhr, Morjan spürt Hunger. Er mag Restaurants nicht sehr, und er kocht ganz passabel, aber seit Angela und Sophia nicht mehr da sind, muss er sich dazu zwingen. Manchmal kommt es ihm absurd vor, den Aufwand für sich allein zu treiben. Dann hört er mit dem Kochen auf und wirft alles in den Müll. Später schämt er sich dafür.
Der Burgerladen gehört zu einer Kette. Man sitzt in einem Wald aus Birkenstämmen wie in der Dekoration eines Theaterstücks für Kinder. So ähnlich hatte die Bühne in Sophias Kita ausgesehen, als sie das Märchen von Hänsel und Gretel aufführten. Niemand will einen Impfnachweis sehen, und Morjan sucht sich einen Platz. Die junge Bedienung duzt ihn, und er bestellt zur Sicherheit das Teuerste von der Karte.
»Bring ich dir«, sagt die junge Frau. »Und Wasser für den süßen Hund?«
»Das ist die Soffy«, sagt Morjan.
»Cute.«
In Morjans und Angelas Plan vom totalen Miteinander gab es von Beginn an eine weiße Stelle: Was war mit Kindern? Würde ein Kind ihr bedingungsloses Miteinander vertiefen oder würde es stören? Ein paar Jahre lang hatten sie das Thema ausgespart. Alles lief gut, und wäre es nur nach Morjan gegangen, hätte alles genau so weiterlaufen können. Doch dann erschien das Kinderthema, nicht etwa allmählich in ihren Gesprächen, es brach vielmehr aus Angela hervor, und im Gegensatz zu allen anderen ließ es sich nicht diskutieren.
Bei Sophias Geburt im Dezember 1999 war Angela einunddreißig, beinahe noch jung für eine Erstgebärende. Morjan hingegen fühlte sich schlagartig alt. Sieben vollgepackte Jahre lang waren Angela und er gleichermaßen Ehepartner wie Geschäftspartner gewesen. Er wusste kaum noch, wie er vorher gelebt hatte. Alles davor war ausgewischt, ersetzt durch ein Leben in einem mittelständischen Unternehmen, womöglich banal und sicherlich weit entfernt von den großen Fragen des Geistes, dafür auf seine Art und Weise absolut perfekt.
Und es kam, wie Morjan es geahnt hatte: Sophia bereitete diesem Leben ein Ende. Die Spedition, die er nur kurz als Mittel zum Zweck betrachtet und dann zur Bühne seines Lebens gemacht hatte, verlor ihren Nimbus, ihren Zauber, weil immer und überall ein kleiner Mensch mit seinen Forderungen beachtet werden wollte. Während Angelas Schwangerschaft hatten sie geplant, wie sie Beruf und Familie unter einen Hut bringen würden. Angelas Arbeit in der Spedition sollte umverteilt werden; eine Leiharbeitsfirma würde eine Aushilfskraft schicken. Möglichst bald sollte dann eine Kinderfrau engagiert werden, damit wieder alles so sein könnte wie früher.
Daraus wurde nichts. Angela blieb anderthalb Jahre lang zu Hause. Als sie endlich ins Büro zurückkehrte, tat sie es widerwillig und nur für halbe Tage. Eine Kinderfrau wurde eingestellt, doch an deren drittem Arbeitstag brach Sophia sich auf dem Spielplatz den Arm. Angela machte sich die schlimmsten Vorwürfe, entließ die Kinderfrau und blieb ganz zu Hause. Inzwischen hatte sich die Leiharbeitskraft Ute Schütters, damals kaum dreißig, als ausgesprochen kompetent erwiesen. Sie war resolut, wenn nötig sogar streng, und sie vertrug den rauen Tonfall der Fahrer. Sie gaben ihr eine feste Stelle, und seitdem fungierte Angela in ihrer eigenen Firma nur noch als gelegentliche Urlaubsvertretung.
Morjan versuchte damals, alles neu zu justieren. Er wollte optimistisch sein. Dann würden sie eben die Firma, ihre Ehe und dazu ihre Elternschaft zu einem perfekten Ganzen machen. Er versuchte, möglichst oft zu Hause zu sein, aber dem waren Grenzen gesetzt. Gelang es ihm, sich schon am frühen Nachmittag freizumachen, packten sie hastig ihre Sachen und zogen mit Sophia los, in den Zoo, zum Ponyhof, in den Märchenwald, Morjan mit der festen Absicht, sich ganz auf seine Frau und sein Kind zu konzentrieren. Doch dann kamen Anrufe, er musste Entscheidungen treffen, und das sorgte für schlechte Stimmung, obwohl Angela doch wusste, was der Betrieb verlangte und dass manches davon nicht zu diskutieren war. Sie selbst schien keinen Verlust zu spüren, vielleicht weil das Muttersein sie für alles entschädigte. Oder weil sie die Spedition im Grunde nie gewollt hatte.
Nach Sophias Geburt waren sie umgezogen. Angelas Vater tat damals gerade den letzten Schritt aus der Firma und übersiedelte mit seiner Frau an die Ostsee, auch aus gesundheitlichen Gründen. Morjan und Angela übernahmen den Betrieb und das Haus der Schwiegereltern, einen großen, L-förmigen Bungalow am Stadtrand, gebaut im leicht überdrehten Stil der frühen Siebzigerjahre. Angela ließ ein paar der modischen Spielereien beseitigen. Die undichten Oberlichter im Flur des Schlaf- und Kindertraktes wurden geschlossen, stattdessen gab es dort zwei neue Fenster mit Blick in den Garten, auf die Terrasse und die Panoramascheibe des Wohnzimmers. Sophia bekam ein eigenes Reich, eine Art Einliegerwohnung. Aus den zwei Kinderzimmern wurden ihr Spielzimmer und ihr Schlafzimmer, durch eine Tür verbunden. Sie hatte sogar ihr eigenes Bad.
Soffy hat ihr Wasser auf dem Boden verteilt, da kommt der Burger mit dem abenteuerlichen Namen. Die Bedienung erklärt Morjan seine Bestellung, als wäre er ein Mitbewohner in ihrer WG. Er antwortet im selben Tonfall der ewigen Jugend, den er in seinen Hamburger Jahren gelernt hat.
Im August 2006 sollte Sophia eingeschult werden, doch ein paar Wochen davor geschah etwas für Morjan völlig Unerwartetes. Beim Frühstück sagte Angela, dass er Sophia heute nicht zur Kita bringen müsse. Das Mädchen war noch in seinem Zimmer. Er fragte nach dem Grund. Angela antwortete ausweichend und sah ihm nicht in die Augen. Das war so gar nicht ihre Art. Morjan wollte nachfragen, aber er musste los. Im Auto überkam ihn ein Gefühl, das er nicht kannte und für das er kein Wort hatte. Er wollte Angela aus dem Büro anrufen, doch er kam nicht dazu, und erst spätabends war er wieder zu Hause. Er wollte freimütig von seinem Gefühl erzählen, doch in der Haustür beschloss er, damit bis morgen zu warten. Vielleicht war es bis dahin verschwunden.
Im Haus war es still, und es brannte kein Licht. Angela war nicht da, Sophia auch nicht. Angelas Handy war ausgeschaltet. Ihre Schränke waren leer, alle Koffer fehlten, und schließlich fand Morjan eine Nachricht, ein Post-it mit drei Wörtern: »Such uns nicht!«
Sein erster Gedanke war, dass Angela mit einem anderen Mann auf und davon war. Wer konnte davon wissen, wen konnte er fragen? Er machte ein paar vorsichtige Telefonate, die nichts ergaben. Angelas Eltern waren so überrascht und ahnungslos wie er, jedenfalls sagten sie das, und er glaubte ihnen. Also wartete er, sein Handy immer in der Tasche und auf laut gestellt. Nach zwei Tagen hätte er eine Vermisstenanzeige aufgeben können, doch es gab keine Anzeichen für ein Verbrechen, und Angela konnte selbst bestimmen, wo sie sich aufhielt. Es blieb ihm nur ein Weg, sie zu finden: Er musste Strafanzeige wegen Kindesentzugs stellen. Niemand konnte ihm verwehren, seine Tochter zu sehen, auch nicht die Mutter. Die Polizei wäre verpflichtet gewesen, nach ihr zu fahnden. Aber Morjan hielt weiter still.
Nach zwei Wochen kam das Schreiben eines Anwalts. Es enthielt Angelas Angebot: Sie würde Morjan ihre Hälfte der Spedition für eine eher geringe Summe überlassen, wenn er im Zuge der Scheidung auf sein Sorgerecht verzichtete. Sie wolle die Firma nicht ruinieren, und einen scharfen Schnitt halte sie in der gegebenen Situation für das Beste. Das alles war in einem sterilen Juristendeutsch formuliert, hinter dem Morjan nichts erkennen konnte, weder Angela noch irgendeine Geschichte.
Das Angebot war ungeheuerlich. Der Anwalt Reiners riet Morjan, sich auf nichts einzulassen. Der Vorschlag, ihm das Sorgerecht praktisch abzukaufen, diskreditiere Angela als Mutter. Womöglich könne man den Spieß umdrehen und ihr das Sorgerecht entziehen. Doch Morjan hörte gar nicht richtig zu. Seit Angela und Sophia fort waren, war ein Ton in seinem Kopf, der lauter und leiser wurde, aber niemals aussetzte, auch nicht, während er mit Kunden oder Mitarbeitern sprach, und nicht einmal, wenn er schlief; das kam ihm jedenfalls so vor. Es war schwer, gegen diesen Ton anzukommen. Seinen Alltag konnte er einigermaßen meistern, aber wenn er an seine Zukunft denken wollte, verhinderte das der Ton. Als er endlich den ersten klaren Satz über seine Lage formulieren konnte, musste er den Ton überschreien. Der Satz lautete: Wenn ich für mein Recht kämpfe, bedeutet das Krieg.
Eines aber wusste Morjan: Er wollte keinen Krieg. Den Krieg in Familien kannte er zu gut. Wie oft hatte er Häuser und Wohnungen ausgeräumt, in denen Ehen gescheitert und Familien zerbrochen waren. Manchmal stritten die Leute noch, während das Umzugsteam schon bei der Arbeit war. Einmal stand ein junges Paar in den sich leerenden Räumen eines neu gebauten Hauses, stumm und reglos, doch Morjan fürchtete, sie könnten einander plötzlich Gewalt antun. Er blieb bei ihnen, bis sie endlich aufbrachen und getrennter Wege gingen.
Dergleichen musste er verhindern. Morjan war sich sicher, dass Sophia ein gutes Bild von ihm hatte, und das wollte er nicht beschädigen. Was geschehen war, war geschehen; jetzt galt es, den Schaden zu begrenzen. Also willigte er in Angelas Vorschläge ein. Der Anwalt Reiners gab seinen Widerstand auf. Vielleicht, sagte er, sei es tatsächlich das Beste für alle Beteiligten. Die Formalitäten wurden in kürzester Zeit erledigt, Morjan nahm einen Kredit auf und zahlte. In dem viel zu großen Bungalow mit dem verlassenen Kindertrakt blieb er wohnen; für den Fall, dass alles sich als Spuk und Irrtum herausstellen würde, wollte er an Ort und Stelle sein.
Der Burger schmeckt nicht schlecht. Morjan fragt sich nur, warum seine Bestandteile zu einem gewaltigen Turm aufgeschichtet sind, den man wieder abbauen muss, um sie essen zu können. Ein Zwang zur Entschleunigung? Eine subtile Kritik an der Fast-Food-Kultur? Vielleicht könnte man daraus eine Performance entwickeln. Jemand zerlegt auf der Bühne einen riesigen Burger, während der Chor des Personals im Sprechgesang die Herkunft der Bestandteile erklärt. Nach und nach kommen die Tiere und Pflanzen auf die Bühne, die ihren Beitrag geleistet haben. Beinahe hätte Morjan laut gelacht, da fragt ihn ein junger Mann, ob der Platz an seinem Tisch noch frei ist.
Das ist ungewöhnlich, nicht nur in Zeiten der Pandemie, aber Morjan macht eine einladende Geste; er will in diesem jugendlichen Ambiente nicht als alter Mann dastehen. Soffy muss ein Stück zur Seite rücken, was sie ungern tut, denn dort ist der Boden nass. Der junge Mann setzt sich und bestellt, ohne vorher in die Karte zu sehen.
Monatelang hatte sich Morjan damals gefragt, warum ihm das zugestoßen war. Natürlich wusste er, dass auch Unerwartetes geschieht. Selbst das Unwahrscheinlichste ist nicht unmöglich, das erlebte er bei seiner Kundschaft immer wieder. Aber waren er und Angela nicht einander in die Arme gelaufen, als hätte das jemand arrangiert? Mag sein, ihre erste Begegnung hatte etwas von einer albernen Komödie, ebenso die verrückte Reise. Aber was man selbst erlebt, kann doch niemals bedeutungsloser Kitsch sein. Morjan hatte diesen grandiosen Anfang jedenfalls immer als Garantie dafür angesehen, dass alles gut bleiben würde, solange er nur wollte. Die Monate vor der Schwangerschaft mochten schwierig gewesen sein, aber sie waren doch überwunden, als Sophia auf Angelas Bauch lag. Und war auch die Zeit danach nicht nach seinem Geschmack gewesen, überall Abstriche, Halbheiten, misslungene Improvisationen, so war er doch letzten Endes damit zurechtgekommen. Aber jetzt stand es fest: Eine Garantie hatte es nie gegeben.
Auch nach dem Verkauf der Firma verging die Zeit ohne ein Lebenszeichen von Angela. Morjans Schwiegereltern machten ihn schließlich für alles verantwortlich, mit abwegigen Argumenten. Sie brachen den Kontakt zu ihm ab. Ob sie jemals von ihrer Tochter und ihrer Enkelin gehört, ob sie sich getroffen haben, weiß er nicht. Vor ein paar Jahren sind sie gestorben, davon hat er durch den Anwalt erfahren. Seine eigenen Eltern hielten zu ihm, doch sie hatten wenig Übung darin, über Liebe und Glück zu reden. Außerdem erkrankte der Vater kurz nach Angelas Flucht; seine Hinfälligkeit war als Dauerthema schon schwierig genug. Nach seinem Tod verbrachte die Mutter ihre Tage damit, das viel zu große Haus zu hüten. Wenn Morjan sie besuchte, redete sie ausschließlich über ihren Kleinkrieg mit den Handwerkern. Alle anderen Themen vermied sie, besonders das Verschwinden ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkelin. Es dauerte lange, bis Morjan begriff, dass sie ihn nicht schonen wollte, sondern alles zu vergessen begann.
Freunde, mit denen er über alles hätte reden können, besaß Morjan nicht. So gut er sich in Unna auskannte, war er doch fremd hier. Seine Bekannten waren zumeist Angelas Jugendfreunde. Da sie vermutlich Loyalitätsprobleme hatten, ging er ihnen aus dem Weg. Nur in der Spedition, die jetzt ihm allein gehörte, fühlte er sich gut aufgehoben. Hier hatte sich nichts verändert, hier konnte er bleiben, was er immer gewesen war: der freundliche, sachliche Chef, zu dem seine Angestellten ein gutes Verhältnis hatten, wenngleich ein distanziertes, trotz des gebräuchlichen Du.
Der junge Mann gegenüber bekommt jetzt, was er bestellt hat. Morjan sagt: »Guten Appetit.«
»Danke.« Der junge Mann schiebt sein Holzbrett zur Seite. Er legt einen Zettel vor Morjan auf den Tisch. »Ich hab da was für Sie.« Auf dem Zettel steht eine Internetadresse, darunter eine Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
»Und was soll ich bitte damit?« Morjan bleibt freundlich, wie er es beim Umgang mit schwieriger Kundschaft gelernt hat.
»Das ist etwas nur für Sie, für Sie ganz persönlich«, sagt der junge Mann. »Sie werden es lieben, Sie werden geradezu süchtig danach werden. Das verspreche ich Ihnen.«
»Ich habe keinen Bedarf an Schweinereien.« Morjan hebt kaum die Stimme. »Gehen Sie, dann vergesse ich das hier. Oder ich zeige sie an.«
Der junge Mann schiebt den Zettel noch etwas weiter in Morjans Richtung. Er scheint nicht aufgeregt. »Die Polizei wird sich dafür nicht interessieren. Sie werden sich nur lächerlich machen.« Er legt einen Zwanzigeuroschein auf den Tisch und wickelt seinen Burger in eine Serviette.
»Aber machen Sie sich keine Sorgen«, sagt er. »Noch bin ich nicht beleidigt. Ich wette, wir kommen ins Geschäft. Einstweilen einen schönen Tag. Und genießen Sie Ihre neue Freiheit.« Er steht auf und geht, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Der letzte Satz hat Morjan nicht besonders beunruhigt. Jemand will ihm etwas verkaufen und hat offenbar in Erfahrung gebracht, dass er flüssiges Geld besitzt. Das ist nicht ungewöhnlich. Er isst in Ruhe zu Ende, Soffy bekommt ein paar Stücke von dem fettgetränkten Brot. Den Zettel steckt er ein, als er geht.
2.
Dienstag, 15. Februar 2022. Gegen sechs Uhr früh wacht Morjan auf, doch er weiß nicht, wer er ist. Er fühlt nur, was er ist. Name, Beruf und dergleichen fehlen; doch da ist die starke Gewissheit, er selbst zu sein, jemand, der dieses mag und jenes nicht, der weiß, wozu er Abstand hält und was ihn mit der Welt verbindet. Und eines ist klar: Nie war er jemand anderes; er ist unverwechselbar und unveränderlich. Der Zustand dauert ein paar Sekunden oder nicht einmal eine. Dann erscheinen sie: sein Name und seine Vergangenheit, der gestrige Tag, seine Pläne, Wünsche und Ängste. Das alles legt sich um den gewichtslosen Kern seiner Person und drückt ihn tief in sein Bett.
Das passiert in letzter Zeit häufig. Und wie immer endet es auch diesmal damit, dass ihm aufgeht: Er ist kein junger Mann mehr, vor dem die Zukunft liegt wie eine flache Landschaft, die bis zum Horizont reicht. Demnächst wird er sechzig. Wenn er sich übelwollte, könnte er sagen: Ich bin nichts als ein reicher alter Mann.
Morjan steht auf, obwohl es noch so früh ist. Barfuß geht er durch den schmalen Flur, ohne das Licht einzuschalten, dann durch die Halle vor der Haustür; dieses pompöse Wort hatten sie von den Schwiegereltern übernommen. Soffy sitzt in der offenen Tür zum Küchentrakt. Ihre Körperhaltung drückt Erstaunen aus, Abweichungen vom Tagesplan irritieren sie. In der Küche schaltet Morjan das Licht an und füllt ihre Näpfe, doch sie frisst nur zögernd, wohl aus Sorge, etwas falsch zu machen. Dass es Soffy gibt, ist jetzt ein noch größeres Glück als zuvor. Sicher hat sie bemerkt, dass es morgens nicht mehr in die Spedition geht, aber es scheint ihr nichts zu fehlen. Zum Ausgleich sind ihre gemeinsamen Spaziergänge länger geworden, zumal der Winter mild und trocken bleibt.
Im Bad betrachtet Morjan sein Spiegelbild. Er hat darüber nachgedacht, sich einen Bart wachsen zu lassen, als äußeres Zeichen dafür, dass er jetzt nicht mehr Teil des Wirtschaftslebens ist. Aber anders als zu seiner Jugendzeit stehen Bärte nicht mehr für Opposition oder Verweigerung. Also drückt er Rasiercreme in den Pinsel und schlägt Schaum in der hohlen Hand, wie er es seit seiner BWL-Zeit jeden Morgen tut. Als er mit dem Rasierer die erste Bahn zieht, fällt ihm der Zettel ein, auf dem die Adresse von etwas stehen soll, das nur für ihn bestimmt ist, das er lieben und nach dem er süchtig wird. Er rasiert sich in Ruhe zu Ende, doch statt zu duschen, geht er zur Garderobe in der Halle.
Der Zettel steckt in seinem Jackett. Morjan trägt ihn in den Raum, den er sein Büro nennt, Sophias ehemaliges Spielzimmer. Wo sich früher bunte Kindermöbel und sorgfältig ausgesuchte Spielsachen drängelten, stehen jetzt ein nüchterner Schreibtisch und schlichte Regale. Ein Jahr nach Angelas Flucht, als seine Hoffnung auf ein gutes Ende erloschen war, hatte er Sophias Spielzeug in Umzugskartons verpackt und der Caritas gespendet. Ihre Möbel stellte er frühmorgens an die Straße, ordentlich arrangiert, sodass es aussah, als wohnte ein Kind auf dem Gehsteig. Passanten betrachteten kopfschüttelnd das Arrangement. Noch bevor der Sperrmüllwagen eintraf, holten Müllsammler alles ab, und der Gehsteig war wieder leer. Fotos existieren davon keine. Später räumte Morjan das Elternschlafzimmer aus. Die Möbel zersägte er, bevor er sie an die Straße stellte. War ein Raum leer geräumt, hatte er ihn neu gestrichen. Die Pastellfarben verschwanden unter einem gut deckenden Weiß. Nur den bunten Fries im Spielzimmer musste er mehrfach übermalen. Bei entsprechendem Licht erkennt er immer noch das flache Relief, eine Zirkusparade mit Artisten, Clowns und Tieren. Sophias Schlafzimmer gleich nebenan steht seit damals leer; es wird regelmäßig geputzt, ebenso ihr Bad. Manchmal steht Morjan dort vor dem Waschbecken. Heute wäre es für Sophia viel zu niedrig.
Während er seinen PC hochfährt, fällt ihm ein, dass hinter der Adresse vom Zettel ein Virus stecken könnte. Er steigt hinunter in den Keller. Hier hat er nach Angelas Flucht eine Werkstatt eingerichtet, zwei stabile Werkbänke und ein Arbeitstisch, darüber hängen die Werkzeuge an den Wänden. So eine Werkstatt hatte Morjan sich in Hamburg immer gewünscht und natürlich nicht leisten können. Allerdings hat er in den letzten vierzehn Jahren nicht viel Zeit hier unten verbracht, die Arbeit ließ es nicht zu. Seit dem Verkauf der Firma ist er öfter hier, doch dann sitzt er nur am Arbeitstisch und sortiert Material, oder er prüft, ob die elektrischen Geräte funktionieren.
Der Laptop, eigens für die Werkstatt angeschafft, ist inzwischen in die Jahre gekommen; er fährt so langsam hoch, als würde er aus einem Winterschlaf geweckt. Morjan gibt die Adresse vom Zettel ein, es ist ein Fantasiewort, er muss Buchstabe für Buchstabe abgleichen. Er zögert kurz. Nein, kein Verlust, wenn das Gerät verseucht wird. Dann drückt er auf Enter, und es erscheint eine schwarze Seite mit einem Eingabefeld. Er tippt das Passwort, eine zwölfstellige Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
Der Bildschirm wird vollkommen schwarz, dann erscheint das Standbild eines Videoclips. Quer darüber steht »1/5«. Morjan startet. Es ist eine alte Aufnahme, wahrscheinlich die Digitalisierung eines Super-8-Films. Die Schärfe wechselt ständig, bisweilen ist das Bild verschwommen oder verwackelt. Die Kamera bewegt sich ruckartig, die meisten Schwenks sind viel zu schnell. Ein Profi war hier nicht am Werk, aber egal, Morjan erkennt, was der Film zeigt: ihn selbst, sieben oder acht Jahre alt, inmitten einer Gruppe von Kindern auf ihrem Schulweg entlang der Dorfstraße. Die Kamera begleitet sie, umkreist sie und nähert sich gelegentlich dem einen oder anderen. Morjan erinnert sich an ihre Namen: Hans-Gerd von gegenüber, Michael, Ronald, Jutta und Marianne; zu dem dritten Mädchen fehlt ihm der Name, aber er weiß, wo sie wohnte.
Es gibt keine Tonspur, aber offenbar reden die Kinder, und sie sind kaum imstande, ihre Blicke von der Kamera zu wenden. Also stolpern sie gegeneinander und schubsen sich weg. Morjan fühlt sich an die Arbeiten der Videokünstler in Hamburg erinnert, denen es immer darauf ankam, dass nichts gestellt war. Der Clip dauert etwas über drei Minuten. Bei zwei Minuten und vierzig Sekunden rechnet er mit nichts Neuem mehr, da fährt die Kamera auf ihn zu, kommt ihm so nahe wie noch keinem Kind zuvor, und in den letzten Sekunden spricht er hinein. Sein Gesicht füllt das Bild. Dann ist Schluss.
Morjans Eltern besaßen keine Filmkamera. Der Vater fotografierte, nicht sehr engagiert und eigentlich nur, um ihren Wohlstand zu dokumentieren. Wer sonst könnte den Film gedreht haben? Es fällt ihm niemand ein. Nur eins steht fest: Er hat ihn niemals gesehen. Er selbst im Film, das wäre damals eine Sensation gewesen. Daran würde er sich erinnern. Er startet ein zweites Mal. Jetzt steht da »2/5«, und Morjan begreift, das ist ein Zähler. Er lässt den Clip bis zum Ende laufen, dann will er ihn auf die Festplatte kopieren, doch das funktioniert nicht.
Was passiert hier? Erlaubt sich jemand ein Spiel mit ihm? Erpressung ist es nicht; den Film dürfte jeder sehen. Der junge Mann im Burgerladen hat die Wahrheit gesagt: kein Fall für die Polizei. Es besitzt nur jemand diesen Film, dessen einzige Besonderheit ist, dass Morjan ihn nicht kannte. Natürlich hat er Interesse, er würde auch dafür bezahlen. Aber warum dieser Aufwand und diese Geheimniskrämerei für ein derart harmloses Geschäft?
Morjan schaltet die Videokamera an seinem Smartphone ein und richtet es auf den Laptop. Die Qualität wird leiden, aber hier geht es nicht um ein Kunstwerk. Er startet den Clip, da verschwindet die Seite, und als er die Adresse wieder eingibt, kommt die Meldung, dass eine solche Seite nicht existiere. Er versucht es noch ein paarmal, dann gibt er auf. Eigentlich ist es ein Witz: Auch hier taucht ein Stück seiner Kindheit auf und geht gleich wieder unter, wie gestern bei seiner Mutter im Altersheim.
Schließlich geht er hinauf in die Küche und frühstückt. In den Nachrichten ist die vierte Welle der Pandemie noch immer das alles bestimmende Thema. Die Infektionszahlen steigen weiter, zum Glück ist die neue Variante des Virus weniger gefährlich. Am Schluss geht es kurz um den russischen Aufmarsch. Es heißt, wahrscheinlich handele es sich dabei um eine Drohgebärde des Präsidenten.
Morjan hat die Meldungen aus der Ukraine in den letzten Wochen gemieden. Sie kommen zur Unzeit. Als er die Spedition im letzten Herbst verkaufte, schien die Pandemie überwunden zu sein, und die Firma gehörte eindeutig zu den Gewinnern dieser Zeit. Diesen würdigen Abschluss seiner Lebensgeschichte als Unternehmer würde er sich ungern von der Weltgeschichte verderben lassen, denn für seine Geschichte hat er viele Jahre lang hart gearbeitet und noch einmal besonders hart zu Beginn der Pandemie. Damals hat er sein Meisterwerk als Unternehmer geschaffen: die Küchenpost.
Anfangs hatten alle die Seuche kleingeredet: wieder ein Problem der Chinesen; doch dann brach Panik aus. Es war von Ausgangssperren die Rede, dazu täglich die Bilder aus Italien, wo Menschen von ihren Balkonen nach Brot riefen. Alle Unternehmen verlangten nach staatlicher Unterstützung, mal flehentlich und mal wütend. Auch die Spedition war betroffen. Umzüge wurden abgesagt, Lieferungen storniert, niemand wusste mehr, was erlaubt war und was nicht. Und genau in dieser schwierigen Lage bewies Morjan Genie. Er kaufte einen Lieferdienst für Getränke, den es seit zwei Jahren gab und der wegen Problemen mit seiner Logistik nicht in Schwung kam. Er vergrößerte dessen Fuhrpark und stattete ihn mit dem Know-how der Spedition aus. Kurzfristig konnte er das Logistikzentrum eines Internetanbieters übernehmen. Doch die eigentliche Innovation bestand darin, dass er das Angebot des Lieferdienstes um ein Sortiment an Lebensmitteln erweiterte. So entstand die Küchenpost.
In der Branche hielt man ihn für verrückt. Der Onlinehandel wuchs zwar beständig, die Branchenriesen drückten den Einzelhandel an die Wand. Doch Lebensmittel per Post, das hielten viele für ein Nischengeschäft ohne Zukunft. In der Pandemie improvisierten zwar manche Einzelhändler einen Lieferdienst, aber das waren nur Maßnahmen zur Überbrückung einer Krise. Morjan plante hingegen nicht für ein paar Wochen, sondern für eine unabsehbare Zukunft. Man warnte ihn: Was, wenn der Spuk demnächst vorbei wäre? Als er die nötigen Kredite beantragte, musste er nicht nur die Firma, sondern auch sein privates Eigentum verpfänden.
Damals hatte Morjan auf eine lange Dauer der Pandemie gesetzt, aber nicht, weil er ein pessimistischer Mensch war.