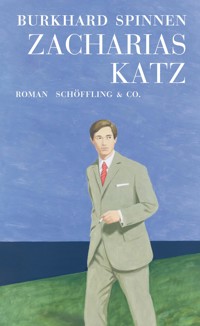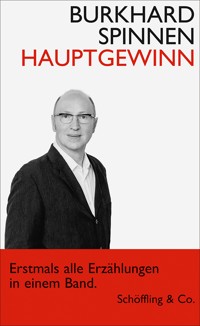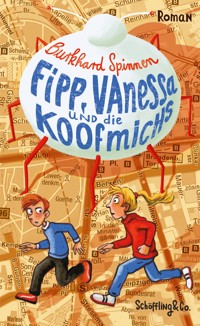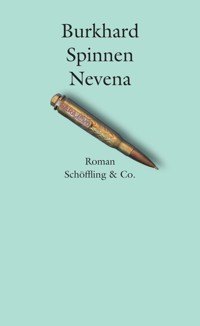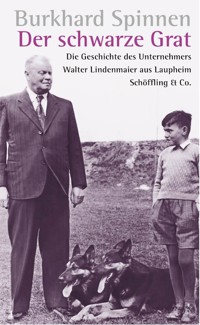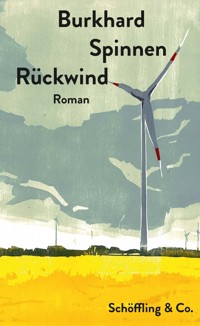
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Hartmut Trössner ist ein Glückskind des Zeitgeistes. Er ist ein grüner Mogul: Chef eines erfolgreichen Windenergieunternehmens, Ehemann einer populären Schauspielerin, Vater eines kleinen Sohnes und jüngst auch Produzent einer bahnbrechenden TV-Serie.Doch dann kommt der 9. April. Hartmut Trössner verliert buchstäblich alles: Unternehmen, Frau, Kind und Haus. Den heißen Sommer verbringt er in einer Klinik. Am 27. August macht er sich auf, mit dem Zug nach Berlin. Und er ist nicht allein. Da ist jemand bei ihm, unsichtbar, hörbar nur für ihn: ein Alter Ego, das vorgibt, sein Überlebenstrainer zu sein und ihn fürs Weiterleben zu retten. Im Zug wird Trössner von einer jungen Frau angesprochen. Ihr erzählt er in mehreren Stationen sein Leben, mit ihr zusammen inszeniert er einen furiosen Auftritt in der Hauptstadt."Rückwind" ist der Roman über einen furchtbaren Verlust, der als himmlische Prüfung oder göttliche Strafe erscheinen muss. Aber für Hartmut Trössner gilt: Above us only sky. Da oben ist niemand! Und dennoch wünscht er sich mit jeder Faser eine Antwort auf die Frage: Warum musste alles so kommen?"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
Rückwind
1
Trössner, was ist? Stellst du dir vor, du bist derjenige, dessen Namen wir tunlichst vermeiden? Selbst in diesen unbedachten Momenten, wenn man ihn ausspricht, ohne ihn zu meinen. Der, dessen Namen wir unterdrücken, weil wir von seiner Nichtexistenz so tief überzeugt sind. Und das auch, ja, gerade jetzt, da man von Leuten in deiner Situation gerne sagt, sie würden das Beten lernen.
Jedenfalls sieht er so aus, Hartmut Trössner, wie er jetzt mit einem langen Finger auf die Bildschirmanzeige des Fahrkartenautomaten zielt. Recht ähnlich dem besagten weißbärtigen Herrn, wie er von seiner Wolke herab so energisch auf seinen Adam zeigt, an dem, wenn man etwas strenger hinschaut, alles ein bisschen schlaff ist, auch der Finger, den er dem Herrn entgegen streckt. Als scheute er die Berührung mit seinem Schöpfer. Du erinnerst dich, Trössner: in Rom, du musstest dir den Kopf verrenken, um das zu sehen, und der Vater las dazu der Mutter aus dem Reiseführer vor. Hätte es damals schon Mobiltelefone gegeben, hätte er daran erinnert, dass man sie an diesem Ort unbedingt ausschalten muss. Schon aus Respekt vor dem da oben. Aber ich schweife ab.
Jetzt drückt er. Ziemlich kräftig sogar.
Warum kräftig, Trössner? Damit da Leben reinkommt? Oder denkst du vielleicht, deine Fingerkuppen könnten zu kalt sein, um den erwünschten Impuls auszulösen? Die Vorstellung passt zwar nicht zur Jahreszeit und dem wunderbaren Wetter, aber zur persönlichen Verfassung. Das hätte eine gewisse Poesie.
Wohin reisen?, fragt der Bildschirm.
Nach Berlin.
Und wann?
Jetzt.
Und warum?
Das frage ich. Mit Nachdruck. Zumal, soweit ich weiß, noch gestern überhaupt nicht von Aufbruch oder Reise die Rede war.
Ich bekomme allerdings keine Antwort.
Der Vorgang wird bearbeitet. Trössner soll seine Karte in den Schlitz stecken und seine Geheimnummer eingeben.
Jetzt wird es ernst! Haben sie womöglich sein Privatkonto gesperrt? Dieses antiquarische, besser nostalgische Girokonto, das, wenn ich richtig unterrichtet bin, der Vater für ihn eingerichtet hatte, als ihm sein Taschengeld erstmals überwiesen wurde. Und auf dem sich momentan ein Betrag befinden müsste, den Trössner mit fünfzehn ein Vermögen genannt hätte und ab dreißig wieder ein Taschengeld.
Er tippt die Geheimzahl. 6369. Geboren auf dem Mond. Eine ausnehmend schöne Eselsbrücke.
Umgehend kommt die Meldung, dass alles funktioniert. Bitte die Karte entnehmen. Fällt hier etwa jemandem ein Stein vom Herzen? Es wird ein Fahrschein gedruckt.
Sag mal, Trössner, bei der Gelegenheit, wann bist du zum ersten Mal Bahn gefahren? Ist das vierzig Jahre her? Würde ich schätzen. Wer in deinen Kopf schauen kann, der sieht darin die Großraumwagen der ersten Intercity-Generation. Gelborange die Wände, die Gepäckablagen und die Sitze, rötlich braun die Stirnwände, und die Reservierungsschildchen steckten hinter verkratztem Plexiglas.
Man konnte das grauenhaft finden. Späte Pop-Art auf staatseigenen Rädern. Aber ich wette, Trössner, du hast das gemocht. Gib’s zu! Du warst jung, diese Farben waren jung, das passte einfach wunderbar zusammen, ein fantastischer Auftakt für eine Klassenfahrt. Vielleicht nach Berlin? Das wurde doch vor Zeiten einmal staatlich bezuschusst. Womit ich auch ganz zwanglos wieder bei meiner Frage wäre: Warum nach Berlin?
Und wieder keine Antwort.
Dafür ist der Fahrschein gedruckt. Trössner nimmt ihn aus dem Kästchen, in dem ein kleines Licht sehr dringlich flackert. Dergleichen Kommunikation mit der Maschine war zu seinen Klassenfahrtzeiten noch unbekannte Zukunft und wirkt heute schon wieder überkommen. Einszweidrei, im Sauseschritt, läuft die Zeit. Aber jetzt keine Nostalgie. Es muss gefahren werden. Mag der Himmel wissen, warum. Und warum ausgerechnet nach Berlin!
Aber das wirst du mir noch sagen, Trössner, nicht wahr? Das wirst du doch nicht vor mir verheimlichen, oder?
Und nicht so schnell! Ich komme ja kaum hinterher.
Hier oben auf dem Bahnsteig ist er nicht allein. Hoffentlich verdirbt ihm das nicht die Stimmung. Nach all den Jahren in so aberwitzig viel Gesellschaft ist er mittlerweile wieder ein Profi im Alleinsein, und er scheint es zu schätzen. Allerdings galt es ja nur, alte Fähigkeiten wiederzubeleben. Als Einzelkind und Unternehmersohn in einem noblen Vorort ohne Kindergarten, da lernt man das Alleinsein von der Pike auf.
Er hatte sich sogar ein gewisses Vergnügen daran bewahrt, als es um ihn herum lebhafter wurde. Das hat er in meinem Beisein einem der Therapeuten erzählt. Mit zwölf oder dreizehn besuchte er dieses altmodische Kino am Bahnhof, das damals still vor sich hin starb. Nachmittagsvorstellung, außer ihm vielleicht nur vier, fünf andere im Saal, unerkennbar in der Dunkelheit. Der Film war ihm egal, es ging nur um das Gefühl, so etwas wie der Einzige oder sogar der Letzte zu sein. Wenn einer kam und fragte, ob jemand Eis wolle, sei das wie eine persönliche Botschaft gewesen.
Lange her, Trössner!
Er nickt bloß. Klemmt dabei die Daumen hinter die Tragegurte des neuen Rucksacks und schaut die Schienen entlang. Trete ich also einen Schritt beiseite. Ich will ihm ja seine wertvollen Momente nicht ruinieren.
Aha, er murmelt etwas. Man wünschte, man könnte von den Lippen lesen. Beziehungsweise: Ich wünschte, ich könnte es nicht. Kann es aber, bräuchte nicht einmal hinzusehen. Zwei Silben, je ein Vokal, die Lippen erst breit, dann rund. Also vielleicht A und O. Ja, was das denn wohl heißen mag?
Dabei soll er bloß nicht beleidigt sein, wenn ich aus seinen Jugenderinnerungen zitiere. Die Zeit war doch, alles in allem, ganz okay. Seine eigenen Worte. Trotz dieses Vaters, der täglich mit dem Damoklesschwert der Firmennachfolge über dem Kopf seines einzigen Sohnes fuchtelte. Letzten Endes ist gar nichts Schlimmes passiert. Damals.
Jedenfalls wollte sich Trössner nie zu den Leuten rechnen, die eine schlimme Jugend hatten und daher immer eine gute Entschuldigung für alles und jedes. Und dabei ist es doch geblieben, oder?
Übrigens: A, O. Das ist Arschloch. Das hat er gesagt. Da bin ich mir vollkommen sicher.
Trössner, warum? Was ist so schlimm daran, ein bisschen an früher zu denken, an das Davor? Warum müssen wir uns darüber immer streiten? Ich habe doch keinen Schritt auf vermintes Gelände getan, ich habe keines deiner heiklen Themen berührt. Wer bin ich denn? Ich habe nur, ganz vorsichtig, ein bisschen von dem zu retten versucht, was noch nicht vollständig verloren ist. So wie man nach einem Zimmerbrand herumgeht und Dinge sucht, die noch zu brauchen sind.
Oh nein! Entschuldigung, mein Fehler. Falscher Vergleich. Jetzt hätte ich Prügel verdient.
Trössner macht einen Schritt Richtung Bahnsteigkante, da kommt die Durchsage. Noch fünf Minuten bis zur Ankunft des Zuges, der infolgedessen pünktlich wäre. In einer halben Stunde das Umsteigen mit zehn Minuten Wartezeit, und dann pfeilschnell auf einer gedachten Geraden Paris-Moskau in Richtung Hauptstadt. Ankunft dort zehn Uhr soundsoviel.
Wenn alles gutgeht.
Trössner, bitte, tritt ein Stück zurück von der Bahnsteigkante. Ich kann das nicht sehen, dich in unmittelbarer Gefahr. Das ist mein wunder Punkt. Danke.
Fünf Minuten also. Das heißt übrigens auch: Noch ist es möglich, umzukehren. Wir müssen ja nicht zurück in dieses zugegebenermaßen jämmerliche Hotel. Gehen wir doch woandershin. Das Wetter ist gut, sehr gut sogar, dieser unglaubliche Sommer nimmt einfach kein Ende, und es ist noch so früh am Tag. Machen wir doch einen Ausflug, oder gleich einen kurzen Urlaub. Die Mittel dazu stehen zur Verfügung. Die Karte hat funktioniert, das alte Taschengeldkonto ist nicht gesperrt. Was öffnen sich da für Möglichkeiten!
Lass uns ins Blaue fahren, wie man so sagt. Und dann, entschuldige, wenn ich wieder damit anfange, dann machen wir einen Plan. Einen positiven Plan, wohlgemerkt. Lass uns darüber nachdenken, ergebnisoffen, aber in einem optimistischen Sinne. Ich hätte so einige Vorschläge. Und, ja, keine Bange, noch ganz andere Vorschläge als die, mit denen ich dich seit Wochen verfolge.
Wieder diese einwandfrei lesbare Lippenbewegung. A und O.
Trössner, zum Teufel, mir platzt gleich der Kragen! Bitte: Was willst du in Berlin? Klassenfahrt – nein! Das war vor Jahrzehnten. Dienstreise – nein! Das ist aus und vorbei.
Also was? Was verheimlichst du vor mir? Oder besser gesagt: Was glaubst du vor mir verheimlichen zu können?
Aber das sagt er nicht. Dreht sich stattdessen um, geht die Bahnsteigkante entlang und tritt nach einer Taube, die sich darum einen Dreck schert. Eine Dame im mittleren Alter ist von dem Tritt nicht angetan, obwohl niemand verletzt wurde. Sieht ja auch furchtbar aus, ein erwachsener Mann, der wie ein Rotzjunge nach Vögeln tritt.
Zum Glück behält die Dame ihre Ansichten für sich. Man hätte ihr sonst womöglich klarmachen müssen, dass es Trössner ist, der hier nach Tauben tritt. Hartmut Trössner, ein in vielerlei Hinsicht besonderer, ein womöglich auserwählter Mensch. Einer, auf den es mit dem Finger gezeigt hat wie auf den besagten Adam, wenngleich mit anderem Resultat, leider. Und wenn dieser Hartmut Trössner auch nicht weiß, wie besonders und wozu er auserwählt ist und wer oder was mit dem Finger auf ihn gezeigt hat, dann, zum Teufel, ändert das nichts daran, dass er hier, wenn Tauben seinen Weg kreuzen –
Trössner, entschuldige bitte, hast du etwas gesagt? Habe ich jetzt etwas überhört? Vielleicht, warum wir ausgerechnet nach Berlin fahren?
Doch sicher nicht wegen der Sehenswürdigkeiten. Und hoffentlich nicht als Nostalgie-Tour, zur Erinnerung an die Zeit, in der Berlin auch deine persönliche Hauptstadt war, mit Büro in der Geschäftsstelle des Interessenverbands, Treffen auf Führungsebene und Arbeitsessen in Ministerien. Oder willst du etwa nach Berlin, weil dorthin alle gehen, die nicht wissen, wohin? Willst du der letzte Lemming sein, der Richtung Hauptstadt zieht?
Entschuldige. Ich wollte nicht so reden.
Die nächste Durchsage, nach einem hässlichen Knacken: Der Zug trifft ein, man möge bitte von der Bahnsteigkante und so weiter. Trössner reagiert folgsam und macht einen Schritt zurück. Dabei sagt er, leise, so dass nur ich es hören kann: Charlotte.
Nun gut. Mittlerweile weiß ich zur Genüge, wie er versucht, bestimmten Themen aus dem Weg zu gehen. Oder gar, mir etwas zu verschweigen. Nämlich so wie jetzt. Es ist ein schlichtes Verfahren, aber wirksam, wie ich zugeben muss.
Die Sache funktioniert immer gleich. Ich frage ihn etwas, zum Beispiel beim Frühstück, ganz harmlos, betont freundlich: Na, was machen wir denn heute? Im Sinne von: Wie verbringen wir, möglichst mit Gewinn, diesen Tag, der bekanntlich der erste vom Rest des Lebens ist?
Woraufhin er mir ein Wort vor die Füße wirft, eines aus der Handvoll von Codewörtern für seinen Unglückstag, den neunten April, den Tag, an dem er, ich zitiere ihn, alles verloren hat, was er einmal war oder besaß. So macht er es immer. Statt einer Antwort auf meine konstruktiven Vorschläge ein Codewort für das alles verloren; diesmal: Charlotte.
Ich sage es nicht gerne, aber das hat mich anfangs mundtot gemacht. Ich musste ihn dann in Ruhe lassen, wider Willen. Mittlerweile habe ich Wege gefunden, im Gespräch zu bleiben. Ich reiche ihm zum Beispiel einen seiner späteren Tage zurück, ganz freundlich, versteht sich. Vielleicht auch nur ein paar Stunden, Worte oder Gesten. Gewissermaßen Schnappschüsse aus Trössners Leben danach, nach dem neunten April, von mir persönlich gesammelt. Damit er sieht, dass ich nicht sein Feind bin, sondern vielmehr sein Freund und mehr noch: sein Bodyguard, bewaffnet mit nichts als unerschütterlichem Optimismus, der besten Waffe, die man tragen kann, wenn Glaube und Gottvertrauen nicht zur Hand sind.
Also kontere ich jetzt, da er wieder seinen neunten April ausspielt, mit dem fünfundzwanzigsten August, vorgestern, Samstag. Und reiche ihm den entsprechenden Schnappschuss.
Auf dem geht Trössner mitten durch die Natur. Damals, als er ein Junge war, soll es hier nichts als Felder gegeben haben. Inzwischen ist die Firma in seinem Rücken auf Sichtweite herangewachsen. Es ist schon warm, obwohl so früh. Ringsum ist alles von der Dürre gezeichnet, der Mais kaum brusthoch und so gelb wie die Stoppelfelder. Ein schmaler, holpriger Feldweg, mittig eine Grasnarbe, auch verdorrt, Traktorspuren rechts und links, die schlimmsten Schlaglöcher auf Trössners Veranlassung mit Splitt verfüllt. Und hier also geht er, den unlängst erworbenen Rucksack geschultert, bis zu dem Platz, an dem alles verbrannt ist, das Haus, sein Haus, die Nebengebäude und sogar die Bäume im Wald dahinter.
Und was tat er dort, vorgestern? Ich könnte sagen, sich seiner innewerden. Aber ich will nicht bewerten. Das ist nicht mein Ding, oder sollte es nicht sein. Nur begleiten soll ich und zeigen. Und nach Möglichkeit raten.
Am Morgen in aller Frühe hatte er ein Taxi bestellt und mit dem Fahrer einen Pauschalpreis für die Überlandstrecke vereinbart. Es folgte eine unspektakuläre Fahrt, zuletzt vorbei an der Firma; dann hatte er den Wagen genau da halten lassen, wo der Feldweg von der Landstraße abzweigt, nicht weit hinterm Industriegebiet. Nach ein paar Hundert Metern feldeinwärts versank die Firma hinter einer sanften Bodenwelle, dafür ragten die drei Windräder auf der kleinen gelben Anhöhe voraus umso mächtiger empor. Am Rande der schwarz verbrannten und von Reifenspuren durchzogenen Fläche machte Trössner Halt, zog das seltsame Buch aus seinem Rucksack, öffnete es, nahm die kleine Glock aus ihrem Samtbett, hielt sie hoch in den Morgen und prüfte, ob sie geladen war. Sie war es, wie sie es von Anfang an gewesen war. Hätte ich ein taugliches Organ dafür gehabt, ich hätte ihm das Ding aus der Hand geschlagen!
Selbstmord also. Schluss machen, genau dort, wo es an jenem neunten April angefangen und geendet hatte. Gut, das war nun wirklich nicht abwegig, auch wenn der zeitliche Abstand zwischen Ursache und Reaktion, sagen wir, befremden konnte. Für gewöhnlich gilt ja: gleich oder gar nicht. Aber viereinhalb Monate warten und dann? Das kann halbherzig wirken. Als sei da einer zuerst für den großen Abgang zu schwach und später auch fürs tapfere Weiterleben.
Nein, ich sollte nicht urteilen! Außerdem gilt jemand, der Hand an sich legt, laut psychologischer Lehrmeinung zwar als verrückt, ist aber immer im Recht. Jedenfalls bringt er die Kritik zum Schweigen, vorausgesetzt, er ist erfolgreich.
Und dennoch hatte ich hier, zwischen Feldern und Brandstelle, meinen Job zu machen, und das hieß: dafür zu sorgen, dass Trössners Lebensbuch nicht zugeschlagen wurde, indem der Held sich nach dem dritten von fünf Kapiteln eine Kugel in den Kopf schoss. Einen Fachmann für die Kommunikation mit Suizidverdächtigen, wie man ihn aus Filmen kennt, konnte ich allerdings nicht beiziehen, ich musste schon selbst verhandeln. Vielleicht, so dachte ich, sollte ich nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern mich über Verfahrensfragen an die Sache heransprechen. Und vielleicht könnte ein bisschen Ironie der Szene das Dramatische nehmen.
Also fragte ich: Trössner, wie lautet der Plan? Kopf oder Brust?
Das war ihm natürlich unangenehm, dass ich so ins Detail ging. Aber große Gesten sind auch Gesten; und für die ist der Körper zuständig. Also habe ich es durchdekliniert. Erstens, in den Kopf. Das ist männlich, heroisch, aber nicht so sicher, wie viele denken. Es sei denn, man nimmt mitsamt dem Pistolenlauf einen Schluck Wasser in den Mund, aber dann wird es eine arge Schweinerei. Zweitens, in die Brust. Das ist dezenter, hat aber etwas von Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Außerdem erhöht es die Chance auf längeres Leiden. Das Herz knapp verfehlt, erstickt man am Blut, das in die Lunge läuft, und wer will das schon! Fazit also wie so oft: Für alles gibt es Argumente. Letzten Endes bleibt es eine Frage des Geschmacks.
Trössner würdigte mich keiner Antwort, hob stattdessen die Glock an die Schläfe.
Ich dachte: Scheiße! Ich hab’s verbockt. Jetzt drückt er ab, und wir sind geschiedene Leute.
Da sagte er, er wolle noch etwas erzählen. Und das tat er auch, er sprach ganz leise vor sich hin, die Waffe an der Schläfe wie einen Finger, der beim Denken helfen soll. In seiner Grundschulklasse, sagte er, in diesem miefigen Altbau, hätten alle Mädchen in den beiden rechten und alle Jungen in den beiden linken Reihen gesessen. Er in der linken, ganz am Fenster, und an was er sich am besten erinnere, das seien die großen Bäume draußen vor dem Schulhof, wie sie im Wind rauschten und wie im Herbst die Kastanien auf den Boden schlugen und platzten.
Ich fragte mich, worauf das hinauslaufen sollte.
Zur Erstkommunion, sagte er, dasselbe Spiel. Die Jungen, alle in schwarzen Anzügen mit weißem Hemd und Fliege, seien auf dem Schulhof in einer Doppelreihe aufgestellt worden und vor ihnen, ebenfalls in Doppelreihe, die Mädchen, alle in weißen Kleidern und mit weißen Blütenkränzen im Haar. Was für ein Unsinn! Wo es doch so viel schöner ausgesehen hätte, wenn sie zu Paaren gegangen wären, lauter kleine Brautpaare, nach Größe zusammengestellt oder besser noch danach, wer zu wem am besten gepasst hätte. Er selbst wäre gerne neben einer Marlene gegangen, das hätte sehr gut gepasst, beide hatten sie dunkelblonde Haare, graue Augen und helle Haut.
Das war’s?
Nein. Als sie vom Schulhof losgehen sollten, sei er aus der Jungenreihe ausgebrochen und habe sich neben die besagte Marlene gestellt. Tatsächlich machte ihm das Mädchen an ihrer Seite wortlos Platz. Doch sofort sei die Lehrerin gekommen und habe gefragt: Was soll das? Und er, Hartmut Trössner, neun Jahre alt, konnte keine Antwort geben. Sie wiederholte ihre Frage, und als er immer noch stumm blieb, führte sie ihn zurück in die Jungenreihe. Dann gingen sie alle los, er mit rotem Kopf, nicht aus Scham, sondern aus Wut. Denn er glaubte damals, sie hätten ihn gelassen, wo er war, hätte er bloß geantwortet. Oder besser noch: hätte er ein Zauberwort gekannt.
Und? Waren das jetzt seine letzten Worte? Etwas rätselhaft. Rosebud, Marke Trössner? Das rutschte mir so raus; gleicht tat es mir leid, und ich erwartete den Schuss, der auch mich treffen würde.
Doch Trössner ließ die Waffe sinken. Mit einem Blick, der den Windrädern galt oder der Brandstelle oder mir. Egal, die Glock zeigte jetzt auf den Boden. Ich atmete auf, zu Recht, wie sich herausstellte.
Aber ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Denn wenn mein Held davon Abstand nahm, sich an diesem Augustmorgen zu erschießen, dann war mein albernder Rosebud-Kalauer sicher nicht der Grund dafür. Ich vermute eher, es lag an der Glock.
Und ich meine das ganz im Ernst. Hätte ich Freude am Tonfall unserer Therapeuten, würde ich sagen: Der Besitz einer Handfeuerwaffe fungierte hier einerseits als Stimulus, andererseits als Aufhebung einer suizidalen Tendenz. Schlichter gesagt: Mit einer Glock in der Tasche lässt man sich nicht zu spontanen Aktionen hinreißen, man springt nicht vom Dach seines jämmerlichen Hotels oder plündert das Medizinschränkchen in der Portiersloge.
Und wer weiß! Wäre Trössner ohne Pistole hierhin geraten, zwischen Firma und Brandruine, womöglich hätte er sich in seinem Keller ertränkt, der noch immer voll Löschwasser stand. Oder er hätte soviel schwarze Asche geschluckt, wie man braucht, um daran zu sterben. Doch füllt sich nicht für den, der eine Waffe in der Hand trägt, die vormals leere Welt wieder mit Möglichkeiten? Vielleicht ist die kleine Glock das eigentliche Ticket für unsere Fahrt nach Berlin.
Aber ich spekuliere. Zurück in den Schnappschuss.
Trössner machte ein paar Schritte mit hängenden Schultern, setzte sich an den Rand des schwarzen Areals, den Rücken zur Brandstelle. Bloß gut, dass gerade niemand vorbeikam. Keiner hätte ihn so sehen dürfen, am Boden sitzend und neben sich eine kleine schwarze Pistole im vertrockneten Gras.
Und noch war wenig gewonnen. Was einmal gutgegangen war, musste nicht immer gutgehen. Also sagte ich: Trössner! Schmeiß das Ding weg! Oder besser noch, wisch deine Fingerabdrücke runter und vergrab es im Feld. Dem Ökoweizen im nächsten Jahr wird es nicht schaden.
Tatsächlich stand er auf und machte ein paar Schritte weg vom Schwarz und hinein ins gelbe Stoppelfeld. Der Boden dort war hart wie Stein. Da müsste, so dachte ich, die kleine Pistole sich selbst ihr Grab hacken.
Trössner aber hatte ganz anderes im Sinn. Denn da lag etwas, recht gut getarnt durch seine hellbraune Hülle. Seit dem neunten April musste es dort liegen, seit seinem Flug aus dem Fenster und der offenbar weichen Landung im Weizen. Das Etui war staubig und ein bisschen verkratzt, vielleicht von einer Erntemaschine, drinnen aber steckten die beiden, wohl geborgen: rechts Trössners Smartphone und links die Karte für sein Privatkonto.
Ich wollte, erleichtert wie ich war, etwas über glückliche Zufälle sagen, aber es hatte mir die Sprache verschlagen.
Trössner dagegen reagierte souverän, wie früher. Er steckte die Glock ins Buch, das Buch in den Rucksack, das Smartphone in die Hosentasche und machte sich auf, zurück in Richtung Landstraße. Zwanzig Minuten brauchten wir von dort bis ins Industriegebiet, noch eine Viertelstunde zum Elektromarkt, wo er ein passendes Ladegerät kaufte, zur Sicherheit nicht mit der Karte, sondern von seinem zur Neige gehenden Bargeld. In dem Schnellrestaurant nebenan gab es einen Tisch mit Stromanschluss. Trössner bestellte ein spätes Frühstück, aß es aber nicht und wartete nur, bis das Gerät mit der üblichen Melodie auf den Knopfdruck reagierte.
Und sieh an, alles war wieder da!
Ich saß atemlos daneben. Da war der Terminkalender, immer noch vollgepackt bis weit hinaus ins nächste Jahr. Das Verzeichnis der Kontakte, ein vollständiges Who is Who von Wirtschaft, Politik und Medien. Die Chat-Gruppen für die Firma, für den Interessenverband, für die Familie, eine nur für Charlotte und ihn. Alles seit dem neunten April verwaist, im Stich gelassen.
Und natürlich das Icon für die Galerie. Ich wollte warnen, doch ich kam zu spät. Schon hatte Trössner es berührt, und winzig klein, jedes ein Steinchen in einem Mosaik, das kein Bild ergibt, erschienen Tausende Fotos, jahrelang von einem Gerät zum nächsten kopiert. Auf eine weitere Berührung öffnete sich das letzte, aufgenommen am achten April: Charlotte auf dem Balkon, wie sie ein Skript las, im Hintergrund ganz klein die Windräder. Ich brachte immer noch kein Wort heraus.
Trössner öffnete ein Menü, tippte Alles Auswählen und schwebte über Alles Löschen. Ich wusste nicht, sollte ich ihn ermuntern, oder sollte ich abraten. Doch da tippte er schon Home, die Bilder verschwanden, er öffnete seine Kontakte, telefonierte kurz und trat auf den Parkplatz vor dem Schnellrestaurant. Keine zehn Minuten dauerte es, bis leise vor sich hin dieselnd ein uralter, aber penibel gepflegter Benz erschien. Der Fahrer hielt an und kurbelte das Seitenfenster herunter.
Herr Trössner, sagte er, sind Sie das wirklich?
Tag, Herr Wiechmann, sagte Trössner. Fahren Sie mich auf Kredit?
Der Fahrer nickte, die Augen aufgerissen, als sähe er einen wandelnden Toten.
Trössner bekommt einen Fensterplatz und ist wahrscheinlich gar nicht glücklich darüber, weil er gleich umsteigen muss. Mit seinem Rucksack blockiert er den Nebensitz. Das ist die übliche, asoziale Praxis, wenngleich in seinem Falle womöglich zu entschuldigen. Denn es darf ja keiner diesem Mann zu nahe kommen, sich ranschmeißen an ihn, das heißt: an so einen wie ihn, der alles verloren hat, und das auf einen Schlag.
Oder hat er Angst um seinen Rucksack? Der es, wie soll ich sagen, in sich hat. Will er ihn nicht aus den Augen lassen, weil er eine Gefahr für andere bergen könnte? Das wäre dann wieder ein sozialer Zug.
Trössner nimmt den Rucksack auf den Schoß und sieht mürrisch vor sich hin. Mir kommt ein Gedanke. Ob er am Ende darauf spekuliert hat, ich könnte zu Hause bleiben? In diesem jämmerlichen Hotel, unter der Beobachtung von Portier und Staatsanwaltschaft.
Sag mal, Trössner, wolltest du mir etwa ausreißen? Nicht nach Berlin, sondern weg von mir?
Er schaut aus dem Fenster.
Keine Bange, mein Lieber, ich nehme das nicht persönlich. Glaub bloß nicht, du könntest mich kränken. Aber denk auch nicht, du würdest mich los. Und vergiss bitte nie: Ich habe dir geholfen. Ich habe dich beschützt! Ich habe dich gerettet vor den Leuten, immer wieder, vor ihrem Gerede, vor ihrem Mitgefühl, vor ihrem Verständnis. Und vor allem vor ihren Fragen.
Ich weiß, dass Trössner sich an diese Fragen erinnert. Wie es ihm geht nach so einem schrecklichen Tag? Was er fühlt nach diesen Erlebnissen? Was er machen will nach diesem furchtbaren Schicksalsschlag? Vor solchen Fragen habe ich ihn gerettet. Und sollte er versuchen, das zu vergessen, werde ich das zu verhindern wissen. In seinem Interesse!
Der erste Frager war dieser Mann in der neongelben Weste, am Vormittag des neunten April, im Ambulanzwagen, als Trössner nach der ersten Sedierung die Augen wieder aufschlug. Der war noch am leichtesten zu ertragen, der interessierte sich nur für Trössners Körper. Ob der womöglich infolge einer Mischung aus Schock und Betäubungsmittel irgendeine lebenswichtige Funktion einstellen wollte. Nein, wollte er nicht, die Dosis war korrekt gewesen, damit war der Neonmann zufrieden.
Der nächste Frager war der Arzt im Kittel, da war es schon Mittag geworden. Der Mann war schwerer zu ertragen. Sein Auftrag lautete: möglichst schnell herauszufinden, ob der Privatpatient Hartmut Trössner nach dem, was ihm widerfahren war, zu fatalen Kurzschlusshandlungen neigte. Und ihn davon möglichst abzuhalten, schon aus ökonomischen Gründen. Selbstmörder landen manchmal nicht im Grab, sondern im Rollstuhl, und das kostet. Sorry, aber man muss die Dinge beim Namen nennen.
Schließlich der Arzt in Zivil, spät in der Nacht, eigentlich schon am nächsten Morgen. Der stellte auch seine Fragen; außerdem wollte er die Botschaft vermitteln, dass einer, der noch lebt, durchaus nicht alles verloren hat. Dass man die Rechnung nicht ohne den Körper machen solle, und Trössners Körper war nicht einmal unterkühlt, obwohl er nackt auf dem Wirtschaftsweg gelegen hatte. Da waren nur zu viel Alkohol und Chemie im Blut. Und ein paar Schrammen an Armen und Beinen, fast ein Wunder bei jemandem, der sein brennendes Haus über den Balkon verlassen hatte. Jedenfalls vorerst kein Hinweis auf bleibende Schäden, wie die Untersuchung ergeben hatte. Und also sei doch zu viel verblieben, so der Arzt am Morgen, als dass man sich vollständig aufgeben und verschleudern dürfe.
Schon da hast du dich gewehrt, Trössner, mit aller Kraft, gegen die Zumutung, dein Unglück auf irgendein Mittelmaß zu verkleinern. Auf irgendein dumm gelaufen mit anschließendem Aufstehen, Mundabwischen, Staubabschütteln und so weiter. Aber deine Gegenwehr ging ins Leere, der Arzt am Morgen redete letzten Endes nur pro forma. Seine aufmunternden Sätze waren bloß die Hintergrundmusik zu seiner Absicht, dir wiederum Substanzen zuzuführen, die dich ausschalten sollten; und das taten sie auch.
Das wirklich Schwierige, und ja, ich gebe zu: das schwer Erträgliche waren später die Sitzungen bei der Frau in der geschlossenen Einrichtung. Die hättest du alleine womöglich nicht ausgehalten. Die Frau sprach nämlich im Gegensatz zu dem Neonmann und den Ärzten kaum und forderte stattdessen dich auf, du mögest doch erzählen. Von dir. Von früher, von heute. Wie es dir geht. Wie du dich fühlst. Was dir gerade so durch den Kopf geht. Oder was du dich bislang zu sagen nicht getraut hast.
Anderen mag das helfen. Dir, Trössner, half es wohl nicht. Du hast nach Hilfe gerufen. Du hast um Hilfe gefleht, gib’s zu. Also bin ich gekommen, in Gestalt eines Rauschens in deinen Ohren, das übertönte, was die Frau auf der anderen Seite des Schreibtisches sagte. Das war eine Erleichterung. Und noch besser, geradezu grandios war, dass du auch nicht mehr hören musstest, was du selber sagtest. Stundenlang konntest du jetzt reden, über diesen Schreibtisch hinweg, ohne ein Wort davon zu hören. Mein Rauschen hat jeden Satz, der aus dir kam, vor dir verheimlicht. Du hast geredet, Trössner, glaub’s mir, ich war dabei, du hast geredet wie ein Buch, ein grauenhaftes Buch; und du hast dabei nichts als Stille vernommen.
Die Frau war zufrieden mir dir, allerdings nur insofern, als du redetest wie ein Wasserfall. Mit dem Inhalt deiner Suada kam sie weniger gut zurecht. Und ich musste ihr zustimmen, aber ich verspreche dir: Niemals werde ich dir verraten, was für ein krauses Zeug du von dir gegeben hast. Wen du alles verflucht hast! Wem du die Schuld an den Ereignissen gegeben hast, die Verantwortung für den neunten April und dein alles verloren. Nur soviel sei gesagt: Grolle nicht mit den Leuten, die dich für verrückt gehalten haben und für hochgradig selbstmordgefährdet überdies.
Aber wie auch immer, die Zeit verging. Die Stunden mit der Frau hinter dem Schreibtisch waren auch nur Stunden, und wie ganz normale Stunden waren sie vorbei, wenn der große Zeiger wieder auf der Zwölf stand. Anschließend hatten wir frei, da konnten wir fernsehen, am liebsten Tierfilme auf Discovery Channel; die anderen Sender waren allerdings auch gesperrt. Oder wir konnten im Park hinter der geschlossenen Einrichtung spazieren gehen und dabei lebhaft miteinander schweigen, wir zwei, Trössner, du und ich.
Ich erinnere mich nicht ungern an diese Tage. Manchmal denke ich, es waren unsere schönsten. Damals hast du den neunten April noch nicht als Totschlagargument benutzt wie eben auf dem Bahnsteig. Damals war der Schrecken noch frisch, dein höchst verständliches Grauen war eines wie am ersten oder am letzten Tag; es war unvergleichlich, und ich wage zu sagen: Es war rein. Wenn wir aus den Stunden entlassen waren, brachte es dich zum Schweigen; anderswo würde man es ein heiliges Schweigen nennen. Natürlich taten die Tabletten das ihre dazu.
Und was gab es da nicht alles, was wir schweigend betrachten konnten. Ein wirklich reiches Leben. Die Familie, die Firma, die Sondermaschinen, die Schulzeit, das Exil im Studium, das Leben als Unternehmer, der Aufstieg der Firma, die Frau und das Kind, die Ämter und die Prominenz. Vielleicht sogar: der Ruhm.
Ja, Trössner, da stimme ich dir ein Stück weit zu: Du warst einer, den es nicht alle Tage gibt. Einer der wenigen, bei dem die Arbeit für das Gemeinwohl untrennbar ist von der für das persönliche Wohlergehen. Du warst populär und wirktest doch beinahe im Verborgenen. Und wenn es so etwas gibt wie die wahre Mitte der Gesellschaft, vom langweiligen Durchschnitt so weit entfernt wie von allen unerfreulichen Extremen, gleichermaßen konservativ wie der Zukunft zugewandt, dann, Trössner, warst du nicht ganz im Unrecht, wenn du sagtest, du seiest diese Mitte.
Doch aus dieser lebendigen Mitte hat es ihn leider herausgerissen. Seit viereinhalb Monaten steckt Hartmut Trössner wie einbetoniert im neunten April und im alles verloren. Tatsächlich ist ihm einiges abhandengekommen, hat sich aufgelöst, am Ende sogar in Rauch. Beim Aufwachen am neunten April hatte er nur die üblichen Probleme, die jeder hat, der Milliarden umsetzt; und am Abend waren da, wenn ich so sagen darf, nur noch rote Zahlen.
Dass sein Fall Schlagzeilen machte, ging damals an ihm vorbei. Die Ärzte sorgten dafür und die Tabletten. Doch während wir unsere schweigenden Parkrunden drehten, sprach man draußen von einem geradezu rekordverdächtigen Unglück und von Trössner als einem Weltmeister der Niederlagen. Die Öffentlichkeit war interessiert, sie war elektrisiert und meldete ihr Grundrecht an, die Details zu erfahren, das sogenannte Menschliche an den Fakten. Doch bis heute kennen alle Beteiligten nur jeweils einen Teil von Trössners neuntem April. Mitarbeiter und Geschäftspartner, die Leute aus dem Verband und aus der Politik, Charlottes Familie, die Leute vom Film, die Rettungssanitäter, Feuerwehrmänner, Polizisten, Versicherungsangestellten, Pfleger, Ärzte und Therapeuten – selbst wenn sie alle ihr Teilwissen zusammentragen würden, was den meisten durch ihre Schweigepflicht strengstens verboten ist, so ergäbe sich doch kein Ganzes. Denn zum Ganzen würde unbedingt eine Frage gehören. Es ist die Frage, der Trössner leider, als unser schönes Schweigen ein Ende fand, mit Haut und Haaren verfallen ist.
Es ist die Frage: Warum?
Warum ist das passiert? Warum so? Warum ausgerechnet ihm, Hartmut Trössner? Und was bitte hat es zu bedeuten?
Wohlverstanden, es geht ihm nicht mehr um Details, um das, wofür Polizei und Insolvenzverwalter zuständig sind. Über solche Kleinkrämerei ist er hinaus. Es geht ihm ums Ganze. Und das Ganze muss doch etwas bedeuten. Meint er. Es muss! Es kann doch nicht sein, dass ihn dieser neunte April getroffen hat wie ein umgekehrter Lottogewinn, also wahllos, zufällig, bedeutungslos.
Also bitte: Warum?
Mit dieser Frage quält sich Trössner, ziemlich genau seit dem Tag, da wir aus der geschlossenen Einrichtung übersiedelten, in dieses einsam gelegene und recht komfortable Haus am Fuße der Berge, das sich offiziell Reha-Klinik nennt. Dort reduzierte man Trössners Medikamente, und prompt erschien in seinem Kopf, aus dem der Nebel verschwand, die Frage nach dem großen Warum? Mal zog sie dort ein wie ein Wolkenband von den Bergen her, mal wie das nächtliche Klopfen aus dem Gebälk, mal wie ein Vogel von der Fensterbank, bis Trössner schließlich ganz ausgefüllt war von ihr. Er grübelte und spekulierte, aber – war das eine Überraschung? – es kam nichts dabei heraus, rein gar nichts; oder alles Mögliche, was auf dasselbe hinauslief.
Mein Rauschen war damals nicht mehr gefragt. Stattdessen habe ich es auf mich genommen, den, wie soll ich sagen, den advocatus vitae zu spielen. Ich plädiere seitdem, wann immer das nötig ist, auf Weiterleben, gegebenenfalls ohne Sinnfrage. Ich war und bin gegen Grübeln und Sinnieren. Ich war und bin gegen Depression und erst recht gegen das suizidale Gedankenspiel. Ich bin der Geist, der stets bejaht, mal mit erhobenem Zeigefinger, mal mit einer spitzen Bemerkung.
Zugleich habe ich Trössner eine neue Stimme gegeben. Das war Schwerstarbeit. Doch um die sogenannte Reha-Klinik überhaupt noch einmal verlassen zu können, musste er unbedingt den richtigen Ton im Umgang mit dem Personal finden. Es gab genug abschreckende Beispiele, Mitinsassen, die diesen Ton nicht fanden oder nicht finden wollten und deshalb schon die Hälfte ihres Lebens am Fuße der Berge verbracht hatten.
Man könnte sagen, ich bin Trössners Coach geworden. Ich habe ihm geholfen, in jeder Sitzung bei den zuständigen Damen und Herren einen kleinen Stern für gutes Betragen zu bekommen. Ich habe ihren Jargon und ihren Tonfall analysiert und Trössners Sätze entsprechend gestylt. Ich habe mit ihm ihre Lieblingsvobakeln gepaukt: den sicheren Ort, den Tresor, den Regler.
Und ich habe ihm geholfen zu lügen.
Oder sagen wir, ich bin mit ihm sein Leben durchgegangen, täglich, stundenlang, und zusammen haben wir eine Version davon erstellt, die er den zuständigen Damen und Herren auf Befragen unterbreiten konnte. Eine Legende für die Legende! Alles, was sie interessieren könnte, in der Form eines freundlichen, aber vollkommen nichtssagenden Bulletins. Trössners ganzes Leben, großartig und glamourös, aber im Grunde stinknormal von Anfang an. Nirgendwo Klippen und Kanten, in denen die Leute vom Fach sich einhaken könnten, keine weichen Stellen, in denen sie so gerne bohren.
Ich habe aber auch dafür gesorgt, dass seine Sätze filigran und zerbrechlich blieben. Monatelang hat man daher niemanden von draußen zu ihm gelassen, mochte es auch um Millionen gehen. Einige Male haben wir beobachtet, wie Wagen mit verräterischen Nummernschildern den Weg zur Klinik hinauffuhren, aber keiner schaffte es durch das große Tor. Das Leben draußen sollte bitte so tun, als würde es ohne Trössner weitergehen; und das tat es wohl auch, irgendwie.
Doch man kann nicht beides haben: sich selbst ganz fit oder wenigstens am sicheren Ort und zugleich den vollkommenen Schutz vor der Welt. Vier Monate lang haben wir abgewogen, Trössner und ich, zwischen den Vorteilen des Attests einer geistigen Gesundheit und den Vorteilen dieses Hochsicherheitstraktes. Schließlich wurde uns klar, irgendwann müsste es heißen: jetzt raus oder nie.
Genau eine Woche ist es heute her, dass wir die Reha-Klinik im Rücken haben. Seitdem lebt Trössner in einem Zwischenreich, in einem vorläufigen Inkognito, genauer gesagt, in diesem jämmerlichen Hotel und in Furcht vor dem Moment, da er sich endlich mit den Funktionären wird abgeben müssen. Mit dieser Meute wohlmeinend-unbeteiligter Kreaturen, die seit dem neunten April darauf warten, ihm mit ihren Formularen, Bestimmungen und Vorschriften auf den Pelz zu rücken. Lieber, nicht wahr, Trössner, wärest du weiter mit mir allein.
Und machtest mir das Leben schwer. Zum Beispiel durch unangekündigtes Reisen in Hauptstädte.
Bei der Gelegenheit, was tut er jetzt?
Gar nichts. Schaut noch immer zum Fenster hinaus. Bemerkt vielleicht, wie viel Landschaft da an ihm vorbei-zieht, immer wieder gespickt mit Windrädern, die sich träge drehen.
Eigentlich könnte er lesen. Was hat er früher im Zug gelesen! Lauter Irrelevantes, Romane, Krimis, Illustrierte, Comics. Wie ein kleiner Junge, sagt er, habe er sich darauf gefreut, wenn eine Zugreise anstand und er ein paar Stunden lang sein Smartphone ausschalten durfte. Doch seit dem neunten April liest er nicht mehr. Ich bedauere das zutiefst.
Und ich bin skeptisch, was seine Begründung angeht. Geschichten, sagt er, würden ihn schmerzen, weil sie alle einen Schluss hätten, eine Auflösung, eine Antwort auf die Fragen, die sie aufgeworfen haben. Noch die Erbärmlichsten könnten damit aufwarten und erinnerten ihn dann an sein eigenes Manko. Außerdem führe das Lesen zu unfreiwilligen Erinnerungen, warum auch immer. Dann spüre er plötzlich, wie der Arbeiter auf ihm liegt, neben der zerstörten Limousine. Oder er höre sich selbst in sein Smartphone schreien. Oder er rieche die Schwimmhalle, wo der Kleine – nun ja, das gechlorte Wasser und das nasse Badezeug. Oder er schmecke den Wein und höre dabei das Knistern der Kerzen. Oder er fühle den Wirtschaftsweg unter seiner nackten Haut. Und all das sei absolut unerträglich, selbst wenn er eines der Medikamente nehme, die er laut Anweisung immer bei sich tragen soll.
Der Umsteigebahnhof wird angesagt. Trössner tut überrascht, wahrscheinlich ist er es auch, hat beim Starren in die rasende Landschaft die Zeit vergessen. Dafür muss er jetzt als erster an der Tür sein. Hat er etwa Angst, nicht rechtzeitig aus dem Zug zu kommen? Bitte, Trössner, mach dich nicht lächerlich! Und tritt niemandem auf die Füße.
Auf dem Nachbargleis rollt der ICE Richtung Berlin ein, beinahe ohne Verspätung. Trössner steht genau richtig an einer Tür, doch beim Einsteigen bleibt er mit seinem Rucksack an der Kante hängen und rutscht von der obersten Stufe zurück auf die zweite. Das ist ein kleiner Fehltritt, doch früher konnte das den alten Schmerz wecken und ihn dazu ermuntern, sich über Schultern oder Becken in Arme oder Beine aufzumachen. Es war ein vagabundierender Schmerz; er peinigte eine Zeit lang irgendwo im Körper, zog dann weiter und ließ verwundetes Terrain zurück. Kaum, dass man ihn tasten konnte. Wie die Maus unterm Teppich war er immer schon nicht mehr da, wo es sich gerade beulte.
Trössner hat in der Reha von dem Schmerz berichtet, mehrmals, immer wenn es um seinen Körper ging. Ein widerlicher Kumpan, dieser Schmerz, der gerne auftauchte, wenn man ihn am wenigsten brauchte. Zum Beispiel in den Sitzungen des Interessenverbands oder beim Besuch ausländischer Staatsgäste. Mit Salben war er nicht zu vertreiben; und sowohl die sanfte Krankengymnastik als auch die Rackerei im Fitnessstudio hatten ihm nur immer neue Quartiere gemacht, in die er dankend einzog. Am besten war es noch, ihn zu ignorieren. Auch das Radfahren half ein wenig, außerdem passte das perfekt zum Image des alternativen Unternehmers, genau wie die verfluchte Elektrolimousine. Hätte er allerdings am Morgen des neunten April unter Missachtung gesundheitlicher Interessen und öffentlicher Imagepflege das Auto für den Weg zur Firma genommen, dann –
Nein! Trössner, ich war das nicht. Das warst du! Bitte lass das! Keine Sätze über diesen Tag, in denen das Wort hätte vorkommt. Du hast mir das geschworen, immer wieder. Du weißt, das bringt nichts.
Immerhin ist seit dem besagten Tag der Schmerz verschwunden. Er ist unbekannt verzogen. Ich entschuldige mich für den Kalauer. Nicht einmal eine Erinnerung hat er zurückgelassen; es ist, als hätte es ihn nie gegeben. Trössner findet dafür keine Erklärung. Vielleicht, hat er einmal gesagt, ist sein Fall so tief, dass er nirgendwo mehr aufschlagen wird und sich infolgedessen im Zustand dauernder Schwerelosigkeit befindet. Und in diesem Zustand ist womöglich die ganze Muskulatur dermaßen entspannt, dass der Schmerz keine Spießgesellen mehr findet.
Mir hat die Erklärung nicht besonders gefallen. So eine Mischung aus Esoterik und Küchenmedizin. Ich glaube, Trössner hängt auch nicht daran. Außerdem profitiert er gar nicht davon, dass der Schmerz ihn verlassen hat. Früher konnte er es immerhin genießen, wenn der sich einmal für eine Weile verzog. Doch auch das rangiert jetzt unter alles verloren.
In einem Großraumwagen gibt es einen nicht reservierten Fensterplatz, einen Einzelsitz. Der Platz gegenüber, auf der anderen Seite des kleinen Tisches, ist nicht besetzt. Das nenne ich Glück. Trössner nimmt Platz und zwingt den Rucksack in eine Ecke wie einen großen, aber duldsamen Hund. Um ihn herum Männer und Frauen in Geschäftskleidung, ein paar Notebooks, die leise vor sich hin klappern, Mobiltelefone mit Kabelverbindung in die Ohrmuscheln.
Übrigens hat Trössner immer darauf gehofft, der Schmerz werde ihn einmal ohne jeden Anlass für immer verlassen. Einem Therapeuten sagte er sogar, er besitze einen Vertrag mit seinem Schicksal, oder immerhin mit seinem Körper. Quasi ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Er habe von seinem Körper schon seit frühester Kindheit nichts Besonderes verlangt, weder ungestüme Kraft noch Ausdauer oder die Fähigkeit, irgendwelche Exzesse folgenlos wegzustecken. Und im Gegenzug habe sich der Körper verpflichtet, ihn als Dank für die Schonung nicht mit den unerfreulichen Begleiterscheinungen des Alterns zu behelligen.
Niedlich, nicht wahr? Aber jeder hat so seine rosafarbenen Fantasien. Und natürlich seine Schreckensbilder. Trössners Dämonen waren die ehemaligen Schülerhelden. Er sah sie auf den Klassentreffen, die er besuchte, um nicht für arrogant gehalten zu werden. Da waren sie und erzählten. Die Sportskanonen hatten nach einem Bänderriss dies und das aufgeben müssen und anschließend zwanzig Kilo zugelegt. Wenn sie nicht gar dauerhaft humpelten. Und die Wilden, die so gar nichts hatten anbrennen lassen, waren jetzt säuerlich und magenkrank und nicht imstande, von zwanzig Speisen auch nur eine ohne Bedenken zu verzehren. Lauter traurige Figuren, mit denen er nichts gemein haben wollte.
Was er auch nicht hatte. Da stimme ich ihm zu. Trössner war in guter Fasson geblieben. Kein Sportler, aber auch kein verfetteter Champion. Nicht aus dem Leim geraten, nicht faltig, nicht kahl, nicht grau, nicht schief, nicht allergisch oder intolerant. Und trotz des vagabundierenden Schmerzes immer noch in der Hoffnung, die aufgesparten Früchte der Jugend beim Älterwerden in kleinen Portionen verzehren zu dürfen.
Doch dann kam leider der neunte April.
Trössner, wohin des Weges?
In den Speisewagen? Von mir aus herzlich gern. Wir könnten uns das sogenannte Bordfrühstück bestellen. Schlechter als das, was wir heute Morgen im Hotel haben ausfallen lassen, kann es unmöglich sein.
Wenn er isst, muss ich allerdings wegschauen. Seine Art, seit dem neunten April Lebensmittel zu verachten, finde ich unerträglich. Tut er das, weil sie Lebens-Mittel heißen? Das Bordfrühstück findet jedenfalls auch keine Gnade vor seinen Augen. Nicht einmal seinen Kaffee trinkt er aus. Er legt einen Geldschein auf den Tisch und beschwert ihn mit dem vollen Saftglas, was zu einem Wasserrand führt. Während er das mit der linken Hand tut, will die rechte das Portemonnaie wieder zurück in die Hosentasche stecken.
Aber es gelingt nicht. Es gelingt schon wieder nicht! Als hätte ich es geahnt. Es ist furchtbar.
Seitdem er dieses Portemonnaie besitzt, also seit – Moment, heute ist Montag – seit vier Tagen ist es Trössner noch kein einziges Mal gelungen, das Scheißding aus der Tasche zu ziehen oder in die Tasche zu stecken, ohne dabei hängen zu bleiben. Das heißt, ohne dabei denken zu müssen: Das ist nicht mein Portemonnaie.
Was, streng betrachtet, stimmt. Denn erstens hat er es von dem Geld erworben, das ihn nach dem Verlassen der Reha-Klinik im Hotel erwartete und von dem er fürchtet, er müsse es zurückzahlen. Und zweitens ist es nicht das Portemonnaie, das er am neunten April besaß, damals auch mehrmals benutzte und das er in frühestens zwei Jahren ausrangiert hätte.
Das lässt sich tatsächlich beweisen. Trössner hat es den Therapeuten vorgerechnet. Bis zuletzt besaß er nämlich eine Sammlung aller Portemonnaies, die ihm jemals gehört hatten. Nun ergibt sein Lebensalter, abzüglich der ersten Jahre ohne Geldbörse, geteilt durch die Zahl der Portemonnaies deren durchschnittliche Nutzungsdauer, in seinem Fall vier Komma soundsoviel Jahre. Und diese Zeit war noch nicht abgelaufen, als die ganze Sammlung – nun, wir wollen ja nicht in die Details gehen.
Was ist los, Trössner? Knickst du jetzt ein? Wäre es nicht, nach allem, was du schon geschafft hast, eine eher leichte Übung, den Verlust einer Sammlung von abgegriffenen und formlosen Ledertäschchen, vollgesogen mit dem Geruch von Schweiß und Geld, locker zu verkraften? Eine therapeutische Petitesse?
Aber nein, das ist vergebliche Liebesmühe. Ich weiß, was er jetzt sagen wird. Trössner, bitte sag das nicht!
Aber er sagt es. Ich wollte, ich könnte zur Abwechslung einmal mir die Ohren zuhalten. Er sagt, da habe er eben einen wunden Punkt. Niemand könne sich aussuchen, wo er seine wunden Punkte habe. Und einer von seinen wunden Punkten sei nun mal seine Sammlung von Portemonnaies, angefangen beim ältesten, das ihm der Vater mit einem Fünfmarkstück darin zur Einschulung schenkte, bis zum jüngsten, das er zum letzten Mal zückte, um Wiechmanns Taxi zu bezahlen, das ihn am Nachmittag des neunten April vom Krankenhaus zu seinem Haus am Waldrand fuhr.
Trössner, was soll das? Schon stecken wir wieder knietief in den Details. Dabei waren wir uns doch einig, das tunlichst zu vermeiden.
Und wieder dieses böse Wort, A und O, das ihm lautlos über die Lippen geht. Bringen wir es also zu Ende.
Regelmäßig hat Trössner nämlich alle Portemonnaies hervorgeholt und in die richtige Reihenfolge gebracht. Diese schiefen, am Körper gebogenen und allesamt irgendwie bräunlichen Dinger. Und während er sie ordnete, wurde er jedes Mal wieder von der Hoffnung gestreift, es könnte sich in einem noch etwas finden, das bislang unentdeckt geblieben war. Ein einigermaßen leserlich gestempelter Fahrschein, eine Eintrittskarte, eine Visitenkarte oder, was mit Abstand das Beste wäre, eine handschriftliche Notiz auf einem Fetzen Papier, mit einem Wort darauf, das ebenso rätselhaft wie einleuchtend wäre. Also hat er immer wieder jedes Portemonnaie geöffnet und in jedes der zerschlissenen Fächer geschaut; und natürlich waren sie alle vollkommen leer.
Ja, Trössner, und dann sagen wir jetzt auch noch, dass du, vielleicht um die enttäuschte Hoffnung zu überspielen, dem Kleinen zu jedem Portemonnaie eine Geschichte erzählt hast. Schon als Vierjähriger konnte er sie in die richtige Reihenfolge bringen.
So ist das also auch gesagt.
Das Portemonnaie, das gerade mal wieder nicht so glatt, also gedankenlos in die Hosentasche wollte, hat Trössner übrigens zusammen mit dem Rucksack ersteigert, letzten Donnerstag. Da saß er in dieser nackten Halle beim Güterbahnhof, wo die Bahn ihre Fundstücke versteigerte, auf der Suche nach einem möglichst billigen Gepäckstück. Aus der Reha-Klinik war er buchstäblich mit einem Pappkarton entlassen worden; und schließlich, so Trössner, brauche ein Mensch, auch wenn er noch so wenig besitzt, irgendein tragbares Behältnis, zumal wenn weitere Ortswechsel anstehen. Ich hatte da meine Einwände, habe die Aktion aber nach Kräften unterstützt. Im Grunde war sie ganz in meinem Sinne, ein Zeichen von Aufbruch und Zukunft, obwohl ich Trössners Armutsrituale ein bisschen unanständig finde.
Es begann allerdings sehr langweilig, mit Dutzenden von ramponierten Fahrrädern, bis es dann um die verlorenen und vergessenen Gepäckstücke ging. Da kam Stimmung auf. Der Mann von der Bahn, kein gelernter Auktionator, aber ein Mensch mit Freude an seiner Aufgabe, tat routiniert geheimnisvoll. Keinesfalls nenne er zuvor den Inhalt der Objekte. Nein, sagte er, da komme jetzt der Zufall zu seinem Recht, da kaufe man einmal mit voller Absicht die Katze im Sack.
Gleich als erstes kam ein mittelgroßer, nicht besonders professionell und ziemlich gebraucht aussehender Rucksack dran, offenbar prall gefüllt. Der Auktionator klopfte ihm auf die Flanken. Damit, sagte er, sei jemand gerade aufgebrochen, ein Globetrotter vielleicht. Man könne diesen Rucksack weitergeben wie ein Staffelholz oder besser: wie ein Überlebenspaket. Er schlug sich eine Hand auf den Mund. Wenn er jetzt mal nicht zuviel verraten habe.
Was immer der Mann damit bewirken wollte, es misslang ihm gründlich. Sein Publikum traute ihm nicht, er hatte übertrieben. Es wurde nur zögernd gesteigert, in sehr kleinen Schritten. Trössner bekam das Teil für einen beinahe läppischen Betrag.
Sie Glückspilz, sagte der Auktionator. Trössner bezahlte bei seinem Kollegen, der neben einer tragbaren Kasse saß und immer eine Hand auf dem Wechselgeld liegen ließ.
Weißt du noch, Trössner? Wie lange du neben dem verschlossenen Rucksack auf dem Bett in unserem Hotelzimmer gesessen hast, neben diesem tapferen Teil, das schon so einiges an Schweiß und Sonne hatte aufsaugen müssen. Richtig mulmig ist dir dabei geworden. Schließlich hattest du dir nur ein praktisches Gepäckstück für wenig Geld besorgen wollen, etwas, um, so deine Worte, dein bisschen Besitz von Exil C zum noch unbekannten Exil D zu befördern. Und jetzt stand nach den Worten des Auktionators zu befürchten, es könnte ein Zeichen für dich in diesem prall gefüllten Rucksack stecken. Etwas, das dich ganz persönlich ansprechen würde.
Na, wie lange haben wir da gesessen? Eine Stunde, zwei?
Jedenfalls lange. Dann hast du den Rucksack geöffnet. Wie aus einem Füllhorn strömte es aus ihm heraus. Doch das Allermeiste war ein Rätsel. Nur ein paar Dinge hast du überhaupt erkannt: eine gut verpackte Regenhaut, ein kleines Reisenecessaire mit den nötigsten Dingen, offenbar wasserdicht, und ein Etui mit Nähzeug und Ersatzknöpfen. Der Rest aber, und das war nicht wenig, bestand aus Sachen, die du noch nie gesehen hattest und von denen du nicht wusstest, wozu sie dienten. Vielleicht, um Wasser zu entgiften, Wunden zu desinfizieren, Insekten fernzuhalten oder Notsignale abzusetzen. Alles originalverpackt, eingeschweißt und asiatisch beschriftet.
Und schließlich das Portemonnaie, in einer Vortasche, brandneu, leer und robust. Das hat die Stimmung endgültig gekippt. Der wunde Punkt. Ich hätte schreien können. Da war er doch gewesen, ich hatte ihn gespürt, diesen Funken Glaube, es gebe für dich noch ein Ziel, zu dem du aufbrechen könntest, mit einem Plan in der Tasche.
Du hast geweint, Trössner, ich sage dir das ganz offen, für den Fall, du hast es vergessen. Du hast geweint.
Keine Träne in der geschlossenen Einrichtung, drei Wochen lang, mag sein, das lag an den Medikamenten. Aber auch keine Träne danach, in der Reha-Klinik, und nicht einmal unlängst, als dich der Brandexperte am Waldrand entlang nach Hause fuhr und du dein Fahrrad sahst, an einen Baum gelehnt, ein letzter Besitz. Keine Träne auch angesichts des Dokuments über die ordnungsgemäße Ausstreuung der Asche aus zwei Urnen auf offener See, abgeheftet mit einem Packen anderer Unterlagen in zwei Aktenordnern, die diese Arschlöcher, deine Worte, für dich im Hotel deponiert hatten. Als wollten sie dich ermuntern, damit eine neue Lebensbuchhaltung zu beginnen: mit einer Urnenquittung, ein paar Polizeiberichten und medizinischen Gutachten und einigen mehr oder weniger kurz gehaltenen Zusammenfassungen der juristischen Angelegenheiten, die jetzt allesamt drängten. Diese Arschlöcher, ich schließe mich ausnahmsweise deinem Wortlaut an, an ihrer Spitze der Insolvenzverwalter, am Ende deine Anwälte. Keine Träne über diese monumentale Herzlosigkeit. Aber über ein nagelneues, vollkommen unbenutztes, vielfächriges, steifledernes Portemonnaie aus dem Besitz eines Unbekannten, Trössner, hast du geweint. Bis du endlich, mit aller Kraft, den Rucksack gegen den Spiegel überm Waschbecken warfst.
Unvergesslich sind mir die Momente der Stille, nachdem die letzte Spiegelscherbe ins Becken gefallen war. Stille, gespeist aus ungläubigem Staunen; denn seit wann, zum Teufel, wirft man mit einem leeren Rucksack einen Spiegel ein? Das schlaffe Ding lag zwischen den Scherben im Becken, und du musstest es sehr vorsichtig herausholen, um dich nicht zu verletzen.
Ein physikalisches Wunder war es dann nicht. Denn ganz unten im Rucksack, in einem doppelten Boden aus Stoff, steckte dieses Buch, das kein Buch war. Das heißt, ein Buch war es schon, aber umgebaut zur Kiste und zum Versteck. Es ließ sich aufschlagen, der Titel und die ersten Seiten blätterten sich ganz normal, der Rest war allerdings zusammengeklebt und hatte in der Mitte, sauber ausgeschnitten und mit grünem Samt ausgeschlagen, ein kantiges Bett.
Darin lag sie, klein, schwarz und irgendwie zart, die Glock. Modell 26.
2
Na, Trössner, wach geworden?
Was für ein Geschenk, im Zug schlafen zu können! Allerdings hat sich inzwischen jemand auf den freien Platz jenseits des kleinen Tisches gewagt, womöglich nach Überwindung eines gewissen Misstrauens gegenüber einem Mann mit Vollbart im honigfarbenen Breitcord-Anzug.
Bisschen steif gelegen?
Nein, nicht der Rede wert; der Körper hat ja nichts mehr zu sagen.
Oder etwas Schlimmes geträumt?
Verzeihung, ich vergaß, er träumt nicht mehr. Sagt er jedenfalls. Denn wenn er träumte, müsste er sich ja sofort aus dem Schlaf lachen, weil was immer er träumen sollte ein alberner Wunschtraum wäre, verglichen mit dem Albtraum, in dem er lebt. Nun ja, was soll man dagegen sagen?
Und? Wie spät ist es? Wo sind wir?
Trössner schaut auf die Uhr in seinem Smartphone, dann aus dem Fenster. Schon weit nach neun, und draußen der alte Osten. Gerade spritzt etwas grauer Beton, der nach ehemaliger LPG aussieht, mit Karacho in Richtung Westen. Ihm auf den Fersen ein Windpark. Trössner muss das Logo auf den Köpfen der Windräder gar nicht erkennen, er weiß auch so, wer die gebaut hat. Er. Also seine Firma. Es sind Fliegende Holländer der dritten Generation.
Lass die Windräder, Trössner. Schau dir lieber sie an!
Ja, die junge Lady gegenüber. Ein wesentlich erfreulicherer Anblick, zumal sie eine elegante Pose eingenommen hat, wenngleich wahrscheinlich nur, um deinen Füßen auszuweichen.
Trössner zieht die Beine ein und schafft ein jungenhaftes Lächeln, soweit der Bart das erlaubt. Als wäre es ihm unangenehm, dass ihn diese Frau womöglich werweiß wie lange im Schlaf beobachtet hat, vielleicht mit offen stehendem Mund. Geschnarcht hat er immerhin nicht. Er schnarcht nämlich nie. Das habe Charlotte gesagt, und wer sollte es besser wissen?
Vorsicht, Trössner! Keine Details. Kein vermintes Gelände. Reiß dich zusammen! Am besten, du sagst jetzt was. Wer etwas sagt, kommt am schnellsten auf andere Gedanken. Zum Beispiel, dass wir jetzt wohl bald in Berlin sind. Gut, das ist nicht originell, aber damit macht man auch nichts falsch.
»Ja«, sagt die junge Lady. »Gott sei Dank.«
Und sie lächelt. Ach was, sie strahlt.
Wenn sie doch nur im Zug schlafen könnte! Sagt sie. Aber sie kann ja leider gar nichts, nicht schlafen und auch nicht arbeiten. Im Zug, wohlgemerkt.
Hoppla! Wird das jetzt eine Unterhaltung? Unverhofft kommt oft. Könnte allerdings für Trössner eine ziemliche Herausforderung werden. Schließlich hat er sich in den letzten viereinhalb Monaten praktisch nur mit dem medizinischen Personal unterhalten, und neuerdings wechselt er bloß einmal täglich ein paar Floskeln mit dem Hotelportier. Wer so aus dem Training ist, der muss sich konzentrieren. Wie ging das doch gleich: ein zwangloses Gespräch führen?
Und welchen Einfluss hat es, wenn die Gesprächspartnerin nicht unbedingt eine ganz besondere, umwerfende Schönheit ist, aber viel unternommen hat, um ihre angenehme Erscheinung zu betonen? Blauer Rock, weiße Bluse, darüber etwas leicht Asymmetrisches, auch in Blau, alles businessmäßig, aber nicht zu streng. Halblange Haare hat sie, eher dunkel. Sagt man dazu schon brünett? Sie ist nicht stark geschminkt, bis auf die Lippen; die sind eindeutig ihr Schmuckstück, herzförmig, man möchte sagen: wie gemalt.
Dass er viel Zug fahre.
Sagt Trössner, nicht ohne Mühe. Und bemerkt sofort das falsche Tempus. Gefahren ist, wäre richtig. Schon weiß er nicht mehr weiter.
Wird das jetzt peinlich?
Wird es nicht. Er bekommt nämlich Hilfe, und zwar von der jungen Frau, die wir jetzt einmal auf Ende Zwanzig, allenfalls Anfang Dreißig schätzen. Denn die verlangt ihm gar keine weiteren Beiträge zur Konversation ab, sondern erzählt ihm rasch, dass sie zwar nicht aus Berlin stammt, dort aber wohnt und arbeitet, wenngleich es in ihrem Falle eigentlich nicht so wichtig ist, wo genau sie wohnt, Homeoffice, er wisse schon. Aber inzwischen ist Berlin ja nun einmal Berlin, also, da ergibt sich einfach mehr als anderswo, das muss man schon einkalkulieren, wenn man sich über die hohen Mieten beschwert oder darüber, wie anstrengend es ist, in einer Metropole zu leben. Anstrengender jedenfalls als auf dem Land, woher sie eigentlich kommt. Und dann nennt sie den Namen eines Ortes, den Trössner nicht versteht.
Er sitzt mittlerweile ganz gerade, aber entspannt. Da kann überhaupt nichts passieren. Glück gehabt. Da braucht er jetzt wahrscheinlich nur zu nicken, und diese nette Person erzählt ihm bis Berlin den kompletten Rest ihres Lebens. Die Aussicht beruhigt. Und vielleicht, weil gleich neben der Ruhe die Sorglosigkeit haust, nickt Trössner nicht nur, sondern sagt, woher er kommt.
Hoppla, mein Lieber! Was, wenn das nette Gegenüber gleich aus purer Höflichkeit fragt, was du denn da tust und ob du beruflich nach Berlin und so weiter?
Das wäre nicht gut. Denn Hartmut Trössner, den seit dem neunten April die Ärzte, die Staatsanwaltschaft und neuerdings auch ein Portier mit Erfolg vor der interessierten Öffentlichkeit schützen, besitzt, soweit ich weiß, keine Legende, keine Tarnidentität und, zu meinem Leidwesen, keine wie auch immer geartete Begründung für Hauptstadtbesuche.
»Ah!«, sagt die junge Frau und spricht noch einmal den Namen der Stadt aus, den Trössner genannt hat. Da arbeite eine Freundin, mit der sie in Stuttgart auf der Uni war. Soll ja eine ganz nette Stadt sein, leider noch nicht dagewesen. Nur das Wetter in der Gegend, so jedenfalls die Freundin, sei nicht das allerbeste, aber darauf gebe sie nichts, die Leute hielten sich zu oft an Vorurteile, statt eigene Erfahrungen zu machen.
Wunderbar! Gerettet. Trössner, du solltest jetzt mit dem Nicken aufhören, wenn du nicht aussehen willst wie ein Wackeldackel.
»Und«, sagt sie, »fahren Sie auch bis Ostbahnhof?«
»Ja.«
Trössner, ich staune. In diesem Moment beschlossen? Aus dem verständlichen Wunsch heraus, deinem Gegenüber zuzustimmen? Nur erwarte bitte keinen Kommentar von mir, ich habe ja nicht die blasseste Ahnung, was du eigentlich vorhast.
Die junge Frau zieht ein Smartphone aus ihrer Tasche, einem bauchigen, sackförmigen Teil, das nicht so richtig zu ihrem Business Outfit passt. »Kleiner Anruf«, sagt sie, aber keine Bange, sie zeigt auf das Logo an der Wand des Wagens, sie wisse ja, was sich gehört, und suche sich dafür ein stilles Örtchen. Steht auf und sagt: »Bis gleich.« Ihre Tasche nimmt sie mit.
Bis gleich?
Ja, Trössner, warum denn eigentlich nicht? Ist diese gewisse Sache denn so gar nicht mehr zu denken? Schau doch hin: Da geht sie durch den Gang, und weil sich der Zug in eine Kurve legt und sie schon das Smartphone ans Ohr hält, muss sie ein wenig den Po zur Seite herausstrecken, als Gewichtsverlagerung, damit es sie nicht über die Sitze wirft. Das sieht doch ganz reizend aus, oder? Werden da nicht Wünsche wach?
Trössner tut, als winkte er ab. Er will da nicht hinschauen und schließt, damit ich es glaube, beide Augen, als wollte er ein erneutes Einschlafen erzwingen.
Und schon sehe ich’s hinter seinen Lidern: es. Es kam früh am Morgen, letzten Dienstag, am Ende der ersten Nacht im Hotel. Es kam zuerst als Bild, dann als Gefühl. Trössner erkannte die Szene sofort. Ein Räuberball, so hieß das, wenn ihre Tanzschule am letzten Tag vor den Ferien schon mittags öffnete. Der ganze Saal war voller aufgekratzter junger Leute; mittendrin er, ich erkannte ihn sofort, sechzehn, nein, gerade siebzehn geworden, also ohne die geringste Ahnung von dem, was er einmal sein und besitzen und verlieren sollte. Und natürlich galt das Gefühl einem Mädchen, so alt wie er, nicht üppig, aber sinnlich, immer in Bewegung und ständig lachend. Er kannte sie flüchtig von den Discoabenden in der Tanzschule, sie hieß Elke, ansprechen konnte er sie nicht, geschweige denn berühren.
Es war noch dunkel, als es aufploppte wie Spam mit Werbung für ein heikles Produkt. Trössner schaltete rasch das Licht ein, doch es ließ sich nicht vertreiben, das Verlangen nach einer Umarmung und mehr noch nach einem Wort, das die Umarmung erlaubte. Würde damit jetzt eine schwere Zeit beginnen? Das heißt natürlich: eine über die schlimmen Umstände seiner Existenz hinaus noch weiter erschwerte Zeit.
In den letzten Monaten hatte Trössner gelegentlich, nun ja, Hand an sich gelegt. Und Verzeihung, wenn ich das so sage, er tat es nicht, um ein Bedürfnis zu befriedigen, sondern um es im Keim zu ersticken. Nicht wahr? Eine Immunisierung gegen die wenigen Kontakte mit Frauen, die der Alltag in der Reha-Klinik erzwang. Und es hatte gewirkt. Kein hübsches Bein unter einem weißen Rock, kein offen stehender Knopf, keine Locke im Wind hatten es über seine Erregungsschwelle geschafft, auch als dieser unerhörte Sommer ausbrach und viel mehr Haut zu sehen war als sonst.
Jetzt aber, da es ihn in diesem Hotel erwischt hatte, was tun? Trössner war aufgestanden. Nebenan konnte er einen Mann atmen hören, vielleicht der Chef einer erfolgreichen Vertreterkolonne. Im Badezimmer trank er kaltes Wasser aus der hohlen Hand. Zurück im Bett, hatte sich das Verlangen nicht gelegt, doch der Impuls, es abzuleiten, war schwach. Außerdem ahnte Trössner, es würde alles nur schlimmer machen. Also wartete er darauf, dass der Tag anbrach.