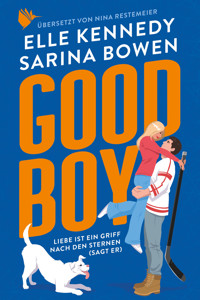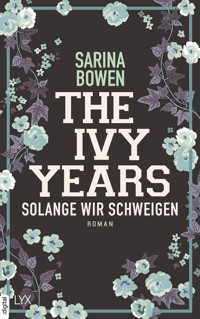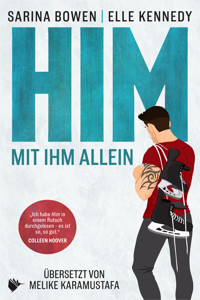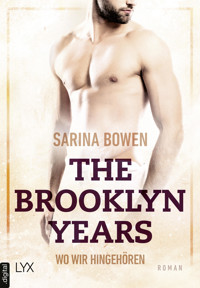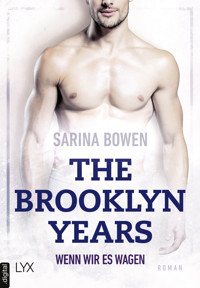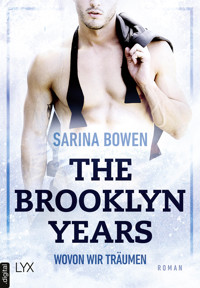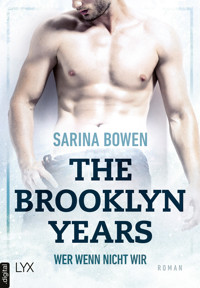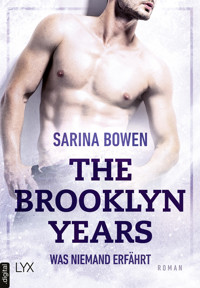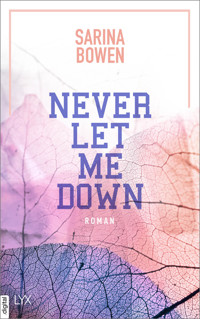
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
When everything wrong turns right
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter begegnet die junge Rachel das erste Mal ihrem leiblichen Vater Freddy Ricks - dem größten Rockstar der Welt.Nicht nur betritt sie damit eine völlig neue Welt aus Reichtum und Freiheit, sondern Freddy erfüllt ihr auch ihren größten Traum: ein Studium am Claiborne College in Vermont. Dort verliebt sie sich in ihren Tutor Jake. Doch je näher sie sich kommen, desto deutlicher spürt Rachel, dass sie erst wirklich nach vorne blicken kann, wenn sie sich den Fragen ihrer Vergangenheit stellt, die nur ihr Vater beantworten kann ...
"Ich liebe Sarina Bowens Geschichten. Ich werde alles von ihr lesen!" COLLEEN HOOVER, SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Der neue Roman von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina Bowen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Ouvertüre
1
2
3
4
5
6
7
8
Duett
9
10
11
12
Oper
13
14
15
16
17
18
Königliche Galavorstellung
19
20
Gegenbewegung
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Coda
31
32
Danksagung
Die Autorin
Weitere Romane der Autorin bei LYX
Leseprobe
Impressum
Sarina Bowen
Never Let Me Down
Roman
Ins Deutsche übertragen von Wiebke Pilz und Nina Restemeier
Zu diesem Buch
Die 17-jährige Rachel Kress begegnet nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter das erste Mal ihrem leiblichen Vater Freddy Ricks – dem größten Rockstar der Welt. Seit sie denken kann, hat sie sein Leben sehnsüchtig online verfolgt und jeden seiner Songs in sich aufgesogen, während ihre Mutter nie über ihn reden wollte. Als Freddy das Sorgerecht für Rachel zugesprochen wird, betritt sie eine ihr völlig unbekannte Welt aus Reichtum, Luxus und Freiheit, die nichts mit ihrem alten Leben zu tun hat. Außerdem ermöglicht ihr Vater ihr ihren größten Traum: einen Studienplatz am renommierten Claiborne College in Vermont. Dort verliebt sie sich in ihren Tutor Jake und könnte eigentlich nicht glücklicher sein. Denn mit Jake hat sie das erste Mal seit Langem das Gefühl, der Realität wenigstens für einen kurzen Moment entkommen zu können. Doch an dem Ort zu studieren, wo auch ihre Eltern sich kennengelernt haben, bedeutet für Rachel Neuanfang und Reise in die Vergangenheit zugleich. Und je näher sie und Jake sich kommen, desto deutlicher spürt Rachel, dass sie erst wirklich nach vorne blicken kann, wenn sie die brennenden Fragen ihrer Vergangenheit geklärt hat, die nur ihr Vater beantworten kann …
OUVERTÜRE
Ouvertüre: Instrumentalkomposition zur Eröffnung eines Bühnenwerks, zum Beispiel einer Oper oder eines Balletts. Die Ouvertüre besteht traditionell aus Themen und Motiven, die im Verlauf des Stückes weiterentwickelt werden.
1
Als ich in der dritten Klasse war, fand ich heraus, dass der Mann aus dem Autoradio, der »Wild City« sang, derselbe war, der meiner Mutter jeden Monat einen Scheck schickte. Die Namen waren nicht völlig identisch; auf den Schecks stand Frederick Richards, und die Radiomoderatoren nannten ihn Freddy Ricks.
Aber schon damals hatte ich ein gutes Gehör. Der Seufzer, den meine Mutter ausstieß, wenn sie seine Umschläge öffnete, war genau der gleiche, wie wenn sie das Radio ausschaltete.
Sie redete nie über ihn, obwohl ich sie anflehte. »Er ist ein Fremder, Rachel. Er hat dich nicht zu interessieren.«
Aber alle anderen interessierte er brennend. Als ich zehn Jahre alt war, war Freddy Ricks für einen Grammy nominiert, und sein zweites Album führte monatelang die Charts an. In meiner Kindheit hörte ich seine Songs in Werbespots für Luxusautos oder wenn ich im Drogeriemarkt in der Kassenschlange wartete. Ich las seine Interviews in People und im Rolling Stone.
Ich lernte seinen Wikipedia-Artikel auswendig. Mein Name kam nicht darin vor. Der meiner Mutter auch nicht.
Und dennoch war mein Interesse ungebrochen. Von dem Geld, das ich als Babysitterin verdiente, kaufte ich seine CDs und sammelte alle Artikel über ihn, die ich in die Finger bekam. Ich war sein größter Fan, und da kannte ich kein Pardon.
Jedes Mal, wenn ich mit meiner Mutter stritt, hängte ich ein weiteres Poster von ihm an meine Zimmerwand. Oder ich stopfte mir die Kopfhörer in die Ohren und ignorierte den Elternteil, der neben mir saß, um dem zu lauschen, den ich nie kennengelernt hatte.
Ihr Schweigen machte mich so zornig. Heute würde ich alles dafür geben, noch einmal ihr Gesicht zu sehen.
Alles.
Aber ich werde nie wieder die Gelegenheit haben, die Musik auszuschalten und stattdessen die Stimme meiner Mutter zu hören. Und so wie es aussieht, sitzt der Kerl, der es fast achtzehn Jahre lang nicht für nötig gehalten hat, sich blicken zu lassen, jetzt vermutlich im Büro der Sozialarbeiterin, um mich zu treffen.
Mir ist schlecht, als der Van vor dem Jugendamt zum Stehen kommt. Meine Hände sind beinahe zu schwitzig, um den Sicherheitsgurt zu lösen. Nachdem ich sie mir an meinem Jeansrock abgewischt habe, fummle ich an dem schmierigen Türgriff herum.
Jedes Mal, wenn ich in diesem klapprigen Fahrzeug sitze, mit dem vermutlich sonst Kinder aus Chrystal-Meth-Küchen abgeholt werden oder was Sozialarbeiter sonst so machen, denke ich: Das ist nicht mein Leben.
Und dennoch: Seit einer Woche ist es das.
Es ist schrecklich, in einem kirchlichen Kinderheim zu leben. Aber es ist längst nicht so schlimm, wie den Arzt sagen zu hören, meine Mutter spreche zwar gut auf die Chemotherapie an, aber das sei leider zweitrangig, weil sie sich eine Infektion zugezogen habe, die sie möglicherweise das Leben kosten könne.
Er hatte recht. Sie starb, und nichts wird je wieder so sein, wie es war.
»Ich hole dich in einer halben Stunde wieder ab«, sagt der Fahrer, während ich wie betäubt in die schwüle Orlando-Nachmittagshitze hinaustrete.
»Danke«, murmle ich. Einsilbige Antworten sind das Einzige, was ich dieser Tage herausbringe.
Mit dem Geschmack von Galle in der Kehle sehe ich den Van davonfahren. Aber noch habe ich die Wahl. Auch wenn der Staat Florida in letzter Zeit einige Entscheidungen in meiner Angelegenheit getroffen hat – und einige davon sind echt der Hammer –, bin ich mir ziemlich sicher, dass mich das Gesetz nicht dazu zwingen kann, dieses Gebäude zu betreten.
Ich muss den Mann nicht treffen, der mich schon vor meiner Geburt verlassen hat. Anstatt hineinzugehen, bleibe ich auf dem heißen Bürgersteig stehen und versuche nachzudenken.
Tausende Male habe ich mir vorgestellt, wie es sein würde, Frederick Richards kennenzulernen. Aber niemals hätte ich erwartet, dass es im gleißenden Neonlicht des Jugendamts von Florida sein würde.
Ich drehe mich um und denke über meine Optionen nach. Der angrenzende Parkplatz gehört zu einem Einkaufszentrum. Es gibt eine Smoothiebar, ein Geschäft für Videospiele und ein Nagelstudio. Ich könnte dort hinüberschlendern und mir einen Smoothie und eine Maniküre gönnen, anstatt meinen Vater zu treffen. Wäre ich mutiger, würde ich das tun. Nimm das, Frederick Richards. Mein Leben kann weitergehen, ohne dass ich ihn jemals kennenlernen muss. In einem Monat werde ich achtzehn. Damit ist dieser Jugendamt-Albtraum sowieso vorbei.
Dann sitzt er da in Hannahs Büro und schaut alle paar Minuten auf die Uhr, während ich auf der anderen Straßenseite meinen Smoothie schlürfe.
Okay. Ich mag überhaupt keine Smoothies. Getränke sollten nicht so dickflüssig sein.
Während ich also diese kleine mentale Rundreise durch Crazytown mache, brennt die Sonne Floridas auf mich herab. Ein Schweißtropfen rinnt mir über den Rücken. Und am Straßenrand sehe ich einen Mann hinter dem Steuer eines schwarzen Viertürers, der mich beobachtet. Ein nervöses Kribbeln schießt mir durch die Brust. Aber es verschwindet genauso schnell wieder, als mir klar wird, dass der Mann hinter dem Steuer ganz sicher nicht Frederick Richards ist. Es ist ein Latino mit grau meliertem Haar.
Ich werfe ihm einen bösen Blick zu.
Er lächelt breit.
Gruselig. Ich wende mich ab und reiße die Tür zum Jugendamtsgebäude auf. Ein erfrischend kühler Luftzug begrüßt mich. Aber die funktionierende Klimaanlage ist auch das einzig Angenehme hier. Alles im Raum ist grau, inklusive der billigen Büromöbel aus Metall und der schmuddeligen Wände, die vermutlich schon länger einen neuen Anstrich nötig haben, als ich auf der Welt bin.
»Hi, Rachel«, begrüßt mich die faltige Rezeptionistin. »Setz dich. Hannah kommt zu dir, sobald sie so weit ist.«
Ich beäuge argwöhnisch Hannahs Bürotür. Ist er wirklich da drin? Ich stelle die Frage aber nicht, denn auf einmal ist mein Mund so trocken wie eine Scheibe Toastbrot. Eine weitere Welle der Übelkeit überkommt mich, als ich mich in den ramponierten Stuhl neben Hannahs Bürotür fallen lasse.
Aus Gewohnheit ziehe ich meinen iPod Classic aus der Tasche. Das Stahlgehäuse liegt kühl in meinen feuchten Fingern. Musik war schon immer die Droge meiner Wahl. In meiner Handfläche halte ich die Welt, geordnet in Playlists für jede Lebenslage. Tausende Beispiele musikalischer Perfektion auf Knopfdruck verfügbar.
Einige der Stücke darauf hat der Mann geschrieben, der nun auf der anderen Seite von Hannahs Tür sitzt. Schon so lange trage ich meinen Vater in der Tasche mit mir herum.
»Du hast Monate deines Lebens damit verschwendet, an ihn zu denken«, beschwerte sich meine Mutter häufig, während sie mit ihrem Laserblick den CD-Stapel in meinem Zimmer betrachtete. »Aber er hat keine fünf Minuten an uns gedacht, das kann ich dir versichern.«
Ich stopfe den iPod zurück in meinen Rucksack und ziehe den Reißverschluss zu.
Mom hatte recht mit alledem, und es tut mir weh, dass ich niemals die Gelegenheit haben werde, mich bei ihr zu entschuldigen. Alles tut weh, die ganze Zeit. Ich bin Angry Rachel. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Selbst jetzt, als ich mich in dem schäbigen kleinen Vorraum umsehe, möchte ich am liebsten alles niederbrennen.
Als neben mir die Tür aufgeht, zucke ich zusammen wie eine von diesen schreckhaften Katzen in so vielen YouTube-Videos. Ich wirble herum, sehe aber nur Hannah, die mich ruhig mit ihren braunen Augen ansieht. Mit einem besorgten Blick tritt sie vor, wobei sie die Tür hinter sich fast zuzieht. »Rachel«, flüstert sie. »Möchtest du Frederick Richards kennenlernen?«
Ja?
Nein.
Manchmal.
Oh Gott!
Beim Aufstehen fühlen sich meine Knie an wie Schwämme. Hannah öffnet die Tür wieder, es sind nur drei Schritte bis in ihr Büro.
Und da sitzt er, nach all den Jahren, auf einem hässlichen Stuhl mit Metalllehnen. Ich würde ihn überall erkennen, das Gesicht, das auf Albumcovern und in den Klatschspalten von Zeitschriften berühmt geworden ist. Ich sehe Videos von ihm vor mir, wie er in Los Angeles oder Rom auftritt. Ich weiß, wie er aussieht, wenn er in New Orleans durch die Straßen schlendert oder in New York in eine U-Bahn steigt. Das können Instagram und ein paar Tausend Stunden YouTube für ein Mädchen tun.
Und jetzt weiß ich auch, wie er aussieht, wenn er ein Gespenst sieht.
Er holt scharf Luft, als ich das Zimmer betrete. Für einen kurzen Augenblick bin ich im Vorteil. Ich starre ihn seit Ewigkeiten an, aber für ihn ist mein Gesicht eine Überraschung. Vielleicht sieht er meine Mutter. Von ihr habe ich die dunkelblonden Haare und die braunen Augen.
Oder vielleicht erinnert er sich auch gar nicht mehr daran, wie meine Mutter ausgesehen hat.
Schließlich steht er auf. Er ist riesig. Ich bin verblüfft, wie groß er in Hannahs kleinem Büro wirkt. Wer hätte gedacht, dass Musikvideos die Proportionen nicht naturgetreu wiedergeben?
Ich stehe immer noch wie angewurzelt neben der Tür, mein Mund ist trocken. Er weiß auch nicht, was er machen soll. Er tritt vor, nimmt meine schweißnasse Hand in seine kühlere. »Das mit deiner Mutter tut mir so leid. Es tut mir leid …« Er räuspert sich. »Tja, mir tut eine Menge leid. Aber vor allem tut es mir leid, dass du deine Mutter verloren hast.«
Ich blicke hinab auf seine große Hand, die meine festhält, auf die langen Finger. Ich bringe kein Wort heraus. Seit einer Woche sagen mir die Leute Variationen dieser Worte, und normalerweise bringe ich immerhin ein »Danke« heraus. Aber diesmal nicht.
»Rachel«, sagt Hannah hinter ihrem Schreibtisch. »Warum setzt du dich nicht?«
Hannahs Stimme ist wie kühles Wasser. Ich lasse die Hand von Mr Frederick Richards los und nehme gehorsam auf einem Stuhl Platz, während er auf seinen zurückkehrt.
»Das ist eine ungewöhnliche Situation«, sagt Hannah und faltet die Hände.
Noch immer starren wir einander an. Er hat Fältchen um die Augen und Mundwinkel. Er hat gerade seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert, das weiß ich von Wikipedia. In den zehn Jahren, in denen ich ihm nun schon folge, ist er gealtert, aber er sieht immer noch gut aus. Vor all diesen Jahren hat meine Mutter für ihn geschwärmt. Das war ihr Wort – geschwärmt. Aber sie betonte es genau so, wie ihr Arzt »bösartig« ausgesprochen hat.
»Rachel, Mr Richards möchte dir helfen. Aber er hat kein Sorgerecht für dich. Seine Unterschrift steht nicht auf deiner Geburtsurkunde, was die Sache ein wenig vertrackt macht. Deshalb hat er eine DNA-Probe abgegeben und einen Anwalt hinzugezogen, der ihm vor dem Familiengericht helfen wird. Aber die Mühlen mahlen langsam. Es ist unwahrscheinlich, dass ihm das Sorgerecht zugesprochen wird, bevor du nächsten Monat ohnehin volljährig wirst.«
Offenbar erwartet sie irgendeine Antwort von mir. »Okay«, flüstere ich. Was bedeutet das? Geht er jetzt einfach wieder?
»Hören Sie, kann ich mit Rachel reden?«, fragt er.
»Sie meinen allein?«, konkretisiert Hannah.
»Das meine ich.« Er antwortet knapp, wie ein Mann, der es gewohnt ist, dass man ihm zuhört.
»Heute nicht«, sagt Hannah. »Dies ist ein beaufsichtigtes Treffen zwischen einem Kind in staatlicher Obhut und einem Fremden. Ich verstehe, dass das schwer für Sie sein muss, Mr Richards, und ein Publikum hilft auch nicht gerade. Aber in diesem Büro finden jedes Jahr Hunderte Gespräche statt, und ich kann Ihnen versichern, dass Sie es überleben werden.«
Hannah ist immer geradeheraus. In einer kurzen Zeit musste sie mir eine Menge schlechter Nachrichten überbringen, und immer ohne jedes Blabla.
Hannah hat die Tatsache, dass ich ins Kinderheim musste, nicht schöngeredet. »Es ist nicht das Plaza Hotel«, gab sie zu, »aber es wird von anständigen Leuten geführt, und wenn es irgendwelche ernsten Probleme gibt, rufst du mich sofort an.«
Mr Frederick Richards seufzt auf seinem Stuhl, seine Hände fahrig. Auf den meisten Fotos von ihm hält er eine Gitarre in der Hand.
»Da Sie nun schon einmal nach Florida gekommen sind, um Rachel Ihre Unterstützung anzubieten«, sagt Hannah, »warum erzählen Sie uns nicht, was Sie im Sinn hatten? Wenn ich das richtig verstehe, war Ihre Unterstützung bislang lediglich finanzieller Natur.«
Er nickt. »Das stimmt. Ich habe immer …« Er presst sich die Finger auf die Lippen. »Bisher habe ich immer angenommen, finanzielle Unterstützung wäre die einzig nötige.« Er schaut mich direkt an. »Ich wusste nicht, dass deine Mutter krank war. Das hat mir niemand gesagt.«
Wieder weiß ich, dass ich etwas sagen sollte, aber ich finde einfach keine Worte. Mein Vater muss glauben, seine Tochter sei stumm.
»Also …« Er wendet seine Aufmerksamkeit wieder Hannah zu. »Sie sagten, Rachel gehe ab Herbst ins Internat.« Seine Augen huschen zu mir. »So, wie es sich anhört, wird sie einen Ort brauchen, wo sie bleiben kann, wenn sie nächsten Monat achtzehn wird.«
»Eigentlich fällt sie im August aus unserem System«, bestätigt Hannah. »Aber sie wird vermutlich noch etwas länger in dem Heim bleiben können, bis sie aufs Internat geht.«
Ich schließe die Augen, mein Magen verkrampft sich beim Gedanken daran, eine Sekunde länger als nötig dort zu bleiben. Als ich sie wieder öffne, sieht er mich an. Er dreht sich ein wenig auf dem zu kleinen Stuhl, sodass er mir zugewendet ist. »Rachel, ich möchte dir helfen. Mein erster Gedanke war, dich einfach hier wegzuholen.« Er wedelt mit der Hand und bezieht sich damit entweder auf das Jugendamt oder den ganzen Staat Florida. Ich weiß es nicht. »Aber wenn das nicht möglich ist, werde ich zumindest dafür sorgen, dass du gut behandelt wirst.«
»Okay«, flüstere ich.
Er wendet sich wieder an Hannah. »Es muss doch eine Möglichkeit für mich geben, sie zu sehen. Sie ist schließlich keine Gefangene.«
»Nun ja.« Hannah trommelt auf ihren Schreibtisch. »Das ist Rachels Entscheidung. Sie besucht den Ferienkurs, und am Abend hat sie Ausgangssperre. Wenn sie Zeit mit Ihnen verbringen möchte, kann sie es Ihnen selbst sagen. Ich bin nicht befugt, Ihnen ihre Kontaktdaten zu geben, aber ich kann Rachel Ihre Telefonnummer geben.«
»Tun Sie das bitte«, sagt er, ohne mich aus den Augen zu lassen.
In meinen Ohren dröhnt es. »Pine Bluff High School«, platze ich heraus und überrasche damit uns alle. »Um halb drei habe ich Schluss.«
Ich werfe Hannah einen verstohlenen Blick zu, um zu sehen, ob sie meinen Vorstoß missbilligt. Aber die Sozialarbeiterin sieht ungerührt aus. »Um halb acht muss ich im Heim sein.«
»In Ordnung«, sagt er, zückt ein Notizbuch und einen Stift aus seiner Hemdtasche. Ich bemerke, dass seine Hände zittern, als er etwas auf das Deckblatt kritzelt.
Hannah wirft einen Blick auf die Uhr. »Wir haben noch ein paar Minuten. Ich könnte Kopien der Dokumente machen, die Mr Richards vorgelegt hat. Soll ich das jetzt machen, Rachel? Ich könnte auch damit warten.«
Ich nicke. »Machen Sie nur.«
Hannah steht auf und blockiert die Tür beim Hinausgehen mit einem Türstopper aus Gummi.
Frederick lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, legt den Kopf an die Wand. »Ich weiß, dass …« Er beendet den Satz nicht. »Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Aber ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen.«
Ich nicke nur, weil ich mir nicht zutraue zu sprechen. Mein ganzes Leben lang habe ich darauf gewartet, diese Worte zu hören. Und dennoch würde ich sie im Handumdrehen eintauschen, wenn ich damit den letzten Monat ungeschehen machen könnte.
»Wenn es für dich in Ordnung ist, hole ich dich morgen um halb drei an der Schule ab.«
»Okay.« Ich lecke mir über die trockenen Lippen. »Ich muss Hausaufgaben machen.« Das ist so eine dämliche Ergänzung. Als wären Hausaufgaben gerade wichtig.
»Ich bleibe nur, solange du willst.«
In der darauf folgenden Stille rauscht Hannah wieder herein. »Hat einer noch Fragen?«
»Ich möchte bloß, dass Sie mich anrufen, wenn ich irgendwie helfen kann«, sagt er. »Sie haben meine Handynummer, und ich wohne im Ritz-Carlton.«
In diesem Augenblick klopft Ray, der Fahrer des Vans, an den Türrahmen. »Hey, Rachel. Bist du so weit?«
Ich stehe auf, bereit zur Flucht.
»Rachel?« Hannahs sanfte Stimme stoppt mich, bevor ich gehen kann. »Ich habe dir heute drei Nachrichten hinterlassen. Lass uns zur Sicherheit jetzt gleich unser nächstes Treffen vereinbaren.«
»Mein Handy geht nicht mehr«, sage ich. »Es muss …« Ich möchte nicht zugeben, dass es gesperrt worden ist. Bevor meine Mutter gestorben ist, lag sie wochenlang im Krankenhaus. Einige Rechnungen sind nicht bezahlt worden. Von all den Dingen, die in meinem Leben gerade schieflaufen, schafft es eine unbezahlte Handyrechnung nicht einmal in die Top 50. Trotzdem ist es mir peinlich.
»Oh«, sagt Hannah und sieht mich mitfühlend an. »Kann ich dir dann die Daten für unseren nächsten Termin mailen?«
Ich nicke.
»Nimm das hier«, sagt sie und reicht mir eine Visitenkarte. Darauf lese ich Freddy Ricks. Hannah hat mir gerade etwas gegeben, das ich vorher noch nie gefunden habe. Seine persönliche Nummer und E-Mail-Adresse.
Ich sehe ihn noch einmal an, nur um ganz sicherzugehen, dass er wirklich echt ist. Er erwidert den Blick. Seine Augen sind gerötet. »Bis dann«, flüstert er. Der Mann, den der Rolling Stone als »tanzbare Eloquenz« bezeichnet, presst die Lippen zusammen und wendet den Blick ab, zu Hannahs Wand.
Es ist ein warmer, stickiger Abend in Florida, so wie die Abende hier im Juli immer sind. Für die nächsten drei Monate wird es in Orlando unerträglich heiß sein. Wenn es kühler wird, habe ich vor, weit, weit weg von hier zu sein.
Ich sitze auf der kratzigen Überdecke und versuche, eine Algebra-Aufgabe zu wiederholen. Auf dem Bett nebenan versteckt sich meine Zimmergenossin Evie unter zu langen Stirnfransen und monströsen Kopfhörern. Die Musik, die aus ihnen herausplärrt, ist so laut, dass ich mir nicht erklären kann, warum Evie nicht schon längst vollkommen taub ist.
Evie lebt seit vier Jahren im Heim. Vielleicht macht es ihr nichts aus, wenn sie taub wird.
Heute ist meine siebte Nacht hier. Hinter diesen Mauern verändert die Realität ihre Form. Ich habe gesehen, wie meine Mutter starb. Und obwohl ich danebenstand, als ihr Sarg in die Erde hinabgesenkt wurde, rechne ich ständig damit, dass sie zur Tür hereinkommt und sagt: »Rachel, pack deine Sachen, wir gehen. Und warum hast du eigentlich deine Abschlussprüfungen noch nicht gemacht?«
Ich blättere eine Seite in meinem Mathebuch um. Claiborne Prep – wo ich nächstes Jahr zur Schule gehen werde – wird ein Zeugnis voller »Ungenügend« nicht akzeptieren. In der Woche, in der meine Mutter starb, habe ich alle meine Abschlussprüfungen verpasst. Die Schule hat dafür gesorgt, dass ich sie während der Sommerferien nachholen darf. Und nun sitze ich hier fest, in diesem Zimmer, mit diesen Hausaufgaben und einem schwirrenden Kopf. Ich versuche ein letztes Mal, die Gleichung auf der Seite zu verstehen. Doch dann höre ich draußen ein Auto hupen.
Ich lasse meinen Bleistift fallen und renne aus dem Zimmer. Die Treppenstufen sind mit einem Teppich ausgelegt, dessen Braunton versucht, den Dreck von Tausenden Füßen über Dutzende von Jahren zu kaschieren, was ihm jedoch misslingt.
Draußen wartet eine wohlbekannte blaue Klapperkiste am Straßenrand. Als ich aus dem Haus trete, steigt Haze aus dem Wagen. Ich hocke mich auf die schmuddelige Treppenstufe, und er setzt sich neben mich, schlingt die tätowierten Arme um seine Knie und stützt das Kinn auf seinen Bizeps. »N’abend«, sagt er.
»Hi!«
»Du hast mich hinterher gar nicht angerufen. Ich wollte doch wissen, wie es war.«
»Mein Telefon geht nicht mehr.« Und selbst wenn, ich hätte nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen.
»Mochtest du ihn?« Er schaut mich von der Seite an.
Ich zucke mit den Achseln. Ich mochte ihn schon immer. »Es war wirklich schwierig. Wir hatten beide Angst.«
»Wovor muss er denn Angst haben? Außer vor mir?«
»Haze«, warne ich ihn. Seit der zweiten Klasse sind wir Freunde, seit ich Adam Lewis in den Hintern gekniffen habe, damit er Haze in Ruhe ließ. Seitdem ist Haze mein treuer Freund, auch wenn er meinen Schutz mittlerweile nicht mehr nötig hat. Mit der neunzehnjährigen Ausgabe von Haze möchten sich die Adam Lewisse dieser Welt nicht anlegen.
Heute bin ich diejenige, die den Schutz braucht. Als meine Mutter ins Krankenhaus kam, saß Haze neben mir. Als ich ihre Hand hielt, hielt er meine andere. Zusammen sahen wir dabei zu, wie meine Mutter immer kränker wurde, jeden Tag an neue Schläuche und zuletzt an ein zischendes Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Während ihres dreiwöchigen Leidens kutschierte er mich zum Krankenhaus und zurück nach Hause. Wenn ich zu erschöpft und zu verängstigt war, um allein zu bleiben, schlief er bei mir auf dem Sofa und schwänzte die Schule.
Haze muss jetzt auch in die Nachprüfungen, und das ist im Grunde genommen meine Schuld.
Und schließlich, am Ende, als ich vor der Beerdigung wie betäubt in seinem Auto saß, hat er mich in seine Arme gezogen und zum ersten Mal geküsst. Wir haben danach nicht darüber gesprochen, aber diese Veränderung sitzt jetzt zwischen uns, hier auf der schmuddeligen Stufe. Auch früher schon hat Haze mir ständig den Arm um die Schultern gelegt oder mir den Rücken getätschelt. Aber inzwischen spüre ich, dass er eine bestimmte Art von Hitze ausstrahlt, wenn wir zusammen sind.
In diesem Augenblick merke ich, wie seine Fingerspitzen auf mein nacktes Knie schlüpfen. Und ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll.
»Ich verstehe nicht, warum Daddy glaubt, er könne helfen«, sagt Haze. »Der Mann ist siebzehn Jahre zu spät dran.«
Ich weiß. Angry Rachel stimmt ihm insgeheim zu. Natürlich bin ich sauer auf Frederick. Trotzdem möchte ich mich nicht gegenüber Haze dafür rechtfertigen müssen, dass ich ihn getroffen habe.
Ich sehe zu, wie Haze mit den Fingerspitzen sanft über mein Knie streichelt. Seine Berührung ist liebevoll, was ich wirklich zu schätzen weiß. Aber sie ist auch erwartungsvoll. Ich greife nach seiner Hand und drücke seine Finger, damit sie beschäftigt sind. Und dann wechsle ich das Thema. »Hast du schon was von Micky Maus gehört?« Haze bewirbt sich gerade auf Jobs in allen möglichen Vergnügungsparks und hofft, er kann anfangen, wenn wir endlich unseren Abschluss in der Tasche haben.
»Noch nicht. Aber ich frage mich … Was meinst du, was ist wohl der schlimmste Job da?«
»Kann Micky schon aufs Töpfchen gehen? Was ist mit Goofy?«
Ein Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus. »Weißt du, dass das Personal einen Geheimcode für die ganzen üblen Sachen hat? ›Code K‹ steht für Kotze. Die wird mit ›Feenstaub‹ weggemacht, und das ist eigentlich Sägemehl mit Aktivkohle.«
»Igitt! Sieh zu, dass du nicht bei Space Mountain eingesetzt wirst.«
»Wem sagst du das? Rachel, du musst in zwei Minuten drinnen sein.«
»Stimmt.«
»Wir können uns morgen nach der Schule treffen.«
Ich schüttle den Kopf. »Frederick kommt mich abholen.« Sein Name fühlt sich komisch in meinem Mund an. So formell. Aber ich kann ihn auch nicht »mein Vater« nennen, denn soweit ich weiß, hat er mich nie seine Tochter genannt.
Haze sieht enttäuscht aus. »Warum das denn, Rae? Du kannst diesen Bullshit nicht brauchen. Was würde deine Mutter dazu sagen?«
Haze und meine Mutter haben sich immer hervorragend verstanden – selbst nachdem Haze kein niedlicher Grundschüler mehr war, sich Tattoos zulegte und einmal sitzen blieb. »So ist Haze eben«, seufzte sie, wann immer sie von seinem neuesten Schlamassel erfuhr. »Er musste eine Menge durchmachen.« Mir gegenüber war Jenny Kress stets eine strenge Zuchtmeisterin. Aber für Haze hatte sie eine Schwäche. Das war eines der fortdauernden Rätsel in meinem Leben.
»Jenny hätte gesagt, dass dieser Mann dir nichts bedeuten sollte«, fährt Haze unnachgiebig fort.
Ich starre auf die Risse im Betonboden. Die Wahrheit ist, dass meine Mutter das ziemlich oft gesagt hat. Bis zu jenem Abend, an dem sich alles änderte.
»Es war ihre Idee«, sage ich langsam.
»Was war ihre Idee?«
Schon jetzt verkrampft sich mein Magen. Die Erinnerung an die letzte Woche meiner Mutter tut noch viel zu weh. Wenn ich diese Tage hier überstehen will, darf ich nicht an diese hektischen Stunden denken, in denen die Ärzte sich abmühten, ihren Verfall zu stoppen, und das Pflegepersonal – Moms Kollegen – mit besorgten Gesichtern kam und ging.
»Es war der Abend, an dem du Milchshakes holen gegangen bist, weil sie gesagt hatte, davon würde sie etwas trinken.« Allein die Erinnerung an ihr Krankenhauszimmer drückt mich unter die Wasseroberfläche dieses tiefen Beckens aus Angst, in dem ich seitdem schwimme. »Völlig unvermittelt sagte sie: ›Wir müssen deinen Vater anrufen.‹«
Damals versuchte ich, die Idee beiseitezuschieben. »Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt«, antwortete ich ihr.
Aber sie erwiderte: »Der richtige Zeitpunkt ist schon längst verstrichen.« Und dann stieß sie den traurigsten Seufzer aus, den ich je gehört hatte.
Das war exakt der Augenblick, in dem ich verstand, wie schlimm es stand. Bis dahin hatte ich es irgendwie geschafft, optimistisch zu bleiben, obwohl ich sie noch nie so krank erlebt hatte. Obwohl sie fast die ganze Zeit über schlief und sich ihre Haut wie heißes Pergament anfühlte. Obwohl Hannah, die Sozialarbeiterin, angefangen hatte, ihrem Krankenzimmer regelmäßige Besuche abzustatten.
Bis zu diesem Augenblick konnte ich mir noch einreden, alles würde wieder gut. Aber dann ließ sie die Blase platzen. Wir müssen deinen Vater anrufen. Das war das Erschreckendste, was sie jemals zu mir gesagt hatte.
»Wir werden ihn nicht anrufen«, widersprach ich erneut und fühlte mich, als müsste ich mich jeden Moment übergeben.
»Wen anrufen?«, fragte Hannah von der Türschwelle.
Und das war’s.
»Oh scheiße«, sagt Haze und klingt überrascht. Er packt mich am Handgelenk und zieht mich sanft auf die Füße. »Das heißt aber nicht, dass es eine gute Idee war. Was, ähm, ist eigentlich zwischen den beiden gelaufen?«
»Ich habe keine Ahnung. Mal abgesehen vom Offensichtlichen.« Bei der Andeutung von Sex kriecht mir Hitze den Hals hinauf.
Aber Haze lächelt bloß. »Das habe ich mir schon gedacht. Was glaubst du: War es eine Affäre, oder waren sie ein Paar?«
Ich kann nur den Kopf schütteln. »Immer wenn ich ihr Fragen gestellt habe, sagte sie bloß, sie habe ihn nicht besonders gut gekannt. Dass er ein Fremder sei.« Auch wenn ich ihr das nie ganz abgekauft habe. Mom wirkte so wütend auf ihn, wie es ein Fremder niemals verdient hätte. Oder war das bloß Wunschdenken von mir?
Ich hasste den Gedanken, die Folge eines One-Night-Stands zu sein. Ein Unfall.
An diesem schrecklichen Abend, als meine Mutter Hannah auftrug, ihn zu benachrichtigen, öffnete sich möglicherweise ein Fenster – für die seltene Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber ich tat es nicht. Ich hatte Angst, das Siegel aufzubrechen, so als würde mein schlimmster Albtraum wahr werden, wenn ich ihn nur zur Kenntnis nähme.
Aber er wurde trotzdem wahr. Die letzten Worte meiner Mutter waren: »Es ist okay, Rachel.«
Haze streicht mir auf eine Weise über den Rücken, die mich in Alarmbereitschaft versetzt. »Rae, du brauchst diesen Typen nicht wiederzusehen, wenn dir nicht danach ist.«
»Ich weiß.«
»Wir fahren morgen bei dir zu Hause vorbei und holen die Sachen, die du brauchst.«
Das ist noch etwas, wovor ich Angst habe. »Das kann warten.«
»Okay«, flüstert er, seine Augen werden sanft. Ich weiß, was jetzt kommt. Er umfasst mein Gesicht mit beiden Händen, und ich halte den Atem an. Langsam neigt Haze sein Gesicht zu meinem und bringt unsere Lippen zusammen. Ich bin mir seiner Handflächen auf meinen Wangen, seinem Atem auf meinem Gesicht und dem leisen Schmatzen seines Kusses allzu bewusst.
Ich löse mich von ihm, sobald ich kann, ohne unhöflich zu sein.
»Wir sehen uns morgen früh«, sagt er. Dann dreht er sich um und joggt zu seinem Auto.
2
Die erste Minute des Tages ist immer die schlimmste.
Wenn ich die Augen öffne, ist der rissige Deckenputz normalerweise der erste Hinweis. Wenn mir dann immer noch nicht klar ist, dass das alles nicht bloß ein Albtraum war, sorgt das graue Licht, das durch die Vorhänge hereinfällt, für die Erkenntnis. Oder der Klang von Schwester Mary Ruths zwitschernder Stimme auf dem Flur.
Meine Mutter ist fort und wird nicht wiederkommen.
In diesem Moment steigt diese Übelkeit in meinem Magen auf, und sie hört auch dann nicht auf, wenn die Dusche frei ist. Nicht einmal wenn Evie niemanden im Flur schubst. Selbst wenn niemand meinen Toast klaut, bevor er aus dem Toaster springt – der Schmerz ist immer da.
Bevor meine Tortur hier begann, wusste ich nicht, dass es solche Orte wirklich gibt. Selbst von den Ferienkursen hatte ich nur eine verschwommene Vorstellung, denn ich hatte noch nie jemanden kennengelernt, der im Sommer büffeln musste, außer vielleicht für die Fahrschule.
Es ist, als wäre an dem Tag, an dem meine Mutter starb, ein höllisches Paralleluniversum erschaffen worden, in dem ich jetzt gefangen bin. Mit klopfendem Herzen wasche und ziehe ich mich an so schnell ich kann.
»Guten Morgen, meine Liebe«, sagt die diensthabende Nonne, als ich in die Küche eile. Sie reicht mir ein winziges Glas Orangensaft, den sie austeilt, als wäre es flüssiges Gold.
»Danke«, flüstere ich und stürze ihn hinunter. Dann schultere ich meinen Rucksack und renne nach draußen, wo ein wohlbekanntes altes blaues Auto am Straßenrand wartet.
Es ist eine Riesenerleichterung, mich auf Haze’ Beifahrersitz sinken zu lassen. Er verschwendet keine Zeit mit Small Talk. Er sagt nicht »Guten Morgen« oder fragt mich, wie ich geschlafen habe. Er rutscht einfach rüber und nimmt mich in die Arme. Ich lege ihm das Kinn auf die Schulter und atme zitternd aus.
»Noch einen Monat«, flüstert er und meint damit die Zeit bis zu meinem Geburtstag. Ich ziehe die Nase hoch und kämpfe gegen die Tränen an. Ein Monat dauert ewig. Und ich habe erst acht Tage geschafft. »Was würde passieren, wenn du einfach nicht zurückgehen würdest?« Er löst sich von mir und mustert mich mit seinen dunklen Augen.
»Die Sozialarbeiterin würde nach mir suchen. Und sie würden mich sowieso in der Schule finden.«
»Unvorstellbar, dass du mal einen Tag schwänzt«, sagt Haze und legt den Gang ein.
Ich mache mir nicht die Mühe, es zu erklären, denn Haze sollte es eigentlich wissen. Ich brauche gute Noten, sonst kann ich im September nicht auf die Claiborne Preparatory Academy wechseln. Und das Internat ist das Einzige in meinem Leben, das sich an dem Tag, als meine Mutter ins Krankenhaus kam, nicht in Luft aufgelöst hat.
Abgesehen von Haze. Gott sei Dank habe ich Haze.
Er lässt das Thema fallen und schaltet stattdessen das Radio ein. Sam Smith schmachtet aus den Lautsprechern und erfüllt das Auto mit dem Klang des Liebeskummers von jemand anderem.
Später an diesem Vormittag sitze ich gerade im Medienzentrum der Schule und lerne, als eine E-Mail in meinem Posteingang landet. Der Name des Absenders ist mir völlig unbekannt. Aber der Betreff lautet: »Herzlich willkommen in Claiborne«.
Liebe Rachel,
hi! Ich schätze, das Letzte, was du brauchst, ist eine E-Mail von einem Fremden, der dich daran erinnert, dass die Schule in sieben Wochen wieder anfängt. Aber du wirst vier davon bekommen.
Tut mir leid, aber ich halte mich nur an die Regeln.
Mein Name ist Jake, und ich habe gerade die elfte Klasse auf der Claiborne Prep abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme und so. Claiborne ist super, und das sage ich nicht nur, weil du die Schulgebühren schon bezahlt hast. Es ist ziemlich klasse hier. Offensichtlich wirkt die Gehirnwäsche bei mir. Wahrscheinlich haben sie mich deshalb gebeten, dir zu schreiben.
Jeder neue Schüler bekommt vier Mails von einem Paten, und du wurdest mir zugeteilt. Meine E-Mail-Adresse ist [email protected], aber du bekommst eine normale mit deinem Namen, also [email protected]. Es ist ziemlich leicht, sich ein Alias auf dem Server einzurichten, wenn man so ein Nerd ist wie ich und Spaß an solchen Sachen hat.
Juchhu! Lustige Zeiten im Internat! Ich weiß, wie man feiert. ;) Als ich mich hingesetzt habe, um diese E-Mail zu schreiben, habe ich mich gefragt, ob ich wie ein cooler Typ rüberkommen könnte. Aber nach nur vier Absätzen sieht man schon das fette L auf meiner Stirn.
Egal.
Alles, was sie mir über dich erzählt haben, ist Folgendes: deinen Namen, deine Adresse, deine ehemalige Schule und dein Schuljahr. Du kommst also aus Orlando, Florida? Ist es nicht seltsam, direkt neben Disney World zu wohnen? Gehst du immer noch gern dorthin, oder wäre es dir lieber, man würde es in Schutt und Asche legen? Ich war ein paarmal mit meiner Familie dort, wie jedes Kind in Amerika. Und ich war dasKind, das sich nach einer Fahrt im Teetassenkarussel übergeben musste.
Ehrlich. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es ziemlich schwül war, da wir im August hingefahren sind, weil es dann billiger ist. Ich schiebe es auf die Hitze und zu viel Limonade. Meine Familie wird es mir bis in alle Ewigkeit unter die Nase reiben. Zehn Jahre danach kriege ich immer noch zu hören: »Weißt du noch, wie Jake sich in Disney World übergeben musste?«
Wenn du also aus Florida kommst, musst du dir Wintersachen kaufen. Und Stiefel. Die darfst du auf keinen Fall vergessen. Hier gibt’s nicht nur fluffigen Neuschnee und Regenbogen. Das Wetter in New Hampshire bringt uns auch jede Menge Matsch und Eis. Und es dauert ewig, bis der Frühling endlich mal kommt. Im März und April gibt’s hier nichts anderes als matschige Wege, kahle Bäume und übrig gebliebene Schneehaufen, die sich weigern zu schmelzen.
Jetzt verkaufe ich es aber richtig gut, was? Claiborne Prep: das Land des fiesen Wetters und unnatürlich langer Betten. Für fünfzig Riesen im Jahr könnte all das dir gehören. Komm zu uns!
Wenn du noch Fragen hast, was du mitbringen sollst oder wie du dich für die Kurse anmelden kannst, dann schreib mir. Geheimtipp: Das mit den extralangen Bettlaken ist kein Witz. Normale zwei Meter lange Laken kriegst du nicht über die Ecken. Deshalb ist es sinnvoll, die langen im Katalog zu bestellen. Und wenn du eine komische Farbe oder ein komisches Muster nimmst, findest du deine Sachen leichter wieder, wenn sie jemand im Wäscheraum aus dem Trockner nimmt. Meine sind mit Schneemännern. (Danke, Mom!)
Schreib mir, wenn du magst.
Jake Willis
Jakes Brief zu lesen ist, als würde ich meine Realität für ein paar Minuten verlassen. Ich lache sogar laut, als ich lese, dass er auf dem Karussell kotzen musste.
Dass ich im Herbst auf die Claiborne Prep gehen werde, kommt mir noch völlig unwirklich vor.
Seit der zehnten Klasse liege ich meiner Mutter in den Ohren, mich dorthin zu schicken. Staunend saß ich vor der Website und verliebte mich in den Glockenturm und die efeuberankten Ziegel. Alles sah aus wie aus einem Film. Ich wollte durch echte Blätterhaufen stapfen (in Florida gibt es die nicht) und mit diesen ernsthaften Schülern verkehren, wie ich sie mir auf einem Internat vorstellte.
Meine Mutter blieb unnachgiebig. »Das können wir uns nicht leisten«, sagte sie die ersten zehn Male, als ich davon sprach. »Das ist viel zu versnobt.«
»Und wenn ich ein Stipendium bekommen würde?«, bohrte ich weiter. Auf diese Weise hatte auch meine Mutter ihr Jahr dort bezahlt. Oder wenn du meinen Vater um das Geld bitten würdest? Auch wenn ich diese Bitte nicht laut aussprach, hing sie immer zwischen uns in der Luft.
Diese Diskussion führten wir tausendmal. Wir beide taten so, als wäre das Geld die große Hürde. Aber es steckte noch viel mehr dahinter. Als sie so alt war wie ich, verbrachte meine Mutter auch ein Jahr auf der Claiborne Prep. Sie war in Claiborne, New Hampshire, aufgewachsen.
Und dort war sie mit mir schwanger geworden.
Meine Mutter hat nie viel über ihre Zeit in Claiborne geredet. Und schon gar nicht über meinen Vater. Aber ich wusste, dass ihr der Gedanke nicht gefiel, ihre kleine Tochter könnte so weit weg gehen. Außerdem wollte sie nicht, dass meine Teenagerzeit so endete wie ihre. Erst zu viel Freiheit und dann ein Baby.
Aber ich gab nicht auf. Ich bearbeitete sie weiter. Ein Jahr auf dem Internat würde sich gut auf meinen Collegebewerbungen machen, und die waren Mom sehr wichtig.
Schließlich willigte sie ein. Eines Tages legte sie mir einen Scheck mit der Anmeldegebühr auf den Tisch, ausgestellt für die Claiborne Prep. Ohne zu fragen, warum sie ihre Meinung geändert hatte, setzte ich mich hin und fing mit der Onlinebewerbung an.
Eine Woche nachdem ich alle Bewerbungsunterlagen abgeschickt hatte, sagte Mom mir, der Krebs sei zurück.
Während ich mir vorstelle, wie sich eine ehrliche Antwort auf Jakes freundliche Nachricht wohl anhören würde, schweben meine Finger über der Tastatur. Hi, Jake! Direkt nachdem ich mich an deiner Schule beworben habe, verwandelte sich mein Leben in eine totale Katastrophe. Meine Mutter wollte nicht, dass ich nach Claiborne gehe, und ich glaube, sie hat nur nachgegeben, weil sie wusste, dass sie sterben würde.
Das kann man aber nicht in einer E-Mail an einen Fremden schreiben.
Lieber Jake,
vielen Dank für deinen Brief. Ich kann mir kaum vorstellen, nächsten Winter in Claiborne zwischen Schneehaufen herumzulaufen. Seit meinem dritten Lebensjahr habe ich keinen Schnee mehr gesehen. Und Disney World mag ich immer noch. Die Touristenströme können ziemlich nerven, aber das alles hat auch seine Vorteile. Mein Freund Haze und ich sind ziemlich gut darin, uns in Hotels reinzuschleichen und den Swimmingpool zu nutzen. Wir haben einen ganzen Stapel herrenloser Schlüsselkarten, die wir zeigen können, falls jemand danach fragt.
Und du bist nicht der Einzige, der sich jemals auf dem Teetassenkarussell übergeben hat. Mein Informant sagt, das passiert ständig.
Ich habe ungefähr eine Million Fragen zu Claiborne. Meine Erfahrung mit Internaten beschränkt sich auf die Lektüre von Harry Potter. Was, wenn der Sprechende Hut mich nach Slytherin schickt? Sind die Hauselfen nett? Ist der Zaubertränke-Unterricht so schwierig, wie er aussieht?
Mal im Ernst – ist es verrückt, dass ich nur für das letzte Schuljahr komme? Vielleicht war das eine blöde Entscheidung für jemanden, der ziemlich introvertiert ist. Werde ich mir das Zimmer mit jemandem teilen? Davor habe ich ein wenig Angst.
Was noch? Ich habe jede Menge Fragen zu den verschiedenen Musikgruppen. Ich weiß, dass es einen Glee Club und einen Chor gibt. Ist das nicht dasselbe? Außerdem interessiere ich mich für die A-cappella-Gruppen. Aber dafür muss man bestimmt vorsingen, oder? Grusel.
Meine E-Mail-Adresse in Claiborne sollte lauten: [email protected].
Danke, dass du mir geschrieben hast. Immerhin kenne ich jetzt schon einen in Claiborne.
Viele Grüße
Rachel Kress
Nachdem ich auf »Senden« gedrückt habe, widme ich mich wieder meiner Aufregung darüber, nach der Schule meinen Vater zu treffen. Die letzte Stunde meines Schultages verbringe ich damit, immer auf dieselbe Seite meines Politikbuchs zu starren. Als es klingelt, habe ich feuchte Hände.
Auf der Mädchentoilette bürste ich mir die Haare. Mit acht Jahren träumte ich einen Monat lang davon, dass Frederick zum Vater-Tochter-Essen in der Schule kommen würde. Selbst vor zwei Monaten habe ich mir noch vorgestellt, wie er während meines Solos beim Frühlingskonzert meines Chors hinten in der Aula steht.
Ein Treffen mit meinem Vater habe ich mir immer in den schönsten Farben ausgemalt. Aber jetzt gibt es nur diese eine Version von mir – die zerknitterte, mit den rot geweinten Augen und den nicht ganz sauberen Klamotten. Ich stecke die Bürste in meine Tasche und verlasse die Toilette, wenigstens entkomme ich so meinem Spiegelbild.
»Hey!« Haze wartet vor der Tür. Im Gleichschritt steuern wir auf den Haupteingang zu. »Und du bist dir ganz sicher?«
»Ja.« Nein.
Die Anspannung, die ich gestern in Hannahs Büro gespürt habe, verdoppelt sich, als Haze mir die Tür aufhält. Und ich weiß nicht, ob ich mehr Angst davor habe, dass mein Vater nicht auftaucht oder dass er auftaucht.
Aber dort steht er, an ein Auto in der Schlange gelehnt, mit Sonnenbrille und Baseballcap. Schon von Weitem sieht man ihm an, dass er ein Promi ist, der unerkannt bleiben will. Aber wie sollte er auch sonst aussehen? Er kann wohl kaum mit einem Konzert-T-Shirt und seiner Gitarre hier aufkreuzen.
Mir ist schwindlig, als ich auf ihn zugehe.
Haze legt mir die Hand auf den Arm und hält mich auf. »Du musst ihn nicht treffen, weißt du? Du musst nicht höflich sein. War er schließlich auch nie.«
Natürlich hat Haze recht. Und trotzdem werde ich freundlich sein. Das sind brave Mädchen immer. »Ich muss da jetzt durch, okay?«
Haze sieht mich unter einer Strähne glänzenden schwarzen Haares hervor an. Sein Gesicht ist wie gemacht für Drama, mit schweren Lidern und kohlrabenschwarzen Wimpern. »Bist du nicht wütend?«
Natürlich bin ich wütend. Sogar stinksauer. Aber ich kann Frederick nicht zeigen, wie ich mich fühle, sonst wird er nach Kalifornien verduften, bevor ich eine Chance habe … Ja, zu was eigentlich? Ihn kennenzulernen? Meinen Standpunkt darzulegen? Die Wahrheit zu erfahren?
Ihn dazu zu bringen, es zu bereuen?
»Sei bitte vorsichtig, Rae«, sagt Haze schroff. »Du kannst mich immer anrufen. Ich komme und hol dich ab.« Er gibt mir schnell einen Kuss auf die Wange. Dann stapft er davon, direkt an Frederick Richards vorbei, den er die ganze Zeit mit Blicken durchbohrt.
Ich schaue ihm hinterher. Dann hole ich Luft und gehe weiter auf den Mann zu, der mein Vater ist.
Frederick Richards nimmt die Sonnenbrille ab und steckt sie sich in die Brusttasche. »Alles in Ordnung?«
»Ja«, sage ich und bleibe stehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich ins Auto einsteigen soll.
Mit den Augen folgt er Haze bis zum Parkplatz. »Also gut. Es ist zwar heiß, aber hättest du Lust, ein Stück zu gehen?«
»Warum nicht?«
»Wenn du willst, kannst du deinen Rucksack im Auto lassen.« Er streckt die Hand aus.
»Okay.« Ich reiche ihm den Rucksack.
Er öffnet die hintere Tür und legt ihn auf den Sitz. Dann schließt er die Tür und dreht sich zu mir um.
»Du kannst hier nicht stehen bleiben«, muss ich ihn belehren. »Hier wird man abgeschleppt.«
»Oh, ist schon gut. Carlos fährt den Wagen weg, wenn es sein muss.« Er öffnet die Beifahrertür. »Bleib cool, Mann. Ich ruf dich an.«
»Okay, Boss«, sagt eine Stimme im Auto.
Mein Vater nimmt zwei Flaschen Wasser vom Sitz und reicht mir eine. Dann schließt er die Wagentür und deutet mit dem Kopf zu dem Weg, der zu den Sportplätzen führt. »Sollen wir?«
Während ich mit ihm Schritt halte, fummle ich am Verschluss der Flasche herum.
»Das ist also deine Schule. Wie ist sie so?«
Das ist eine leichte Frage. Das krieg ich hin. Ich nehme einen Schluck Wasser. »Nicht schlecht. Aber Florida ist nicht gerade bekannt für seine exzellenten Schulen.«
»Auf mich macht sie einen guten Eindruck. Meine Highschool sah aus wie ein Gefängnis, was ich für eine passende Metapher hielt.«
»Kein großer Schulfan, was?«
Meine muntere Antwort erschreckt uns beide. Er lächelt mich kurz an. »Nicht besonders. Ich war ungeduldig. Dachte, es gäbe wichtigere Orte, an denen ich sein sollte.«
Wir unterhalten uns tatsächlich. Das Gehen ist gut – viel besser als auf Plastikstühlen im Büro der Sozialarbeiterin zu sitzen. Vielleicht war ihm das klar, als er gefragt hat, ob ich ein Stück gehen will.
»Ich habe gehört, du hast große Pläne für nächstes Jahr«, sagt er.
»Ja, Claiborne Prep.« Die Aufnahmebestätigung hat mir einen Monat lang alles bedeutet. Und dann konnte meine Mutter eines Morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen, und die Hölle brach los. Wie von Sinnen habe ich die 112 angerufen. Ein paar Wochen später war sie tot.
»Das ist ein großer Schritt«, sagt er vorsichtig. Der Fußweg erstreckt sich bis zur Baseballanlage.
»Ja …« Die wahren Gründe, warum ich dort hingehen will, kann ich ihm nicht verraten. Ich kann ihm nicht erklären, dass ich, abgesehen von der außergewöhnlichen Schulbildung, unbedingt den Ort sehen will, an dem meine Geschichte begann. »Mein, äh, Beratungslehrer hat mir geraten, auf eine Privatschule zu gehen. Hier gibt es zu wenig Leistungskurse.«
Das stimmt. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit.
»Das ist toll. Claiborne ist eine schöne Stadt. Ich bin dort aufs College gegangen.«
Natürlich weiß ich das schon. Das steht bei Wikipedia. »Auf den Bildern sieht es nett aus«, sage ich lahm.
Er bleibt stehen. »Du warst noch nie dort?«
»Nicht, seitdem ich ein Baby war. Und nachdem ich mich beworben habe … Es war kein gutes Jahr zum Reisen.« Meine Mutter hat den Winter auf dem Sofa verbracht, sie wurde immer dünner und hat ihre Haare verloren. Aber das hatte mich nicht in Alarmbereitschaft versetzt, weil die Tumore durch die Chemo kleiner wurden.
Er atmet geräuschvoll ein. »Klar.« Wir gehen weiter den Weg entlang. Das Baseballteam trainiert, aber die Tribüne ist leer und liegt im Schatten. Er geht hinüber und setzt sich, also setze ich mich auch. Die Spieler führen eine komplizierte Wurfübung aus, und überall fliegen Bälle durch die Luft. Alle paar Sekunden bläst der Trainer in seine Pfeife.
»Rachel …«
Es ist komisch, ihn meinen Namen sagen zu hören. Wenn er spricht, klingt seine Stimme genauso rau wie wenn er singt, und ich habe mir den Klang eingeprägt, seit ich denken kann.
»Ich kann mir kaum vorstellen, was für ein Jahr du hinter dir hast. Und ich weiß nicht, was unhöflicher wäre: dich danach zu fragen oder dich nicht zu fragen.«
Auf gar keinen Fall kann ich mit Frederick über den Tod meiner Mutter sprechen. Allein daran zu denken fällt mir schwer. Deshalb sage ich nichts.
»Aber ich muss dich unbedingt nach dem Heim fragen, in dem du gerade lebst. Fühlst du dich dort sicher?«
Ich sehe ihn nicht an. »Es ist dort nicht gefährlich. Es ist ein bisschen eklig, aber niemand versucht, mir wehzutun. Und ich bin die Älteste dort.«
»Warum ist es eklig?«
Ich schaue ihn ganz kurz an, aber das macht mich nervös. »Es ist einfach schmuddelig. Und die Kinder, die dort leben, deprimieren mich.«
»Aber sie lassen dich in Ruhe?«
»Meistens. Sie durchwühlen meine Sachen, wenn ich nicht da bin. Ich wollte mehr Sachen von zu Hause holen. Aber jetzt glaube ich, dass das Unsinn wäre. Ich hatte mein eigenes Shampoo, und es ist verschwunden. Solche Sachen eben. Es sind … nur Kleinigkeiten.«
»Was, wenn du eine abschließbare Truhe hättest?«
»Das ist nicht erlaubt.«
Er reibt sich das Kinn. »Na, das hört sich ja richtig scheiße an. Und du fühlst dich wahrscheinlich nicht wie du selbst.«
»Nein, nicht so richtig.« Soweit ich sagen kann, werde ich mich nie wieder wie ich selbst fühlen, und das liegt nicht am Heim. »Es gibt viele kleine Demütigungen. Marken für kostenloses Mittagessen. Nicht genug Zeit unter der Dusche.« Ich fahre mir mit den Fingern durch die Haare. Sie sind struppig und furchtbar.
»Was passiert mit dem Haus am Pomelo Court?«, fragt er.
Dass er unser Haus erwähnt, überrascht mich. Natürlich weiß er, wo wir gewohnt haben – er hat uns jeden Monat einen Scheck dorthin geschickt. Die Postleitzahl kann er wahrscheinlich auswendig.
Es ist nur so, dass er kein einziges Mal vorbeigekommen ist.
Mir fällt auf, dass er auf eine Antwort wartet. »Ähm, eine Freundin meiner Mutter kümmert sich um alles. Mary.«
»Mary …«, wiederholt er. Seine Augen sind von einem warmen Grau. Das konnte ich auf den Fotos nie richtig erkennen. »Vertraust du ihr?«
»Ja, klar. Sie war Moms beste Freundin. Sie hat einen Friseursalon in South Eola.«
»Na gut«, sagt er und sieht nachdenklich aus. »Hör mal. Die Sozialarbeiterin und der Anwalt haben gesagt, dass ich nur wenig für dich tun kann, bevor du nächsten Monat achtzehn wirst. Wenn du deine Sachen wiederbekommen oder zu Marys Salon fahren und ein neues Shampoo kaufen willst, kann ich dir helfen.«
Ich fahre mir mit der Hand durch die strähnigen Haare. »Ich würde Mary sehr gern sehen.« Genau genommen hätte ich selbst darauf kommen können, sie zu besuchen. »Aber wahrscheinlich muss sie arbeiten.«
Er zuckt mit den Schultern. »Komm, wir fahren hin. Wenn sie heute zu beschäftigt zum Reden ist, kannst du morgen wiederkommen.« Er steht auf, und ich folge ihm.
Ich war mal eine Person, die Probleme in Angriff genommen hat. Jetzt bin ich eine Person, die vom Leben herumgeschubst wird.
3
Als wir beim Auto ankommen, öffnet Frederick die Tür zum Fond und rutscht durch. Ich setze mich neben ihn.
Der Chauffeur dreht sich zu uns um, und da erkenne ich ihn. Es ist der Mann, der mich gestern auf dem Parkplatz vor Hannahs Büro aus dem Auto heraus angelächelt hat. »Hi, Rachel«, sagt er. »Ich bin Carlos.«
»Hi, Carlos.«
»Wohin?«
»East Washington Street.«
»Alles klar.« Er streckt die Hand nach dem Navi aus, obwohl ich ihm auch erklären könnte, wo es langgeht. »Hey, Boss«, sagt er, während er Frederick über die Schulter ein Handy reicht. »Das tanzt schon die ganze Zeit Macarena.«
»Das ist ungünstig.« Das Auto gleitet vom Bordstein weg, während Frederick durch die Nachrichten auf seinem Handy scrollt.
Dann klingelt es auf einmal in seiner Hand. Er tippt aufs Display und hält sich das Telefon ans Ohr. »Henry. Was gibt’s?« Er hört vielleicht zwei Sekunden lang zu, bevor er dem Anrufer das Wort abschneidet. »Ich weiß, dass Unsicherheit dich nervös macht. Aber ich bin seit über zehn Jahren ein unkomplizierter Klient. Du musstest mich noch nie aus dem Gefängnis holen oder in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Und jetzt brauche ich einmal deine Hilfe, und du tust so, als würde ich dir sonst was schulden.«
Ich starre aus dem Fenster, während ich mir so vorkomme, als würde ich ihn belauschen.
»Ich habe noch keine Antworten für dich. Und ich verstehe, dass mich alle für ein Arschloch halten werden, bevor das hier vorbei ist. Aber so ist es nun einmal. Ich muss Schluss machen.« Frederick beendet das Gespräch.
Er wirft das Handy auf den Sitz. »Also, Carlos. Wie schlagen sich die Dodgers?«
»Nicht besonders gut, Boss«, antwortet der Fahrer und stellt das Radio ein wenig lauter. »Das wird heute wieder eine Demütigung.«
»Das scheint heute das Tagesmotto zu sein.«
Das Türglöckchen klingelt, als ich den Salon betrete. Die junge Frau hinter dem Tresen kenne ich nicht. Aber Mary steht an ihrem üblichen Platz am Fenster, im Stuhl vor ihr sitzt eine ältere Frau. Ich bleibe auf der Türschwelle stehen, und Mary blickt auf.
»Rachel!« Sie legt ihre Schere ab und kommt zu mir. »Ach, Süße. Warum bist du denn nicht bei deiner Tante in Atlanta?«
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber das muss ich auch nicht. Denn Marys Blick wandert aufwärts, an meinem Kopf vorbei, und dann schnappt sie nach Luft.
Als ich mich umdrehe, sehe ich Frederick vor einem Regal mit Haarpflegeprodukten stehen. Ungerührt hebt er eine Hand und winkt uns beiden zu.
Mary reißt sich zusammen. »Komm mit, Süße. Ich habe gerade eine Kundin, aber Megan wird dir schön die Haare waschen, und du brauchst Conditioner. Und danach schneide ich dir die Haare, während wir uns unterhalten, okay?« Sie legt mir die Hände auf die Wangen und mustert mich besorgt. »Du siehst schrecklich erschöpft aus.«
Ich lasse mir einen Frisierumhang umlegen und mich zu einem Waschbecken führen. Dann lege ich meinen Kopf auf die Nackenstütze.
»Sag mir Bescheid, wenn es zu heiß ist«, sagt das Mädchen.
»Okay.« Ich schließe die Augen, während mir beim Haarewaschen der Kopf massiert wird. Das ist ein edler Salon, und Mom und ich können ihn uns nur leisten, weil Mary uns einen Freundschaftspreis macht. Das Mädchen lässt sich Zeit, reibt mir mit den Daumen über die Schläfen, massiert mir den Kopf. Die sanfte Berührung hat den unerwarteten Nebeneffekt, dass ich weinen möchte. Jede ihrer Handbewegungen durch den Schaum droht mich zu zerbrechen.
»Nur noch einmal ausspülen«, sagt sie. Und als ich mich schließlich wieder aufsetze, sehe ich mich um. Frederick hat sich auf einen pinken Divan mit einem flauschigen Fußhocker gesetzt. Eine Zeitschrift liegt aufgeschlagen auf seinen Knien, und er tippt mit einem Finger auf seinem Handy herum.
»Jetzt schnell«, sagt Mary. »Meine nächste Kundin kommt immer zu spät, das schaffen wir noch.«
»Danke«, sage ich und setze mich in den Stuhl.
Mary dreht den Stuhl herum, und das Gesicht, das mir aus dem Spiegel entgegenblickt, ist so ausgezehrt, dass ich zurückzucke.
Es ist mein eigenes.
»Ach, Süße. Geht es dir gut? Du musst mir erzählen, was los ist. Und du bist so dünn geworden, Rachel.«
Ich schließe die Augen. »Mir geht es gut … Es ist bloß schwer.«
»Ist das dein Vater?«
Ich nicke. »Ich habe ihn gestern kennengelernt.«
»Himmel! Deine Mutter hat mir mal erzählt, wer er ist, aber danach hat sie das Thema nie wieder angeschnitten. Entschuldigung, das muss sich schrecklich anhören. Aber ich war mir nie sicher, ob sie das ernst gemeint hat.«
So ernst wie ihre Krankheit.
Im Spiegel sehe ich Marys Blick zur Seite wandern, während sie Frederick begutachtet. »Ein hübscher Kerl. Kein Wunder, dass deine Mutter …« Sie lässt den Satz ersterben.
Ich mache Mary keinen Vorwurf, weil sie das sagt. Ich habe selbst schon versucht, es mir vorzustellen – der zwanzigjährige Freddy und meine neunzehnjährige Mutter. Sie vertrieb sich die Zeit in New Hampshire, während sie fürs College sparte. Und er war vielleicht schon ein lokaler Star, der gerade sein Musikstudium beendet hatte und kurz vor seinem nationalen Durchbruch stand.
Irgendwie haben sie sich eines Abends kennengelernt, vielleicht nach einem seiner Auftritte. Sie haben einander die Kleider vom Leib gerissen und ein Baby gemacht. Und dann brach er zu seiner ersten Tour auf und ließ Mom zurück, bevor sie auch nur wusste, was passiert war.
Die Mutter, die ich kannte, war ganz anders. Sie war das typische brave Mädchen – ging zur Krankenschwesternschule, während sie in Vollzeit arbeitete, und schob schließlich Doppelschichten, um sich die Überstunden auszahlen zu lassen. Meine Mom konnte nicht gemachte Hausaufgaben oder schmutziges Geschirr aus einem Block Entfernung riechen.
Die Mutter, die ich kannte, hatte ein müdes Lächeln und schwärmte für niemanden.
»Wenn du schon mal hier bist, sollten wir über das Haus reden«, schlägt Mary vor, während ihre Schere hinter mir klappert. »Der Strom ist das Einzige, was ich angelassen habe. Und die Miete ist bis zum fünfzehnten August bezahlt.«
»Bis zum fünfzehnten August«, wiederhole ich.
Mary legt die Schere ab und kommt um den Stuhl herum, damit ich sie ansehen kann. »Wenn du noch einen Monat länger brauchst, können wir dem Vermieter Bescheid sagen. Aber ich dachte, du würdest dein Geld sicher nicht für ein Haus ausgeben wollen, in dem du nicht wohnst.«