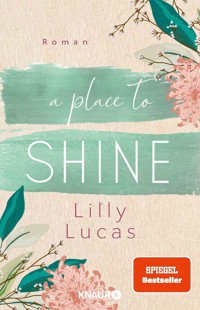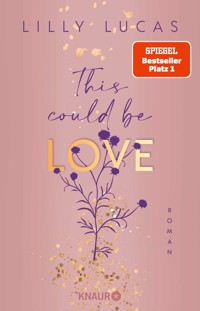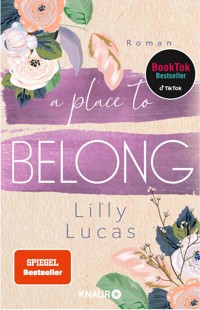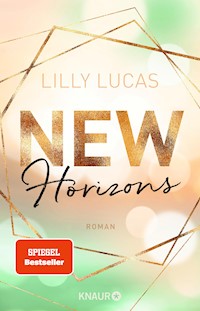
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Green Valley Love
- Sprache: Deutsch
Verliebt in einen Netflix-Star: Der 4. Liebesroman aus der romantischen New-Adult-Reihe »Green Valley Love« erzählt die Geschichte von Annie und Cole Als hätte das Leben sie zurück auf Los geschickt – so fühlt sich Annie, als sie nach einem schweren Unfall aus dem Koma erwacht. Die einfachsten Dinge, selbst das Laufen, muss sie neu lernen. Dabei möchte Annie so schnell wie möglich wieder als Automechanikerin in der Werkstatt ihres Vaters in Green Valley arbeiten. In der idyllischen Kleinstadt in den Rocky Mountains versteckt sich derweil Netflix-Star Cole Jacobs nach einem peinlichen Fehltritt vor der Presse und langweilt sich zu Tode. Nur widerwillig erklärt er sich bereit, die Inszenierung des alljährlichen Weihnachtstheaterstücks zu übernehmen. Bei den Proben trifft Cole auf Annie, die so anders ist als all die Frauen, die ihn anhimmeln. Es kommt, wie es kommen muss: Annie und Cole geraten kräftig aneinander – und dann knistert es gewaltig … Mit viel Gefühl, Romantik und einem guten Schuss Humor entführt Bestseller-Autorin Lilly Lucas auch im 4. New-Adult-Liebesroman ihrer Reihe »Green Valley Love« in die idyllische Kleinstadt in den Rocky Mountains. Perfekte Wohlfühl-Lektüre zum Wegträumen für alle, die romantische Geschichten lieben. Die Green-Valley-Reihe Die New-Adult-Liebesromane der Green-Valley-Reihe sind in folgender Reihenfolge erschienen – sie sind aber auch unabhängig voneinander lesbar: - New Beginnings (Lena & Ryan) - New Promises (Izzy & Will) - New Dreams (Elara & Noah) - New Horizons (Annie & Cole) - New Chances (Leonie & Sam) - Find me in Green Valley (Kurzroman; Sarah & Grayson) - New Wishes (Rebecca & Leo)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lilly Lucas
New Horizons
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Als hätte das Leben sie zurück auf Los geschickt – so fühlt sich Annie, als sie nach einem schweren Unfall aus dem Koma erwacht. Die einfachsten Dinge muss sie neu lernen. Dabei möchte Annie so schnell wie möglich wieder als Automechanikerin in Green Valley arbeiten.
In der idyllischen Kleinstadt in den Rocky Mountains versteckt sich derweil Netflix- und Hollywood-Star Cole Jacobs nach einem peinlichen Fehltritt vor der Presse. Als er auf Annie trifft, die so anders ist als all die Frauen, die ihn anhimmeln, fliegen erst die Fetzen … und dann die Funken. Aber kann eine Liebe zwischen Hollywood und Green Valley gut gehen?
Inhaltsübersicht
Für A.
Der immer da ist, wenn ich ihn brauche.
Und immer dort, wo ich ihn brauche.
1.
Ein lautes Hupen weckte mich. Verschlafen warf ich einen Blick durch die Autofensterscheibe und sah gerade noch, wie die rote Abendsonne hinter den mächtigen Gipfeln der Rocky Mountains versank. Ein warmes Gefühl breitete sich in meiner Brust aus. Ich ließ das Fenster einen Spalt nach unten und sog den vertrauten Duft der Kiefern ein, die an den Berghängen wuchsen. Die milde Septemberluft blies mir ein paar lose Strähnen in die Stirn. Ich hatte mich immer noch nicht daran gewöhnt, wie lang mein Haar jetzt war. Früher hatte es mir bis knapp über die Ohren gereicht, inzwischen kitzelte es fast mein Kinn.
»Tut mir leid, Kleines. Der Idiot da vorne weiß offenbar nicht, wie man einen Blinker benutzt«, brummte Dad ungehalten. Er beobachtete mich durch den Rückspiegel und fragte mit deutlich sanfterer Stimme: »Wie fühlst du dich?«
»Müde«, erwiderte ich und unterdrückte ein Gähnen.
»Was macht dein Bein? Sollen wir eine Pause einlegen?«
»Wir sind doch gleich da.«
»Das war nicht die Antwort auf meine Frage«, bemerkte Dad.
Doch. Wenn man Zwischentöne hören konnte. Aber das konnte mein Vater nicht. Gott sei Dank. Sonst hätte er vermutlich auf der Stelle einen hollywoodmäßigen U-Turn hingelegt, um zurück ins Krankenhaus nach Denver zu fahren.
»Alles gut«, log ich und schenkte ihm ein Lächeln.
Ich wusste nicht, ob er es mir abkaufte, aber er konzentrierte seinen Blick wieder auf die Straße, die uns nach Green Valley bringen würde. Eine seltsame Mischung aus Vorfreude und Anspannung machte sich in mir breit, als ich an meine Heimatstadt dachte. Dieser kleine Ort in den Rocky Mountains, der mir alles bedeutete. In dem die Menschen lebten, mit denen ich aufgewachsen war, die mich kannten und liebten. Geliebt hatten. Kurz blitzte Noahs Gesicht vor meinen Augen auf. Sein klarer, wacher Blick, das dunkle Haar, in dem ich so gerne meine Finger vergraben hatte, die weichen Lippen, die ich …
»Soll ich noch bei Moe halten und uns ein paar Burger mitnehmen?«, holte mich Dads Stimme zurück ins Jetzt. Noahs Bild verschwamm, als hätte jemand Wasser auf Tinte gekippt.
»Nein, ich hab keinen Hunger.«
Es war die zweite Lüge in zwei Minuten. Der Gedanke an einen fettigen Cheeseburger aus dem Diner ließ meinen knurrenden Magen laut applaudieren. Aber mit diesem Gedanken ging die Vorstellung einher, den Hauptumschlagplatz des Kleinstadttratschs zu betreten, und dazu war ich heute noch nicht bereit. So etwas wie Privatsphäre existierte in Städten wie Green Valley nicht. Jeder kannte jeden, jeder half jedem. Das brachte aber auch mit sich, dass einem seine Sorgen nicht allein gehörten.
»Ich brate uns einfach ein paar Spiegeleier«, schlug mein Vater vor, und ich musste schmunzeln. Weil er mich durchschaut hatte und weil Spiegeleier noch immer das Einzige waren, was er in der Küche zustande brachte. Als ich ein Kind gewesen war, hatte es in manchen Wochen fünfmal Spiegeleier bei uns gegeben. Bis Barbara Fitzgerald, die Frau des Pfarrers, davon Wind bekommen und uns fortan regelmäßig zum Essen eingeladen hatte. »Ob ich für sechs oder acht Personen koche, ist egal«, hatte sie behauptet und Dad und mich mit amerikanischer Hausmannskost verwöhnt. Ihr Haus war zu meinem zweiten Zuhause geworden, ihr ältester Sohn Noah zu meiner großen Liebe.
»Klingt gut«, antwortete ich mit einem liebevollen Lächeln in Dads Richtung, bevor ich den Kopf gegen die Scheibe lehnte und den Blick wieder aus dem Fenster schweifen ließ. Der Herbst warf schon jetzt mit Farben nur so um sich. Tiefgelbe Espenwälder ließen die Flanken der Rockys golden glänzen, und wuchtige Ahornbäume hoben sich in satten Rot- und Orangetönen vom Himmel ab. Der Anblick hätte einer Postkarte entsprungen sein können und entschädigte mich ein wenig dafür, dass ich den Sommer in den Bergen verpasst hatte. Dass mein Leben eine Jahreszeit ausgelassen hatte.
»Home, sweet home«, trällerte Dad eine Spur zu euphorisch, als wir das Ortsschild von Green Valley passierten und durch die Main Street fuhren, die Straße, die auf ein paar hundert Metern alles vereinte, was unser kleiner Ort zu bieten hatte. Auf den ersten Blick hatte sich nichts verändert. Aus dem Lebensmittelgeschäft strömten immer noch Menschen mit braunen Papiertüten, das Steakhouse warb nach wie vor für seine 400-Gramm-Rindersteaks, und mit Sicherheit bot Molly McAbott täglich frischen Pumpkin Pie in ihrem Blumenladen an. Ich wusste nicht, ob mich dieser Stillstand glücklich machte oder ernüchterte. Irgendwie ging man immer davon aus, dass sich die Welt veränderte, wenn man kein Teil mehr davon war. Dass sie sich zumindest weiterdrehte. Aber in Städten wie Green Valley blieb immer alles beim Alten.
Als wir in unsere Straße abbogen, die einzige in Green Valley, die keinen malerischen Namen wie Eagle Road oder Mountain Drive trug, sondern schlichtweg Washington Street hieß, kam uns ausgerechnet Earl auf seinem Fahrrad entgegen, den viele Gossip Earl nannten – und das nicht ohne Grund. Er schwang den größten Löffel in der Gerüchteküche, und wer wollte, dass sich etwas schneller als ein Lauffeuer verbreitete, steckte es am besten ihm.
»Okay, wir hätten doch ins Diner gehen können«, seufzte ich, und Dad lachte.
Unser Haus war das letzte auf der rechten Seite. Ein zweistöckiges Holzhaus im Blockhüttenstil mit einer großen Veranda, die einmal ringsherum führte. Obwohl es genauso groß wie die anderen Häuser in der Straße war, wirkte es deutlich schlichter und unscheinbarer. Wir hatten keine Hängeschaukel auf der Veranda wie die Delaneys, keine Gartenkräuter auf den Fensterbrettern wie die Browns. Auch farbenfrohe Chrysanthemen, jahreszeitliche Türkränze oder Dekokram suchte man bei uns vergeblich. Es lag nicht daran, dass Dad in den letzten Monaten keinen Nerv dafür gehabt hatte, weil er unsere Autowerkstatt mit Tankstelle irgendwie am Laufen halten musste. Unser Haus hatte auch in meiner Kindheit nicht anders ausgesehen. »Da fehlt einfach die weibliche Hand«, hatte ich eine unserer Nachbarinnen einmal sagen hören. Als Kind hatte ich nicht verstanden, dass sie damit meine Mutter gemeint hatte, die uns verlassen hatte, ehe ich meinen Namen schreiben konnte.
»Das mit den Spiegeleiern hat sich dann wohl erledigt«, murmelte Dad und lenkte meine Aufmerksamkeit auf unsere Veranda, die voller Töpfe, Kuchenformen und Aluschalen stand. Sogar auf den Treppenstufen türmten sich Schüsseln und Körbe. Ungläubig starrte ich durch die Frontscheibe.
»Die wissen aber schon, dass ich nicht gestorben bin, oder?«
»Annie!«, kam es entrüstet vom Vordersitz.
»Ich meine ja nur«, murmelte ich. »So viel Essen hab ich das letzte Mal bei der Beerdigung von Mrs. McPhee gesehen.«
Dad ignorierte meinen Zynismus und öffnete die Fahrertür. »Moment, ich bringe dir deine Krücken.«
Ehe ich protestieren konnte, hatte er den Wagen umrundet und den Kofferraum geöffnet.
»Ich hätte es auch ohne geschafft«, murrte ich, als er mir die beiden silberfarbenen Gehstützen entgegenstreckte.
»Du sollst aber langsam machen«, rief er mir in Erinnerung, was die Ärztin heute bei meiner Entlassung gesagt hatte. Mit einem Zwinkern fügte er hinzu: »Außerdem muss uns jemand den Weg freiräumen.«
Ich kapitulierte, schloss beide Hände fest um die Krücken und stemmte mich hoch. Als mir ein stechender Schmerz ins Bein schoss, verzog ich kurz das Gesicht und war froh, dass Dad damit beschäftigt war, meine Reisetasche aus dem Kofferraum zu befördern. Es hatte nicht viel zu packen gegeben, obwohl ich so lange im Krankenhaus gewesen war. Ein paar Jogginghosen, T-Shirts, Toilettenartikel und Automagazine. Sieben Monate, verstaut in einer ausgebeulten Sporttasche.
Als wir uns der Veranda näherten, stellten wir fest, dass sie viel vollgestellter war als von Weitem ersichtlich. Staunend musterten wir die süßen und deftigen Leckereien, die unsere Tür blockierten, auf der ein selbstgebasteltes Plakat angebracht war. Eine Kinderzeichnung von einem Mädchen mit dunklen, kurzen Haaren, braunen Augen und einem Schraubenschlüssel in der Hand. Darunter in krakeligen Buchstaben: Willkommen zu Hause. Als ich den Namen der kleinen Künstlerin auf dem Plakat entdeckte, verdrückte ich gerührt ein paar Tränchen. Ruthie war Noahs Schwester und mit ihren sieben Jahren der jüngste Spross der Fitzgeralds. Ich nahm mir fest vor, sie demnächst zu besuchen und mich bei ihr zu bedanken. Dad schob indessen ein paar Töpfe mit dem Fuß zur Seite, und ich kam ihm mit meinen Krücken zu Hilfe, bis wir eine Gasse freigeschaufelt hatten.
Unser Haus empfing mich mit dem charakteristischen Duft nach Kaffee und Kaminholz. Auch hier hatte sich nichts verändert. Meine Jacken hingen ordentlich an der Garderobe, darunter standen meine grauen Timberlands mit dem Ölfleck und derbe Wildleder-Boots. Als wäre ich nie weg gewesen. Als wäre ich nicht überstürzt in mein Auto gestiegen und Monate später in einem Krankenhausbett aufgewacht.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Dad und deutete auf meine Sneakers.
»Nein, geht schon«, murmelte ich und schlüpfte etwas umständlich aus den Schuhen. Ich lehnte die Krücken gegen die Wand und zog meine Sweatshirtjacke aus. Eigentlich war es Noahs Jacke. Er hatte sie mir geschenkt, nachdem seine Mutter sie versehentlich zu heiß gewaschen hatte. In den letzten Wochen hatte ich immer wieder darüber nachgedacht, sie zu entsorgen, aber ich mochte sie einfach zu gern. Außerdem fühlte sie sich in schwachen Momenten wie eine Umarmung von ihm an.
»Ich habe mir überlegt, dass du vorerst in mein Schlafzimmer ziehen könntest.«
Er stellte meine Tasche im Flur ab und tupfte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Sein Flanellhemd war zu warm für einen milden Herbsttag.
»Ich bin vierundzwanzig, Dad«, bemerkte ich stirnrunzelnd. »Ein bisschen Privatsphäre wäre …«
»Ich würde natürlich solange in dein Zimmer ziehen.«
»Warum?«
»Na … wegen der Treppe.« Er deutete auf die rund zwanzig Stufen, die in mein Zimmer im oberen Stockwerk führten.
»Ist doch ein gutes Training«, erwiderte ich schulterzuckend.
»Annie«, seufzte er. »Du sollst langsam machen.«
»Kein Problem. Ich nehme eine Stufe nach der anderen.«
Dad schenkte mir einen eindeutigen Blick, bevor er damit begann, die ersten Schüsseln von der Veranda in die Küche zu tragen.
»Apropos Training«, rief er mir zu. »Mrs. Albright hat angeboten, dass du die Reha im Sebastian fortsetzen kannst. Du sollst dich mal bei ihr melden.«
Ich runzelte die Stirn. »Im Sebastian?«
Das Sebastian war ein 5-Sterne-Hotel in Vail. Die Direktorin, Mrs. Albright, wohnte in Green Valley und war die Mutter unseres Sheriffs Will.
»Die haben offenbar einen voll ausgestatteten Fitnessraum«, erwiderte Dad, bevor er die Kühlschranktür quietschend öffnete und Platz für die vielen Schüsseln schaffte.
»Ich weiß nicht …«
Der Gedanke, meine Reha in einem Luxushotel fortzusetzen, war irgendwie skurril.
»Ich finde die Idee gut«, sagte Dad, während er einen Topf in die Küche trug, der verdächtig nach Chili con Carne roch. »Das erspart dir die ständigen Fahrten nach Denver.«
Das war tatsächlich ein Argument. Vail war nur dreißig Minuten von Green Valley entfernt. Womöglich konnte ich dadurch sogar mehrmals die Woche trainieren und meine Regeneration beschleunigen.
»Mrs. Albright meinte, das Hotel wäre zu dieser Jahreszeit noch verhältnismäßig leer. Die Wanderurlauber sind bereits weg, und die Skisaison beginnt erst in einem Monat.«
»Bleiben nur noch ein paar Ölbarone«, spöttelte ich.
Es war kein Geheimnis, dass im Sebastian hauptsächlich Superreiche abstiegen. Vail hatte sich über die Jahre zum Nobelort gemausert, der in den Wintermonaten wie die Kulisse eines Weihnachtsfilms von Hallmark daherkam. Lichterketten und geschmückte Tannenbäume zierten den Innenstadtbereich, in dem sich Luxushotels aneinanderreihten, die mit ihren alpenländischen Fassaden eher wie riesige Blockhütten wirkten. Die Gehwege zwischen den Restaurants, Boutiquen und Cafés waren beheizt und mit urigen Feuerstellen ausgestattet, und zu den Skiliften führten Rolltreppen.
»Ich finde das Angebot wirklich sehr großzügig«, sagte Dad, dessen Gesicht nun von einem Berg Aluschalen verdeckt wurde. Mit einem Grinsen schob er hinterher: »Vielleicht triffst du ja einen netten Ölbaron.«
»Ölwechsel wäre mir lieber.«
Ich folgte ihm in die Küche und setzte mich an unseren Esstisch, der vier Kuchen, drei Töpfe mit Suppe sowie eine Lasagne beherbergte.
»Ja, darüber sollten wir auch noch reden«, sagte er eine ganze Spur ernster, während ich nach einer Sitzposition suchte, die mir keine Schmerzen bereitete. Ein, zwei Sekunden schien er sich die richtigen Worte zurechtzulegen. »Ich habe jemanden eingestellt.«
»Für die Tankstelle?«
Sein Blick huschte kurz zur Seite. »Nein, für die Werkstatt.«
Ich kniff die Augen zusammen. »Für die Werkstatt? Aber ich dachte, wir können uns gerade niemanden zusätzlich leisten.«
»Ja, es … ist auch nicht zusätzlich.« Seine Stimme wurde belegt. »Wesley wird vorerst deine Aufgaben übernehmen.«
Ich riss die Augen auf. »Was?!«
»Annie«, sagte er sanft. »Du musst jetzt an dich denken.«
»Und deswegen stellst du einfach jemanden ein? Ohne mich zu fragen?« Meine Stimme zitterte vor Unglauben. »Ich dachte, wir führen diese Werkstatt gemeinsam.«
»Das tun wir doch auch. Aber ich möchte, dass du dich in Ruhe um deine Gesundheit kümmern kannst.«
»Das kann ich doch auch, wenn ich in der Werkstatt arbeite«, erwiderte ich schroff.
»Du hast gehört, was die Ärztin gesagt hat …«
»Dass ich es langsam angehen soll. Nicht, dass ich es gar nicht angehen soll«, schnaubte ich.
Er seufzte schwer. »Es ist doch nicht für immer, Annie. Nur, bis du dich wieder erholt hast.«
»Und was soll ich bis dahin machen? Auf der Couch liegen und die Schrauben in meinem Bein zählen?«
»Wenn es unbedingt sein muss, könntest du ab und zu in der Tankstelle aushelfen. Wir stellen dir einen Hocker hinter den Tresen, dann hast du es bequem und kannst dein Bein schonen.«
Ich sah ihn an, als hätte er sich einen schlechten Scherz erlaubt. »In der Tankstelle aushelfen? Ich bin Automechanikerin, Dad!«
»Im Moment bist du eine Automechanikerin auf Krücken.«
So sanft die Worte aus seinem Mund kamen, so sehr traf mich die Wahrheit, die sie beinhalteten.
»Es ist nur eine Übergangslösung. Dein Platz ist in der Werkstatt, daran zweifelt niemand.«
Seine müden Augen riefen mir in Erinnerung, wie hart die letzten Monate auch für ihn gewesen waren, und dämpften meine Verärgerung. Nachdenklich zupfte ich ein paar Butterstreusel von einem Apfelkuchen, der eindeutig die Handschrift von Barb Fitzgerald trug. »Ist er gut?«
»Der Kuchen?«
»Dieser Wesley«, brummte ich.
Dad lachte: »Ja, ist er.« Und mit einem versöhnlichen Zwinkern fügte er hinzu. »Aber er kann dir selbstverständlich nicht das Wasser reichen.«
2.
Dass ich zurück in Green Valley war und in der Tankstelle aushalf, sprach sich schnell herum. Zumindest verspürte in der darauffolgenden Woche die halbe Stadt das Bedürfnis, Frostschutzmittelvorräte aufzustocken oder überteuerte Chips zu kaufen. Eigentlich hätte es mich nicht überraschen sollen, schließlich lebte ich in einer Stadt, in der der Buschfunk schneller war als das Internet. Und es freute mich ja auch, all die Menschen wiederzusehen, mit denen ich aufgewachsen war. Die mich als Kind huckepack getragen und mir ein Eis ausgegeben hatten, die neben mir im Sandkasten oder im Schulbus gesessen hatten, die mit mir gelacht und gefeiert hatten. Nur mit ihren mitleidigen Blicken konnte ich nicht umgehen. Ihren aufmunternden Worten und überflüssigen Komplimenten. Plötzlich war ich nicht mehr Annie Hudgens, das Mädchen, das Autos reparieren konnte, sondern Annie Hudgens, das Mädchen, das im Koma gelegen hatte.
»Steht dir gut, die neue Frisur«, bemerkte Mrs. Miller lächelnd und schob zwanzig Dollar über den Kassentresen. Sie sah deutlich älter aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Ihr Haar war vollkommen ergraut, und ihre Augen hatten an Strahlkraft verloren.
»Danke«, erwiderte ich und verkniff mir die Bemerkung, dass man für diese Frisur lediglich fünf Monate im Koma liegen musste. Mrs. Miller hatte meinen Sarkasmus nicht verdient. Noch dazu war ich mir sicher, dass sie nicht aus Neugier hier war. Als ich klein war, hatte sie manchmal auf mich aufgepasst und jedes Jahr in der Weihnachtszeit mit mir Plätzchen gebacken. Außerdem schnitt sie mir regelmäßig die Haare, obwohl sie ihren Friseursalon längst aufgegeben hatte.
»Damit siehst du ihr noch ähnlicher«, bemerkte sie mit einem schwachen Lächeln.
Mrs. Miller war die Einzige, die sich nie davor scheute, meine Mutter zu erwähnen. Für alle anderen – vor allem meinen Dad – war sie der Voldemort von Green Valley. Man sprach nicht über sie, und man erwähnte schon gar nicht ihren Namen. In unserem Haus gab es kein einziges Bild von ihr, nur ein Familienfoto, das ich beim Aufräumen in einem Buch gefunden hatte. Es zeigte meine Eltern auf einer Picknickdecke am Silver Lake. Mom hatte mich auf dem Schoß, und Dad strahlte sie verliebt an, den Arm um ihre Hüfte gelegt. Manchmal fragte ich mich, ob es ihm schwerfiel, mich anzusehen. Mit meinen kurzen, dunklen Haaren, den großen braunen Augen und den hohen Wangenknochen sah ich ihr verblüffend ähnlich.
Mom war gerade einmal zwanzig gewesen, als sie Dad geheiratet hatte und nach Green Valley gezogen war – mit nichts als einem kleinen Koffer, ihrem Cellokasten und spärlichen Englischkenntnissen. Ein kaputter Reifen hatte die beiden zusammengeführt. Mom sollte an jenem Abend mit dem Orchestre de Paris im Red Rocks Amphitheater auftreten. Kurz hinter Denver hatte der Tourbus einen Platten gehabt. Ein Automechaniker aus Green Valley war zufällig zur Stelle gewesen und hatte den Reifen gewechselt. Als Dankeschön war er zum Konzert eingeladen worden und hatte sich am selben Abend unsterblich in eine junge Französin namens Marie-Camille Marchand verliebt, die auf einem Niveau Cello spielte, von dem Normalsterbliche nur träumten. Und damit endete auch schon der märchenhafte Teil dieser Geschichte – und mein gedanklicher Ausflug in die Vergangenheit. Ich drückte Mrs. Miller ihr Wechselgeld in die Hand und wünschte ihr einen schönen Tag.
»Den wünsch ich dir auch, Annie«, gab sie mit einem freundlichen Lächeln zurück und machte sich ans Gehen. »Komm doch mal wieder vorbei.«
Ob das ein dezenter Hinweis war, meine Haare könnten mal wieder einen Schnitt vertragen?
»Mach ich. Und richten Sie Ihrem Mann liebe Grüße aus.«
Für den Bruchteil einer Sekunde erstarrte sie. Dann nickte sie knapp und verließ die Tankstelle. Stirnrunzelnd sah ich ihr nach.
»Er ist gestorben.« Dad stand hinter mir in der Tür, die Tankstelle und Werkstatt verband. »Mr. Miller …«
»Was?! Wann?«
»Im März. Er hatte einen Herzinfarkt.«
»Aber … sie hat gar nichts gesagt«, krächzte ich, während mein Blick aus dem Fenster schweifte. Mrs. Millers silbrig-weiße Dauerwelle verschwand gerade in ihrem Ford Focus.
»Wahrscheinlich wollte sie dich nicht vor den Kopf stoßen.«
Ich schluckte. »Ich bitte sie, Grüße ins Jenseits zu schicken, und sie will mich nicht vor den Kopf stoßen?«
Dad wischte sich die ölverschmierten Hände an seiner Arbeitshose ab und bediente sich am Kaffeeautomaten.
»Warst du auf seiner Beerdigung?«
»Natürlich«, antwortete er, ohne sich umzudrehen.
Während die Maschine zu brummen begann und ein heißer Strahl Kaffee zischend in Dads Tasse schoss, versuchte ich mich an meine letzte Begegnung mit Mr. Miller zu erinnern, aber es gelang mir nicht.
»Mach dir keinen Kopf. Du konntest es nicht wissen«, holte mich Dads Stimme zurück ins Jetzt. Sein Versuch, mich aufzumuntern, ging ins Leere. »Kommst du klar?«, fragte er sanft.
Ich wusste nicht, ob sich seine Frage auf die Nachricht von Mr. Millers Tod bezog oder die Tatsache, dass ich einen weiteren Tag in der Tankstelle verbringen würde – anstatt unter Motorhauben.
»Ja«, seufzte ich.
Dads Blick ruhte etwas länger als nötig auf mir, bevor er seine Tasse unter der Maschine hervorzog und in die Werkstatt verschwand.
Nachdem die Stahltür quietschend zugefallen war, zog ich mein Notizbuch aus der Hosentasche und schrieb Mr. Miller ist gestorben hinein. Direkt unter Tempolimit in der Main Street, Die Whistlers haben sich getrennt und Justin Bieber ist verheiratet. Dad hatte mir das Notizbuch im Krankenhaus geschenkt. Die ersten Seiten hatte er für mich gefüllt und über Monate hinweg festgehalten, wie die Welt sich weitergedreht hatte, nachdem meine stehengeblieben war. Wer den Super Bowl gewonnen, wen Trump gefeuert und wer die Charts gestürmt hatte. Welche Naturkatastrophen Colorado heimgesucht hatten, wer neu in der Stadt war, wer weggezogen war, wer sich verliebt und wer sich getrennt hatte. Nur Mr. Miller hatte er vergessen. Nachdenklich stierte ich auf seinen Namen. Die krakeligen Buchstaben, die mal nach rechts, mal nach links kippten. Meine Schrift unterschied sich kaum von der einer Zehnjährigen. Ich hatte das Schreiben erst wieder lernen müssen, nachdem meine Hände mehr als fünf Monate lang regungslos auf einem Krankenhauslaken gelegen hatten.
»Hey Annie! Ist dein Dad in der Werkstatt?«
Mike Laurentis Stimme brachte mich dazu, den Blick von meinem Notizbuch zu lösen und es rasch in meiner Gesäßtasche verschwinden zu lassen.
»Bist du mal wieder liegengeblieben?«, zog ich ihn auf.
Mike fuhr einen 69er Dodge Charger, den er von seinem Vater geerbt hatte. Ein echtes Sammlerstück – und eine Goldgrube für jeden Automechaniker. Unter keine Motorhaube aus Green Valley hatte ich meinen Kopf häufiger gesteckt. Unter keinem Wagen hatte ich häufiger gelegen.
»Er verliert Öl«, brummte er.
»Motor oder Getriebe?«
»Motor.«
»Ich seh ihn mir mal an«, antwortete ich spontan und schob mich etwas mühsam von dem Hocker, den Dad mir hinter die Ladentheke gestellt hatte.
»Nein, lass gut sein«, sagte Mike hastig, als ich nach meinen Krücken griff.
»Kein Problem, ich …«
»Nein, Annie, wirklich. Ich … muss sowieso noch was mit deinem Dad besprechen. Bleib sitzen und, ähm …«, er räusperte sich, »schon dich.«
Ehe ich protestieren konnte, war er auch schon aus der Tankstelle verschwunden. Schon dich, äffte eine gehässige Stimme in meinem Kopf. Ich versuchte, sie zu ignorieren, und stellte die Krücken zurück – eine Spur zu schwungvoll. Scheppernd fielen sie zu Boden und rissen gleich noch eine Reihe Zigarettenschachteln mit sich.
»Verdammt«, fluchte ich. Als ich mich bückte, um das Chaos zu beseitigen, ließ mich ein blitzartiger Schmerz aufstöhnen.
»Alles okay?«, vernahm ich eine Stimme hinter mir.
»Ja«, kam es eine Spur zu genervt aus meinem Mund. Als ich mich aufrichtete, sah ich, wen ich angepflaumt hatte. Ein Mädchen in meinem Alter mit blonden lockigen Haaren, das mich immer noch erstaunlich freundlich anlächelte. Irgendwoher kam sie mir bekannt vor, aber ich kam nicht darauf.
»Sorry. Nicht mein Tag«, entschuldigte ich mich sogleich und seufzte. »Wobei … nicht mein Jahr trifft es vielleicht eher.« Ich ließ ein zynisches Lachen folgen.
»Drei Monate.«
Verständnislos sah ich sie an.
»Noch drei Monate. Dann hast du es geschafft«, bemerkte sie zwinkernd. Sie sprach mit einem komischen Akzent, den ich nicht sofort zuordnen konnte.
»Die Zwei?«, fragte ich und schielte auf den metallicblauen Ford Explorer an der Zapfsäule. Plötzlich wusste ich wieder, woher ich sie kannte. Das war Ryan Coopers Freundin. Das Mädchen aus Deutschland, das im vergangenen Jahr als Au-pair bei seinem Bruder gearbeitet hatte. Ich war davon ausgegangen, dass sie längst wieder zurück in ihrer Heimat war.
»Ja, leider«, seufzte sie.
Fragend hob ich die Brauen.
»Der Wagen gehört meinem Freund. Ich verstehe wirklich nicht, warum ihr hier alle so riesige Autos fahren müsst.«
»Großes Land, großes Auto?«, mutmaßte ich schmunzelnd.
»Eher großes Ego, großes Auto. Zumindest in seinem Fall«, gluckste sie und reichte mir ihre Kreditkarte.
Lena Lenz stand dort in gestanzten Lettern.
»Ich brauch jedenfalls dringend ein eigenes Auto. Eins, in dem ich mich nicht verlaufe.« Sie zog eine selbstironische Grimasse.
»Wheelers in Vail hat gute Gebrauchtwagen-Angebote«, bemerkte ich beiläufig und zog ihre Karte durch das Gerät. »Falls du da mal hinschauen willst.«
»Danke für den Tipp«, erwiderte sie sichtlich erfreut.
»Sorry«, murmelte ich, als eine Fehlermeldung aufblinkte. »Ich hab Dad schon tausendmal gesagt, dass das Ding in ein Museum gehört.«
»Ich bin übrigens Lena«, sagte sie bereitwillig, während ich mit dem Kreditkartengerät kämpfte.
»Ich weiß.«
»Was hat mich verraten? Mein Akzent?« Sie rümpfte die Nase. »Es ist immer mein Akzent. Ryan sagt, ich klinge wie Heidi Klum.«
Endlich akzeptierte das Gerät ihre Karte. »Die hier hat dich verraten.« Grinsend gab ich ihr die Mastercard zurück.
»Was steht denn auf deiner?«
Erst mit etwas Verzögerung kapierte ich, was sie von mir wollte. Es war lange her, dass mich jemand nach meinem Namen gefragt hatte. Green Valley war ein Ort, an dem jeder jeden kannte.
»Annie«, antwortete ich und war fast überrascht, dass sie sich damit zufriedengab. Offenbar war der Kleinstadttratsch nicht bis zu ihr vorgedrungen.
Lena zog indessen ein lautstark vibrierendes iPhone aus ihrer Handtasche und warf einen schnellen Blick auf das Display. »Oh, das ist meine Mutter. Sorry, da muss ich ran.«
Sie nahm den Anruf entgegen und wechselte mühelos ins Deutsche, eine Sprache, die ein wenig abgehackt in meinen Ohren klang. Ihr Gesichtsausdruck und das Tempo, in dem sie sprach, verrieten mir, dass es wichtig war. Wortlos, aber mit einem netten Lächeln, verabschiedete sie sich und lief zu ihrem Wagen.
Kurz nachdem sie weg war, fuhr ein weiteres Auto an die Tankstelle. Wobei, nein, es schlich sich an wie ein Panther. Lautlos, geschmeidig, fast elegant. Ein schwarzer Tesla Model X Performance. 163 mph, 300 Meilen Reichweite, von 0 auf 60 in 2,6 Sekunden. Einen Moment lang verfluchte ich mein Gehirn dafür, dass es mir diese Info mit Leichtigkeit ausspuckte, während es sich gleichzeitig weigerte, mir zu verraten, warum ich in jener Nacht von der Straße abgekommen war. Meine Erinnerungen an den Unfall waren nach wie vor verschwommen und entglitten mir, wenn ich meine Gedanken darauf fokussierte. Als wollte ich einen glitschigen Fisch mit bloßen Händen fangen.
Ich zückte mein Handy und machte ein Foto von der schwarzen Schönheit. Dad und ich diskutierten schon eine ganze Weile darüber, ob wir eine Ladestation für Elektroautos an der Tankstelle anbringen sollten. Dad war der Meinung, dass es dafür noch zu wenig Bedarf gab. Um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, führte ich eine Liste und machte Beweisfotos von jedem Elektroauto, das an unserer Tankstelle vorbeikam. Dieses Modell war bisher allerdings nicht dabei gewesen. Es kostete 120.000 Dollar. Durch die Linse meiner Handykamera beobachtete ich, wie ein Typ mit Sonnenbrille aus dem Wagen stieg. Auch aus hundert Metern Entfernung hätte ich sagen können, dass er nicht von hier stammte. Er trug eine dunkle Bikerjacke zu schmal geschnittenen Jeans und Boots, und seine Haare verschwanden unter einer lässigen Beanie. Ein Look, der in der Großstadt vermutlich nicht auffiel, hier in den Rockys aber ähnlich viel Aufmerksamkeit erregte wie ein Schwarzbär mit Schlittschuhen. Als er sich der Tankstelle näherte, legte ich mein Handy rasch zur Seite und hob die Zigarettenschachteln auf, die noch immer wahllos über den Boden verteilt lagen. Als ich mich bückte, fuhr mir erneut ein heftiger Schmerz ins Bein. Ich schnappte nach Luft und schloss einen Moment lang die Augen. Als ich mich wieder aufrichtete, stand der Typ mit der Sonnenbrille bereits vor mir und murmelte ein knappes, aber nicht unfreundliches »Hey«, bevor er eine Flasche Wasser auf den Tresen stellte.
»Hey«, erwiderte ich mit einem höflichen Lächeln, obwohl ich mich insgeheim über seine Sonnenbrille lustig machte. Abgesehen davon, dass die Sonne den ganzen Tag mit Abwesenheit glänzte, bedeckte das Teil fast sein halbes Gesicht. Außerdem wirkte sie protzig mit den verspiegelten Gläsern und dem goldenen Gestell. Aber wer ein Auto im Wert eines Einfamilienhauses fuhr, gab sich eben nicht mit einem Modell von Walmart zufrieden.
»Gibt es hier in der Nähe einen Supercharger?«, fragte er und entblößte eine Reihe strahlend weißer Zähne.
»Einen Supercharger?«
»Eine Schnellladestation für …«
»Teslas, ich weiß«, kam ich ihm zuvor. »Aber so etwas haben wir hier nicht.«
»Shit«, murmelte er. »Dann nur das Wasser.«
Er tippte mit dem Zeigefinger gegen die Flasche, die er auf den Tresen gestellt hatte. Gepflegte Hände für einen Mann, dachte ich spontan. Um einiges gepflegter als meine, die mal wieder ein wenig Creme vertragen konnten. Aber immerhin waren meine Nägel sauber, seit sie nicht mehr täglich mit Benzin und Motoröl in Berührung kamen.
»In Vail steht die nächste Elektro-Ladesäule. Gleich hinter dem Ortseingang auf der rechten Seite. Ist aber kein Supercharger.«
»Okay, danke«, sagte er und rang sich ein Lächeln ab.
Wow, diese Zähne waren wirklich weiß. Fast zu weiß. Ich unterdrückte den Impuls, mit der Zunge über meine eigenen zu fahren, und kassierte das Wasser. Er war schon fast aus der Tür, als er noch einmal herumwirbelte. »Könntest du das Foto bitte löschen?«
»Hm?«
»Das Foto«, wiederholte er und klang dabei, als wäre ich schwer von Begriff – was ich offenbar war.
»Welches Foto?«
»Das, das du von mir gemacht hast.«
Verwirrt sah ich ihn an.
»Okay«, seufzte er. »Ich weiß, dass ich wahrscheinlich das Spannendste bin, was dir heute passiert ist, aber bitte lösch es trotzdem.«
Ungläubig hob ich die Brauen. Hatte ich das richtig verstanden? Das Spannendste, was dir heute passiert ist?
»Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst.«
»Natürlich nicht«, murmelte er mit einem süffisanten Lächeln. »Ich hab nur leider gesehen, wie du mich fotografiert hast.«
Sein Zeigefinger wies auf die Fensterscheibe neben der Kasse, und plötzlich begriff ich.
»Ich habe dein Auto fotografiert«, sagte ich, als wäre mir gerade ein Geistesblitz gekommen.
»Mein Auto«, wiederholte er spöttisch und machte eine kurze Pause, als müsste er sich sammeln. »Wieso solltest du mein Auto fotografieren?«
»Wieso sollte ich dich fotografieren?«
Jetzt wirkte er ernsthaft verdattert. Ein, zwei Sekunden sagte er nichts. Mir wurde das Ganze indessen zu blöd. Kurzerhand zog ich mein Handy aus der Hosentasche, wischte ein paarmal über das Display und hielt ihm das Foto hin, das ich gemacht hatte. »Bitte schön.«
Er kam näher und runzelte die Stirn. »Das ist ein Foto von mir.«
»Was?« Ich schielte auf das Display. »Nein! Okay, du bist zufällig auch drauf«, relativierte ich, »aber mir ging es nur um dein Auto.«
Er schüttelte den Kopf, als wäre er die Unterhaltung leid. »Dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du das Foto von meinem Auto löschen könntest.«
Ich gab mir keine Mühe mehr, meinen Unmut zu verbergen, hielt ihm das Smartphone hin und drückte vor seinen Augen auf das Papierkorb-Symbol.
Er brummte ein »Danke«, bevor er sich umdrehte und die Tankstelle verließ, wobei er im Gehen versehentlich noch ein paar Zeitschriften aus dem Ständer riss.
»Hey!«, rief ich ihm empört hinterher, aber er steuerte bereits im Stechschritt auf seine Luxuskarre zu. Ungläubig schüttelte ich den Kopf und murmelte »Idiot«, während er in seinen Tesla stieg und das Weite suchte.
3.
Vielleicht steht er auf einer Fahndungsliste«, sinnierte Dad und stocherte in den letzten Resten einer Lasagne herum. Seit fünf Tagen ernährten wir uns ausschließlich von dem Zeug, das wir auf unserer Veranda gefunden hatten, und obwohl wir einiges eingefroren hatten, türmten sich noch immer Kuchen, Aufläufe und Suppen in unserem Kühlschrank. »Hast du sein Kennzeichen? Wir könnten den Albright-Jungen fragen, ob er ihn mal durch die Datenbank jagen kann.«
»Der Albright-Junge ist unser Sheriff, Dad«, bemerkte ich belustigt und stellte einen Teller Chili in die Mikrowelle. »Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Will Besseres zu tun hat, als versnobbten Tesla-Fahrern hinterherzujagen.« Wobei … sicher war ich mir da nicht. Für Polizisten musste Green Valley in etwa so aufregend sein wie Toastbrot, denn die Kriminalitätsrate hier ging gegen null. Wir schlossen weder unsere Autos noch unsere Haustüren ab, und das größte Verbrechen, an das ich mich überhaupt erinnern konnte, war der Einbruch eines hungrigen Schwarzbären ins Steakhouse. »Außerdem hab ich mir sein Kennzeichen nicht gemerkt. Und das Foto musste ich ja löschen.« Ich verdrehte die Augen.
»Dir ist natürlich klar, dass das Auto ohne Beweisfoto nicht in die Statistik einfließen kann«, sagte Dad mit unverhohlener Freude.
»Auch ohne den Tesla waren es heute zwölf Elektroautos. Zwölf!« Ich schenkte ihm einen bedeutungsschweren Blick.
»Ich hab ja gesagt, ich denke darüber nach.«
»Du denkst seit einem Jahr darüber nach«, murrte ich. »Wir wären neben Vail die einzige Ladestation weit und breit. Das würde uns zusätzliche Einnahmen sichern.«
»Erst mal würde es Ausgaben bringen. Und du weißt genau, dass die im Moment nicht drin sind. Nicht solange …« Er sprach es nicht aus. Musste er auch nicht.
… deine Behandlungskosten noch nicht abbezahlt sind. Mein Unfall hatte unsere Werkstatt fast in den Ruin getrieben. Dad hatte unser Haus und die Werkstatt mit einer weiteren Hypothek belasten und seine zwei Mitarbeiter entlassen müssen. Miguel arbeitete inzwischen in einem Autohaus in Vail, und Ezra hatte eine Stelle in Boulder angenommen. Dass der Laden nicht komplett vor die Hunde gegangen war, verdankten wir ausgerechnet meinem Ex-Freund Noah, der sein Studium unterbrochen und den Sommer über in der Werkstatt ausgeholfen hatte. Dafür würde ich ihm auf immer und ewig dankbar sein, egal, wie die Dinge zwischen uns gelaufen waren.
»Wollen wir uns gleich das Spiel ansehen?«, schnitt ich ein anderes Thema an, ehe sich das bedrückende Schweigen zwischen uns häuslich einrichten konnte. »Ich mache Popcorn«, fügte ich mit einem Zwinkern hinzu.
Dad schob die Aluschale von sich und bedachte mich mit einem sorgenvollen Blick. »Es ist Freitag. Willst du nicht ein bisschen … raus? Unter Leute? Du hast jeden Abend mit deinem alten Herrn verbracht, seit du wieder zu Hause bist.«
»Ich verbringe eben gerne Zeit mit meinem alten Herrn.«
Dad lächelte. Aber es war kein sorgenfreies Lächeln. »Ich meine ja nur. Du hast viel mitgemacht in den letzten Monaten. Vielleicht täte dir ein wenig … Spaß gut.«
»Mit dir Football zu schauen, macht auch Spaß. Vor allem wenn die Broncos eins auf den Sack bekommen.«
»Annie …«
»Dad …«, imitierte ich ihn.
Seufzend befasste er sich wieder mit seiner Lasagne. Plötzlich tat es mir leid, dass ich seine Sorge mit Spott quittiert hatte.
»Ich bin nicht wie Mom«, sagte ich leise.
Er sah nicht von seinem Teller auf. »Das weiß ich.«
Und trotzdem hast du Angst, dass ich wie sie werde. Dass ich hier vereinsame und dich verlasse.
»Aber ich weiß auch, wie sehr du darunter leidest, nicht arbeiten zu können.« Er schenkte mir einen weiteren gedankenvollen Blick.
»Ist ja nur vorübergehend«, sagte ich und legte all meinen Optimismus in diesen Satz.
»Natürlich ist es das.«
Auch wenn Dad sich Mühe gab, hörte ich einen Anflug von Zweifel.
»Also, was ist? Sehen wir uns das Spiel an?«
Dad nickte und erhob sich etwas schwerfällig vom Küchentisch. »Ich geh schon mal vor.«
Ich wartete, bis die Mikrowelle mit einem Pling aufsprang, und gab noch einen Löffel Sour Cream auf mein dampfendes Chili. Mit meinem Teller in der Hand und einer Dose Dr. Pepper unter dem Arm schlurfte ich ins Wohnzimmer und ließ mich in unser altes Ledersofa sinken, das mich mit dem üblichen Seufzen begrüßte. Dad lümmelte wie immer im Sessel neben mir, die Füße halb auf dem Couchtisch, und lauschte der Vorberichterstattung. Die Vertrautheit dieses Anblicks füllte mein Herz mit Wärme, aber gleichzeitig schwirrten seine Worte wie eine lästige Fliege am Rande meines Bewusstseins. Er hatte recht, ich konnte mich nicht weiter Abend für Abend zu Hause verkriechen, nur weil mir der Schritt nach draußen vor Augen führen würde, was ich längst wusste. Dass es mein altes Leben nicht mehr gab.
4.
Und du bist sicher, dass ich dich nicht fahren soll?«
»Jaaa«, antwortete ich zum wiederholten Mal an diesem Morgen und schwang mir die Sporttasche eine Spur zu lässig über die Schulter. »Ah«, stöhnte ich leise. Aber nicht leise genug. Sogleich schoss mein Vater um die Ecke.
»Hast du Schmerzen? Soll ich …«
»Dad!«, unterbrach ich ihn halb belustigt, halb genervt.
»Ich hab dich stöhnen hören, junges Fräulein!«
»Manchmal vergesse ich eben, dass meine Schulter noch nicht ganz die alte ist.«
Mit einem zerknirschten Gesichtsausdruck stand Dad im Türrahmen. »Also mir gefällt es nicht, dass du allein nach Vail fährst. Was, wenn du unterwegs wieder Schmerzen bekommst und das Lenkrad loslässt? Oder wenn …«
»D’Shawn hat gesagt, ich darf Auto fahren. Vergessen?«
»D’Shawn«, murrte Dad. »Der hatte mehr Augen für deine Beine als …«
Nun musste ich lachen. »Er war mein Physiotherapeut. Natürlich hat er sich meine Beine angesehen.« Die vor allem im Moment alles andere als spektakulär waren. Ich hatte nämlich absolute Puddingbeine. Nicht solche, die man von Schmetterlingen im Bauch bekam, sondern davon, dass sich das Auto mehrfach überschlug und man monatelang in einem Krankenhausbett lag. Noch dazu zog sich eine zwölf Zentimeter lange Narbe über meinen Oberschenkel. »Außerdem ist er Mitte dreißig und hat eine Freundin.«
»Mir wäre es trotzdem lieber, dein Physiotherapeut würde nicht wie ein Gangstarapper heißen.«
»Himmel, Dad! Seit wann bist du so spießig?«
»Jeder Vater ist spießig, wenn es um seine Tochter geht. Vor allem um seine Lieblingstochter.«
»Du hast nur eine.«
»Wenn ich noch drei weitere hätte, wärst du trotzdem meine Lieblingstochter.«
»Bis später«, seufzte ich und lief zur Tür.
»Fahr vorsichtig! Und ruf an, wenn du da bist. Und …«
Dad rief mir noch etwas nach, aber die Tür war bereits hinter mir ins Schloss gefallen. Beschwingt warf ich die Sporttasche auf den Rücksitz meines Jeeps, der den Unfall deutlich besser verkraftet hatte als ich. Nachdem Dad die vorderen Kotflügel ausgebeult und neu lackiert hatte, sah er fast wie neu aus. Ob ich das irgendwann auch von mir behaupten konnte? Die Narbe auf meiner Haut ließ sich leider nicht einfach übermalen. Mit klopfendem Herzen setzte ich mich ans Steuer. Ich hatte das Autofahren vermisst, auch wenn es mich in jener Nacht fast das Leben gekostet hätte. Das Gefühl des Lenkrads unter meinen Händen, das Brummen des Motors, den Rausch der Beschleunigung, die einen sanft gegen den Sitz drückte. Mit klopfendem Herzen drehte ich den Zündschlüssel um, trat aufs Gas und bog langsam aus unserer Einfahrt. Eine unglaubliche Ruhe überkam mich, als der Wagen durch unsere Straße fuhr, die Häuser an mir vorbeizogen. Es war so schön, wieder hier zu sein. Überhaupt noch hier zu sein. Ich freute mich sogar auf meine erste Trainingseinheit, auch wenn sie mit Anstrengung und Schmerzen einhergehen würde. Aber jeder Tropfen Schweiß war ein Schritt nach vorne und würde mich meinem Ziel näher bringen, endlich wieder als Automechanikerin arbeiten zu können.
Gut eine halbe Stunde später passierte ich das Ortsschild von Vail und parkte meinen Wagen in der Nähe des Sebastian. Leicht nervös betrat ich die Lobby des 5-Sterne-Hotels. Es war das erste Mal, dass ich es von innen sah, und ich war ziemlich beeindruckt von der weitläufigen Eingangshalle mit ihren Steinmauern, Deckenbalken und Ledersesseln. Ein älterer Herr saß vor einem freistehenden Kamin und las Zeitung, während neben ihm zwei Frauen mit Prosecco anstießen. Das Ganze war mir so fremd, dass ich jeden Moment damit rechnete, dass sich eine Hand auf meine Schulter legen und jemand »Darf ich fragen, was Sie hier machen?« sagen würde. Bemüht, keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, steuerte ich die Rezeption an und blinzelte. Denn hinter dem Tresen stand niemand Geringeres als Lena. Sie hatte ihr Haar zu einem ordentlichen Pferdeschwanz frisiert und trug einen weinroten Pullover, an dem ein dezentes Namensschild aus Messing angebracht war.
»Was machst du denn hier?«, fragte ich überrascht.
»Arbeiten«, erwiderte sie mit einem breiten Lächeln.
»Ich dachte, du bist Au-pair.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nicht mehr. Ich mache hier eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Und du?«
»Mrs. Albright hat mir angeboten, den Fitnessraum für meine Reha zu nutzen.« Ich hielt eine meiner Krücken hoch.
»Ah! Dann bist du A. Hudgens!« Sie kramte nach etwas und reichte mir eine weiße Chipkarte mit dem Logo des Hotels. »Die ist für dich hinterlegt worden. Weißt du, wo du hinmusst?«
Ich schüttelte den Kopf, und Lena sah sich kurz nach allen Seiten um. »Ich bring dich schnell hin.« Sie kam hinter der Rezeption hervor und wies mit dem Zeigefinger nach links. »Da lang.«
Wir durchquerten die Lobby und folgten einer Reihe von Schildern, die mit Spa beschriftet waren, bis wir zu einer Treppe gelangten. »Sollen wir den Aufzug nehmen?«, fragte Lena, auf meine Krücken schielend.
»Nein, das geht schon.«
Demonstrativ humpelte ich die erste Stufe nach unten und war erleichtert, dass der übliche Schmerz ausblieb.
»Wie ist das passiert?«
Kurz war ich überrascht. Offenbar hatte sie wirklich noch nichts über mich gehört.
»Autounfall«, gab ich angestrengt zurück und nahm die zweite und dritte Stufe.
»Oh«, entfuhr es ihr betreten, als hätte sie mit einer unspektakuläreren Antwort gerechnet. Ehe sie noch etwas hinzufügen konnte, kam uns eine Hotelangestellte entgegen und wechselte ein paar Worte mit Lena.
»Wie lange arbeitest du schon hier?«, fragte ich, in der Hoffnung, vom Thema abzulenken. Das Treppenhaus eines Hotels war definitiv der falsche Ort, um über die letzten Monate zu sprechen.
»Das ist erst meine zweite Woche«, räumte sie ein. »Aber ich habe hier letztes Jahr ein Praktikum gemacht und kenne den Laden schon ganz gut.«
»Dann bist du jetzt fest hierhergezogen?«
Sie nickte. »Zumindest für die Dauer meiner Ausbildung. Danach sehen wir weiter …«
»Wow«, erwiderte ich ehrlich beeindruckt. Ich hatte mein bisheriges Leben – abgesehen von ein paar Urlauben – ausschließlich in Green Valley verbracht und konnte mir nicht vorstellen, diesen Ort jemals zu verlassen. »Vermisst du dein Zuhause nicht?«
Wir waren am Ende der Treppe angekommen, und ich war erschöpft, aber stolz.
»Doch. Vor allem meine Familie und meine beste Freundin«, gab sie zu. »Aber als ich den Sommer über wieder in Berlin war, habe ich Ryan vermisst. Und Green Valley. Egal, wo ich bin, irgendetwas fehlt immer.« Sie lächelte ein wenig traurig und hielt ihre Chipkarte an das Lesegerät. Ein Klicken ertönte, ehe die Tür aufschwang. Der Spa-Bereich empfing uns mit gedämpftem Licht und dem Duft nach ätherischen Ölen. Melodische Entspannungsmusik drang an mein Ohr, als ich Lena etwas zögerlich folgte. Ich war noch nie in einem Wellnessbereich gewesen und fühlte mich hier in etwa so wohl wie Michelle Obama bei der Amtseinführung von Donald Trump.
»Hier geht es zum Schwimmbad«, legte Lena los und wies geradeaus. »Da drüben sind die Saunen, und der Fitnessraum ist hier. Dich umziehen und duschen kannst du dort.« Sie wies mit dem Kopf auf die Tür rechts neben uns. »Falls du Handtücher oder einen Bademantel brauchst, kannst du dich gerne bedienen. Wasserspender gibt es auch überall. Und natürlich frisches Obst.«
Überwältigt von der Fülle an Informationen nickte ich nur.
»Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach bei Bethany. Die schwirrt hier irgendwo herum.«
Ich nickte erneut.
»Dann viel Spaß!«, erwiderte sie zwinkernd und verabschiedete sich. Sie war bereits an der Tür, als sie sich noch einmal umdrehte. »Hast du heute Abend schon was vor?«
»Heute Abend?«
»Wir wollten ins Olly’s und uns das Spiel ansehen. Ryan, ich und eine Freundin.«
»Welches Spiel?«
Lena zuckte mit den Schultern. »Football, Baseball … irgendwas mit einem Ball.«
Ich lachte.
»Wir treffen uns zur Burger Happy Hour. Also … falls du Lust hast?«
»Burger Happy Hour?«, wiederholte ich verwirrt.
»Ja, donnerstags ist doch immer Burger Happy Hour im Olly’s. Von sieben bis acht.«
Was so selbstverständlich aus ihrem Mund kam, war mir vollkommen neu. Ich sah mich schon in mein Notizbuch kritzeln: Donnerstag, Burger Happy Hour, Olly’s.
»Okay. Ich überleg’s mir.«
Sie lächelte zufrieden. »Cool. Dann vielleicht bis heute Abend.«
Ich sah ihr nach, bis sie durch die Tür verschwunden war, und machte mich auf den Weg in die Umkleide – die erste, die nicht nach Schweiß und alten Socken muffte, sondern nach Orangenblüten und Lavendel duftete. Zu meiner Linken gab es geräumige Kabinen, gegenüber luxuriöse Duschen mit winzigen Shampoo-Flakons. Ich schlüpfte in meine Turnschuhe und tauschte Jeans und Pullover gegen Jogginghose und T-Shirt. Beides war mir fast zwei Nummern zu groß und schlackerte sackartig um meinen Körper. Ich war schon vor dem Unfall zierlich gewesen, aber die fünf Monate im Koma hatten mich sämtliche Muskeln gekostet. Nachdem ich meine Sporttasche verstaut hatte, machte ich mich mit einem Handtuch um den Hals und einer Wasserflasche unter dem Arm auf den Weg in den Fitnessraum, der zu allen Seiten verglast war, wie ich verblüfft feststellte. Ich stieß ein ungläubiges Lachen aus, als ich die topmodernen Laufbänder, Crosstrainer und Fahrräder erspähte, die Hantelbänke und Krafttrainingsgeräte. Im Vergleich zu der kleinen Rumpelkammer im Krankenhaus in Denver war dieser Raum ein einziger Fitnesstempel. Beim Näherkommen sah ich, dass bereits jemand mit einer Langhantel trainierte. Kurz bereute ich meinen Schlabberlook. Weil ich absolut unförmig darin aussah und weil er gnadenlos offenbarte, dass ich nicht hierhergehörte. Bemüht unauffällig öffnete ich die Glastür und murmelte das obligatorische »Hey« zu dem Kerl, der gerade eine mit Gewichten bepackte Hantel schwer schnaufend zu Boden gleiten ließ. Er sah auf und betrachtete mich, als wäre ich eine Anomalie in seinem Universum. Dann stieß er ein ungläubiges Lachen aus.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«
Ich warf einen hastigen Blick über meine Schulter, aber da war niemand außer mir.
»Meinst du … mich?«, fragte ich stirnrunzelnd.
Er gab vor, sich umzusehen. »Ist hier noch jemand, der nicht weiß, was Privatsphäre bedeutet?« Seine Mundwinkel zuckten. »Mein Auto steht übrigens in der Tiefgarage. Nur für den Fall, dass du mich wieder heimlich fotografieren willst.«
Privatsphäre? Fotografieren? Mit grenzenloser Verwirrung starrte ich ihn an. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Und plötzlich fielen die Puzzleteile an ihren Platz. Das war der Kerl aus der Tankstelle! Der Tesla-Fahrer! Ohne Beanie und Sonnenbrille sah er deutlich jünger aus. Mitte zwanzig, schätzte ich. Er war groß, leicht gebräunt und hatte dunkelblondes Haar, das ihm verschwitzt und etwas durcheinander in die Stirn hing.
»Wie bist du überhaupt hier reingekommen?«
Er musterte mich mit einer Mischung aus Erstaunen und Belustigung.
»Mit meiner Chipkarte«, entgegnete ich, als ich mich wieder einigermaßen gefangen hatte. Ich hatte nicht beabsichtigt, dass es so spöttisch aus meinem Mund kam, feierte mich aber spontan dafür.
»Deiner Chipkarte«, wiederholte er. Ein amüsierter Zug zeigte sich auf seinem Gesicht – das, zugegeben, lächerlich attraktiv war. Mit seiner geraden Nase, dem gemeißelten Kinn und den vollen, aber nicht zu vollen Lippen entsprach er so ziemlich jedem Schönheitsideal der Welt. Wie einer dieser gecasteten Boyband-Sänger. Oder der Typ aus der Zahnpasta-Werbung. Auf jeden Fall löste er in einem das Gefühl aus, ihm Ecken und Kanten schenken zu wollen.
»Sorry, aber ich weiß echt nicht, was du von mir willst. Ich will hier nur in Ruhe meine Übungen machen.«
»Du willst mir also erzählen, dass du Gast in diesem Hotel bist?«
Seine Augen fixierten mein Schlabbershirt, und obwohl ich mich dagegen wehrte, kroch eine unangenehme Röte meinen Hals hinauf.
»Ja. Also nein, ich bin kein Gast, aber …«
»Hör zu, ich will echt nicht, dass du Ärger bekommst, aber ich kann es mir gerade nicht er…«
Ehe er seinen Satz zu Ende sprechen konnte, schwang die Tür hinter uns auf, und eine wie immer gut gelaunte Mrs. Albright betrat den Fitnessraum. Ihr cremefarbener Hosenanzug fügte sich perfekt in die Umgebung ein, und ihr Parfum roch feminin und teuer.
»Einen wunderschönen guten Morgen«, sagte sie erst in meine, dann in seine Richtung.
»Hey Mrs. Albright«, begrüßte ich sie mit einem Lächeln, obwohl alles in mir in Aufruhr war.
»Lena hat mir gerade gesagt, dass du schon hier bist. Ich wollte mal nach dir sehen.« Ihr perfekt umrandeter kirschroter Mund verzog sich zu einem freudigen Lächeln. Aus dem Augenwinkel sah ich den verdutzten Gesichtsausdruck von Mr. Tesla und verspürte ein angenehmes Gefühl des Triumphes.
»Alles bestens.«
»Das freut mich. Wenn ich noch irgendetwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen, ja?«
»Danke, Mrs. Albright. Das ist wirklich sehr nett.«
Sie warf einen Blick auf die schmale Uhr an ihrem Handgelenk. »Dann will ich auch gar nicht weiter stören.«