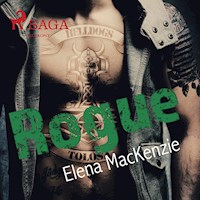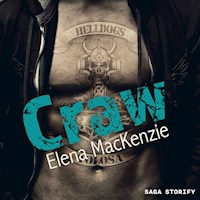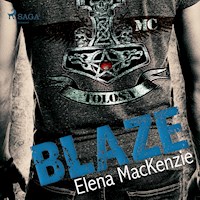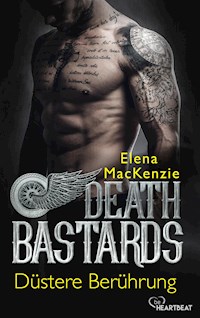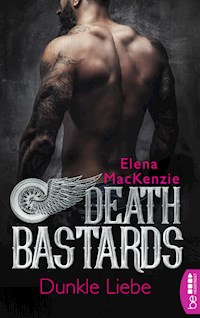Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: New Shoreham
- Sprache: Deutsch
Als Avery nach New Shoreham kommt, ist sie verzweifelt und pleite. Ihr Traumstudium musste sie abbrechen, nach dem Tod ihrer Mutter sind die Panikattacken zurück. Hier, auf der kleinen Insel mitten im Atlantik, will sie Ruhe finden. Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist jemand, der ihr Leben noch weiter durcheinanderbringt. Doch bei einem Putzjob stolpert sie über den provozierend lässigen Dylan Malone. Dylan gelingt es immer wieder, Avery aus ihrem Schneckenhaus herauszulocken. Und so beginnt ein Inselsommer, der Averys Leben in eine ungeahnte Richtung lenkt. Bis plötzlich dunkle Wolken am Horizont heraufziehen. Denn auch Dylans Leben ist keineswegs so unbeschwert, wie es den Anschein hat. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elena MacKenzie
New Shoreham – Tief wie das Meer
Saga
New Shoreham – Tief wie das Meer
Copyright © 2022, 2022 Elena MacKenzie und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728412084
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1. Kapitel
Avery
Augen schließen. Einatmen. Eins. Zwei. Drei. Ausatmen.
Ich wende mein Gesicht in Richtung des kleinen runden Fensters und weg von meinem Sitznachbarn, damit er die Panik nicht bemerkt, die mich gerade überrollt. Möglichst unauffällig lege ich den Zeigefinger der einen Hand auf das Handgelenk der anderen und taste nach meinem Puls. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, zähle ich in Gedanken und versuche, meinem rasenden Herzschlag den viel ruhigeren Rhythmus aus meinem Kopf aufzuzwingen, um die Kontrolle zurückzuerlangen. Jetzt bloß nicht anfangen zu zittern, bloß nicht heulen, bloß nicht ohnmächtig werden. Blamier dich nicht vor all diesen Menschen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen.
Ich spüre die Tränen schon gegen meine Lider drängen. Meine Atmung geht viel zu hektisch. Jeden Moment wird jemandem auffallen, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und wenn er mich dann anspricht, verliere ich die Kontrolle vollkommen und die Panikattacke bricht wie eine Welle über mir zusammen und ich kann sie nicht mehr aufhalten. Das darf nicht passieren. Nicht vor all diesen Fremden auf der Fähre nach Block Island.
Ich schlucke hart gegen den Kloß an, als mich die Erinnerung an meine letzte Attacke einholt. Sie kam so überraschend schnell, dass ich nichts tun konnte. Von einer Sekunde auf die andere war sie da, während ich den Donut der Kundin eingepackt in der einen Hand hielt und mit der anderen den Becher mit ihrem Latte macchiato habe fallen lassen. Mein Herz hat so laut in meiner Brust getrommelt, dass ich zwar gesehen habe, wie sie versucht hat, mich anzusprechen, aber nicht gehört habe, was sie gesagt hat. Ich hätte ihr ohnehin nicht antworten können, denn ich habe keine Luft mehr bekommen.
Zuerst war ich wie erstarrt, dann habe ich mich mitten im Café auf den Boden gesetzt, um mich herum die Kundschaft dieses Morgens, und habe angefangen zu zittern, vor mich hin zu murmeln und mich vor und zurück zu wiegen. Ich habe ungehemmt geheult und jeden um mich herum ignoriert, während ich versucht habe, mich aus der Todesangst zu befreien, die mich in ihrem Griff hatte. Todesangst, die mich seit ein paar Monaten immer wieder überwältigt. Meine Freundin und Therapeutin sagt, das habe mit der langen Krankheit und dem traumatischen Verlust meiner Mutter zu tun.
Ich hasse diese Panikattacken. Ich fühle mich damit so hilflos. So wie bei meiner Mutter. Ich konnte nichts tun, als die Krankheit sie mir genommen hat. Ganz langsam, Stück für Stück hat die Amyotrophe Lateralsklerose ihren Körper zerstört und ihren Geist darin eingesperrt. Die meisten kennen diese Krankheit nur dank der Ice Bucket Challenge, aber ich habe zugesehen, wie sie in nur drei Jahren das Leben aus meiner Mutter gesaugt hat. Und jetzt raubt sie mir alles, was sie noch übrig gelassen hat.
Die Panikattacke, die ich im Café vor all den Kunden hatte, hat mich meinen Job gekostet. Mein Studium musste ich schon lange vorher aufgeben, um mir einen Vollzeitjob suchen zu können, damit ich die Pflegekosten und Arztrechnungen meiner Mutter und unseren Lebensunterhalt bezahlen konnte. Und jetzt habe ich nichts mehr außer zwei Monatsmieten Schulden, weil ich mir ohne Einkommen die Wohnung nicht mehr leisten konnte, und der kurzen Nachricht meiner Großmutter auf meinem Handy, dass ich bei ihr leben und für sie arbeiten könne. Ich hätte mich nicht getraut, eine neue Anstellung in New York anzunehmen, immer mit dem Damoklesschwert über meinem Kopf, während der Arbeitszeit wieder eine Panikattacke zu erleiden. Mein Leben in New York ist für mich zu einem Albtraum geworden, aus dem ich endlich wieder aufwachen wollte.
Auf Block Island bietet meine Großmutter Sally mir eine Arbeit an, bei der ich nicht Gefahr laufe, vor anderen Menschen zusammenzubrechen, weil ich die meiste Zeit allein sein werde. Sie schafft mir die Möglichkeit, erst mal wieder durchzuatmen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen und den Verlust und die Trauer zu bewältigen. Und so kann ich auch die Insel kennenlernen, auf der meine Eltern aufgewachsen sind. Auf der ich geboren wurde. Ich habe New York den Rücken gekehrt. In meinem Koffer befinden sich nur meine Kamera, ein bisschen Kleidung und ein paar Fotos von mir und meiner Mutter.
Ich spitze die Lippen und blase langsam die Atemluft aus, als würde ich in einen Strohhalm blasen. Ein Tipp von Anny. Eigentlich war sie meine Nachbarin und Freundin. Sie studiert auf der NYU Psychologie. Ich war im siebten Semester auf der New York Academy of Arts und wollte Digital Arts und Illustration lernen. Nicht mehr lange, dann hätte ich meinen Abschluss gemacht und vielleicht hätte mich die Galerie, in der ich mein Praktikum absolviert hatte, dann fest eingestellt, bis ich bereit gewesen wäre für eine eigene Galerie. So wie Mom und ich es uns immer erträumt haben. Aber das alles habe ich aufgegeben, denn Träume sind nicht mehr wichtig, wenn deine Welt plötzlich zu wanken beginnt und du zusammen mit deiner Mutter um jeden Atemzug kämpfen musst.
Ich hole durch die Nase tief Luft, halte den Sauerstoff in der Lunge kurz fest und blase durch die gespitzten Lippen aus. Ich muss nur noch ein paar Minuten durchhalten, dann legen wir an. Ich kann das große weiße Hotel schon sehen, die bunten Sonnenschirme und die Promenade. Langsam senkt sich die Frequenz meines Herzschlags wieder. Ich bin auf einem guten Weg. Vielleicht muss ich mich doch nicht vor all den Menschen hier blamieren. Ich konzentriere mich weiter auf meine Atmung und lenke mich mit den Fotos auf meinem Handy ab, nur um aus meinem Kopf herauszukommen.
Ich kann mich nicht mehr an viel von Block Island erinnern. Als wir das letzte Mal meine Großmutter besucht haben, war ich neun Jahre alt, aber es gibt ein paar wenige Fetzen, die sich jetzt langsam wieder in mein Gedächtnis drängen. Zum Beispiel, wie unwohl meine Mutter sich hier immer gefühlt hat. Alles auf der Insel hat sie an ihre Trauer erinnert, den Schmerz, meinen Vater und ihren Mann verloren zu haben. Deswegen wollte sie nie hierher zurück. Ich war erst fünf, als sie nach dem Tod meines Vaters mit mir regelrecht von der Insel geflüchtet ist. Danach waren wir nur noch zweimal zu Besuch hier.
Auch an meine Großmutter kann ich mich kaum noch erinnern. Sie hat mir jedes Jahr zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten ein Geschenk zukommen lassen und ich habe ihr als Kind Selbstgebasteltes und Gemaltes geschickt. Als meine Mutter krank geworden ist, war sie zweimal in New York und hat versucht, meine Mutter davon zu überzeugen, nach Block Island zu ziehen, wo sie mir helfen wollte, meine Mutter zu versorgen. Aber meine Mutter hat sich geweigert, sie wollte die Insel nicht wieder betreten. Manchmal glaube ich, sie hat Block Island aus tiefstem Herzen gehasst, weil die Insel ihr ihre Liebe genommen hat. Und zugleich hatte sie immer dieses verträumte Lächeln auf ihren Lippen, wenn sie mir als Kind von sich, Dad und ihrem Leben hier erzählt hat. Als wäre sie zerrissen.
Bumm. Bumm. Bumm. In meiner Brust trommelt es. Mein gesamter Körper scheint mitzupulsieren. Ich fühle ihn zucken und hole frustriert tief Luft. Im Kopf zähle ich schon die Sekunden, bis wir anlegen werden. Laut Fahrplan der Fähre sollte das in weniger als vier Minuten sein. Nervös starre ich auf die näher kommende Küste. Am Hafen warten Reisende, die mit der Fähre wieder zurück nach Rhode Island wollen. Ich stehe von meinem Sitzplatz auf, als es die anderen um mich herum auch tun, packe den Griff meines Rollkoffers und folge den Menschen.
Gleich ist es so weit. Du kommst weg von all den Menschen, du wirst wieder atmen können, beruhige ich mich und konzentriere mich nur darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen und den Menschen vor mir zu folgen, die sich langsam in eine Schlange einfügen.
Die Fähre legt an, eine frische Brise salziger Luft erreicht mich und fühlt sich in meiner Lunge wie eine kleine Befreiung an. Ich bin endlich hier. Und zugleich wird mir bewusst, dass ich eigentlich nie hierherkommen wollte. Aber ich hatte auch keine andere Wahl. Es sind nicht nur der Verlust meines Jobs, meine Ziellosigkeit und die Schulden, die mich hertreiben. Ich brauche diesen Neuanfang. Ich brauche Abstand zu New York und zu meinem Leben dort. Eigentlich ist es verrückt zu wissen, dass meine Mutter damals mit mir von Block Island nach New York geflohen ist, und jetzt fliehe ich von New York zurück nach Block Island. Aber der Abstand wird mir guttun, meint Anny. Ich würde ihn brauchen, um mich ein wenig von den anstrengenden letzten Monaten zu erholen und mich dann neu zu orientieren. Ich hoffe, sie hat recht.
Sobald die Fähre an Point Judith in Shoreham angelegt hat, kann ich es kaum noch erwarten, an Land zu kommen. Nicht weil ich mich so sehr freue, sondern weil ich mittlerweile um jeden Atemzug kämpfe. Vor meinen Augen flimmern schon schwarze Punkte. In meiner Angst schiebe und zwänge ich mich dem ersehnten Ausgang entgegen. Ich bin wem auch immer dankbar für den freien Platz vor der Anlegestelle und den Parkplatz, der sich gleich daneben befindet. Statt den Touristen in das Hotel und die einladende Promenade zu folgen, eile ich auf den Parkplatz zu, der mit nur wenigen Autos belegt ist, und halte dort auf meinen Koffer gestützt erst mal kurz inne. Mit der kühlen salzigen Meerluft strömt die Erleichterung in meine Lungen. Ich habe es bis hierher geschafft.
Für eine Sekunde schließe ich noch einmal die Augen und sperre alles um mich herum aus, bevor ich mir die Kraft zugestehe, mich umzusehen und den Anblick der strahlend weißen Häuser mit ihren umlaufenden Terrassen im New-England-Stil auf mich wirken zu lassen. Ich kann mich noch an das große Hotel erinnern, das sich jetzt genau vor mir befindet, die bunte Promenade mit den verschiedenen Geschäften, Restaurants und Cafés, die außerhalb der Saison einsam und verlassen wirkt. Als wir das letzte Mal hier waren, war gerade Winter und selbst mit neun Jahren hat mich die Einsamkeit auf der Insel bedrückt. Ich bin nun mal in New York aufgewachsen, der Stadt, von der alle behaupten, sie würde niemals schlafen. Block Island schläft fast den ganzen Winter.
Der kürzeste Weg von der Anlegestelle nach South Kingstown (so heißt die kleine Ortschaft, in der meine Großmutter ihr B&B betreibt) ist der mit dem Boot quer durch die Bucht von Point Judith, hat sie mir geschrieben. Da es aber nicht leicht ist, einen Fischer oder einen Jachtbesitzer davon zu überzeugen, den Chauffeur für einen Touristen zu spielen, soll ich mir ein Taxi nehmen, das braucht für die knapp zehn Meilen nur fünfzehn Minuten.
Ich sehe mich nach einem Taxistand um, kann aber keinen entdecken. Mit dem Rollkoffer in der Hand laufe ich langsam auf die Promenade zu. Es ist warm, die Sonne strahlt gleißend vom Himmel, was noch zu meiner Erschöpfung beiträgt. Vor der Einfahrt zum Parkplatz bleibe ich stehen und versuche mich neu zu orientieren, als mir eine junge Frau hektisch zuwinkt.
»Bist du Avery?«, will sie wissen. Neben ihr steht ein älteres Ehepaar. Ich kann mich erinnern, die beiden auf der Fähre gesehen zu haben. Sie haben auch einen Koffer bei sich, den gerade ein junger Mann in den Kofferraum eines kleinen Busses verfrachtet.
»Ja, das bin ich«, sage ich noch immer mit einem Kloß im Hals, weswegen ich mich räuspere und noch einmal wiederhole: »Ich bin Avery.«
»Dann kannst du mit uns mitfahren. Sally hat gemeint, du würdest auch heute mit der Fähre ankommen. Wir sollten die Augen nach dir offen halten.« Die junge Frau kommt auf mich zu. Sie dürfte etwa in meinem Alter sein. »Ich bin Meghan, aber nenn mich Meg. Und das ist Will. Ihm gehört der Shuttlebus rüber nach Kingstown.«
Will nickt mir knapp zu, deutet auf meinen Koffer und greift danach, nachdem ich unsicher zurückgenickt habe. »Danke«, sage ich zu ihm. »Ich hatte schon befürchtet, ich müsste mich auf die Suche nach einem Taxi machen.«
Meg grinst. »Das wäre schwierig geworden. Es gibt nicht viele Taxis hier. Die meisten Autos gehören Touristen, die sie mit der Fähre rüberbringen. Aber am besten bist du hier mit einem Fahrrad oder Moped unterwegs. Es gibt hier viele schmale Straßen.«
Meg bedeutet mir, in den Kleinbus zu steigen. Das ältere Ehepaar sitzt schon ganz hinten auf der Sitzbank, sie hat ihren Kopf an seine Schulter gelehnt und wirkt müde. Er starrt zum Fenster raus und betrachtet das kleine Fischrestaurant, vor dem wir stehen. Im Fenster hängt ein Plakat, das eine Race Week bewirbt, die in etwa drei Wochen stattfinden soll. Auf einem Bild des Plakats sieht man Segelboote auf dem Meer und Zelte am Strand, in denen Getränke ausgeschenkt werden.
Will setzt sich hinter das Lenkrad, Meg in die zweite Reihe neben mich, was mir leider die Chance auf ein paar Minuten für mich allein nimmt. Aber ich lasse es mir nicht anmerken, denn Meg will bestimmt nur höflich sein.
»Siehst du auf der anderen Seite die großen Villen?«, fragt sie mich, als wir losfahren.
Ich konzentriere mich auf das Ufer gegenüber und entdecke zwischen Bäumen prächtige Villen mit eigenen Anlegestellen und kleinen Privatstränden. »Ja«, bestätige ich leise.
»Das ist die Fire Lane. Ein Teil deines neuen Jobs.« Meg kichert. »Also unser beider Job. Wir werden uns zu zweit um die Villen kümmern. Aber keine Sorge, ich werde dir alles erklären«, winkt Meg ab. Sie wischt sich eine honigblonde Strähne aus der verschwitzten Stirn und zeigt auf ein weiteres Gebäude auf der anderen Seite, das zwischen den Bäumen auftaucht, während wir an der Küste entlangfahren. »Das B&B deiner Großmutter. Es liegt ganz am Ende der Fire Lane. Irgendwann hat das Haus mal einer wohlhabenden Familie gehört, dann stand es lange leer und jetzt ist es ein B&B.«
Ich kann nicht viel von dem Haus erkennen, weil es nur hin und wieder kurz zwischen den Bäumen hervorblitzt, aber meine Erinnerung füllt ein paar der Lücken. Ich weiß noch, dass es umgeben war von unzähligen mit bunten Blumen bepflanzten Töpfen und ich als Kind fasziniert von dem lauten Summen der Insekten war, aber auch ein wenig Angst hatte, gestochen zu werden, wenn ich daran vorbeigegangen bin.
»Es ist schon lange her«, gebe ich zu.
»Du kommst aus New York, oder?«, will Meg wissen und mustert mich neugierig.
»Ja«, bestätige ich knapp.
»Deine Großmutter spricht nicht viel über ihre Familie, aber sie hat New York mal erwähnt. Sie kümmert sich heute um Besorgungen für die Race Week, weswegen sie dich nicht persönlich begrüßen kann, aber ich soll dir dein Zimmer zeigen. Da gerade die Saison beginnt, ist das B&B ausgebucht, du wirst also bei ihr wohnen«, erklärt Meg. »Dann habt ihr Zeit, euch kennenzulernen. Du und Sally habt euch bestimmt viel zu erzählen«, fügt sie mit einem milden Lächeln an.
Seit dem Tod meiner Mutter haben Sally und ich mehrmals telefoniert. Mit ihr zu reden hat mir etwas Halt gegeben. Aber eigentlich stimmt, was Meg gesagt hat, wir kennen uns nicht wirklich. Zwei Besuche in all den Jahren knüpfen noch keine echte Verbindung zwischen zwei Menschen. Weswegen ich ihr Angebot, mein Studium auf der Academy zu finanzieren, auch abgelehnt habe. Ich kann nicht so viel Geld von ihr annehmen. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt zurückwill. Im Moment erscheint mir das alles sehr weit weg.
»Ganz Block Island ist schon im Race-Week-Fieber.« Meg deutet auf die vielen Plakate entlang der Promenade und lacht wieder. Sie scheint ein fröhlicher, offener Mensch zu sein und ihre freundliche Art macht es mir etwas leichter, mich zu entspannen. »Während der Race Week gibt es überall auf der Insel verschiedene Wettkämpfe und sehr viele Partys.« Ihr Grinsen wird breiter.
Meg hat warme, bernsteinfarbene Augen, ein wenig wie flüssiger Waldhonig. In ihren blonden schulterlangen Haaren verstecken sich zarte rosa und hellblaue Strähnen, ein bisschen wie bei einer Meerjungfrau. Was in ihrem Gesicht aber am auffälligsten ist, das sind ihre vollen Lippen, um die sie die meisten Frauen in New York beneiden würden. Meg ist sehr zierlich und kaum größer als einen Meter sechzig. Ich bin auch schlank, war aber früher mal fülliger, bevor Mom krank wurde und bevor ich mit nur einer Mahlzeit am Tag auskommen musste. Aber im Gegensatz zu Meg bin ich fast eins zweiundsiebzig. Was auch nicht sonderlich groß ist, aber deutlich größer als Meg.
»Deine Großmutter macht die besten Pies, die du jemals essen wirst«, schwärmt Meg. »Sie ist eine unglaublich gute Köchin und Bäckerin. Wegen des Essens ist das B&B auf der ganzen Insel bekannt, was nicht schwer ist, die Insel ist ja nicht groß. Aber trotzdem, sie ist einfach toll und alle lieben sie. Außerhalb der Saison öffnet sie das B&B als Restaurant über die Nachmittagsstunden, damit wir nicht den ganzen Winter über auf ihre Kuchen verzichten müssen.«
Ich kämpfe gegen den Kloß in meinem Hals an. »Meine Mutter hat auch immer Pies gemacht.«
Meg mustert mich, als meine Stimme versagt, und verzieht die Lippen zu einem bedauernden Lächeln. »Dann waren ihre Pies bestimmt genauso gut wie die von Sally.«
Der Bus fährt eine schmale Straße entlang, die durch einen Wald führt. Hin und wieder blitzt zwischen den Bäumen das strahlende Weiß eines Hauses auf. Obwohl ich mich kaum an etwas erinnern kann, fühle ich, dass wir uns unserem Ziel nähern. Und mit jedem Meter schwillt meine Kehle mehr zu. Ich wünschte, ich müsste das hier nicht tun. Ich wünschte, meine finanzielle Lage würde mich nicht dazu zwingen. Plötzlich überkommt mich wieder die Scham, die ich schon gefühlt habe, als ich meine Großmutter gefragt habe, ob ich eine Weile nach Block Island kommen könnte. Ich fühle mich nicht wohl mit dem Gedanken, von einer Person abhängig zu sein, die ich so wenig kenne. Als würde ich mich ihr aufdrängen und ich möchte niemandem zur Last fallen.
Als der Bus vor einem dreistöckigen Haus stehen bleibt, verkrampft sich mein Magen und die gefürchtete Angst macht sich in meinem Hinterkopf leise bemerkbar. Aber ich dränge sie vehement zurück, indem ich mich nur auf dieses Haus konzentriere. Es wirkt freundlich, einladend, ein wenig wild-romantisch. So wie die ganze Insel und doch ist meine Mutter mit mir von dieser Insel geflohen.
Das mit meinen Panikattacken ist eine komische Sache. Solange ich versuche, sie zu bekämpfen, schwimmen sie immer nah unter der Oberfläche und drohen damit hervorzubrechen. Jede kleine Veränderung kann dann dazu führen, sie explodieren zu lassen. Wie eine ständig lauernde Gefahr. Manchmal reicht schon ein vorwurfsvoller Blick eines Fremden. Und dann lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Aber wenn die Attacke vorüber ist, und das ist noch viel komischer, fühle ich mich wie belebt. Wie nach einem entspannten Lauf durch den Park, der meinen Puls zum Rasen gebracht hat. Anny sagt, dass dieses Hochgefühl vom Adrenalin kommt, das nach einer Angstattacke durch meine Venen rinnt.
Ich kämpfe und schnappe nach Luft. Konzentriere mich nur darauf, Meg zu folgen. Sie führt mich durch das B&B hindurch, zur Hintertür wieder nach draußen und auf ein kleines Haus am Ende eines wilden Gartens zu. Ich schenke den bunten Blumen in den Pflanzkübeln links und rechts neben der Tür meine volle Aufmerksamkeit, während ich versuche, mich zusammenzuhalten.
Seit die Panikattacken begonnen haben, fürchte ich mich vor ziemlich allem, was mich aus meiner Komfortzone holt. Ein Umzug wie dieser in eine unbekannte Zukunft gehört dazu. Manchmal ist es, wie auf Glas zu wandeln, nur ein falscher Schritt und ich breche ein und falle. In den letzten Wochen bin ich aus Angst vor der Angst schon kaum mehr aus dem Haus gegangen.
Genau deswegen fand Anny es gut, dass ich für eine Weile wegziehe und mich selbst herausfordere, damit ich aufhöre, mich vor allem und jedem zu fürchten, von dem ich glaube, dass es eine Attacke auslösen könnte. Das muss jetzt vorbei sein. Ich will kämpfen. Ich will wieder leben. Und das kann ich nur, wenn ich die Komfortzone verlasse.
Meg öffnet ein kleines Vogelhäuschen, das neben der hellblauen Tür an der Wand hängt, und holt einen Schlüssel hervor. »Es ist das Zimmer oben rechts vom Bad. Das andere ist das deiner Großmutter.«
Ich nicke stumm und nehme den Schlüssel entgegen, nachdem Meg die Tür aufgeschlossen hat.
»Ich sag Will, er soll deinen Koffer unten ins Wohnzimmer stellen, dann kannst du dich erst mal ausruhen.« Sie geht an mir vorbei zurück auf den kleinen Weg aus weißen Pflastersteinen, der von diesem Haus zum B&B führt. »Das mit deiner Mutter tut mir leid.« Mit einem Nicken wendet sie sich ab und lässt mich allein.
Ich betrete das Haus, schließe die Tür hinter mir und lasse los. Mein Puls explodiert, meine Atmung stockt und alle Muskeln in meinem Körper beginnen unkontrolliert zu zittern. Ich lasse mich an der Tür nach unten gleiten und breche in Tränen aus. »Nicht ohnmächtig werden. Nicht die Kontrolle verlieren. Nicht sterben«, bete ich runter und höre das Trommeln meines Herzens so laut, dass ich meine eigenen Worte nicht verstehen kann. Einatmen. Ausatmen.
2. Kapitel
Dylan
Sanft, aber mit Nachdruck schiebe ich Judy von meinem Schoß. »Heute nicht mehr«, sage ich zu ihr und ignoriere ihren Schmollmund. Ich kenne Judy jetzt schon seit Jahren, hin und wieder haben wir beide mal etwas miteinander, aber es ist nichts Ernstes. Heute lief mal wieder was. Hier im Auto vor dem Haus ihrer Eltern, die zufälligerweise mit meinen befreundet sind. Manchmal frage ich mich, aus welchem Grund ich mich mehr mit Judy abgebe: Weil es meinem Vater gefallen würde oder weil es ihm nicht gefallen würde, wenn er davon wüsste.
Zum einen ist Judys Familie sehr einflussreich in Boston, wenn ich es also ernst mit ihr meinen würde, wäre mein Vater sehr glücklich und würde darauf hoffen, dass ihm eine Beziehung zwischen mir und der Tochter des stellvertretenden Bürgermeisters von Boston Vorteile verschaffen würde. Zum anderen, wenn ich es nicht ernst mit Judy meinen und so ihren Vater verärgern würde, hätte das wiederum negative Folgen für die Ambitionen meines Vaters. Er würde es also hassen, mich mit ihr zu sehen. Ich glaube, Letzteres ist der eigentliche Grund, warum ich mich mit ihr abgebe. Aber im Grunde ist Judy nur eine weitere Manifestation für den Zwiespalt, in dem ich mich seit einiger Zeit befinde.
Ich fühle mich von dem Erbe eingeengt, das ich gezwungen bin, anzutreten, sobald mein Vater sich offiziell von seinem Posten als CEO von Malone Constructions zurückziehen wird. Malone gehört zu den größten und mächtigsten Bauunternehmen der USA. Und wenn mein Vater die Leitung abgibt, werde ich in seine Fußstapfen treten. Dieser Weg war für mich mein ganzes Leben lang vorbestimmt und ich habe ihn als meine Pflicht angesehen und diese Pflicht akzeptiert, weil es seit fünf Generationen in unserer Familie so gemacht wird. Vom Vater zum Sohn. Aber jetzt, wo ich mein Studium an der Columbia abgeschlossen habe und nach dem Sommer voll in das Familiengeschäft einsteigen werde, werden meine Zweifel immer größer. Malone Construction ist nicht nur eine der größten Baufirmen in den USA, sondern auch sehr vielseitig. Wir haben schon Hochhäuser in New York und Hotels in Las Vegas gebaut. In den letzten zehn Jahren bauten wir sogar weltweit. Wie lange kann ich es an der Seite meines Vaters aushalten, ohne zu enden wie meine Mutter?
»Nun verschwinde schon«, sage ich zu Judy, die sich durch ihre blonde Mähne fährt und mit spitzen Fingern nach ihrem Unterhöschen fischt, das im Fußraum des Wagens liegt. Sie macht sich nicht erst die Mühe, es wieder anzuziehen. Auch ihre High Heels zieht sie nicht wieder an, aber sie zerrt ihr enges Kleid über die Hüften nach unten bis auf ihre Oberschenkel, bevor sie schnaubend aussteigt.
»Es hätte mich nicht gestört, wenn wir es heute noch mal getan hätten«, sagt sie. »Ich kann nicht genug davon bekommen. Du weißt, dass ich scharf darauf bin, wenn ich betrunken bin.«
Ich lache. »Und genau deswegen gehst du jetzt lieber nach Hause. Ich muss auch nach Hause«, sage ich. »Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder.«
»Ist das ein Versprechen?«, will sie wissen. Genau in der Sekunde, in der mir mein Fehler selbst auffällt.
Ich verdrehe über meine Dummheit die Augen. Natürlich wollte ich ihr keine falschen Hoffnungen machen. »Ist es nicht. Es ist nur ein: Wir sehen uns«, stelle ich klar.
»Ja, du mich auch«, entgegnet sie und stolpert über ihre eigenen Füße, als sie auf das große Herrenhaus mit den roten Ziegeln zuwankt.
Ich lenke den Tesla auf die Straße zurück und fahre die zweihundert Meter bis zur nächsten Auffahrt weiter. Als ich unseren Familiensitz zwischen den Bäumen auftauchen sehe, verkrampft sich jeder Muskel in meinem Körper. So fühlt es sich immer an, wenn ich nach Hause komme. Ich ertrage die Stimmung in diesem Gefängnis nicht mehr. Meine Mutter, die ständig in ihrem Unglück versinkt, und meinen Vater, der von allen nur fordert, aber nicht in der Lage ist, auch zurückzugeben.
Ich starre auf die beleuchteten Fenster und hoffe, dass ich es schaffe, mich am Büro meines Vaters vorbeizuschleichen. Auf eine weitere Diskussion mit ihm kann ich heute gut und gerne verzichten. Seit Wochen liegt er mir wegen der Sommerferien in den Ohren. Am liebsten hätte er es, wenn ich dieses Jahr auf meinen Urlaub auf Block Island verzichten und stattdessen mehr Zeit in die Firma investieren würde. Ich zerreiße mich seit vier Jahren zwischen Malone Construction und dem Studium. Reicht ihm das nicht? Er weiß doch genau, dass ich meiner Pflicht nachkommen und die Firma in seinem und Großvaters Sinne weiterführen werde.
Es ist nicht so, dass ich nicht auf den Thron des Familienimperiums will, wie mein Vater es immer nennt. Oh, ich will. Ich habe hart dafür gearbeitet und ich habe keine Lust, mir das von Daniel wegnehmen zu lassen, nur weil mein Vater ihn für besser als mich hält. Ich bin der Älteste, ich bin sein Sohn, ich bin der verdammte Erbe. Aber ich will auch nicht, dass die Firma zu meinem einzigen Lebensinhalt wird und nichts anderes mehr für mich zählt. Ich will nicht wie mein Vater werden und den Blick auf alles andere verlieren.
Ich betrete das, was ich als „Protzpalast“ bezeichne. Mit fast fünfzehn Zimmern, zehn Bädern, einem Tanzsaal für die prachtvollen Spendengalas des Malone-Clans und einem Wintergarten, der fast so groß wie das Hauptgebäude ist, ist der Hauptwohnsitz der Malones die größte Villa in Boston. Es ist ein Mausoleum, in dem ich mich begraben fühle, weswegen ich es hasse, hier wieder wohnen zu müssen. In New York habe ich absichtlich in einem Verbindungshaus gewohnt, um endlich mehr von einem normalen Leben mitbekommen zu können. Ich wollte herausfinden, wie es sich anfühlt, ein normaler Mensch zu sein. So weit normal für jemanden wie mich möglich ist.
Ich öffne die breite Haustür so leise, wie es geht, und schließe sie auch wieder, ohne das geringste Geräusch zu machen. Die Stille im Haus ist erdrückend. Das ist sie immer. Außerdem herrscht eine allgegenwärtige Kälte, die nicht von den Außentemperaturen im sommerlichen Boston stammt, sondern von der frostigen Stimmung im Haus.
Die Bürotür meines Vaters steht offen, das tut sie immer, weil es für ihn ein Unding wäre, wenn er etwas, das sich in seinem Haus tut, verpassen würde. Ein Gespräch nicht mitbekommen würde. Er muss ständig über alle Vorgänge informiert sein. Wenn er könnte, würde er mich verwanzen. Er ist ein Kontrollfreak, der alles im Blick haben muss. Selbst die unwichtigsten Vorgänge innerhalb seiner Familie, es könnte sich ja jemand gegen ihn wenden oder einen Fehler begehen, der dem Ansehen der Familie schadet. Er hasst nichts mehr als schlechte Presse oder einen befleckten Familienruf.
Seine Sucht nach Kontrolle wirkt sich auf uns alle aus. Nur nicht auf meine Schwester Liz, die erst seit ein paar Monaten wieder zurück in den USA ist. Die letzten Jahre hat sie zuerst eine Privatschule in London besucht und anschließend ist sie nach Cambridge gegangen. Sie hat sich in dieser Zeit verändert. Zwischen uns befindet sich ein Graben, den es früher nicht gab. Sie ist distanziert, wahnsinnig fokussiert und verbringt mehr Zeit in der Firma als mein Vater selbst. Sie hatte das Privileg, nicht in dieser Gruft aufwachsen zu müssen. Und auf ihr lastet nicht der Druck, der auf jedem männlichen Nachkommen der Malones lastet. Ihr Leben ist nicht vorbestimmt. Und trotzdem ist sie unzufrieden.
Ich schleiche mich an dem Büro vorbei in die Bibliothek, aus der leise Jazzklänge zu hören sind. Für meine Mutter ist die Bibliothek wie ein Rettungsanker, ein Ort, an dem sie sich versteckt, wenn sie meinen Vater nicht mehr ertragen kann und wenn sie der Bar darin möglichst nahe sein möchte. Was in etwa jeden Tag ist.
Leise stoße ich die angelehnte Tür etwas weiter auf. Ich höre sie schon weinen, bevor ich den Raum überhaupt betreten habe. Ihr leises Wimmern wird zu einem herzzerreißenden Schluchzen, als sie mich in der Tür stehen sieht. Sie wischt sich hektisch die dunkelbraunen Strähnen aus dem Gesicht und sieht mich aus rotgeränderten Augen an. Manchmal weiß ich nicht, warum ihre Augen rot sind, kommt es vom Alkohol oder der Heulerei? Heute scheint es eine Mischung aus beidem zu sein. Meine Mutter ist eigentlich eine attraktive Frau, zumindest kann sie das sein, wenn sie sich nicht gehen lässt.
»Wenn du hin und wieder auch mal das Haus verlassen würdest, ginge es dir besser«, sage ich leise und trete wenige Schritte auf sie zu.
Sie sitzt in einem der dunkelbraunen Chesterfieldsessel vor dem Kamin, vor dem ich manchmal ganz gerne im Winter sitze und in die Flammen starre, um meinen Gedanken nachzuhängen und einfach mal nicht an die Firma denken zu müssen. Heute ist der Kamin kalt. Aber meine Mutter braucht kein Kaminfeuer, um der Kälte in ihrer Ehe zu entfliehen, Bourbon funktioniert auch ganz gut. In letzter Zeit immer besser.
Manchmal wünschte ich, ich könnte einfach gehen. Alles hinter mir lassen. So wie Liz, als sie nach London gegangen ist. Aber für meinen Vater kommt das nicht infrage, weil ich als sein Nachfolger immer bereit sein muss. Ich muss neben ihm stehen und zusammen mit ihm eine Einheit bilden, gegen die niemand sich zu stellen wagt. Ein Bild von einer erfolgreichen amerikanischen Katalogfamilie. Dabei sind wir nur eine schlechte Imitation des Kennedy-Clans.
Meine Mutter sieht mich an und bricht plötzlich in Gelächter aus. »Als ob das irgendwas ändern würde.« Ihre Zunge ist schwer, als sie spricht, weswegen die Worte nur undeutlich über ihre Lippen kommen.
Ich ziehe abfällig eine Braue hoch. »Du würdest mal aus deinem Kopf kommen, weg von ihm.«
Die Hände meiner Mutter zittern, als sie sie in ihr wirres Haar schiebt. Heute scheint einer ihrer ganz üblen Tage zu sein. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal das Haus verlassen hat. Es muss Monate her sein. Früher war sie oft und viel mit uns unterwegs. Aber ihre Fröhlichkeit ist mit jedem Ehejahr mehr und mehr verschwunden. Manchmal hasse ich sie, weil sie zugelassen hat, dass diese verlorene Frau aus ihr geworden ist. Und manchmal habe ich Angst um sie, weil ich befürchte, dass die Depression irgendwann gewinnt und wir sie vollkommen verlieren werden.
Meine Mutter schüttelt den Kopf und schluchzt auf. »Er hat sie verjagt«, sagt sie heiser und starrt in den schwarzen Rachen des Kamins. »Er nimmt sie mir ständig weg.«
»Wen verjagt?«, will ich verwirrt wissen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, aber in meiner Brust breitet sich ein dumpfes Gefühl aus. Sie redet doch hoffentlich nicht von Nancy, Mutters Therapeutin.
»Liz. Sie hat ihre Sachen gepackt und ist einfach gegangen. Dabei habe ich sie doch gerade erst zurückbekommen.« Meine Mutter greift nach dem Glas Bourbon, das neben ihr auf einem Beistelltisch steht, und kippt die gold-braune Flüssigkeit in einem Zug runter, dann lässt sie die Hand mit dem Glas in ihren Schoß sinken und lacht leise. »Sie ist einfach zur Tür rausgegangen.«
Ich beobachte diese Bewegung und sie erscheint mir wie in Zeitlupe, während ich versuche, ihre Worte zu erfassen. »Liz ist gegangen?«, frage ich durcheinander und verstehe nicht, was daran so schlimm sein soll.
Unser Vater interessiert sich kaum für Liz, das war schon immer so. Liz ist nur seine Tochter. Aber ich bin der Prinz, zukünftiger Herrscher seines Imperiums. Während Liz ihr Leben frei von Pflichten und ständigem Druck leben konnte, war ich hier. In meinem Leben gab es nur die Firma, die Familienehre, Befehle meines Vaters und die Presse, die mich manchmal verfolgt, als wäre ich der Sohn des Präsidenten. Mein Leben findet fast komplett in der Öffentlichkeit statt. Jedes Bier, das ich auf einer Party trinke, jede Frau, die ich küsse, jeder Anzug, den ich trage, alles wird dokumentiert und in den Klatschspalten fein säuberlich analysiert. Vor alldem war Liz in England immer bewahrt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob den meisten bewusst ist, dass ich eine Schwester habe.
Meine Mutter lacht wieder und wirkt ein wenig, als hätte sie ihren Verstand verloren. Sie hebt das Glas wieder an und deutet mit dem Zeigefinger auf mich. »Du hättest sie aufhalten können. Und wie immer warst du nicht da«, wirft sie mir vor und lässt die Tränen ungehemmt laufen.
»Wo ist Daniel?«, frage ich sie. Daniel, zweiundzwanzig Jahre alt, zwei Jahre jünger als ich, und obwohl er nicht der leibliche Sohn meines Vaters ist, ist er in seinen Augen perfekt. Was ich nicht bin, egal, wie sehr ich mich anstrenge.
»In New York.«
Ich fahre mir über das Kinn und ziehe mein Handy aus der Jeans. Ich verstehe noch immer nicht, warum Nathalie so ein Drama macht. Aber wenn sie so drauf ist, dann schrillen meine inneren Alarmglocken, also ist es am besten, ich tu etwas, bevor unsere Mutter wieder etwas anstellt, das sich dann in meinem Gehirn festsaugt und in meinen Albträumen lebendig wird.
Wo bist du?, tippe ich und schicke die Nachricht an Liz.
Die Nachricht kommt an, die Häkchen werden blau, aber sie antwortet nicht. Was mir noch immer keine Sorgen macht. Liz und ich haben kaum Kontakt, ich weiß nicht, wann ich ihr das letzte Mal eine Nachricht geschrieben habe, also warum sollte sie mir antworten? Als wir Kinder waren, war das anders. Aber seit sie nach England gegangen ist, hat sich zwischen uns alles geändert.
»Was ist passiert?«, frage ich Nathalie.
»Na das, was immer passiert. Das, was jeden Tag passiert. Er«, lallt sie und deutet mit der Hand auf die Wand, hinter der sich auf der anderen Seite das Büro meines Vaters befindet.
Ich seufze schwer auf. »Was hat ihr wieder nicht gepasst?« Seit Liz wieder zurück ist, ist sie wie einer dieser kleinen bissigen Hunde mit den großen runden Augen. Ein falsches Wort durch unseren Vater und sie verbeißt sich regelrecht in ihm. Die meiste Zeit gehe ich dieser toxischen Stimmung aus dem Weg. Ich habe genug Sorgen mit Nathalie.
Meine Mutter schenkt sich schluchzend nach. »Dieses Haus, die Familie, er«, sagt sie. Sie nennt ihren Ehemann seit einer Weile nur noch »er« und nicht mehr bei seinem Namen.
»Er heißt John«, stoße ich aus, blicke auf mein Handy und entscheide mich, Liz anzurufen. Nathalie sieht so fertig aus wie schon lange nicht mehr und das macht mich ziemlich nervös. Das Freizeichen ertönt, dann werde ich weggedrückt. Aber das überrascht mich nicht. Schließlich bin ich derjenige, der ihr aus dem Weg geht und eigentlich nur noch wütend auf sie ist, weil sie ständig Ärger macht. Und Ärger ist gar nicht gut für Nathalie. Und was nicht gut für unsere Mutter ist, versetzt mich in Panik. Und ich weiß dann nicht, ob ich weglaufen oder ihr nicht von der Seite weichen soll. Das sind diese Augenblicke, die die Bilder in meinem Kopf wieder lebendig werden lassen. Und das kann ich nicht aushalten. Also laufe ich die meiste Zeit weg. Oder tue alles, was ich tun kann, um es für Nathalie erträglicher zu machen.
Liz und ich waren mal unzertrennlich. Wie echte Zwillinge eben. Liz war meine beste Freundin. Sie wusste alles über mich. Ich wusste alles über sie. Es gab keine Geheimnisse zwischen uns. Und dann ist Nathalie passiert und jeder von uns beiden ist anders mit der Sache umgegangen. Nach den Schuldzuweisungen und all dem Schmerz, den wir beide voreinander und vor unseren Therapeuten ausgekotzt haben, sind wir unterschiedliche Wege gegangen. Sie ging nach England und ich war noch immer hier. Und ich war allein mit Dad, Daniel und mit Nathalie.
»Sie kommt bestimmt gleich zurück. Gib ihr ein paar Minuten«, stelle ich gleichgültig fest.
Meine Mutter schüttelt den Kopf und wirft das Glas in einer unerwarteten Bewegung nach vorne. Ich weiß nicht, ob sie mich treffen wollte, aber das Glas fliegt nur haarscharf an meiner Schulter vorbei und zerbricht klirrend an dem Regal hinter mir. Die Scherben und auch der Bourbon gehen zu Boden und verteilen sich auf dem Hartholzparkett. »Du hörst mir nicht zu, wenn ich mit dir rede. Genau wie dein Vater. Sie hat ihre Koffer gepackt. K.O.F.F.E.R«, buchstabiert Nathalie und schüttelt ihren Kopf, bis ihre Haare noch wilder aussehen. »Koffer«, stößt sie lachend aus.
»Was ist hier los?« Die dunkle, fast schon brutale Stimme meines Vaters lässt mich zusammenzucken. Ich drehe mich um und er steht im Türrahmen und betrachtet zuerst mit gerunzelter Stirn das zerbrochene Glas und dann abfällig seine Ehefrau. »Du bist widerwärtig«, stößt er aus. »Reiß dich gefälligst zusammen. Du siehst ja völlig fertig aus.«
Ich sehe John Malone wütend an. Ich bin nicht schockiert, weil ich ihn nicht zum ersten Mal so mit seiner Frau sprechen höre. Eigentlich sprechen die beiden kaum noch miteinander, außer so, oder wenn es darum geht, dass meine Mutter eine seiner Partys organisieren oder sich als die perfekte Ehefrau auf einer öffentlichen Veranstaltung präsentieren soll.
»Sprich nicht so mit ihr«, stelle ich ernst klar und schiebe mich schützend zwischen sie und ihn. Es ist nicht so, dass John Nathalie je körperlich angegriffen hat, die meiste Zeit ignorieren sie einander, aber er verhält sich ihr gegenüber wie ein Arschloch. Es ist keine Entschuldigung, aber ich glaube, er kommt nicht damit klar, dass seine Frau krank ist, und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Ich weiß es auch nicht, aber ich versuche es zumindest.
Der Blick meines Vaters zuckt zu mir und gleitet musternd über mich. Seine Stirn legt sich in Falten, als er bemerkt, dass meine Kleidung zerknittert ist. »Schön, dass du auch mal wieder zu Hause bist.«
Ich verziehe das Gesicht. »Wie jeden Abend.«
»Du kannst froh sein, dass ich dich nicht aus dem Knast holen musste«, brüllt er mich an. »Saufen, in dein Auto steigen und dich dabei von den Paparazzi fotografieren lassen. Idiot!«
»Berichten sie wieder über deinen nichtsnutzigen Sohn? Gratuliere«, sage ich und gebe mir keine Mühe, zu verbergen, wie egal es mir ist, was die Medien und das halbe Internet über mich berichten. Ich habe ein Recht darauf, zu leben, jung zu sein und Dinge zu tun, die niemand bei anderen in meinem Alter hinterfragen würde. Wenn ich nicht hin und wieder mal ausbrechen kann, dann ersticke ich. Ich tue alles für die Firma und die Familie, aber ich werde nicht aufhören, Spaß zu haben, weil ich sonst wie meine Mutter unter dem Druck zerbreche.
»Du reißt dich gefälligst zusammen. Du bist eine Schande für diese Familie.«
»Wer nicht?«, gebe ich zurück.
Meine Mutter steht auf, das Gesicht völlig verheult, kniet sie sich mit zuckenden Schultern auf den Boden und beginnt, die Scherben einzusammeln. Ich hocke mich neben sie und halte sie auf, bevor sie sich verletzen kann. »Lass mich das machen«, sage ich zu ihr und beachte das verächtliche Geräusch nicht, das mein Vater ausstößt.
»Wie wäre es, wenn du noch ein paar von deinen Pillen einwirfst, Nathalie, und dich ins Bett legst, einfach um uns von deiner Gegenwart zu verschonen.«
Ich zucke heftig zusammen und balle meine Hand zur Faust. Ich würde sie ihm am liebsten in den Magen rammen, für das, was er eben gesagt hat. Aber stattdessen halte ich mich zurück, um die Stimmung nicht noch mehr aufzuheizen.
»Hör endlich auf!« Ich sammle die letzten Scherben auf und werfe sie in den Papierkorb neben dem Schreibtisch aus massiver Eiche. Ich drehe mich zu ihm um und sein Blick wird versöhnlicher.
»Du bist der nächste CEO von Malone Constructions Company. Du solltest dich auch so benehmen.«
»Noch bin ich nichts weiter als dein Assistent. Ich habe keinerlei Verantwortung, außer der, dir alles mundgerecht zu machen.« Ich schüttle den Kopf. Ich habe keine Lust, dieses Thema schon wieder durchzukauen. Zwar gebe ich mein Bestes, beweise mich ständig, aber entscheiden darf ich nichts, ich soll nur funktionieren und gut neben ihm aussehen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche nur noch einen Schritt mehr und dann überquere ich diese unsichtbare Grenze und alles, was von mir dann noch bleibt, ist nicht mehr als das ausgezehrte Häufchen, das mein Vater aus meiner Mutter gemacht hat.
»Was ist mit Liz?«, frage ich ihn unvermittelt. »Musstest du dich wieder mit ihr streiten?«
»Genau? Musstest du?«, will meine Mutter wissen und torkelt gefährlich, als sie vom Boden aufsteht. Ich helfe ihr auf und halte sie fest, bis sie steht.
Mein Vater winkt nur ab. »Sie ruiniert einfach alles.«
»Ja, so wie wir alle«, sage ich leise und schiebe mich an ihm vorbei aus dem Raum. Ich halte es nicht länger mit meinen Eltern aus. Ich ertrage es nicht, meine Mutter so zu sehen. Und ich ertrage diese Selbstgefälligkeit meines Vaters nicht länger.
Während ich die breite Freitreppe nach oben nehme, wähle ich noch einmal die Nummer meiner Schwester.
Sie nimmt nicht ab, aber es läutet, bis die Mailbox anspringt. Ich überlege eine Sekunde lang, etwas draufzusprechen, aber was soll ich ihr sagen? Ich lege auf und bleibe vor ihrer Zimmertür stehen. Ich war auch schon eine Ewigkeit nicht mehr in diesem Zimmer. Als wir klein waren, haben wir jede Nacht zusammen in ihrem Bett geschlafen, weil sie in der Dunkelheit Angst hatte.
Ich klopfe an die Tür, nur für den Fall, dass sie doch zu Hause ist und schläft und Nathalie sich einfach nur geirrt hat. Als Liz nicht antwortet, versuche ich es noch einmal, erst dann trete ich ein. Es ist stockdunkel. Ich knipse das Licht an und zuerst fällt mir ihr Bett auf. Auf der schwarzen Bettwäsche liegt Kleidung, an der Wand daneben hängt eine E-Gitarre, zwei weitere stehen in einem Ständer, daneben ein Verstärker. Früher hat sie Gitarre gespielt, ich weiß gar nicht, ob sie das noch tut. Sie war zwölf, als sie nach England gegangen ist. Ich hab ihr aus den Büchern vorgelesen, die ich aus der Bibliothek hatte, und sie saß neben mir und hat auf der Gitarre gespielt und stundenlang die komplizierten Griffe geübt.
Ich trete ein und schaue mich weiter um. Im Buchregal stehen Wirtschaftsbücher, ein paar davon kenne ich von meinem eigenen Studium, andere sagen mir nichts.
»Holst du sie zurück?«
Ich drehe mich zu Nathalie um und fühle wieder diese Mischung aus Enttäuschung und Sorge, als ich sehe, dass sie sich abstützen muss, um sich auf den Beinen zu halten. Mein Blick fällt auf die Kleidung, die Liz auf dem Bett zurückgelassen hat, den offen stehenden Kleiderschrank und einen vereinsamten Gitarrenständer neben ihrem Schreibtisch. Offensichtlich hat sie auch die Gitarre, die dort reingehört, mitgenommen.
Ich deute auf das Foto, das auf dem Schreibtisch steht. Es zeigt Liz, Daniel und mich kurz nachdem Daniel bei uns eingezogen und Teil unserer Familie geworden ist. Das ist jetzt acht Jahre her. »Ich versuche es bei ihm«, schlage ich vor. Wenn jemand von uns geschäftlich in New York ist, wohnen wir für die Zeit in unserem Penthouse, das sich über den Büros unserer Vertretung in New York befindet.
Meine Mutter schluchzt auf. »Sie ist nicht bei ihm.«
»Woher weißt du das?«, hake ich nach und trete an den Schreibtisch, ohne mich nach meiner Mutter umzusehen. Ich nehme das Foto daneben hoch, es zeigt Liz und mich, als wir vierzehn Jahre alt waren. Wir sitzen vor dem Ferienhaus auf Block Island, das John gekauft hat, als wir noch Kinder waren. Damals haben wir die Sommer noch als Familie verbracht.
»Sie kann ihn im Moment nicht besonders gut leiden.«
Ich sehe meine Mutter verwundert an. »Ich hatte keine Ahnung.«
Sie lacht leise auf. »Ja, woher auch? Du bist ja kaum noch zu Hause«, wirft sie mir vor. Sie will mich damit verletzen, das sehe ich an ihrem stechenden Blick. Ihre Bemerkung trifft mich, ich mache kaum noch was anderes, als in der Firma zu arbeiten, um John zu entlasten, der sich nicht entlasten lassen will.
Ich betrachte das Haus im Hintergrund auf dem Foto. Die Wochen in diesem Haus waren die schönsten meines Lebens. Hier waren wir noch eine Familie. John hat zumindest versucht, die Besuche wie einen Urlaub für uns wirken zu lassen, auch wenn es ihm nur darum ging, vielleicht irgendwann die ganze Insel in ein Luxusresort für Reiche zu verwandeln. Ich bin froh, dass aus den Plänen nichts geworden ist, das hätte Block Island kaputtgemacht. In den letzten Jahren war ich nur noch allein dort. Meine Sommer wollte ich mir nicht nehmen lassen. Dieses Jahr wäre mein erster Sommer ohne Ferien gewesen.
Sie nimmt das Foto und betrachtet es. »Es war dort für ein paar Sommer schön.«
»Das ist es noch immer. Du kannst nur nicht mehr hin, weil du so drauf bist.«
»Wie bin ich denn drauf?« Sie klingt zornig und verleiht ihrer Wut Ausdruck, indem sie versucht, mich zu schubsen, aber weil sie zu betrunken ist, kippt sie nach hinten und landet mit dem Hintern auf dem Boden vor dem Bett meiner Schwester.
»So«, antworte ich vorwurfsvoll. In dem Augenblick kündigt mein Handy eine Nachricht an. »Von Liz«, sage ich zu meiner Mutter. »Sie ist auf der Insel und wir sollen sie gefälligst in Ruhe lassen, sonst verschwindet sie irgendwohin, wo wir sie nicht finden werden.«
»Du musst hingehen und dich um sie kümmern.«
»Liz ist erwachsen«, entgegne ich wirsch und runzle die Stirn. »Und ich kann hier nicht weg.«
»Ja, ist sie. Trotzdem wirst du auf diese verdammte Insel gehen und nachsehen, wie es ihr geht. Und dann holst du mir mein Baby zurück.« Ihre Stimme zittert, ihre Hände zittern, und ihr Gesicht wird ganz blass.
»Liz kommt allein klar, du offensichtlich nicht.«
Sie seufzt, über ihre Wangen rollen wieder Tränen. Sie windet sich regelrecht und sieht flehend von unten zu mir herauf. »Ich geh in diese beschissene Klinik und mache einen Entzug, wenn du Liz nach Hause holst.«
Ich ziehe erstaunt eine Braue hoch. Nathalie wehrt sich seit über einem Jahr, wieder in die Klinik zu gehen. Ihr plötzlicher Meinungswechsel leuchtet wie ein rotes Alarmsignal vor mir auf und lässt mich erstarren. Wenn sie mir diesen Deal anbietet, dann ist es ihr verdammt wichtig, dass ich Liz zurückbringe. Und das könnte ich benutzen.
»Was ist hier wirklich passiert? Worum geht es bei all dem Mist?« Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte etwas verpasst. Und das fühlt sich beängstigend an.
»Rede mit Liz.«
»Mach ich, nachdem ich deine Therapeutin angerufen habe und sie für dich einen Termin ausmacht.«
»Versprichst du es? Ich will sie nicht schon wieder verlieren.«
Ich ziehe eine Braue hoch und nicke zustimmend. Nathalie ist so. Sie klammert, deswegen erschrickt es mich nicht, dass es ihr so wichtig ist, Liz wieder in ihrer Nähe zu wissen. Aber dass sie solche Angst hat, dass sie sich freiwillig einweisen lassen möchte, das ist erschreckend. »Versprochen.«
3. Kapitel
Avery