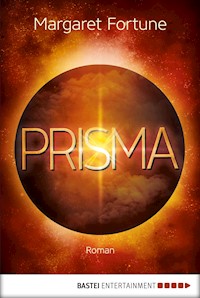9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Krieg der Schatten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Lia wurde nur für einen Zweck kreiert: um die New Sol Raumstation in die Luft zu jagen. Sie ist eine genetisch gezüchtete Bombe. Es gelingt ihr, die Station zu erreichen, aber ihre Mission scheitert, als ihr interner Countdown eine Fehlfunktion hat und bei *00:02:33* stehen bleibt. Ohne Plan B und nur mit der gestohlenen Identität einer Toten ausgestattet, weiß Lia nicht, was sie tun soll. Gibt es eine Möglichkeit, den Countdown wieder in Gang zu bringen? Und will sie das überhaupt?
"Es wird glorreich sein. Das sagen sie zumindest. Natürlich habe ich es nie selbst erlebt. Noch nicht. Ich werfe einen Seitenblick zu Michael hinüber. Es ist schade, dass er nie fühlen wird, was ich fühlen werde, nie sehen wird, was ich sehen werde, nie erleben wird, was ich erleben werde. Diese Ehrfurcht erweckende Kraft, wenn man zur Nova wird."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
Oberer Habitatring – fünf Minuten zuvor
Dank
Über die Autorin
Margaret Fortune schrieb ihre erste Geschichte mit sechs Jahren, seitdem ist das Schreiben ihre absolute Leidenschaft. Sie hat bereits diverse Kurzgeschichten in Magazinen veröffentlicht, darunter im NEO-OPSIS SCIENCE FICTION MAGAZINE und im SPACE AND TIME MAGAZINE. NEW SOL ist ihr Debütroman. Die Autorin lebt in Wisconsin.
Margaret Fortune
NEW SOL
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Kerstin Fricke
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Margaret FortuneTitel der amerikanischen Originalausgabe: »Nova«Originalverlag: DAW Books IncBy arrangement with DAW Books, New York
Dieses Werk wurde vermittelt durch Interpill Media GmbH, Hamburg
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Michelle Gyo, Limburg an der LahnTitelillustration: © Anke Koopmann, MünchenUmschlaggestaltung: Guter Punkt, MünchenE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3044-1
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für meine Familie – Mom, Dad & Wendy.Danke, dass ihr immer an mich geglaubt habt, selbst wenn mir Zweifel kamen.
1
Mein Name ist Lia Johansen, und ich war eine Kriegsgefangene. Ich geriet in Gefangenschaft, als die Aurora-Kolonie erobert wurde, und lebte fast zwei Jahre lang mit zehntausend anderen Zivilkolonisten in einem Internierungslager. Meine Eltern sind vor meinen Augen an Entkräftung und Krankheiten gestorben. Und ich habe um sie geweint.
Oder nicht?
Meine Erinnerungen sind meist sehr verschwommen, zusammenhangslos und bruchstückhaft, sie treiben davon, wann immer ich sie fassen will, und lassen meinen Kopf leer und ausgebrannt zurück. Momentan versuche ich vor allem, mir meinen Namen zu merken und meine Geschichte immer wieder durchzugehen, so wie sie es mir beigebracht haben.
Mein Name ist Lia Johansen, und ich war eine Kriegsgefangene …
Bis heute.
Ich stehe am Aussichtsfenster auf dem Vordeck der Xenia Anneli und sehe zu, wie die New-Sol-Raumstation langsam vor uns auftaucht. Sie ist sogar noch größer, als ich sie mir vorgestellt habe, mit zwei konzentrischen Ringen, die durch Streben mit einem kreiselförmigen zentralen Kern verbunden sind. Die Station dreht sich auch wie ein Kreisel, und die Lichter blinken wie eine bunte Weihnachtsbaumbeleuchtung. Es sieht wirklich großartig aus.
Großartig … und furchterregend.
Ich strecke eine Hand aus, berühre das Fenster und fahre mit dem Zeigefinger langsam den gewundenen oberen Ring nach und die Oberseite des inneren Kerns. Man hat mir gesagt, dass mich dort die Freiheit erwartet. Es ist mein erster Schritt in ein neues Leben, nachdem ein Waffenstillstand mit der Tellurianischen Allianz geschlossen wurde und man uns Gefangene freigelassen hat. Aber wie soll ich ein neues Leben anfangen, wenn ich mich kaum an mein altes erinnere?
Ein lautes Zischen lässt mich zusammenzucken, und ich ziehe erschrocken die Hand zurück, bevor ich begreife, dass es nur eine der Schubdüsen des Schiffes gewesen ist, die uns auf eine Lücke zwischen den Ringen zusteuert. Ich sehe mich um und schäme mich ein bisschen für meine Reaktion, aber andererseits habe ich allen Grund, nervös zu sein. Wir waren erst eine Woche unterwegs gewesen, als eine Tür mit defekter Steuerung mir einen bösen Stromschlag verpasst hat. Ich bin nicht schwer verletzt worden – eigentlich nur eine Verbrennung an der Fingerspitze –, aber der Stromstoß war trotzdem so stark gewesen, dass ich kurz das Bewusstsein verloren habe. Zwar kam ich nach wenigen Sekunden wieder zu mir, war aber die darauffolgenden anderthalb Tage leicht benommen und stand irgendwie neben mir. Diese Erfahrung möchte ich nicht so schnell noch einmal machen.
Wieder trete ich vor die Aussichtsluke, achte jetzt jedoch darauf, nichts anzufassen. Wir fliegen gerade zwischen den Ringen hindurch, und ich kann die Andockrampen direkt vor uns sehen, die sich in der Mitte des zentralen Kerns der Station befinden. Das Schiff dreht sich langsam, um sich entsprechend auszurichten, und auf einmal kann ich zwischen den Ringen hindurch einen langen Streifen schwarzen Weltalls erkennen, der mit Sternen übersät ist.
Diesen Anblick habe ich in den letzten drei Wochen immer vor mir gesehen, seitdem der Transporter die Tiersten-Internierungskolonie verlassen hat. Viele der anderen ehemaligen Gefangenen waren ihn rasch leid geworden und hatten sich lieber darüber unterhalten, wie ihr Leben wohl aussehen würde, sobald wir die Station endlich erreicht haben und wieder in den Sternenbund aufgenommen worden wären, doch ich war am Fenster geblieben und hatte hinausgesehen. Gut, normalerweise stand ich auf dem Achterdeck und blickte zurück, als gäbe es da etwas auf Tiersten, das ich einfach nicht loslassen kann. Dummerweise habe ich nicht die geringste Ahnung, was das sein könnte.
Das Schiff bebt, als wir andocken, und das aufgeregte Schnattern der Passagiere wird noch lauter, obwohl uns der Captain per Durchsage bittet, ruhig zu bleiben, bis die Offiziere an Bord gekommen sind und uns aussteigen lassen. Aber ich kann es ihnen nicht verdenken, viele von ihnen sind weitaus länger in Gefangenschaft gewesen als ich. Sie haben Familien, die auf sie warten, ein Heim, in das sie zurückkehren können. Nicht, dass viele von ihnen auf New Sol zu Hause sind. Es ist nur eine Raumstation, ein Sprungbrett in den Sternenbund. Hier werden viele von ihnen in andere Schiffe umsteigen und in alle Richtungen weiterfliegen. Alle außer mir, wie es scheint.
Für mich ist auf New Sol Endstation.
Ich blinzle und frage mich, wo dieser Gedanke auf einmal hergekommen ist. Eine Erinnerung ist fast schon greifbar nahe, und ich versuche, sie festzuhalten, da ich instinktiv spüre, wie wichtig sie ist … Mein Name ist Lia Johansen, und ich war eine Kriegsgefangene.
Doch die Erinnerung ist wieder weg, sie ist mir durch die mentalen Finger geglitten, und ich schüttle den Kopf. Vielleicht wird für mich New Sol die Endstation sein, vielleicht aber auch nicht. Da es die Aurora-Kolonie nicht mehr gibt und meine Eltern tot sind, werde ich vermutlich dorthin gehen, wo immer sie mich hinschicken.
»Achtung! Achtung, bitte!«
Ich drehe mich zum Eingang um und recke den Hals, um zwischen den beiden Damen mittleren Alters hindurchsehen zu können, die vor mir stehen. Ein Offizier in der steifen, schwarz-goldenen Uniform der Flotte gibt Anweisungen für unseren Ausstieg, und es bildet sich eine unordentliche Schlange vor der Tür. Ich stelle mich hinter den beiden Damen an, und merke, dass mir die Beine wehtun, weil ich eine Ewigkeit auf einem Fleck gestanden habe. Endlich setzt sich auch der hintere Teil der Schlange in Bewegung. Ich folge den anderen durch die Korridore und in die Andockrampe des Schiffes, zögere dann jedoch, als ich durch die Sicherheitsscanner in die dahinterliegende Station schauen kann. Nachdenklich sehe ich über die Schulter zurück in das Transportschiff und runzle die Stirn. Irgendwie nagt das Gefühl an mir, dass ich noch etwas zu erledigen hätte. Ein Offizier drängt mich, weiterzugehen, und ich zucke mit den Schultern. Was immer es auch war, jetzt ist es zu spät. Ich betrete den Andockring und nehme meinen ersten Atemzug als freie Bürgerin des Sternenbunds.
Mattgraue Wände, der Boden aus Metallplatten und sanftes weiches Licht. Das ist alles, was ich sehe, bevor mich die anderen Gefangenen weiter durch den Gang schieben. Ich schaue mich im Gehen nach beiden Seiten um und lasse mich von der Menge vor mir leiten, ebenso wie von den lächelnden Offizieren, die in regelmäßigen Abständen an den Seiten stehen. In diesem Gang gibt es nicht viel zu entdecken, bist auf die zwei Reihen flacher blauer Lampen, die auf beiden Seiten in den Boden eingelassen wurden und die den ganzen Gang entlangzuführen scheinen. Ist das die Notbeleuchtung oder dienen sie noch einem anderen Zweck?
Am Ende des Gangs leitet man uns in eine Art großen Frachtraum. Es ist ihnen gelungen, den Großteil der ursprünglichen Fracht vor unserer Ankunft wegzuschaffen, und die restlichen Fässer, Eimer und Kisten wurden an die Wände geschoben, damit wir alle Platz finden. Dennoch wird es verdammt eng, und die Menschen stauen sich in langen Reihen hinter behelfsmäßigen Kontrollpunkten, die mit einer Handvoll Offizieren bemannt sind. Viele Passagiere haben sich bereits auf den Boden gesetzt, während sie warten, andere treten auf der Stelle, für mehr ist hier kein Platz.
Ich stelle mich ans Ende einer Schlange und sehe auf den großen Bildschirm, der über dem anderen Eingang hängt. Ein Name und ein Foto sind darauf zu sehen. Mir wird bewusst, dass es sich um den Namen und das Foto eines ehemaligen Gefangenen handelt, und der Sinn und Zweck dieses Bildschirms wird mir dann auch klar, als ich die wartende Menge hinter der Absperrung auf der anderen Seite der Tür entdecke. Nun weiß ich, was das Ganze soll. Der Bildschirm ist nicht für uns, sondern für sie bestimmt. Für die Stationsbewohner, die hergekommen sind, um herauszufinden, ob ihre Lieben zu den wenigen Glücklichen gehören, die freigelassen wurden. Ich staune darüber, wie lange einige von ihnen schon da stehen müssen, um nervös darauf zu warten, dass ein ganz bestimmter Name auf dem Bildschirm erscheint. Dann stelle ich mir vor, wie mein Name da oben zu sehen ist.
Lia Johansen.
Keine Familie, keine Verwandten, es wird niemand da sein, um sie abzuholen.
Um mir die Zeit zu vertreiben, belausche ich die Unterhaltungen um mich herum. Ein Stück weiter links erzählt ein Vater seinen Kindern gerade vom alten Haus seiner Familie in der Devora-Kolonie. Sie sehen so jung aus, dass sie sich garantiert nicht mehr daran erinnern, falls sie es überhaupt jemals gesehen haben. Vor mir halten sich die beiden Damen mittleren Alters an den Händen und sagen keinen Ton, sehen sich aber immer wieder an, und in ihren Blicken spiegeln sich zu gleichen Teilen Hoffnung und Unglauben. Möglicherweise lauschen sie aber auch der Großmutter ein Stück hinter uns, die dem Kleinkind auf ihrem Schoß gerade ein altes Schlaflied von der Erde vorsingt.
Jeder scheint irgendjemanden zu haben, und wenn es auch nur ein Freund ist, den man in den Monaten oder gar Jahren der Gefangenschaft gefunden hat. Jeder, außer mir. Nach zwei Jahren auf Tiersten müsste ich doch wenigstens ein paar dieser Leute kennen, aber falls dem so ist, erinnere ich mich nicht daran. Gut, allein in dem Lager, in dem ich lebte, wurden mehrere Tausend Gefangene festgehalten, und die kann ich unmöglich alle gekannt haben. Auf dem Transportschiff habe ich mich abgeschottet und jedem den Rücken zugedreht, der mich angesprochen hat. Es wäre doch sinnlos, mich an Menschen zu hängen, an die ich mich sowieso nicht erinnere und die ich letzten Endes wieder aus den Augen verlieren werde.
Die Schlange rückt langsam vorwärts, und ich mit ihr. Ich mustere zwei Soldaten, die an einer Wand nicht weit entfernt von mir stehen. Sie wirken entspannt, wie sie die Menge ungezwungen mustern, aber ihre Hände ruhen auf Hüfthöhe, sodass sie schnell ihre Waffen ziehen könnten. Ich spitze die Ohren, um ihr Gespräch zu belauschen.
»… kennst du irgendjemanden aus der Tiersten-Kolonie?«, fragt der eine.
Die Soldatin schüttelt den Kopf und lässt den Blick erneut über die Menge schweifen. »Nein. Du?«
»Meine Cousine kannte jemanden«, erwidert der Soldat. »Eine alte Freundin, die ein paar Jahre zuvor nach Aurora gezogen war.«
»Das nenne ich mal schlechtes Timing.«
»Das kannst du laut sagen. Sie glaubte, sie könnte dort nach ihrer Scheidung ein neues Leben anfangen, nur um dann zwei Jahre lang auf einem Gefängnisplaneten festzusitzen. Falls sie die Invasion überhaupt überlebt hat. Ich halte nach ihr Ausschau, habe sie aber noch nicht entdeckt. Aber das hier ist ja auch nur ein kleiner Prozentsatz aller Gefangenen, die auf Tiersten festgehalten wurden. Wie hoch sind die Chancen, dass sie unter den glücklichen Fünfhundert ist?«
Die Frau schnaubt. »Ich bin überrascht, dass die Tellurianer die Gefangenen überhaupt gehen gelassen haben, wo die Zukunft von New Terra doch noch immer in den Sternen steht.«
»Vermutlich hoffen sie, dass wir weich werden, wenn sie ein paar Gefangene freilassen, und zu weiteren Zugeständnissen bereit sind. Als was haben sie es doch gleich bezeichnet? Als Geste guten Willens?«
»Als ob die auch nur wüssten, was ein guter Wille ist! Ich wette einhundert Milicreds, dass der Waffenstillstand kein Vierquadrat andauert!«
»Die Wette gilt«, antwortet ihr Gegenüber. »Ich gebe ihm maximal sechs Wochen. Und, hast du vorgestern das Spiel gesehen?«
»Nein, ich habe es verpasst. Warum? War es gut?«
»Das kannst du wohl glauben. Am Ende des ersten Viertels …«
Die Schlange rückt weiter vor, und die Soldaten gehen in die entgegengesetzte Richtung, sodass ich sie nicht mehr hören kann. Ich warte jetzt schon seit zwei Stunden, und so langsam kann ich die Leute verstehen, die ungeduldig auf der Stelle treten, alles ist besser, als einfach so herumzustehen.
Um mich abzulenken, blicke ich zum Ende der Schlange. Ich bin jetzt nah genug, um den Offizier erkennen zu können, der an meinem Kontrollpunkt das Sagen hat. Er ist ein junger Mann mit dunkelblondem Haar, und die Abzeichen an seiner Uniform weisen ihn als Lieutenant aus. Und nicht nur das, er ist außerdem noch Mitglied des PsyCorp.
Ein Seher!
Unwillkürlich mache ich einen Schritt zurück und stoße fast mit dem älteren Mann hinter mir zusammen. Mein Herz schlägt schneller, auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass all die Schauergeschichten über das PsyCorp nichts als Ammenmärchen sind. Jeder weiß, dass die meisten Seher direkten Kontakt brauchen, um irgendetwas empfangen zu können, und selbst durch eine kurze Berührung können sie kaum mehr aufschnappen als einen Hauch der Gefühle und Absichten der Person vor sich und vielleicht einen flüchtigen Gedanken. Außerdem ist es ja nicht so, als hätte ich noch nie einen Seher gesehen. Erst vor drei Wochen, beim Einsteigen in das Transportschiff auf Tiersten, ist mir einer begegnet. Dennoch wird meine Unruhe immer größer, je länger ich den Mann anstarre, und ich weiß, dass ich ihm um jeden Preis aus dem Weg gehen will.
Daher beschließe ich, einfach in eine andere Schlange zu wechseln, trete zur Seite und gehe auf die Nachbarschlange zu. Das bedeutet zwar, dass sich meine Wartezeit deutlich verlängert, aber ich habe es ja auch nicht wirklich eilig.
Dummerweise trägt die Offizierin am nächsten Kontrollpunkt denselben Halbstern auf ihrer Tunika, ebenso wie jeder andere Offizier an den Kontrollpunkten. Gibt es hier deshalb so wenige Kontrollpunkte für so viele Leute, weil sie nur Seher einsetzen, um die Flüchtlinge aufzunehmen? Aber warum?
Der ältere Mann ist so freundlich, mich wieder an meinen Platz in der Schlange zu lassen. Bestimmt geht er davon aus, dass ich nur eben eine der Hygieneeinheiten am anderen Ende des Raumes aufgesucht habe. Ich wische mir die schweißnassen Hände am Overall ab und nehme meinen ursprünglichen Platz widerstrebend erneut ein. Minute für Minute rückt die Schlange voran, und ich komme dem Kontrollpunkt vor mir unausweichlich näher. Inzwischen fällt mir auch das Atmen schwer. Die Seher, die Soldaten, die vielen Leute, die Wände – dieser Ort wirkt plötzlich wie eine Falle und genauso wie das Gefängnis, das ich vor Kurzem erst verlassen habe. Als niemand mehr vor mir in der Schlange ist, wird mir leicht schwindlig und es fühlt sich an, als würde sich mein Kopf gleich einfach von meinem Hals lösen und davonfliegen.
»Name?«
Ich blicke zu Boden, und mein Mund ist auf einmal so trocken, dass ich keinen Ton herausbekomme. Der Offizier trägt keine Waffe, und doch gibt mir jedes Nervenende in meinem Körper zu verstehen, dass dieser Mann sehr gefährlich ist.
»Miss? Ihr Name?«, fragt der Offizier erneut, seine Finger schweben bereits ungeduldig über seinem Pad.
Ich räuspere mich und bekomme die Worte endlich über die Lippen. »Lia. Lia Johansen.«
»Okay, Lia. Du musst den Kopf heben, dich vorbeugen und die Augen weit aufmachen.«
Er hat einen Netzhautscanner in der Hand, ein kleines Metallröhrchen, das etwa die Größe eines Stiftes hat und an dessen Spitze ein runder Scanner befestigt ist. Netzhautscanner sind nichts Ungewöhnliches und ein schneller und schmerzloser Weg, die Identität einer Person festzustellen, aber aus irgendeinem Grund macht mich das Gerät nur noch nervöser, als wäre es eine Waffe und kein Werkzeug. Ich sollte tun, was er verlangt, aber irgendwie gelingt es mir nicht, mich zu bewegen.
Kalte Finger drücken mein Kinn nach oben. Ein heller Lichtstrahl blendet mich, und ich zucke zurück und drehe den Kopf mit einem Aufkeuchen zur Seite. Angst rast durch mich hindurch, läuft mir eiskalt den Rücken hinunter, und ich kann trotz des Stimmengewirrs um mich herum hören, wie schnell und abgehackt mein Atem klingt. Panisch versuche ich, die Ursache für meine Angst zu verstehen, aber mir ist, als würde sich Nebel auf mich herabsenken, sich durch die Lücken in meinem Verstand zwängen, meine Gedanken verschleiern, meine Erinnerungen abblocken und mein Denkvermögen einfach abschalten. In meinem Kopf herrscht plötzlich Leere, und ganz kurz bin ich einfach nicht mehr da, treibe verloren im Nichts ohne einen Namen, ohne ein Gedächtnis, ohne etwas, das mir gehört. Ich taste mich hektisch durch den Nebel, suche nach etwas, nach irgendetwas, woran ich mich festhalten kann …
»Lia?«
Mein Name ist Lia Johansen, und ich war eine Kriegsgefangene.
Und auf einmal bin ich wieder da.
Mein Herzschlag verlangsamt sich, und endlich kann ich den Offizier wieder ansehen.
Seine Ungeduld ist verschwunden, dafür mustert er mich mitfühlend, und ich frage mich, was er während der kurzen Berührung in meinem Kopf sehen konnte. Zum ersten Mal blicke ich an seinen Lieutenant-Abzeichen und dem Halbstern auf seiner Brust vorbei. Obwohl er noch keine dreißig sein kann, wirkt er müde, wie ein Mann, der in zu viele Augen gesehen und zu viel darin entdeckt hat. Seine Augen sind von einem strahlenden Blau, glasklar, tief und überraschend sanft. Mein Blick fällt auf den Namen, der auf seiner Brusttasche steht. Rowan.
»Es wird nicht wehtun, Lia. Das verspreche ich dir.«
Meine Angst ist noch nicht verschwunden, sie lauert unter der Oberfläche und scheint sich dort fieberhaft zu ballen, aber ich habe sie jetzt im Griff. Ich beuge mich vor und gestattet ihm, den Scanner langsam vor meinem rechten Auge hin und her zu bewegen. Das Gerät summt, piept dann, und PsyLieutenant Rowan sieht die Daten an, die auf seinem Pad aufgetaucht sind. Er runzelt die Stirn. »Woher kommst du, Lia? Wo hast du vor der Gefangenschaft gelebt?«
»In der Aurora-Kolonie.«
Er nickt und hat schon mit dieser Antwort gerechnet. Die Zentralakten von Aurora wurden bei der Eroberung der Kolonie zerstört, was bedeutet, dass es für jeden, der in der Kolonie geboren wurde, weder einen Netzhautscan noch irgendwelche anderen persönlichen Informationen in der Datenbank gibt. Er tippt einige Daten ein und legt vermutlich einen neuen Eintrag für mich an.
»Und deine Familie? Sind noch irgendwelche Verwandten von dir hier, die mit dir im Lager gewesen sind?«
Ich schüttle den Kopf. »Ich hatte nur meine Eltern, und sie sind auf Tiersten gestorben.«
»Das tut mir leid«, sagt er, und seine Stimme klingt erneut so unerwartet sanft. »Und abgesehen davon? Hast du Freunde oder Verwandte, die nicht auf Aurora gelebt haben? Irgendjemanden, der dich bei sich aufnehmen kann?«
»Nein«, flüstere ich und muss wieder an diesen Bildschirm mit den Namen denken und die vielen Leute, die hinter der Absperrung warten.
PsyLt Rowan hält kurz inne, betrachtet mich schweigend und nickt schließlich. »Kannst du mir dein Geburtsdatum sagen? Wie alt bist du, Lia?«, fügt er hinzu, als ich nicht sofort antworte.
Er will mein Alter wissen? Mir fällt zuerst nichts ein, und wieder überkommt mich kurz Panik, weil er mir eine Frage stellt, die ich problemlos beantworten können müsste, es jedoch nicht kann. Aber ich zwinge mich, ruhig zu bleiben, und atme erleichtert auf, als die Zahlen in meinem Kopf aufleuchten. Er lächelt, als ich ihm mein Geburtsdatum nenne.
»Sechzehn? Das habe ich mir gedacht. Du ähnelst …« Er spricht nicht weiter, blickt in die Ferne und schüttelt dann den Kopf. »Ach, vergiss es.«
Er stellt mir noch ein paar Fragen, die ich beantworte, so gut ich kann, und tippt die Informationen mit flinken Fingern in sein Pad, seine Fingernägel so präzise wie das Skalpell eines Chirurgen. Danach speichert er die Datei und codiert sie auf einen Identitätschip von der Größe meines kleinen Fingers. Nachdem er diesen in eine kleine Implantierungsspritze geschoben hat, streckt er mir seine linke Hand mit der Handfläche nach oben entgegen. Nach einer Sekunde begreife ich, dass er mich dazu auffordert, ihm meine Hand zu geben.
Auch wenn ich ihn eigentlich auf gar keinen Fall anfassen möchte, lege ich meine Hand in seine und bin dieses Mal auf die Angst und das Adrenalin vorbereitet, die bei der Berührung erneut in mir aufsteigen. Er nimmt meine Hand, dreht sie um, sodass die Handfläche oben ist, und drückt den Chip in den fleischigen Bereich unterhalb meines Daumens. Die Metalldornen dringen in meine Haut ein, und ich zucke zusammen, als sich die biometallischen Fasern des Chips entfalten und sich in meiner Handfläche ausbreiten, um sich in den Nerven in meinen Fingern festzusetzen.
»Hat das wehgetan?«, fragt Rowan irritiert, lässt meine Hand los und befühlt geistesabwesend seinen eigenen Chip.
Ich lege den Kopf bei seiner Frage schief und denke nach. Hat es wehgetan? Das Gefühl war so schnell vorbei, dass ich es gar nicht richtig einordnen kann. Endlich schüttle ich den Kopf. »Ich war nur überrascht.«
»Entschuldige«, entgegnet er. »So, Lia, dir wurde vorübergehend eine Koje in Frachtrampe 8A zugewiesen. Du kannst über deinen ID-Chip in der Cafeteria etwas zu essen bekommen, und hier ist dein Bettzeug. Wir hoffen, euch allen in den nächsten Tagen Kleidung zum Wechseln bereitstellen zu können, aber vorerst musst du mit dem auskommen, was du mitgebracht hast.« Er zuckt entschuldigend mit den Schultern und mustert meinen schlichten grauen Overall, bevor er mir das Bündel mit meinem Bettzeug reicht, in dem auch ein Handtuch und Waschzeug eingewickelt sind. Er deutet auf den Eingang und gibt mir noch ein paar letzte Tipps. »Die nächste Cafeteria befindet sich im Hauptbereich, das ist hier, entlang des gelben Rings auf der fünften Etage, und der Frachtraum, in dem du schlafen wirst, ist im roten Ring auf Ebene acht. Wir haben vor dem Frachtraum eine Karte ausgehängt, damit ihr euch zurechtfindet. Vorerst bitten wir euch …«
*36:00:00*
Die Uhr wird derart unvermittelt in meinem Kopf aktiviert, dass ich zusammenzucke. Der Nebel verschwindet so schnell, als wäre er nie da gewesen. Auf einmal sind meine Erinnerungen wieder da, so scharfkantig und klar, dass sie Rillen in meinen Verstand pflügen, und plötzlich weiß ich Bescheid. Ich weiß genau, wer ich wirklich bin.
Mein Name ist Lia Johansen, und ich wurde nach einer Kriegsgefangenen benannt. Sie lebte zwei Jahre lang in der Tiersten-Internierungskolonie, und als die Rückkehr der Gefangenen ausgehandelt worden war, hat man mir ihre Erinnerungen gegeben und mich an ihrer Stelle zurückgeschickt.
Ich bin eine gentechnisch veränderte menschliche Bombe.
2
Ich bin unglaublich erleichtert, als die letzte kristallklare Erinnerung zurückgekehrt ist. Nachdem ich wochenlang völlig verwirrt gewesen bin und mein Gedächtnis immer wieder infrage gestellt habe, bin ich endlich frei. Mein Verstand ist klar, meine Identität gesichert, und mein Lebensziel … steht eindeutig fest. Selbst meine Ängste sind jetzt, da ich sie verstehe, nicht mehr so übermächtig. Ich stehe im Lager des Feindes und bin eine gentechnisch veränderte menschliche Bombe, die aus der DNS eines Wissenschaftlers geschaffen wurde. Alle anderen um mich herum würden mich sofort vernichten, wenn sie wüssten, was ich wirklich bin, und direkt vor mir steht ein Mann, der mich durch eine bloße Berührung enttarnen könnte. Kein Wunder, dass sein Anblick mich in Panik versetzt hat.
»… kann anfangs verwirrend sein«, sagt PsyLt Rowan gerade. Er klingt sehr weit weg, da ich ihm überhaupt nicht zuhöre, »aber vergiss nicht, dass auf den Ebenen …«
*35:59:59*
»… wurden in vier Sektoren codiert: rot, gelb, grün und blau …«
*35:59:58*
»… die jeweils einem Quadranten des Zentrums entsprechen. Wenn du dich also …«
*35:59:57*
»… verläufst, dann schau einfach zu Boden. Hast du das verstanden, Lia? Lia?« Er streckt eine Hand nach mir aus.
Er darf dich nicht anfassen! Er darf dich auf gar keinen Fall anfassen!
Ich kehre mit einem Ruck in die Realität zurück und mache einen Schritt nach hinten, um ihm gerade noch rechtzeitig auszuweichen. »Ich hab’s verstanden«, versichere ich ihm schnell. »Danke. Für alles. Ich sollte jetzt allein zurechtkommen.«
Während er besorgt die Stirn runzelt, nicke ich und gehe in Richtung Ausgang. Ich erschaudere, als mir klar wird, wie kurz ich davorgestanden habe, enttarnt zu werden. Da die Erinnerungsüberlagerung verschwunden ist und mein wahres Gedächtnis wiederhergestellt wurde, hätte er mich nur einmal berühren müssen, um zu merken, dass ich nicht mehr dasselbe verwirrte Flüchtlingsmädchen bin wie kurz zuvor. Hätte ich zugelassen, dass er mich erneut anfasst, oder wäre die Uhr einige Minuten früher gestartet worden, bevor ich an der Reihe gewesen wäre …
Ich reibe mir das Kinn mit der Handfläche und muss daran denken, wie Rowan meine Hand genommen und mein Kinn berührt hat. Erst jetzt wird mir bewusst, dass sie den Befehl hatten, mit jedem Körperkontakt herzustellen. Sie sind auf der Suche nach feindlichen Agenten. Das ist die einzige Erklärung für die Besetzung der Posten mit je einem Mitglied des PsyCorp.
»Ach, und Lia?«
Ich erstarre, nur wenige Schritte vom Stationseingang entfernt. Habe ich mich irgendwie verraten? Meine Instinkte sagen mir, dass ich die Flucht ergreifen soll, aber ich zwinge mich dazu, mich umzudrehen.
Rowan lächelt mich an. »Willkommen auf der New-Sol-Station.«
In nicht einmal sechsunddreißig Stunden wird dieser Mann sterben, und ich werde der Grund dafür sein. Er wird in einer Feuersbrunst aufgehen, in der Blüte seiner Jahre dahinscheiden, sein kurzes Leben wird enden, nachdem es gerade erst begonnen hat. Dieser Mann, der einem misshandelten Flüchtling mit Freundlichkeit begegnet ist und nicht wissen konnte, dass das Mädchen nicht das ist, was es zu sein vorgibt. Sollte ich mir deswegen etwa Vorwürfe machen?
Vielleicht hätte Lia das getan – aber ich bin nicht Lia.
*
Direkt vor dem Frachtraum bleibe ich stehen, um mich zu orientieren. Ich stehe in einem riesigen runden Raum in der Mitte des zentralen Kerns. Einige Bereiche wurden für die Wartenden abgesperrt, daher führen behelfsmäßige Gänge an der Wand entlang und dann zu den Aufzügen in der Raummitte. Einige aus der Menge starren mich hoffnungsvoll an, nur um dann enttäuscht das Gesicht zu verziehen, als sie begreifen, dass ich nicht ihre Tochter, Schwester, Cousine oder Freundin bin. Ich ignoriere sie. Stattdessen konzentriere ich mich auf die Karte, die an einer Wand hängt.
Die Zentrale besteht aus dreizehn Ebenen, die alle über die Aufzüge in der Mitte zu erreichen sind. Momentan befinde ich mich auf Ebene sieben, auf der nur die Andockrampen, Hangars und Frachträume zu finden sind, dasselbe gilt für die Ebenen sechs und acht. Die Station ist ein militärischer Außenposten und gleichzeitig eine Kolonie, und soweit ich es erkennen kann, wird der Kern hauptsächlich für militärische Zwecke und den Transport benutzt. Ich schaue mir die oberen drei Ebenen – die Stationssteuerung – genauer an und merke mir diese Information für später.
Die Ebenen fünf und neun sind für die Öffentlichkeit gedacht. Hier findet man auch die Speichen, die zu den Habitatringen führen, und außerdem jede Menge Geschäfte, Bars, Restaurants – lauter Orte, an denen die Besucher etwas essen, sich entspannen und neue Vorräte kaufen können. Mein Magen knurrt, als mir auffällt, dass sich dort auch die beiden Cafeterias befinden. Ich überprüfe meine innere Uhr, die brav die Sekunden herunterzählt. Noch fünfunddreißig Stunden, sechsundvierzig Minuten und drei Sekunden. Mehr als genug Zeit, um etwas zu essen.
Als ich glaube, mir den ungefähren Weg gemerkt zu haben, marschiere ich den mit Seilen abgetrennten Gang entlang und auf die Aufzüge zu. Einige der Wartenden rufen mir etwas zu, als ich an ihnen vorbeigehe, und wollen wissen, ob ich diese oder jene Person gesehen habe. Ich starre stur geradeaus und antworte nicht auf ihre Fragen.
»Lia? Lia!«
Ich gehe weiter und bin davon überzeugt, dass ich nicht gemeint sein kann. Lias Eltern sind tot. Sie hat jetzt keine Familie mehr und niemanden, der nach ihr Ausschau halten könnte.
»Lia Johansen!«
Dieses Mal muss ich stehen bleiben. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass ich gerufen werde. Okay, nicht ich, aber die Person, für die man mich hält. Obwohl ich es eigentlich besser weiß, mustere ich alle in meiner Nähe.
»Lia!«
Die Stimme klingt sehr nah, und ich wirbele herum und stelle fest, dass er direkt hinter mir steht. Vor Schreck mache ich einen schnellen Schritt nach hinten und falle über meine eigenen Füße. Warme Hände halten mich an den Handgelenken fest und verhindern, dass ich zu Boden stürze. Dunkle Augen, so braun, dass sie schon fast schwarz aussehen, schauen mich an.
Ich vergesse zu atmen.
Zwar wurde ich durchaus schon früher berührt, angesehen oder angesprochen, schließlich habe ich drei Wochen in der Gesellschaft von fünfhundert Gefangenen verbracht. Doch bisher war es immer ein unpersönlicher Kontakt zwischen Fremden gewesen. Keiner von ihnen hat mich jemals so angesehen, als hätte ich irgendeine Bedeutung. Bis jetzt.
Sein Griff lockert sich, aber er lässt mich nicht los. »Du bist es wirklich«, sagt er leise. »Als ich deinen Namen auf der Liste gesehen habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass du es tatsächlich bist.«
Das Klügste wäre, ihm zu sagen, dass ich es nicht bin. Zu leugnen, die Person zu sein, für die er mich hält, ihn wegzustoßen und wieder zu vergessen. Ich habe nur eine einzige Mission, und sie schließt ihn nicht mit ein. Wer immer er ist. Aber … Ich möchte nicht, dass er mich loslässt. Ich will auch nicht, dass er aufhört, mich anzusehen.
Daher versuche ich, Zeit zu schinden. »Wer hätte ich denn sonst sein sollen?«
»Keine Ahnung. Eine andere Lia Johansen aus der Aurora-Kolonie, schätze ich.«
»Gab es denn mehrere von uns?«
»Falls dem so war, dann waren alle außer dir ohne Bedeutung.« Er legt den Kopf schief, wirkt ein wenig peinlich berührt und fügt hinzu: »Es ist unglaublich schön, dich zu sehen, Lia.«
»Ich freue mich auch, dich zu sehen, Michael.«
Michael? Der Name ist einfach so in meinem Kopf aufgetaucht, aber er scheint zu stimmen, sonst würde er mich nicht mehr anlächeln. Als die Erinnerungsüberlagerung zerstört wurde, sind auch Lias Erinnerungen vernichtet worden und aus meinem Bewusstsein verschwunden. Ich dachte eigentlich, sie wären einfach nicht mehr vorhanden, aber anscheinend sind sie noch immer da und verbergen sich irgendwo in den hintersten Ecken meines Verstands.
Ich tauche in die Tiefen meines Gedächtnisses ein und versuche, diesen Michael zuzuordnen. Er sieht aus, als wäre er ungefähr in meinem Alter – oder vielmehr in Lias Alter –, aber da er dunkle Haut hat und ich blass bin, sind wir wahrscheinlich nicht verwandt. Außerdem hat Lia keine Verwandten mehr, die noch am Leben sind. Dann ist er vielleicht ein Freund?
»Diese Sommertage im Park sind wirklich lange her, was?«, fährt er fort. »Wann war das, vor sieben Jahren?«
Der Park.
Ein Spielplatz, Rasen, überall weiße Blumen.
»Höher, Michael! Ich will noch viel höher schaukeln!«
»Wie hoch, Li-Li?«
»Bis zum Himmel!«
Ich blinzle und wundere mich über die Erinnerung. Wo kommt die denn auf einmal her? In den drei Wochen an Bord der Xenia Anneli habe ich mich nie an so etwas erinnert. »Du hast L… mich immer auf der Schaukel angeschubst.«
Er grinst. »Es konnte dir gar nicht hoch genug sein.«
»Bis zum Himmel«, stimme ich ihm zu. So langsam fällt mir noch viel mehr ein. Michael aus der Aurora-Kolonie. Er und Lia haben als Kinder miteinander gespielt und nebeneinander gewohnt, bis seine Eltern die Kolonie verlassen haben, als er neun Jahre alt gewesen ist. Ich habe nach seiner Abreise tagelang geweint.
Sie, korrigiere ich mich. Lia hat nach seiner Abreise tagelang geweint. Ich habe Michael noch nie zuvor gesehen, und er begegnet mir gerade zum ersten Mal. Auf einmal fühle ich mich wie die Hochstaplerin, die ich ja auch bin. Nicht nur, weil ich eine feindliche Agentin und eine Bombe bin, sondern vor allem, weil ich die Zuneigung in seinem Blick genieße, die eigentlich für jemand ganz anderen bestimmt ist. Jemand ganz Besonderen. Jemand, der ich nicht bin.
Es ist noch schlimmer, als angesehen zu werden, als wäre man niemand.
Ich entziehe ihm meine Hände und wende den Blick ab, da mir plötzlich bewusst ist, dass Michael Lias Hände hält und nicht meine. »Ich sollte gehen«, murmele ich und kann ihm nicht in die Augen sehen, während ich versuche, einen Bogen um ihn herum zu machen. »Danke, dass du hergekommen bist.«
Er versteht den Hinweis jedoch nicht und läuft neben mir her. »Wo willst du denn hin? Vielleicht kann ich dir den Weg zeigen.«
»Zuerst in die Cafeteria, aber ich finde …«
»Ach, natürlich. Du hast bestimmt Hunger, nachdem du so lange unterwegs gewesen bist. Komm, wir gehen hoch zu der auf der Fünf.«
Wir? »Das ist schon okay, du musst nicht …«
»Es gibt auch eine auf der Neun«, fährt er fort und nimmt mir das Bettzeug ab, bevor ich überhaupt begreife, was er da tut, »aber in der Fünf ist der Nachtisch besser.«
Irgendwie haben wir gerade die Positionen getauscht, und anstatt dass Michael mir zum Aufzug folgt, laufe ich jetzt ihm hinterher. Während ich noch überlege, wie ich ihn wieder loswerden kann, hat er längst die Führung übernommen.
Die Aufzugstation ist eigentlich nichts weiter als ein riesiger Paternoster aus Metall, bei dem die eine Seite immer nach oben und die andere immer nach unten fährt. Ich sehe zu, wie der Mann vor uns auf eine Plattform tritt, sobald sie sich auf einer Höhe mit dem Fußboden befindet, und sich kurz an der Metallstange festhält, während die Kabine weiter nach oben fährt. Vorsichtig schaue ich in das Loch und zögere, während die nächste Plattform langsam in Sicht kommt. Als würde er meine Unsicherheit spüren, nimmt Michael meine Hand, tritt auf die Plattform und zieht mich mit sich.
Mein erster Impuls ist, mich festzuhalten, doch dann stelle ich fest, dass das überhaupt nicht nötig ist. Die Kabine bewegt sich nicht besonders schnell, und die Plattform ist auf drei Seiten von hüfthohen Glaswänden umgeben. Die Menge wird unter uns kleiner, als wir immer weiter nach oben getragen werden. Wir fahren an der dicken Metallplatte vorbei, die zugleich als Boden und als Decke dient, und dann sind wir auf Ebene sechs, die genauso aussieht wie die Sieben, nur ohne die vielen Leute und die abgetrennten Bereiche. Ich habe kaum Zeit, mir alles einzuprägen, als wir auch schon Ebene fünf erreichen. Die Fahrt begeistert mich derart, dass ich ganz vergessen hätte, wieder auszusteigen, wenn mich Michael nicht mit sich gezogen hätte.
Neben dem Aufzug bleibe ich stehen und sehe zu, wie die Plattform durch ein Loch in der Decke verschwindet. »Was passiert, wenn man oben nicht aussteigt?«, frage ich nervös.
»Das müssen wir wohl irgendwann mal ausprobieren«, erwidert Michael gelassen.
Ich reiße die Augen auf und male mir aus, wie wir an der Decke zerquetscht werden oder oben einfach in die Luft fliegen, und auf einmal grinst Michael breit.
»Keine Sorge, uns passiert dabei nichts, das verspreche ich dir.«
Okay, wir werden nicht zermalmt, sondern fliegen nur in die Luft.
Ich sehe auf meine innere Uhr. Fünfunddreißig Stunden, achtundzwanzig Minuten und drei Sekunden, dann …
Nova.
Sie haben mir erzählt, wie es sein wird, wenn ich schließlich explodiere. Es wird damit beginnen, dass ich ein Dehnen in meinem Kopf spüre, als würde mein Gehirn in die Länge gezogen, plattgedrückt und gespannt. Danach wird mein Sehvermögen aussetzen und die Welt um mich herum wird verschwimmen, während ich silberne und goldene Punkte vor den Augen sehe. Schließlich wird mein Herz immer schneller schlagen – und das muss es auch, um die Chemikalien durch meine Adern und in meine Brust zu befördern, wo sie aufeinandertreffen und sich entzünden. Die Chemikalien kommen aus meinen Armen, da mir im linken und rechten Unterarm jeweils ein Beutel eingelassen wurde. Getrennt voneinander sind sie absolut unschädlich und können von keinem Sicherheitssystem entdeckt werden, aber in Kombination miteinander können sie diese ganze Station vernichten.
Ich werde wissen, wann die Chemikalien in meinen Blutkreislauf freigesetzt werden, weil ich dann ein Brennen in den Armen spüren werde. Ab dann wird es nicht mehr lange dauern. Vor meinen Augen werden eine Million glitzernde Funken tanzen, während die Chemikalien dank meines rasenden Herzens vermischt werden, und dann wird um mich herum alles weiß. Es wird ein grelles, blendendes Weiß sein, wie es noch niemals zuvor zu sehen gewesen ist, und schlichtweg glorreich werden.
Zumindest haben sie mir das so gesagt. Ich selbst habe das natürlich nicht erlebt. Noch nicht.
Ich werfe Michael einen Blick zu. Es ist schon irgendwie schade, dass er nicht dasselbe fühlen, sehen oder erleben wird wie ich. Dass er nie die Ehrfurcht gebietende Macht kennenlernen und zur Nova werden wird. Doch er wird immerhin genau wie alle anderen auf der Station ein Teil davon sein. Nur nicht auf dieselbe Weise wie ich.
Michael wartet auf mich und verzieht die Lippen auf eine Art und Weise, die ich nicht deuten kann, während er mich mustert. Weiß er, dass ich nicht Lia bin? Wenn es irgendjemand herausfinden könnte, dann doch vermutlich ihr Freund aus Kindertagen. Aber er deutet nur mit der Hand nach vorn und meint: »Sollen wir?«
Ich nicke und folge Michael von der Aufzugstation weiter in Ebene fünf hinein. Im Vergleich zur relativ ruhigen Ebene sechs ist hier richtig viel los. Die Fläche ist in vier verschiedene Bereiche aufgeteilt, die durch rote, gelbe, grüne und blaue Bodenleuchten markiert werden. Sie führen von den Aufzügen weg und jeweils zu einer der Speichen, die den Habitatring mit der zentralen Station verbinden. Zwischen den einzelnen Bereichen befinden sich Geschäfte und Restaurants, die mit kleineren Ständen und Händlern wetteifern, bei denen man ein Sammelsurium an Waren kaufen kann. Offiziere in schwarz-goldenen Uniformen mischen sich unter Kolonisten und Stationsbesucher, und ich kann sogar einige Flüchtlinge entdecken, die hier herumschlendern und in ihren grauen Overalls sofort auffallen. Gut, dass ich Michael dabeihabe, der mir den Weg weist, denn sonst hätte ich mich in dem Gewimmel innerhalb von Sekunden verlaufen.
Er führt mich zielsicher zwischen den vielen Leuten hindurch, geht um einige Stände herum und zieht mich in einen Gang neben einem ionianischen Restaurant und einem Klamottengeschäft. Während wir uns von den Geschäften in der Mitte entfernen, wird es um uns herum etwas leiser, da sich in den äußeren Bereichen des Kreises Lounges und Bars befinden. Ich blicke zu Boden und entdecke die gelbe Notfallbeleuchtung, die in die Deckplatten eingelassen ist. Gelber Quadrant.
Die Cafeteria befindet sich im äußersten Abschnitt und wird gleichermaßen von Militärpersonal und Flüchtlingen besucht. Ich bin anscheinend nicht die Einzige, die zuerst einmal etwas essen will. Michael schiebt sich mein Bettzeug unter den Arm und reicht mir ein Tablett.
»Und, was möchtest du essen?«
Ich nehme das Tablett und starre die verwirrende Auswahl an Gerichten an, ohne zu wissen, was ich auf seine Frage antworten soll. Bei meiner Erschaffung wurde kein Wert auf einen ausgeprägten Geschmacks- oder Geruchssinn gelegt. Für mich riecht alles gleich und hat einen fahlen süßsauren Geschmack, der in meinen Nasenlöchern kribbelt und mir leicht über die Zunge geht. Nur die Intensität verändert sich. Auf dem Transportschiff hatte ich diesen Geruch ständig in der Nase, aber hier fällt er mir kaum auf.
Auf dem Weg hierher waren auch mein fehlender Geschmacks- und Geruchssinn nicht weiter wichtig. Die Soldaten haben uns ohnehin keine Wahl gelassen, und wir haben entweder das gegessen, was uns vorgesetzt wurde, oder gehungert. Zwar erkenne ich die meisten der Gerichte, aber ich habe eigentlich keine besonderen Vorlieben. Essen ist für mich nicht mit Vergnügen verbunden. Es ist ein Mittel zum Überleben, nichts weiter. Mir schießt durch den Kopf, dass ich meine Entscheidung aufgrund des Nährwerts treffen sollte, aber das ist auch nicht weiter von Bedeutung, wenn meine Existenz in weniger als sechsunddreißig Stunden enden wird. Ich überlege, was ich gegessen habe, bevor ich an Bord des Transportschiffs gegangen bin, aber aus irgendeinem Grund will mir keine einzige meiner früheren Mahlzeiten einfallen.
Daher zucke ich mit den Schultern und stelle mir ein buntes Menü zusammen: ein Stück Hühnchen, eine Stange Sellerie, eine Orange und ein paar Pommes frites. Michael zieht die Augenbrauen hoch, als er einen Blick auf meinen Teller wirft.
»Ich dachte, du kannst Sellerie nicht ausstehen?«
Wirklich? Ich ringe nach einer passenden Antwort. »Wir haben auf Tiersten so viel Sellerie essen müssen, dass ich mich inzwischen anscheinend daran gewöhnt habe.«
»Die haben euch Sellerie vorgesetzt? Krass.« Michael schüttelt den Kopf, zuckt dann mit den Schultern und nimmt sich ein Stück Kuchen vom Desserttresen.
Nachdem wir dem Kassierer unsere Chips zum Abkassieren vorgezeigt haben, konzentriere ich mich auf mein Essen und nutze es als Ausrede, um nichts sagen zu müssen. Da Lias Erinnerungen tief unter der Oberfläche verborgen sind, versuche ich, möglichst wenig zu reden. Ansonsten kommt mir noch etwas über die Lippen, das Lia niemals gesagt hätte.
Zu meiner Überraschung scheint sich Michael ebenso unwohl zu fühlen wie ich, und das Selbstbewusstsein, das er bis eben an den Tag gelegt hat, ist mysteriöserweise verschwunden, jetzt, wo wir uns gegenübersitzen und nichts anderes tun können, als miteinander zu reden. Er trommelt mit den Fingern auf dem Tisch herum.
»Du bist so still«, meint er schließlich.
»Bin ich das?«
»Als wir noch Kinder waren, hast du in einer Tour geplappert. Meine Mom hat immer gesagt, dass du eine richtige kleine Quasselstrippe bist.«
Indem ich einfach nur geschwiegen habe, ist mir offenbar bereits ein Fehler unterlaufen. Ich suche in meinem Kopf nach Lia und hoffe darauf, die Worte zu finden, die sie darauf erwidert hätte, aber sie ist nicht da. So zucke ich betreten mit den Schultern. »Die Dinge ändern sich.« Das ist keine besonders gute Erklärung, aber er scheint sie zu akzeptieren.
»Mir ist aufgefallen, dass die Namen deiner Eltern nicht auf der Liste gestanden haben«, beginnt er vorsichtig. »Sind sie …?«
Meine Eltern sind vor meinen Augen an Entkräftung und Krankheiten gestorben.
Er reißt die Augen auf, und mir wird erst jetzt bewusst, dass ich die Worte laut ausgesprochen habe, dass mir dieser auswendig gelernte Spruch automatisch über die Lippen gekommen war, bevor mein Gehirn ihn auch nur verarbeitet hatte. »Das tut mir leid«, sagt Michael. »Ich habe deine Eltern sehr gemocht. Du vermisst sie bestimmt ganz schrecklich.«
»Ich habe um sie geweint.«
Noch eine vorgefertigte Antwort, und ich habe auch keine andere. Ich kenne keine eigenen Gefühle und keine Worte außer denen, die sie in meinen Kopf eingepflanzt haben. Selbst mein Name gehört mir nicht, sondern wurde von einem anderen Mädchen geschätzt und geliebt und mir bloß aufgezwungen. Und wie alles, was man jemandem gestohlen hat, wurde auch er von seiner ursprünglichen Besitzerin abgenutzt und wird nie so gut zu mir passen, wie er zu ihr gepasst hat.
Wir essen schweigend weiter, oder versuchen es zumindest. Michael stochert mit seiner Gabel in seinem Kuchen herum, und ich tunke geistesabwesend eine Orangenspalte in Ketchup, bevor ich sie mir verstohlen in den Mund schiebe. Wäre die richtige Lia derart wortkarg gewesen, wenn sie Michael zum ersten Mal nach sieben Jahren wiedergetroffen hätte?
Michael sieht sich um, als hoffe er darauf, dass sich irgendwo ein Gesprächsthema manifestieren würde, und dann schaut er auf mein Tablett. »Du hast dir ja gar keinen Nachtisch genommen«, ruft er.
»Ach, na ja …«
»Das war doch der Grund, warum wir überhaupt auf Fünf gekommen sind, weißt du nicht mehr? Der Nachtisch. Hier, koste wenigstens meinen«, bietet er mir an, sticht seine Gabel in den unangetasteten Teil des Kuchens und reicht mir einen Happen.
»Ich möchte wirklich nicht …«
Ich senke den Kopf, gerade als er die Gabel auf mich zubewegt, sodass der Kuchen nicht meinen Mund, sondern meine Nase trifft. Michael will sich schon entschuldigen, und ich bin für einen Augenblick erstarrt und weiß nicht, was man in so einer Situation tut. Ich möchte nur, dass er sich deswegen jetzt nicht schlecht fühlt.
Daher wische ich mir mit dem Finger vorsichtig ein wenig Zuckerguss von der Nase und schiebe ihn mir in den Mund. Michael, der mich eben noch entsetzt angestarrt hat, fängt langsam an zu grinsen, und dann fragt er: »Und, wie schmeckt er dir?«
Er schmeckt genauso wie der Ketchup. Was bedeutet, dass er nach gar nichts schmeckt.
»Der ist wirklich lecker«, erkläre ich, nehme die Serviette entgegen, die er mir reicht, und wische mir die Nase ab.
Aus irgendeinem Grund habe ich das Richtige getan, denn jetzt erzählt mir Michael eine Geschichte darüber, wie er das erste Mal in der Cafeteria hier auf der Station gewesen ist, und seine unbeschwerte Art kehrt nach und nach zurück. Er stibitzt mir ein paar Pommes, und ich esse noch ein Stück von seinem Kuchen, während ich einfach zufrieden lausche und nicke.
Nach einer Weile hält er inne und senkt geknickt den Kopf. »Mann, jetzt hör mich nur an. Sieht ganz danach aus, als wäre ich jetzt die Quasselstrippe.«
Ich zucke mit den Schultern. »Das macht mir nichts aus.«
Er bedenkt mich mit einem Blick, den ich nicht deuten kann, und sammelt dann unsere Tabletts und Teller zusammen. Ich schnappe mir mein Bettzeug, und wir verlassen zusammen unseren Tisch und die Cafeteria. Wir wandern außen um die Plattform herum, bis wir den nächsten Quadranten und die Kreuzung erreichen, an der zur einen Seite gelbe und zur anderen grüne Lichter wegführen. Schiebetüren am Ende des Querwegs öffnen sich in regelmäßigen Abständen, wenn jemand von der Speiche zur Station oder der Station zur Speiche wechseln will. Michael nickt zu den Türen hinüber.
»Ich sollte lieber gehen, bevor sich Gran noch Sorgen macht.« Er zögert. »Aber ich freue mich sehr, dich wiederzusehen, Lia. Vielleicht kann ich dich ja morgen mal besuchen, was denkst du? Wo hat man dich untergebracht?«
Ich denke zurück an das, was PsyLt Rowan gesagt hat. In Frachtraum 8A.
»Ich bin bei den anderen Flüchtlingen in Frachtraum 7 C«, behaupte ich.
»Okay, super.« Er winkt mir zum Abschied noch einmal zu, während er rückwärts in Richtung Speiche geht. »Bis bald, Lia.«
*34:17:02*
Nein, Michael, denke ich, während er zu den Türen geht und dahinter verschwindet.
3
Meine Selbstsicherheit kehrt zurück, als Michael durch die Tür verschwindet. Die letzte Stunde war schwierig und verwirrend gewesen, es hatte sich angefühlt, als müsste ich, ohne den Text zu kennen, ein Theaterstück aufführen. Jetzt, wo er weg ist, wird auf einmal alles wieder klar: meine Identität, mein Zweck, meine Existenz. Sie alle sind gleich.
Ich gehe den Weg zurück zu den Aufzügen und lasse mich zwischen all den anderen treiben. Niemand achtet auf mich, ein blasses, sechzehnjähriges Flüchtlingsmädchen, das etwas klein für sein Alter ist, aber ich betrachte sie genau, sehe mir ihre Kleidung an, analysiere ihre Bewegungen und belausche ihre Unterhaltungen.
»… müssen diese Berichte bis achtzehnhundert dem Colonel …«
»… können uns keine Verzögerung erlauben, da die Santa Maria in wenigen Wochen …«
»Unser Andockpass läuft in drei Stunden aus. Wir müssen diese Lieferung sichern …«
»… und da habe ich ihm gesagt, nicht von meinen Milicreds, das wird er …«
Eine Frau in einem langen roten Kleid, huscht an mir vorbei und beschwert sich über befallene Produkte im hydroponischen Garten, und der weißhaarige Mann, der sie begleitet, erwähnt Chinakohl. Ihre Worte haben für mich keine Bedeutung, sie sind Bruchstücke von Leben, die nicht die meinen sind und die ich daher nicht verstehe. Möglicherweise faszinieren sie mich deshalb so sehr.
Ich erreiche die Aufzüge, aber anstatt mich in die lange Schlange einzureihen und nach unten zu fahren, betrete ich eine Plattform, die sich nach oben bewegt. Niemand sonst will in diese Richtung, und die Plattformen über und unter mir sind leer, soweit ich das erkennen kann. Ich fahre an der Trennwand vorbei und gelange zu Ebene vier, der Verwaltungsebene, auf der Büros und Konferenzräume untergebracht sind. Das alles interessiert mich nicht, und ich recke den Hals und sehe zu, wie der Aufzug die Decke erreicht und zu Drei weitergleitet. Dem Kontrollraum der Station.
Dort steige ich aus und stehe in einem kleinen Vorraum aus vier Metallwänden, die den Aufzug komplett umgeben. Abgesehen von einer Bank, einer künstlichen Pflanze und einem gerahmten Bild ist der Raum leer. An den beiden Türen, die hinausführen, sind Tastenfelder und Netzhautscanner angebracht, offensichtlich hat hier nicht jeder Zutritt.
Ich steige wieder in den Aufzug und fahre auf Ebene zwei, die genauso aussieht wie Ebene drei, nur, dass ein anderes Bild an der Wand hängt. Dort halte ich die Finger über das Tastenfeld und bin gespannt, ob irgendeine Erinnerung oder eine Art Anweisung in mir aufsteigt, aber es passiert nichts. Also lasse ich die Hand wieder sinken und drehe mich genau in dem Augenblick zum Aufzug um, in dem die Tür aufgeht und ein Offizier herauskommt. Er prallt mit mir zusammen, und ich mache bei dem Körperkontakt einen Satz nach hinten und rümpfe die Nase, als der süßsaure Geruch mit einem Mal intensiver wird. Der Mann muss ein sehr starkes Aftershave benutzen.
»Was machst du hier oben? Diese Ebene darf nur von Technikern und Militärangehörigen betreten werden.« Er mustert meinen grauen Overall kritisch.
Ich muss wieder an meine Unterhaltung mit Michael denken. Keine Sorge, uns passiert dabei nichts, das verspreche ich dir.
»Ich wollte nur wissen, ob es stimmt«, erwidere ich.
»Ob was stimmt?«
»Dass man nicht an der Decke zerquetscht wird, wenn man vergisst, aus dem Aufzug auszusteigen.«
Er lacht los. »Wer hat dir denn das erzählt?«
Ich zucke mit den Schultern. »So ein Junge auf Ebene fünf. Er hat gesagt, ich würde mich nicht trauen, raufzufahren und es zu versuchen, aber ich habe Angst bekommen und bin hier ausgestiegen.«
Sein Misstrauen ist verschwunden, und nun ist er wider Willen amüsiert. »Kinder«, stößt er hervor. »Wenn ich für jedes Mal einen Milicred bekäme, dass ich das höre, dann wäre ich längst ein reicher Mann.«
Ich verkrampfe, als er mir eine Hand auf die Schulter legt und mich sanft in Richtung Aufzug schiebt, aber mit einem kurzen Blick vergewissere ich mich, dass er keinen Halbstern auf der Uniform trägt. Daher lasse ich zu, dass er mich zu der Seite führt, über die ich wieder nach unten gelange.
»Geh zurück zu deinen Freunden, Kleine, und versuch, keinen Ärger zu bekommen. Denk immer daran, wir finden es heraus, wenn du vom rechten Weg abkommst«, warnt er mich und tippt mit wichtiger Miene auf den in seine Handfläche eingelassenen Chip. Ich mustere meinen eigenen. Dann ist das nicht nur ein Gerät, mit dem ich mich ausweisen und bezahlen kann, sondern man kann mich darüber auch überwachen. Das hätte ich mir eigentlich denken können.
Der Offizier lässt mich nicht aus den Augen, während ich auf die nächste Plattform nach unten warte. Als ich einsteige, ruft er mir widerstrebend hinterher: »Wenn du noch mal auf Erkundungstour gehen willst, versuch’s auf Ebene dreizehn, da gibt es eine Beob…«
Ich kann ihn nicht mehr hören, weil die Plattform die Ebene verlassen hat. Nicht, dass es von Bedeutung wäre. Ich habe nicht das geringste Interesse daran, mich wie ein neugieriges Kind auf der Station umzusehen – es sei denn, meine Mission kann davon profitieren. Ich durchforste meinen Kopf nach Anweisungen, da mich meine Erschaffer doch bestimmt nicht ohne irgendwelche Instruktionen zur Durchführung meines Auftrags losgeschickt haben.
Aber da ist nichts.
In mir steigt Unruhe auf, aber ich schüttle sie wieder ab. Wenn es etwas gäbe, das ich wissen müsste, dann würde ich mich ganz bestimmt daran erinnern, davon bin ich überzeugt. Wieder einmal nagt an mir dieses Gefühl, dass da noch etwas war, dass ich auf dem Transportschiff etwas hätte erledigen sollen.
Aber ich lasse diesen Gedanken einfach los. Jetzt ist es sowieso unwichtig. Noch dreiunddreißig Stunden, fünfundfünfzig Minuten und neunundvierzig Sekunden. In kurzer Zeit ist das alles nicht mehr von Bedeutung.
Die Ebenen schweben an mir vorbei, und ich überlege, was ich als Nächstes machen soll. Da mir noch so viel Zeit zur Verfügung steht, sollte ich vielleicht mein Quartier aufsuchen und mein Bettzeug dort deponieren.
Daher steige ich auf Ebene acht aus und bahne mir einen Weg zwischen einer Gruppe von Flüchtlingen hindurch, um nach Frachtraum 8A zu suchen. Ich habe Glück und kann ihn ohne größere Schwierigkeiten finden. Der Frachtraum sieht fast genauso aus wie der, in dem mich PsyLt Rowan vor wenigen Stunden auf der Station aufgenommen hat. Auch hier hat man die ganze Fracht an die Seiten geschoben, um in der Mitte Platz für lange Reihen mit Prischen zu schaffen. Allerdings sind die Reihen mittlerweile unordentlich, da einige der eintreffenden Flüchtlinge ihre Pritschen zusammengeschoben und Decken rundum aufgehängt haben, um in diesem riesigen Raum wenigstens ein Minimum an Privatsphäre genießen zu können.
Ein Offizier, der an der Wand gelehnt hat, kommt auf mich zu, als ich weiter in den Raum hineingehe. »Den Chip, bitte.«
Ich halte ihm meine Handfläche hin, und er scannt sie mit seinem Pad. »Johansen, Lia. Ja, Frachtraum 8A ist korrekt. Die Hygieneeinheiten sind dort hinten«, er deutet in eine Ecke, »und da. Such dir einfach eine Koje aus.«
»Sie sind nicht zugewiesen?«
»Tja, ursprünglich war das so geplant, aber …« Er verzieht das Gesicht und deutet mit einer Hand auf das Chaos.
Ah. Ich nicke verständnisvoll und entdecke eine leere Pritsche neben einem älteren Paar. Die beiden können wundersamerweise schlafen, trotz des grellen Lichts und des Stimmengewirrs um sie herum. Sie haben ihre Pritschen zusammengeschoben und halten sich an den Händen. Im Tiefschlaf sehen sie gar nicht mehr aus wie Flüchtlinge, die in einem Frachtraum voller anderer Leute liegen, sondern wirken wie ein Paar in seinem eigenen Bett, und jeder von ihnen erfreut sich der Gewissheit, dass er nicht allein ist. Ich fühle mich wie ein Eindringling, deshalb schiebe ich meine Pritsche so weit wie möglich an die Wand.
Mein Bündel enthält Bettzeug, eine dünne Matratze, ein Laken und eine Decke, die ich auf meine Pritsche lege. Dann starre ich mein neues Bett sehnsüchtig an, ich bin ziemlich erschöpft, obwohl es nach Stationszeit gerade mal Mittag ist. Ich weiß auch, dass ich bei der ganzen Unruhe um mich herum ohnehin nicht schlafen könnte. Zu schade, dass ich nicht länger Lia bin. Sie hätte sich in dieses Nest gekuschelt und wäre sofort eingeschlafen. Sie konnte überall schlafen. Ich bin mir sicher, dass sie nicht diese nagende Unruhe gespürt hätte, die mir zu schaffen macht, seitdem die Erinnerungsüberlagerung zerbrochen ist.
Da ich nicht schlafen kann, stelle ich mich in die Schlange vor den Hygieneeinheiten. Es dauert lange, bis ich endlich unter die Dusche kann, aber es ist die Wartezeit wert, auch wenn ich danach meine Ersatzklamotten aus dem Transportschiff anziehen muss, die auch nicht viel sauberer sind als das, was ich vorher getragen habe. Wenigstens habe ich jetzt wieder saubere Haare, und der zuvor verfilzte Pferdeschwanz fällt mir jetzt in feuchten Strähnen auf den Rücken.