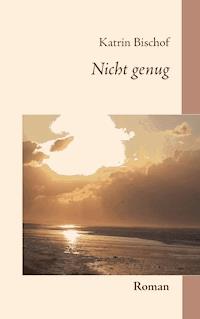
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erik ist krank; schwer krank. Längst schon hat er sich mit seinem Dasein als Schwerbehinderter abgefunden, der versucht, „das Beste draus zu machen“, als er ganz unerwartet die große Liebe findet - in Gesa, die ihn so annimmt, wie er ist. Mit ihr, die aus einer sehr anderen Welt kommt, scheint für ihn noch so mancher Traum wahr werden zu können. Aber auf das rauschhafte Glück folgt schon bald darauf ein umso tieferer Absturz… Die tragisch verlaufende Liebesgeschichte von Gesa und Erik bildet den Hintergrund, vor dem Fragen aufkommen, die gerade aktuell sehr kontrovers diskutiert werden. Wie stirbt es sich „selbstbestimmt“ in einer Gesellschaft, die den Tod als vermeidbaren Unfall ansieht und seine Realität verdrängt? Die Schwerkranke zwingt, zu „funktionieren“, Rücksicht auf die Ängste ihres Umfelds zu nehmen, „da zu bleiben“, bis zum bitteren Ende?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für J.E.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Kapitel 19.
Kapitel 20.
Kapitel 21.
Kapitel 22.
Kapitel 23.
Kapitel 24.
Kapitel 25.
Kapitel 26.
Danksagung
Es überraschte Gesa nicht, dass sie nicht zur Beerdigung eingeladen worden war.
Mareike hatte irgendwann noch zu ihr gesagt: »Du solltest dich beizeiten informieren, wie Beerdigungen in den Niederlanden ablaufen, was man anzieht, ob man Blumen mitbringt und so weiter.« So war Mareike eben; man muss alles manierlich über die Bühne bringen und sich an die Regeln halten; das war für sie eine völlige Selbstverständlichkeit. Darum hatte sie auch überhaupt nicht daran gezweifelt, dass man Gesa Bescheid sagen würde. Aber Gesa hatte schon damals nicht mehr ernsthaft damit gerechnet.
Joke hatte ihr Bescheid gesagt. Aber erst, als alles vorbei war. Es machte Gesa nichts aus. Eine Beerdigung war für ihr Empfinden nichts weiter als eine Show für die Lebenden, die den Toten nichts mehr anging. Ihr hätte nichts daran gelegen, den reibungslosen Ablauf dieses letzten Aktes durch ihre Anwesenheit zu stören.
Joke hatte ihr eine Nachricht aufs Handy geschickt. Gesa wusste, was in der Nachricht stand, als sie den kleinen gelben Umschlag und Jokes Namen daneben auf dem Display sah. Es hatte nichts anderes sein können.
Elina war in die Küche gekommen, um ihr das neue Armband zu zeigen, das sie geknüpft hatte.
»Guck mal, Mama«, sagte sie stolz und streckte Gesa ihr Handgelenk hin. »Wie findest du es?«
»Schön«, sagte Gesa. »Ganz schön, Süße.«
»Das ist das Fischgrätmuster. Habe ich heute neu gelernt. Wenn du es magst, mache ich für dich auch eins, in deinen Lieblingsfarben. Aber du guckst ja gar nicht hin.«
»Entschuldige«, sagte Gesa. »Ich habe eine Nachricht von Joke bekommen.«
Die dunklen Kinderaugen unter den langen Wimpern wurden ernst. »Ist Erik gestorben, Mama?«
»Ja«, antwortete Gesa. »Erik ist gestorben. Vor zwei Wochen.«
Elina kroch auf ihren Schoß und schlang ihren dünnen Arm um Gesas Nacken. Gesa drückte den schmalen, tröstlich warmen Körper dankbar an sich.
»Aber das ist doch besser für ihn«, sagte sie. »Oder, Mama?«
»Ich glaube schon.« Gesa seufzte. »Denn er konnte so nicht mehr leben.«
»Bist du jetzt traurig?«, fragte Elina.
»Ich weiß nicht. Ich bin so lange schon traurig gewesen. Vielleicht bin ich jetzt auch nur erleichtert.«
Elina sah sie stirnrunzelnd an. »Was bedeutet ›erleichtert‹?«
»Froh, dass es vorbei ist.«
Sie nickte. »Verstehe. Vor allem für ihn, nicht?«
»Ja. Du bist so schlau, meine Kleine.«
Elina drückte ihr mit gespitzten Lippen einen leise knallenden, schmetterlingszarten Kuss auf die Wange. »Kann ich dann bald wieder mit Rick und Louisa spielen, Mam?«
»Ich weiß es nicht… Wir werden sehen.«
Plötzlich hatte Elina es eilig, von ihrem Schoß herunterzukommen. »Ich mach mit meinen Armbändern weiter, okay?«
Eine lange Weile noch saß Gesa an dem riesigen Küchentisch aus massivem Sheeshamholz, den Erik und sie gemeinsam ausgesucht hatten. Sechs Personen passten um diesen Tisch herum, und sechs Stühle hatte sie dazu gekauft. Mit cremeweißen Stuhlkissen dazu, denn die hatte er lieber gemocht als die braunen, die sie genommen hätte, weil man Flecken darauf nicht so sah. Gesa hatte fröhliche Sonntagmorgenbrunches vor Augen gehabt. Oder einen gemütlichen Winterabend mit Entenbraten und Rotkohl und Semmelknödeln. Mit sechs Personen, einem Mann, zwei Frauen und drei Kindern. Und über die Flecken auf den cremeweißen Stuhlkissen hätte sie großzügig hinweggesehen.
Joke hatte das Gesicht verzogen, als Gesa sie zu Entenbraten, Rotkohl und Knödeln eingeladen hatte. »Ente? Hab ich noch nie gegessen… Kommt mir irgendwie komisch vor.« Sie hatte zweifelnd den Kopf gewiegt, mit leicht vorgeschobenem Unterkiefer und einem Runzeln ihrer unsichtbaren hellblonden Augenbrauen. »Kannst du nicht Huhn stattdessen machen? Und Knödel… Das ist auch so was typisch Deutsches, oder? Ich weiß nicht, ob wir das mögen.«
Vier der sechs Kissen auf den Stühlen waren noch immer fleckenlos cremeweiß.
Erik schaute aus dem Bilderrahmen an der Wand auf Gesa herab. Das Foto war im Sommer des vorletzten Jahres aufgenommen worden, während des Urlaubs auf dem Campingplatz. Er trug einen Strohhut mit bunt gestreifter Binde und ein »Werner – das muss kesseln!«-T-Shirt. Im Gesicht hatte er ein Grinsen, das wohl verwegen sein sollte. Aber in seinen Augen sah sie die schüchterne, beinahe ehrfürchtige Zärtlichkeit, mit der er ihr immer begegnet war. Gesa war sicher, dass er an sie gedacht hatte, als das Foto geschossen wurde.
Sie wusste, dass sie sich etwas vorgemacht hatte mit ihrem Traum von der großen, glücklichen Familie. Er hätte eine Entscheidung treffen müssen, früher oder später, und vielleicht war es der einzige ehrenhafte Ausweg, der ihm irgendwann noch geblieben war: zu sterben.
1.
An diesem Dienstag hatte Robert wieder die Ruhelosigkeit überfallen.
Gesa hatte Elina zur Schule gebracht und spürte es sofort, als sie um kurz vor halb neun zurückkam. Er saß hinter seiner Zeitung verschanzt beim Frühstück, noch in seiner grauweißgestreiften, Gesa immer an Sträflingskleidung erinnernden Pyjamahose und verblichenem grauen T-Shirt. Sein Knie zuckte in einem eigensinnigen Rhythmus auf und ab, als hätte es sich selbständig vom Rest seines Körpers gemacht. Gesa hatte ihm einen guten Morgen gewünscht, den Computer eingeschaltet und sich an die Arbeit gemacht. Am Dienstag musste sie nicht in die Schule. Sie nutzte diesen einzigen freien Morgen in der Woche gerne, um so viele der Deutschstunden wie möglich vorzubereiten, die sie bis Ende der Woche noch zu geben hatte.
Gesa hörte das Rascheln der Zeitung, Roberts Räuspern und das lauter werdende Rauschen und Brodeln des Wasserkochers, als er sich mehr Kaffee machte. In dieser Wohnung hatte jeder sein eigenes Zimmer, aber aus irgendeinem Grunde fand trotzdem alles in dem riesigen, hufeisenförmig geschnittenen, Küche, Wohn- und Esszimmer umfassenden einen Raum statt: Spielen, Arbeiten, Kochen, Verzehren von Mahlzeiten. Manchmal fand Gesa das gemütlich. Aber oft genug hätte sie auch lieber eine Tür hinter sich zugemacht, um all den Geräuschen und Gerüchen nicht mehr ausgesetzt zu sein.
Gegen zehn war Robert zu ihr herübergeschlendert, inzwischen in Trainingshose, aber immer noch mit dem Drei-Tage-Bart im Gesicht. Lange hatte er am Fenster gestanden und hinaus auf den menschenleeren Platz vor dem Haus gestarrt, in das trübe, feuchtkalte Februarwetter. Schließlich hatte er sich mit seiner Kaffeetasse an das Laptop gesetzt und war in die Tiefen des Internets abgetaucht. Seine festen Anlaufpunkte jeden Tag waren zunächst verschiedene internationale Online-Zeitungen und -Magazine. Von dort aus ließ er sich einfach treiben. Das allein hätte Gesa wohl gar nicht so sehr gestört (immerhin war er Rentner, wie sie sich immer wieder vor Augen hielt, und hatte somit das Recht, ziellos in den Tag hineinzuleben), wenn er nicht die enervierende Angewohnheit gehabt hätte, irgendwelche Clips einfach drauflos abzuspielen. Das fröhlich schmetternde Gestampfe von Cajun-Musik, Ausschnitte aus den von Robert so verehrten Akira Kurosawa-Filmen, natürlich in japanischer Sprache (die für ihre Ohren abgehackt und immer bedrohlich aufgeregt klang), ein Zusammenschnitt sämtlicher in »Fargo« geäußerter »Yeahs«: Alles, wirklich alles, konnte jederzeit ohne Vorwarnung auf Gesa abgefeuert werden. Diesmal war es das sonore Organ von Bill Cosby, das, untermalt von kreischenden Konservenlachsalven, hinter ihrem Rücken losdröhnte.
Robert lachte, ein leises, glucksendes Kichern, das unversehens in schallendes Hahaha überging. »Das hier ist lustig… Willst du dich nicht eben mal zu mir setzen?«
»Eigentlich nicht, ich habe zu tun. Könntest du das bitte ein bisschen leiser machen?«
Am liebsten hätte sie Kopfhörer aufgesetzt oder den Raum verlassen. Sie tat es nicht, denn sie fand, dass er schließlich ebenso gut Kopfhörer aufsetzen oder den Raum hätte verlassen können.
»Wolltest du nicht anfangen, diesen Artikel von Amnesty International zu übersetzen?«, fragte sie ihn, als der Clip zu Ende war.
»Ja, das sollte ich wohl…« Er reckte sich und gähnte.
»Keine gute Nacht gehabt?«
»Nein… Wieder wach gelegen von zwei bis fünf. Wie spät ist es?«
Gesa hätte ihn beinahe darauf hingewiesen, dass der Bildschirm rechts unten die Uhrzeit anzeigte. Aber sie unterließ es. »Zehn vor elf«, sagte sie.
»Ich glaube, dann werde ich bald mal mit den Vorbereitungen fürs Mittagessen beginnen.« Er gähnte wieder, nahm seine Kaffeetasse und stand auf. Gesa musterte den Wohnzimmertisch. Dort, wo die Tasse gestanden hatte, war jetzt ein Kaffeering auf der Glasplatte. Sie widerstand dem Drang, in die Küche zu laufen und ein Papiertuch zu holen.
»Ich schalte das Laptop aus, wenn du es nicht mehr brauchst«, rief sie Robert hinterher. »Strom ist schon wieder teurer geworden.«
Er machte sich in der Küche zu schaffen; öffnete und schloss Schränke, klapperte mit Geschirr; hackte irgendetwas. Der durchdringende Geruch gebratener Zwiebeln wehte aus der Küche zu ihr herüber.
»Was machst du?«
»Kürbissuppe vorweg. Und danach Salat, Gnocchi und Broccoli.«
Wenigstens kochte er. Das war schon mal viel wert.
Um zwölf holte Gesa Elina von der Schule ab. Neben den Partien Mensch-ärgere-dich-nicht oder Memory, die sie alle drei mit Leidenschaft ausfochten, Abend für Abend, bevor es für Elina Zeit war, zu Bett zu gehen, waren die Mahlzeiten zu dritt das, was Gesa an Roberts Besuchen mittlerweile am meisten schätzte. Es war schön, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen und Essen vorgesetzt zu bekommen, das jemand anders zubereitet hatte. Robert gab sich große Mühe, auf die Vorlieben aller einzugehen, was rührend war. Aber sie aßen alle nicht nur mit mehr Appetit, es wurde auch viel mehr geredet bei Tisch, wenn er da war. Elinas und Gesas Mahlzeiten zu zweit verliefen meist recht einsilbig, denn das Kind war wenig gesprächig und Gesa zwar stets ansprechbereit, doch in Gedanken oft anderswo. Ihr Nichtreden störte weder sie noch Elina (nahm sie zumindest an), aber mit Robert war es schon etwas anderes; der graue Alltagsbrei erhielt bunte Farbtupfer. Er stellte Elina detaillierte Fragen, darüber, ob sie ihre Lehrerin mochte, welche Klassenkameraden sie zu ihrem Geburtstag einladen wollte, was sie in der letzten Turnstunde gelernt hatte, mit denen er diese sonst sehr kontrollierte, knapp Sechsjährige zu Reaktionen brachte, die einen gewissen Einblick in ihre ansonsten sorgfältig abgeschirmte Gefühlswelt gaben. Das konnte manchmal nur ein Augenrollen oder Schulterzucken sein, aber es zeigte doch, dass Elina über die Dinge ihre ganz eigene Meinung hatte. Sehr oft gelang es Robert, sie aus der Reserve zu locken und in regelrechte Diskussionen zu verwickeln, in deren Verlauf sich für alle erstaunliche Erkenntnisse ergaben. Er fand immer einen Anknüpfungspunkt und hatte – wenn es um Elina ging – ein erstaunlich gutes Gedächtnis, selbst für banalste Kleinigkeiten.
»Wie hieß doch gleich nochmal dieser Junge, der neulich von deiner Lehrerin aus dem Klassenzimmer geschickt wurde? Jordi?«
»Ja«, sagte Elina. »Weil er nur Quatsch gemacht hat.«
»Und geht es denn jetzt besser mit ihm? Ich meine, macht er nicht mehr ganz so viel Quatsch?«
»Doch, immer noch. Gestern hat er Nienke seinen Kaugummi ins Haar geklebt. Und die hat geheult.«
»Das kann ich mir vorstellen. Bestimmt musste ihre Mutter ihr die Haare abschneiden.«
Elina nickte. »Ja, an der Seite fehlt jetzt was, das fand Nienke auch ganz schlimm. Warum machen Jungs eigentlich immer so viel Quatsch, Robert?«
»Tja…« Robert überlegte kurz. »Es hat viel damit zu tun, dass Jungs Mädchen beeindrucken wollen.«
»Was heißt ›beeindrucken‹?«
»Sie wollen, dass die Mädchen glauben, dass sie alles können und wissen.«
»Wirklich?« Elina verdrehte die Augen. »Warum wollen sie das denn bloß?«
»Es steckt so in ihnen drin. Sie können nicht anders.«
Elina winkte mit einer Handbewegung ab, die der einer Fünfzehnjährigen an Lässigkeit in nichts nachstand. »Also, mich beeindruckt es nicht, wenn sie Quatsch machen.«
»Du bist ja auch ein kluges Mädchen, das selbst sehr beeindruckend ist.«
Elina kicherte, nahm diese Aussage aber ansonsten wie selbstverständlich hin. »Und, hast du auch Quatsch gemacht, damit Mama glaubt, dass du alles kannst und weißt?«
»Sicher.« Robert verzog das Gesicht zu einem Lächeln, das vielleicht eine Spur angespannt war. »Aber deine Mama ist genau wie du, sie kann und weiß selbst eine ganze Menge, da hilft Quatsch machen auch nichts.«
Elina überdachte es einen Moment, dann verkündete sie: »Ich finde, du kannst gut kochen. Und vorlesen und Geschichten erzählen.«
»Quatsch ist ja auch nicht nur schlecht«, sagte Gesa, die Roberts Blick auf sich ruhen fühlte. »Man sollte nur wissen, wann Schluss mit dem Quatsch sein muss.«
»Ich hoffe, das habe ich immer gewusst.« Roberts Lächeln hatte sich noch etwas mehr verkrampft.
Gesa sagte nichts, obwohl sie wusste, dass sie das, was er hoffte, nun bestätigen sollte, und fing stattdessen an, den Tisch abzuräumen. Elina fragte Robert, ob er noch einen Clip mit ihr sehen würde. Die beiden setzten sich an den PC, Elina auf Roberts Schoß. Kurz darauf ein Ernie-und-Bert-Dialog über ein Stück Schokoladenkuchen, dessen Verschwinden der listige Ernie dem Krümelmonster in die Schuhe zu schieben versuchte. Gesa hörte beide laut lachen. Robert hatte ihr einmal erzählt, dass seine Exfrau immer gesagt hatte, er sei nur für den Spaßpart gut gewesen. Lange hatte sie nicht verstanden, was die Exfrau damit eigentlich gemeint hatte.
Elina musste zurück zur Schule gebracht werden. Robert fragte Gesa, ob sie auf dem Rückweg eben schnell Kaffee aus dem Spar-Laden mitbringen könne.
»Wenn du absolut nicht ohne kannst… Um zwei muss ich schon los.«
»Wo geht es heute nochmal hin?«
»Konversationskurs an der Sprachschule. Wie nun schon seit anderthalb Jahren jeden Dienstagnachmittag.«
»Richtig, heute ist ja Dienstag. Entschuldige, ich vergesse manchmal, welchen Tag wir haben.«
Er hätte jetzt sagen müssen, dass er sich seinen Kaffee eigentlich auch ohne weiteres selbst holen könnte. Aber er sagte es nicht. Und auch sie sagte es nicht. Es stimmte ja, sie kam sowieso am Spar-Laden vorbei, es war kein großer Aufwand für sie. Dennoch, irgendetwas war falsch daran. Aber das hätte er schon von selbst erkennen müssen.
Als sie zurückkam, saß Robert wieder auf dem Sofa vor dem Laptop.
»Ich habe das Geschirr abgewaschen«, eröffnete er ihr.
»Schön, danke.« Sie wusste, dass er mehr Lob erwartete. Willst du jetzt wieder einen Orden, neckte sie ihn manchmal. Aber heute war ihr nicht danach.
»Darf ich kurz das Fenster aufmachen?«, fragte sie. »Hier stinkt es nach Essen.« In Wahrheit wollte sie Kälte ins Zimmer lassen, die ihn aufscheuchte, hoch von seinem gemütlichen Sofa, hinter dem Laptop weg, aus seiner undurchdringlichen Selbstabsorbiertheit.
Die Pfanne war noch ölig, im Kunststoffbehälter schwamm das schmutzige Abwaschwasser, und die Kochfläche war voller Fettspritzer und Soßenflecken. Gesa spülte die Pfanne noch einmal nach, kippte das Wasser mit einem wütenden Schwung weg und wischte den Herd sauber. Zwanzig nach eins; kaum noch Zeit für die Vorbereitung. Sie würde sich auf dem Weg nach Emmen etwas ausdenken. Vielleicht konnte sie den Konversationskurs über die gerechte Aufteilung der Hausarbeit diskutieren lassen.
Während der zehnminütigen Fahrt nach Hause rekapitulierte Gesa die vergangenen anderthalb Stunden.
Insgesamt war sie zufrieden, auch wenn die Unterhaltung heute – gerade im Vergleich zur vergangenen Woche, als sie über die Daseinsberechtigung der niederländischen Monarchie hatte debattieren lassen – eher behäbig dahingeplätschert war. Ihre fünf Kursteilnehmer, zwei Herren, drei Damen, waren alle über sechzig, seit vierzig Jahren verheiratet oder auch schon verwitwet. Falls sie jemals Kämpfe um die gerechte Aufteilung der Hausarbeit geführt hatten, waren diese anscheinend schon seit langem ausgefochten.
Der Kurs schätzte seine feste Routine, und so hatten sie zunächst wie immer gemeinsam das zum Thema gehörige Wortfeld beackert. Immerhin, dabei war doch allerhand Interessantes zusammengekommen, neben dem unverzichtbaren, eher prosaischen Grundvokabular auch zwei, drei dieser durch und durch idiomatischen Redewendungen, nach denen der leidenschaftliche Sprachenlerner so unermüdlich auf der Jagd ist wie ein nach kostbaren Perlen suchender Taucher. Nach einem grammatischen Abstecher in die Tücken der deutschen Adjektivdeklination von stark über schwach durch alle Fälle hatten die fünf dann freundlich Konversation darüber gemacht, wie sie und ihre Partner das Problem der gerechten Aufteilung des Haushaltes denn nun bewältigt hatten. Wobei es sich für Gesa so angehört hatte, als sei da eigentlich gar kein Problem gewesen. »Es hat eben jeder seine Rolle gefunden«, hatte eine der Damen es auf den Punkt gebracht, und die anderen hatten zustimmend genickt. Ganz so, als habe sich das automatisch von selbst ergeben müssen, früher oder später.
Zum Schluss hatte Gesa noch für eine heitere Note gesorgt, ein Manöver, das immer gut ankam. Sie hatte die von Psychologen aufgestellte (und angeblich durch seriöse Studien untermauerte) These in den Raum geworfen, nach der Männer, die im Haushalt mithelfen, von ihren Frauen dafür mit mehr Sex belohnt werden. Einer der beiden Herren hatte ein bisschen herumgewitzelt, wie schade es doch sei, dass man das nicht schon vor zwanzig Jahren herausgefunden hatte, als er noch bereit und physisch in der Lage gewesen sei, für Sex so ziemlich alles zu tun, während eine der Damen verschmitzt gekichert und gemeint hatte, dass ihr Mann sie auch heute noch ganz schön in Wallung bringe, wenn er da so auf der Leiter stehe und Fenster putze. »Ja, siehst du, genau da liegt das Problem«, hatte Herr Nummer eins gefeixt, »all diese Zipperlein, die man im Alter so hat. Auf Leitern steigen, das ist ja heute schon ein Angehen.« Alle hatten gelacht. »Und wie ist das bei dir?«, hatte ihr zweiter Herr, einer der langjährig Verheirateten, Gesa keck gefragt. »Welche Belohnung kriegt dein Mann, wenn er mithilft?«
Um zwanzig nach vier kam Gesa beim Hort an. Sie brachte Elina schnell zur Turnstunde, half beim Aufbau der Geräte und fuhr nach Hause.
2.
Robert hatte sich über anderthalb Stunden lang auf dem Sofa im Wohnzimmer hin- und hergewälzt, gähnend, dann wieder ächzend im Halbschlaf, während Gesa Vokabeltests korrigierte und die Donnerstagsstunde bei Agrofeed vorbereitete, einem Futtermittelhersteller in Emmen, der so abhängig von seinen deutschen Kunden war, dass er sich die Verbesserung der Sprachkenntnisse seiner Mitarbeiter einiges kosten ließ. Die Geräusche vom Sofa gingen Gesa auf die Nerven. Sie wollte Robert sagen, dass er in sein Zimmer verschwinden und sich ins Bett legen sollte, wenn er müde war, aber sie hielt die Worte mit aller Macht zurück. Er sollte nicht das Gefühl haben, sich hier nicht frei bewegen zu können. Und außerdem lag er auch so schon zu viel im Bett, tagsüber, wenn nicht die Zeit dafür war.
Um halb sieben Uhr holte sie Elina von der Turnstunde ab. Auf dem Rückweg ertappte sie sich bei dem Wunsch, nach Hause zu kommen und die Wohnung leer vorzufinden.
Robert hatte sich vom Sofa hochgerappelt und war wieder in der Küche. Er fragte Elina, was er ihr zum Abendbrot machen sollte. Elina sagte, dass sie keinen Hunger hatte. Aber als sie sah, wie Robert die vom Mittagessen übriggebliebenen Gnocchi in eine Pfanne tat, fragte sie: »Kann ich davon auch welche haben?«
Gesa saß am Schreibtisch und hörte Robert gereizt antworten: »Ich habe dich gerade gefragt, und du hast gesagt, du wolltest nichts essen. Du bist alt genug, um dir zu überlegen, was du willst. Ich bin doch nicht dein Zirkuspferd.«
Elina kam zu Gesa herüber und sah sie verwirrt an. »Mama, was habe ich falsch gemacht?«, flüsterte sie.
Nachdem Gesa Elina gute Nacht gesagt und Robert ihr die übliche Viertelstunde lang vorgelesen hatte, sprach sie ihn darauf an.
»Ich habe ihr gesagt, dass es mir leid tut«, sagte Robert reumütig. Gesa hatte keinen Zweifel daran, dass es ihm wirklich leid tat. In den bald fünf Jahren, die er nun schon bei ihnen ein- und ausging, hatte er nicht ein einziges Mal ungehalten mit Elina gesprochen. Und er hatte sich immer die größte Mühe gegeben, mit einer gewissen Beständigkeit für sie da zu sein, auch wenn er nicht in Stimmung war oder Kopfschmerzen hatte. Weit mehr Mühe als bei Gesa. »Ich hätte sie nicht so anfahren dürfen. Aber ich war müde und unzufrieden mit mir selbst, weil ich heute Nachmittag nichts geschafft habe. Ich weiß auch nicht, dieser Artikel… Ich komme einfach nicht in Gang. All diese Zahlen und Organisationsnamen. Aber sie scheinen meine Arbeit ja sehr zu schätzen.«
»Natürlich tun sie das«, sagte Gesa. »Du warst vor Ort, du weißt, wovon die Leute reden. Und für dich ist es auch gut, etwas Sinnvolles zu tun zu haben.«
»Morgen werde ich ganz bestimmt anfangen… Und du, was hast du noch zu tun?«
»Siebenundzwanzig Vokabeltests, dann ist es geschafft.«
»Wollten wir nicht zusammen die Stunde für deinen Businesskurs am Donnerstag vorbereiten?«
»Das habe ich schon erledigt. Während du geschlafen hast.« Gesa zwang sich zu einem Lächeln.
»Ich habe nicht geschlafen… Warum hast du nichts gesagt? Ich hätte dir sehr gerne geholfen.«
»Du machtest nicht den Eindruck, wirklich ansprechbar zu sein.«
Gesa wandte sich wieder ihrer Arbeit zu, er nahm seine Zeitung zur Hand. Diesmal setzte sie tatsächlich Kopfhörer auf; das Rascheln lenkte zu sehr ab.
Um zwanzig nach neun schaltete sie den PC aus.
»Und jetzt?«, fragte er. »Fertig für heute?«
Gesa nickte. »Sagte ich doch.«
Er fragte sie, ob sie sich nicht neben ihn setzen wolle. Sie schüttelte den Kopf und blieb in ihrem Schreibtischstuhl ihm gegenüber sitzen.
»Schade.« Er lächelte, was bei ihm immer ein wenig traurig wirkte, und Gesa bemerkte, wie abgespannt und müde er aussah. Aber es war einzig und allein sein Problem, dass er sich davor drückte, etwas gegen seine hartnäckigen Schlafstörungen zu unternehmen.
»Ich glaube, ich gehe ins Bett«, sagte sie.
»In dein eigenes?«
Sie wusste, dass er enttäuscht war, aber sie blieb hart. Heute Abend verspürte sie nichts als Widerwillen gegen das, was er im Sinn hatte; gegen den Akt an sich, vor allem aber gegen das, was mit Sicherheit darauf folgen würde, den betäubungsähnlichen Schlaf, in den er so oft binnen Sekunden fiel, nachdem er sich an ihr getröstet und berauscht hatte. »Das war es, woran ich dachte, ja. Und vielleicht solltest du das auch tun. In dein Bett gehen, meine ich.«
»Vielleicht solltest du mal den Vermieter anrufen, damit er nach der Heizung in meiner Klause schaut.« Klause, so nannte er das Zimmer, das sie für ihn eingerichtet hatte. »Mir ist so kalt da drin.«
»Aber du schläfst doch schon unter drei Decken.«
»Mir ist kalt nachts.« Er hatte jetzt diesen störrischen Gesichtsausdruck, der nichts Gutes verhieß. »Aber du hast ja nun einmal beschlossen, mir die Klause zuzuweisen. Wie du ja auch bestimmt hast, dass wir in die Niederlande ziehen.«
Seine plötzliche Aggressivität überrumpelte Gesa. »Aber du hattest doch damals überhaupt nichts dagegen?« Sie klang wie jemand, der sich im Grunde nicht ganz sicher ist, ob er sich nicht vielleicht doch schuldig fühlen musste. Dabei wusste sie, dass sie keinen Grund hatte, sich schuldig zu fühlen. Wenn er damals vor zwei Jahren Einwände gehabt hatte, hätte er sie vorbringen können.
Er ließ die Zeitung sinken und warf ihr einen dieser leidenden Blicke über den Rand seiner Brille zu. »Hast du mich eigentlich jemals gefragt, ob ich Lust habe, hier in der Agrarwüste der Provinz Drenthe zu hocken, in einem Nest, über dem die meiste Zeit der pestilenzartige Gestank nach Schweinegülle hängt, als ob man eine riesige Käseglocke darüber gestülpt hätte?«
Gesa erinnerte sich blitzartig an das, was Mareike ihr neulich am Telefon eingeschärft hatte. »Aber du hast doch den Mietvertrag mit unterschrieben. Deswegen ging ich davon aus, dass es für dich in Ordnung war.« Dagegen kann er doch einfach gar nichts sagen, hatte Mareike gemeint.
Aber er konnte, durchaus. »Wie hätte ich denn nein sagen sollen. Es bedeutete dir doch so viel. Und ohne meine Unterschrift hättest du diese Wohnung ja nun einmal nicht mieten können. Ich wollte dich glücklich sehen. Und außerdem«, fuhr er schnell fort, bevor sie ihn unterbrechen konnte, »war ich blind vor Liebe. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich diesen Riesenfehler gemacht habe, dir hierher zu folgen.«
Das Wort »Riesenfehler« ließ Gesa brutal werden. »Komm schon, dir war doch alles recht damals«, fuhr sie auf ihn los. »Du hast dich an mich drangehängt, weil es für dich das Bequemste war und dir nichts Besseres einfiel. Und im Übrigen bist du mir eben nicht gefolgt. Du bist nicht hierher gezogen. Du hast immer noch deine Wohnung in Deutschland. Für dich hat sich doch überhaupt nichts geändert.«
An diesem Punkt versicherte er ihr in tragisch-verletztem Ton: »Oh, aber es hat sich alles geändert, alles.«
»Ich sehe nicht, was. Außer dass du jetzt in einen anderen Zug steigen musst, wenn du uns besuchen willst.«
»Die Machtverhältnisse haben sich umgekehrt… Das ist es, was sich geändert hat.«
»Ich verstehe nicht, was du meinst«, sagte Gesa verärgert. »Dass du abhängig von mir bist? Du bist doch ein freier Mensch.«
»Ach ja, bin ich das? Es ist alles eine Frage der Territorialität. Und dies ist dein Territorium.«
»Hör auf.« Gesa fühlte ein hässliches, wütendes Brennen in der Magengrube. »Du kannst tun und lassen, was du willst.«
»Mir scheint, du übst ziemlichen Druck auf mich aus.«
»Sieh mal«, sagte sie beschwichtigend, »es hat vielleicht damit zu tun, dass es hier kein Sicherheitsnetz mehr gibt, das mich auffängt, wenn etwas schiefgeht. Wenn sie mir die Stunden an der Schule kürzen, weil kein Schüler mehr Lust hat, Deutsch zu lernen, oder Agrofeed den teuren Kurs streicht, sobald sie meinen, dass ich ihren Mitarbeitern genug beigebracht habe. Manchmal glaube ich, das ist dir noch nicht ganz klar. Nicht mal auf meine Eltern kann ich noch zurückgreifen. Was ist, wenn ich arbeitsunfähig werde und kein Einkommen mehr habe, oder wenn Elina…«
»Darüber haben wir schon so oft geredet«, fiel er ihr ins Wort. »Und ich habe dir jedes Mal gesagt, dass du dir wegen Geld keine Sorgen zu machen brauchst. Ich bin nicht gerade arm.«
»Aber ich will doch dein Geld gar nicht.« Gesa zögerte, für die Dauer eines Atemzugs, wollte es nicht sagen und konnte dann doch nicht mehr anders. »Ich will einen wirklichen Partner.« Nun stand es im Raum, bedeutungsschwer und nicht mehr zurückzunehmen.
Robert legte die Zeitung beiseite und sah sie stirnrunzelnd an. »Und was bin ich bisher gewesen?«
Ein Dauergast, der seit Jahren einen Platz besetzte, den er nicht ausfüllen konnte. Ein Buckelgeist, der auf ihren Schultern hockte. Ein Parasit, der sich an ihr festgesaugt hatte und alles nahm, was er kriegen konnte. Die bösen Worte schwirrten in Gesas Kopf wie ein Schwarm wilder, giftiger Bienen, den man endlich losgelassen hatte. Gleichzeitig schämte sie sich.
Ihr fiel wieder ein, was ihre Kursteilnehmerin heute Nachmittag gesagt hatte, und es erschien ihr auch jetzt sehr passend. »Ich habe das Gefühl, dass du deine Rolle nicht recht finden kannst«, sagte sie.
»Meine Rolle? Du meinst die Rolle des Hausmännchens, die du für mich vorgesehen hast?«
Jetzt fühlte Gesa die Wut unkontrolliert ihre Kehle hochschießen. »Und welche Rolle ist es, die du für dich selber vorgesehen hast?«, gab sie zurück. »Hast du darüber einmal nachgedacht?«
»Ich weiß nur, dass ich mein Bestes tue, gerade in Bezug auf Elina, und ich denke, das ist eine ganze Menge«, sagte er steif. »Es ist sicher mehr, als die meisten Männer tun würden, die nicht der biologische Vater deiner Tochter sind. Wenn das nicht genug ist, tut es mir leid.«
»Ich wünschte, du würdest das nicht so sagen, als ob es ein Opfer für dich wäre, dich mit meinem Kind abzugeben«, sagte sie.
»Und ich wünschte, du würdest das, was ich tue, mehr schätzen, anstatt mir immer nur vorzuwerfen, was ich alles nicht tue.« Er nahm seine Zeitung wieder zur Hand. »Ich weiß wirklich nicht, was du noch von mir erwartest.«
Gesa antwortete nicht. Wahrscheinlich wusste er das wirklich nicht. Und wie hätte sie es jemandem auch erklären sollen, der spontane Hilfsbereitschaft für Zuverlässigkeit hielt und sich jede Schwäche wie selbstverständlich erlaubte, während sie funktionieren musste, immer; egal, wie müde, krank oder frustriert sie war.
»Vielleicht erwarte ich von dir, dass du damit aufhörst, dich als wehrloses Opfer meiner Herrschsucht zu stilisieren und diesem Ort die Schuld an allem zu geben«, sagte sie schließlich und gab sich Mühe, langsam und unaufgeregt zu sprechen. »Unsere Probleme haben nichts, aber auch gar nichts mit diesem Umzug zu tun.«
»Aber für mich ist das hier ein absoluter Kulturschock.«
»Ein Kulturschock?«, wiederholte Gesa.
»Ich frage mich, wie du das nicht sehen kannst.« Robert machte eine weit ausholende Handbewegung. »Dieses raue, ungehobelte Idiom! Diese beklemmenden, urnenartigen Gefäße in den Fenstern! Diese bäuerische Küche!«
»Ich muss gestehen, dass ich Probleme habe, daran zu glauben«, sagte Gesa gepresst. »Ich meine, du warst Entwicklungshelfer. Du hast in Flüchtlingscamps gehaust und alle möglichen Sprachen gelernt, war da nicht auch dieser komische äthiopische Dialekt…«
»Orominya, eine der Regionalsprachen. Kein Dialekt.«
»Was auch immer.« Gesa zuckte die Schultern. »Ich weiß nicht, wie viele Sprecher diese Sprache hat, aber offenbar war es dir die Mühe wert. Und nun tust du eine europäische Kultursprache als raues, ungehobeltes Idiom ab.«
»Ich finde keinen Zugang dazu.«
»Weil du dir keine Mühe gibst.«
»Möglicherweise fühle ich mich hier einfach nicht willkommen.«
»Weißt du«, sagte sie, »du musst nicht hier sein, wenn du nicht willst. Du kannst auch wieder ins Ausland gehen. Ich hindere dich nicht daran.«
»Aber ich will bei dir und Elina sein.«
»Dann solltest du akzeptieren, dass wir jetzt hier sind und hier bleiben. Und der Ort lediglich ein Katalysator ist, der eine Entwicklung beschleunigt hat, die irgendwann sowieso hätte kommen müssen, und zwar an jedem anderen Ort auch.«
»Siehst du, genau das meinte ich.« Er hob resigniert die Schultern. »Friss oder stirb, das ist es doch, was du mir sagst. Es ist letzten Endes völlig egal, was ich will oder nicht will. Und wenn es mir nicht passt, kann ich gehen.«
Gesa begriff in diesem Moment, dass er Recht hatte. Die Machtverhältnisse hatten sich umgekehrt. Denn es war so, wie er sagte: Zum ersten Mal seit zehn Jahren war es ihr egal, was er wollte oder nicht. Nicht völlig; aber doch so egal, dass sie es darauf hätte ankommen lassen.
Sie fragte sich, was diese tiefen Risse in ihre bis vor einiger Zeit noch betonfeste Überzeugung, dass dieser Mann ein für allemal in ihr Leben gehörte, hatte sprengen können. Es hatte Enttäuschungen gegeben, viele; kleine und später auch größere. Aber sie konnte es nicht an einem bestimmten Ereignis festmachen.
Kennen gelernt hatte sie Robert mit Mitte dreißig. Er war damals dreiundfünfzig gewesen und frisch geschieden. Drei Jahre lang waren sie ein Paar gewesen, wobei räumliche Trennungen von kürzerer und längerer Dauer, die durch seine häufigen Auslandsreisen bedingt waren, immer dazugehört hatten. Dann hatte er sich von einem Tag auf den anderen abgesetzt, spurlos, ohne ein Wort des Abschieds, weil er sich von Gesas Kinderwunsch zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt hatte. In den fast zwei Jahren, die er verschwunden blieb, hatte Gesa von einem anderen das Kind bekommen, das seins hätte sein sollen. Völlig unerwartet hatte sie schließlich eines Tages wieder eine Nachricht von ihm erhalten, da war er gerade bei einem Einsatz auf den Philippinen. Ob sie ihn nicht besuchen kommen wolle, hatte er sie gefragt; er habe nicht aufhören können, an sie zu denken, die ganzen fast zwei Jahre lang nicht. Gesa hatte damals keine Fragen gestellt und ihn eingeladen, nach seiner Rückkehr bei Elina und ihr vorbeizukommen, in ihrer kleinen Heimatstadt, in die sie wieder gezogen war, als sich abzeichnete, dass sie alleinerziehend sein und die Unterstützung ihrer Eltern gut würde gebrauchen können. Er war auch ohne zu Zögern gekommen, anfangs nur am Wochenende und während seiner Urlaube. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand vor drei Jahren war er dann immer länger geblieben, manchmal ganze zwei Monate. So lange, bis er andere Termine hatte oder wieder einmal Zeit für sich brauchte.
»Sag mal…«
Er hob den Kopf. »Ja?«
»Wo wir gerade von ›gehen‹ sprechen… Heute ist Dienstag. Wann fährst du eigentlich wieder nach Hause? Wir hatten doch neulich abgesprochen, dass du eine Woche bleibst und dann wieder fährst, erinnerst du dich? Und nun bist du schon wieder zehn Tage hier.«
»Ich dachte, es liefe diesmal extrem gut«, sagte er. »Darum dachte ich, ich bleibe noch etwas länger.«
»Genau das ist der Punkt«, sagte Gesa. »Du willst so lange bleiben, bis es eben nicht mehr gut läuft. Aber so funktioniert das doch nicht.«
Er sah sie nur stumm an, und in Gesas Brust krampfte sich etwas zusammen. Noch vor einem halben Jahr hätte sie sich nicht vorstellen können, jemals so mit ihm zu sprechen.
Robert sagte immer noch nichts, also redete Gesa weiter. »Weißt du, wir müssen versuchen, da einen Rhythmus reinzukriegen, wir müssen Verabredungen treffen… Nicht mehr dieses Beliebige. Ich möchte auch andere Leute sehen, und die können nun mal nicht spontan, alle haben ihre Verpflichtungen. Das ist bei dir ja ganz anders, ich meine, du bist ja nicht mehr berufstätig, und Freunde hast du auch keine…«
Er zuckte zusammen, und einen Moment lang fürchtete sie, er würde in Tränen ausbrechen.
»Hör zu«, sagte er, und die ungewöhnliche Schärfe seiner ansonsten leisen und eher phlegmatischen Stimme verriet, dass er außer sich war. »Ich glaube, ich bin hier nicht länger willkommen, das war mehr als deutlich. Morgen früh haue ich ab. Du hast jetzt genug auf mir herumgetrampelt.«
Er stand auf und verließ den Raum.
Gesa spürte die Wut wie eine heiße Flüssigkeit aus sich heraussickern und einer hilflosen Panik Platz machen. Ein paar Minuten lang hockte sie zusammengesunken in ihrem Schreibtischstuhl. Dann ging sie hinüber zur Spüle, leerte halbvoll stehen gelassene Tassen mit kaltem Kaffee aus und wusch sie ab, fegte Krümel zusammen, hielt inne, horchte. Sie hörte das Wasser im Badezimmer laufen. Kurz darauf Schritte. Er ging in sein Zimmer. Die Tür schloss sich hinter ihm.
Gesa schlich auf Zehenspitzen in ihr Schlafzimmer. Sie zog alles aus bis auf den Slip, stand fröstelnd und überlegend mitten im Raum. Der karierte Flanellschlafanzug lag auf der Bettdecke. Gesa kam zu einem Entschluss. Sie öffnete den Kleiderschrank und griff das schwarze Seidennachthemd mit den Spagettiträgern heraus, das sie in den vergangenen zehn Jahren vielleicht dreimal angehabt hatte.
Eine halbe Minute lang stand sie hoch aufgereckt vor dem Spiegel, ohne zu lächeln, die Hände hinten auf den Hüften abgelegt. Der Schein der Straßenlaterne fiel in den Raum. Ihre Augen lagen im Schatten. Nur das milchige Weiß ihrer Brüste schimmerte durch den dünnen Stoff.
Gesa streifte den Slip ab und trat aus dem Schlafzimmer heraus. Unter Roberts Tür war ein schmaler Lichtstreifen zu sehen.
Sie würde das jetzt in Ordnung bringen.
3.
Mitte Februar hatte Elina eine Woche Frühlingsferien.
Auf der Fahrt nach Hamburg (wo sie beide die Woche verbringen würden, Elina bei ihrem Vater und Gesa bei Mareike) hatte Elina Gesa gefragt, woher man eigentlich wüsste, wann jemand ein wirklich guter Freund sei.
Gesa hatte gesagt, einen wirklich guten Freund erkenne man daran, dass dieser Mensch einem Dinge sagen dürfe, die zu sagen sonst niemand das Recht hatte – zum Beispiel auch und gerade dann, wenn man mal etwas nicht so gut mache –, und zwar deswegen, weil dieser Mensch einen damit nicht ärgern oder traurig machen, sondern einem helfen wolle; wirklich helfen. Dabei war ihr aufgefallen, dass sie sich bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Alter von fast vierundvierzig Jahren, nie wirklich Gedanken darüber gemacht hatte. Aber in dem Moment war es ihr eingefallen, ohne dass sie groß darüber nachdenken musste.
Mareike erwartete sie vor der Tür der gediegenen Eigentumswohnung im ersten Stock, die sie vor zwei Jahren erworben hatte, nachdem die Universität Hamburg ihren Vertrag entfristet hatte.
»Na, wie sieht es aus?«
Umarmungen waren zwischen ihnen noch nie üblich gewesen. Nur dieses Willkommensgrinsen auf ihren beiden Gesichtern, das im Laufe der Jahre immer breiter geworden war.
Kaum etwas anderes fühlte sich für Gesa mehr an wie Nachhausekommen als der Moment, in dem sie ihre Jacke in den Garderobenschrank im Vorflur hängte, ihre Tasche in Mareikes Arbeitszimmer absetzte, immer an denselben Platz neben dem Sofa, und im Bad ihre Zahnbürste in den schon bereitstehenden Becher stellte. Es war vergleichbar mit der wohligen Ruhe, die in sie einzog, wenn sie sich spät abends neben die schlafende Elina legte, nach einem dieser zermürbenden Tage, an denen alles verkehrt schien.
»Noch Abendbrot?«, fragte Mareike.
»Kleiner Snack reicht.«
»Und ein Glas Weißwein dazu darf es sicher auch sein?«
Alles war an seinem gewohnten Platz: Die bauchige weiße Teekanne mit dem grün-blauen Streifen auf dem Stövchen. Die Olivenholzschale mit den Pistazien neben der Weinflasche. Die Kerze in dem schlichten, mit weißem Kieselgranulat gefüllten Glas auf dem Tresen, der die Küche vom Wohnzimmer abteilte.
Sie setzten sich an den Couchtisch, Gesa auf das Sofa, Mareike ihr gegenüber in einen der Korbsessel mit den Füßen auf dem anderen. Mareike schenkte ihre Gläser halb voll und reichte Gesa ihres herüber.
»Unsere kleinen Rituale, was?«, sagte Gesa und nahm eine Handvoll Pistazien. »Ich esse sonst nie Pistazien. Ich mag sie nicht mal besonders. Nur mit dir.«
»Was wäre das Leben ohne kleine Rituale.« Mareike hob ihr Glas. »Na, dann.«
»Wie lange machen wir das eigentlich schon?«
»Was? Pistazien zusammen essen?«
»Befreundet sein.«
»Ich weiß nicht. Zweiundzwanzig Jahre?«
Gesa nickte. »Einer der wenigen Fixpunkte inmitten all der Unstetigkeit.«
»Ach komm, in den letzten Jahren sind wir doch schon sehr beständig geworden. Für unsere Verhältnisse. Und wo wir gerade von Beständigkeit sprechen: Was machen denn deine Pläne in Richtung Immobilienerwerb?«
»Ich nähere mich dem Gedanken.«
»Ich denke, es wäre in deiner Lage ein sehr sinnvoller Schritt. Du weißt jetzt, dass du in den Niederlanden bleiben wirst, dein Einkommen ist stabil, du hast genug Eigenkapital, es ist die ideale Altersvorsorge, also warum nicht.«
»Ja«, sagte Gesa und lächelte. Es tat gut, zu wissen, dass es einen Menschen in ihrem Leben gab, der so viel über sie wusste, um eine so treffende Analyse ihrer persönlichen Umstände mit so wenigen Worten erstellen zu können. »Du hast ja völlig Recht. Ich werde mich umsehen. Da ist nur noch ein Problem.«
»Lass mich raten: Robert.«
»Touché. Und gleich beim ersten Mal.«
»Nicht weiter schwierig, da es in deinem Leben seit einigen Jahren schon eigentlich nur dieses eine Problem gibt.« Mareike rieb sich erwartungsvoll die Hände. »Also, was ist denn jetzt wieder mit Robert?«
»Er hat mir neulich gesagt, er würde zwanzigtausend dazugeben.«
»Zwanzigtausend?« Mareike hob die Augenbrauen. »Und, wirst du darauf eingehen?«
»Natürlich nicht.«
»Warum ›natürlich‹ nicht? Ist es denn so abwegig?«
»In dieser Situation: ja.«
»Was ist denn an der Situation jetzt so anders als noch vor einem Jahr?«
»Rein äußerlich nichts.« Gesa zuckte die Achseln. »Er hat immer noch seine Schlafstörungen, Kopfschmerzattacken, diese Phasen von absoluter Lethargie – manchmal kommt er tagelang kaum aus dem Bett. Soziale Kontakte hat er, soweit ich weiß, keine, vielleicht hat er die auch noch nie gehabt, keine Ahnung. Jedenfalls verlässt er ohne mich das Haus eigentlich gar nicht mehr – er hatte sich doch vor über anderthalb Jahren dieses Rennrad gekauft, habe ich bestimmt erzählt, seither steht das Ding bei uns im Keller, meinst du, er hat es auch nur ein einziges Mal benutzt? Obwohl der Nachbar ihn mehrmals gefragt hatte, ob er nicht mal eine Tour mit ihm machen will.« Gesa seufzte. »Immerzu erzählt er mir, er müsse Struktur in seinen Tag bringen, und dann kann er sich doch wieder zu nichts aufraffen, und alles bleibt liegen. Was wiederum bewirkt, dass er sich noch mehr als Versager fühlt, der nichts auf die Reihe kriegt. Und dann entschuldigt er sich, weißt du, auf Schritt und Tritt, für alles, für seine Unzuverlässigkeit, seine Übellaunigkeit, dafür, dass er überhaupt geboren ist… Beteuert, er wisse, was er zu tun habe, dass er an sich arbeiten werde…«
»Also das Übliche.«
»Vielleicht ist es auch noch schlimmer geworden, ich kann es nicht sagen.« Gesa überlegte einen Augenblick. »Ich denke aber eher, dass meine Wahrnehmung sich verändert hat.«
»Und was genau hat dazu geführt, dass deine Wahrnehmung sich verändert hat? Wäre ja mal interessant, darüber nachzudenken.«
»Ich weiß es nicht. Es gibt da nicht das eine Ereignis… Oder vielleicht doch, im letzten Jahr, als er seine Gesprächstherapie abgebrochen hat. Da muss ich irgendwie endgültig die Hoffnung verloren haben.«
»Hattest du dir denn jemals ernsthaft etwas davon erhofft?«
Gesa schüttelte den Kopf. »Er hatte diese Therapie ja sowieso nur angefangen, weil ich ihm gesagt hatte, dass ich ihn nicht mehr sehen will, wenn er die Dinge einfach weiter so schleifen lässt. Ich weiß noch, wie er mich anrief, um mir zu verkünden, dass er einen Therapeuten gefunden hatte, und im selben Atemzug fragte, wie oft er denn da hin müsse, bis er wieder zu uns kommen dürfte.« Sie zog eine Grimasse. »Erinnerte mich irgendwie an die Sitzscheine, die wir damals für Pädagogik brauchten, weißt du noch?«
»Du meinst die für diese Vorlesungen, bei denen immer hundertfünfzig Teilnehmer auf der Liste standen, aber nur fünfundsiebzig tatsächlich anwesend waren, weil die fehlenden fünfundsiebzig sich durch die tatsächlich anwesenden fünfundsiebzig hatten eintragen lassen?«
Beide kicherten ein wenig, darüber, dass sie nun hier saßen und ausgerechnet an etwas so Absurdes wie die sinnlosen Pädagogikvorlesungen, die gefälschten Unterschriften auf Anwesenheitslisten und die ermogelten Sitzscheine ihrer nun schon ein halbes Leben zurückliegenden Studienzeit zurückdachten.
»Wie hat er es damals eigentlich begründet, dass er die Therapie abgebrochen hat?«
Gesa machte eine wegwerfende Handbewegung. »Therapeut inkompetent, auf seinen Fall nicht spezialisiert, das hat er nach fünf Sitzungen behauptet.«
»Aber das ist doch unlogisch. Denn damit hat er im Prinzip ja zugegeben, dass es einen ›Fall‹ gibt.«
»Im Prinzip schon, aber das nützt mir auch nichts«, sagte Gesa müde. »Eine Diagnose ist ja nie gestellt worden. Ich denke, dass er genau das auch vermeiden wollte: Als krank abgestempelt zu sein.«
Mareike ließ ein verächtliches Schnauben hören. »Als krank abgestempelt, meine Güte, der Mann hat einfach nur Depressionen! Wie zig andere Menschen auch. Dagegen kann man doch was tun.«
»Ganz offenkundig ist sein Leidensdruck aber nicht so hoch, dass er etwas dagegen tun würde.«





























