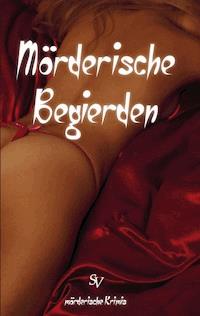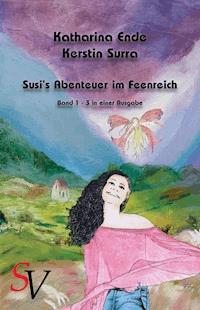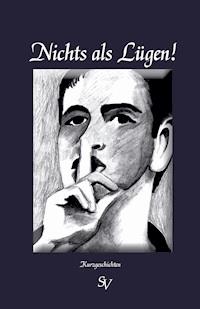
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schweitzerhaus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wissenschaftliche Studien belegen: Wir lügen jeden Tag, bewusst oder unbewusst, in Gedanken oder laut. Wir verschonen die Lieben mit der Wahrheit und lügen stattdessen, damit es erträglicher bleibt. Oder wir lügen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben und eine Ausrede brauchen. Es gibt viele bekannte Menschen, die kluge Sprüche zum Thema Lügen ersonnen haben. Wer sagt, dass er ehrlich ist, lügt bereits mit diesem Satz. Die schlimmsten Lügen sind die Lügen, mit denen wir uns selbst belügen. Die Lebenslügen, die mit dem Ausspruch: 'Alles ist gut so, wie es ist, und der Spatz in der Hand ist allemal besser als die Taube auf dem Dach!', beginnen und die darauffolgende Erklärung, warum man nicht handelt. Nur eine Ausrede, um in seinem Leben nicht das Steuer in die Hand zu nehmen. Lügen bleiben Lügen, ob sie nun gut gemeint sind oder das eigene Leben vermeintlich schützen. Lesen Sie spannende Geschichten, in denen gelogen wird, dass sich die Balken biegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nichts als Lügen
Kurzgeschichten
von
den besten Autoren
Lola Lorella und Lipobello
Kerstin Surra
Lola schloss für Sekunden die Augen und stellte es sich vor, ihr Leben mit Lipobello. Sie hassten sich, waren alt geworden, im Ärger über Nichtiges, und ihre Träume waren zerronnen.
Dabei hatte es eine Zeit gegeben, in der sie verrückt nacheinander gewesen waren. Da hatte Lipobello sie mit gierigen Blicken verfolgt, wenn sie in ihrem Kleidchen über den Markt gestöckelt war. Scheinbar die Blicke nicht spürte, die sie unweigerlich auf sich zog, wenn sie über den Marktplatz schlenderte. Die langen Haare züchtig unter einem Tuch versteckt, das Körbchen am Arm baumelnd, die Knie nicht ganz von Stoff bedeckt.
Lola malte sich aus, wie es werden würde mit Lipobello und seiner schwarzen Mähne.
Er hatte mit den anderen Burschen in einer Reihe gestanden, die Beine leger an die Mauer geklappt, lässig in zu weiten Hosen, derben Schuhen, Unterhemden. Pfeifend!
Die Königin von Saba nahm es huldvoll hin. Hatte aber auf ihrem schönen Gesicht ebenso wenig Platz für eine Regung, die über diese Huld hinausging, wie ihre Hüften genug Platz zum Schwingen hatten.
Das Universum schien zu klein zu sein für dieses Becken, umkleidet von Blümchenstoff und Laszivität.
Die neidischen Blicke der anderen Mädchen, die missbilligenden Gesten der alten Frauen, der schwarzen Krähen, wie sie sie heimlich nannte, konnten ihr nichts anhaben.
Sie war die Schönste und das Leben forderte eben Opfer. Und wenn es der Anschein von Tugend war, der auf dem Altar geopfert wurde, nun, dann war das eben so.
Lola Lorella war gerne bereit, ihren guten Ruf zu ruinieren, wenn es sich nur lohnte.
Natürlich hatte sie diesen Namen nicht über dem Taufbecken erhalten. Der Pfarrer hätte ihre Eltern sofort exkommuniziert, wenn sie ihr nicht einen christlichen Namen verpasst hätten. Aber Maria war nicht das passende, wenn man wie sie, zum Film, wollte. Sie wollte ins Kino, nicht ins Kloster. Also ging Maria Immaculata überhaupt nicht.
Lipobello wollte Lola. Sonst nichts. Und eine von diesen schicken Sonnenbrillen. Und eine Vespa ... Die Liste war endlos. Sonst nichts.
Aber vor allen Dingen wollte er Lorella und zwar so schnell wie möglich in sein Bett kriegen.
Er benötigte nicht viel Überredungskunst.
Alles, was es dazu brauchte, seinen Traum wahr werden zu lassen, beschaffte er bei seinem Kumpel Giovanni. Der verkaufte ihm eine alte, gebrauchte Schrottkiste von Motorrad.
Die putzte er, bis sie trotz der vielen Dellen, glänzte. Dann fuhr er auf den Marktplatz und wartete darauf, dass sie ihn ansprach. Ließ sie ein wenig zappeln. Klar biss sie an. Endlich versprach er Lola, sie in die Hauptstadt und dann in die Welt zu fahren. Hollywood! Ja, damals konnten Mofas anscheinend schwimmen, oder wie glaubte Lipobello sonst, den Ozean überwinden zu können? Wenn Lipobello Hollywood sagte, klang es wie irgendeine unwiderstehliche Süßigkeit aus Schokolade und viel, viel Zuckerguss, oben drauf eine Schicht aus rosafarbenem Marzipan.
Hollywood!
Aber vorher liebten sie sich unter den Sternen, im grellen Sonnenlicht, an eine weiße Kaimauer gelehnt, am Strand auf dem gurgelnden und schleifenden Kies, in Kemenaten, alten Schuppen, zwischen grünen Netzen und verrosteten Werkzeugen.
Auf Stroh und Holz, im Wasser, an Land und wieder unter den Sternen.
Heiß und klagend, wimmernd und schweigend, keuchend und verbissen, selten zärtlich, meist gierig. Als könnten sie die Wucht, mit der ihre Körper aufeinander prallten, benutzen, um sich zu den Sternen zu katapultieren, nach denen sie griffen. Zu denen sie werden wollten. Doch sie vergeudeten lediglich ihre Energie, zugegebenermaßen auf nicht unangenehme Weise.
Lipobello liebte ihre großen Brüste und die schönen langen Beine. Er liebte jedes noch so feinste Haar auf diesen gebräunten Stelzen.
Lola ergötzte sich an seiner unrasierten Kinnpartie und den starken Oberarmen, die er in Matrosenmanier durch aufgekrempelte Ärmel betonte.
Und sie liebte seine Maschine. Damit konnte sie es überall hin schaffen.
Lipobello konnte immer noch nicht genug von ihr kriegen, doch sie machte sich rar.
Er schob immer neue Probleme im Getriebe, an der Ölzufuhr, an den Reifen vor. Sie zog den Rock über ihren Knien immer tiefer hinunter. Ließ ihn nur ab und zu erahnen, was sich zwischen ihren Schenkeln noch alles an Gefahren und Freuden verbarg. Es machte Lipobello rasend. Lola kokettierte unter den wütenden Blicken der anderen Mädchen mit diesem und jenem. Doch immer seltener mit Lipobello, dem sie die kalte Schulter zeigte.
Da geschah ein Wunder und das Motorrad wurde fertig.
Ihr Ultimatum trieb ihn zu Höchstleistungen an.
Endlich packten sie ihre wenigen Habseligkeiten, ein paar Stullen und jede Menge Hoffnungen. Ließen das alte, klägliche Kaff hinter sich zurück. Die trägen Nachmittage, das Glitzern der Fischleiber und der Sonne auf Wellenkämmen.
Sie tauschten sie ein gegen die staubige Straße, die endlose Hitze und endlich die Stadt.
Überrumpelt von ihrer Fülle, überbordender Enge, unausgesprochenen Wonnen, dem hektischen Geschehen auf den Straßen, dem Konzert aus Hupen, schreienden, schimpfenden Menschen, dem Gigantismus ihrer Bauten, standen ihre Münder provinziell offen vor Staunen.
Lola erkannte bald, dass diese Stadt voller Sterne war und sie nur ein blasser Abklatsch all der Sonnen, die um diese Metropole kreisten. Auch Lipobello sah es. Die Spucke lief ihm im Munde zusammen, als er all diese Geschöpfe erblickte, die Gott in einer Mußestunde geschaffen haben musste, während ihn eine Muse geküsst und die Sonne Italiens verwöhnt hatte.
Lipobello schnalzte mit der Zunge und fasste im Traum in all diese wonniglichen Busen, Schenkel, Pos.
Doch die Trauben hingen unerreichbar hoch.
Er ahnte, dass er sich mit den sauren Trauben würde begnügen müssen.
Gedrungene Kerle mit knotigen Armen, schwarzen, struppigen Haaren und sonnenverbrannten Gesichtern gab es hier genug. Viele, die mehr her machten, als er.
Doch neben den schönen Damen in feinen Kleidern und in Wellen gelegten Frisuren gingen solche Kerle nicht. Die hingen an den Armen von großgewachsenen Männern, in hellen, leichten Sommeranzügen.
Feingezwirbelte Schnäuzer, gefüllte Brieftaschen, Hüte, die sie artig voreinander zogen, nichts davon war Lipobello.
Er und Lola sahen sich an, in ihrer abgetragenen Schäbigkeit.
Ihre Gesichter, Hände, Körper, Gedanken kamen ihnen mit einem Mal gewöhnlich vor. Kein bisschen Würde bedeckte sie, keine Winzigkeit Stolz adelte ihre Armut. Beide waren bloß und braun gebrannt und mitleiderregend. So kam es ihnen vielleicht nur vor. Doch das reichte aus.
In diesem Augenblick trennten sie sich voneinander, wenn auch nur geistig. War das Gegenüber doch ein Spiegel der eigenen Bedeutungslosigkeit. Sie waren nicht außergewöhnlich. Sie waren viele. Hoffnungen, Träume schwirrten umher und füllten die Luft mit einer Schwingung, die sie vibrieren ließ und irgendwie auch klingen.
Was war schon Würde, was Stolz? Sie hatten es doch an ihren Eltern gesehen, die sich für ein kleines bisschen Leben krumm gelegt hatten und den Rücken ruiniert, die knotigen Finger ganz gichtig vom Flicken der Netze.
Stumme Menschen, die schweigend das Schicksal ertrugen, was ihnen auferlegt worden war. Nebeneinanderherlebten, um nichts kämpfend, als nur um das nackte Überleben. Nichts erhoffend als nur den Sonntag. So wollten sie nicht sein und es war ihnen ja auch zu wünschen, dass sie diesem Schicksal entrinnen konnten. Doch wo sollte all das viele Glück herkommen, das in diesen Tagen erfleht wurde?
Was Lipobello und Lola bis jetzt zusammen gehalten hatte, war nie Liebe gewesen. Nur Hoffnungen und Leidenschaft.
Lola traten Tränen der Scham in die Augen. Doch sie wischte sie ärgerlich weg.
Sie konnte so schön sein wie diese grell geschminkten Puppen. Das wusste sie. Sie hob stolz den Kopf und strich das billige Kleidchen glatt.
Sie wollte nicht gewöhnlich bleiben, nicht nach dem kleinen Glück streben.
Sie fasste Lipobello am Arm und hob ihr Köfferchen auf. Sie mussten zusammen bleiben, um zu überleben. Noch.
Als erstes suchten sie sich eine Bleibe. Absteige traf es besser. Eine Stiege hinauf, zwei hinunter, ein echter Abstieg.
Feuchte Wände und ein Bauch, der immer dicker wurde. Soviel zu Hollywood.
Putzfrauen wurden immer gesucht. Jetzt war sie den Reichen und Schönen so nah und doch so fern, wie nie. Kniete auf ihren Böden, scheuerte ihre Fußspuren.
Lipobello gaunerte ein wenig, stand den lieben langen Tag herum, nahm gelegentlich eine Arbeit an, die nicht viel hergab. Eingereiht in das Heer von Männern, die wie er auf der Suche nach einer Gelegenheit waren. Das wenige Geld, das er zum Unterhalt beitrug, reichte gerade aus, um die Liebschaften zu finanzieren, die er sich gönnte.
Lola, die nun wieder Maria war, nur nicht mehr unschuldig, machte ihm die Hölle heiß und zerbarst unter der Wut, die sie durchtränkte. Sie kümmerte sich nicht viel um die Kinder, die ihr bald am Rockzipfel hingen und, wie es schien, den lieben langen Tag nur gefüttert werden wollten. Doch womit?
Sie schrie herum, kommandierte und fand nur ab und zu ein wenig Zeit und Aufmerksamkeit für eines der Kinder, wenn sie es zu Grabe trug.
Wie oft sie ihre Koffer packte und mit fliehenden Fahnen den Dreck und das Elend in ihrer Hütte hinter sich ließ, zählte sie nicht mehr. Ebenso oft kehrte sie um, krempelte die Arme hoch, schrubbte den ganzen Raum, in dem sie hausten, seifte es samt der Kinder und Lipobello ein und hängte anschließend ihr ganzes Leben zum Trocknen hinaus. Dann fühlte sie so etwas wie Befriedigung, wenn es glänzte und blitzte, als wäre es wirklich sauber und schön.
Oh, sie hatten auch gute Momente.
Dann, wenn er ein wenig Geld nach Hause gebracht, in überschwänglicher Laune eine Kleinigkeit für jeden erstanden hatte, glitzernde Geschenke an seine Brut und die immer rundlicher werdende Gattin. Ja, er hatte sie geehelicht, eine ehrbare Frau war sie dadurch nicht geworden, aber sie strichen sich wenigsten die Fassade damit an, der Anschein war gewahrt.
Für einen Ehering hatte es nie gereicht, aber für ein Eis in der Innenstadt, einen sommerlichen Ausflug aufs Land, der einen wunderbaren Tag dauerte und eine fröhliche, lärmende Schar mit rosigen Wangen sah, die sich über den Picknickkorb hermachte, während Lola und Lipobello auf der Wiese lagen, den Hang hinabblickten auf eine ewige Stadt und so etwas wie Glück empfanden.
Er schmauchte, hielt sie im Arm und fühlte ihr weiches Fleisch unter seinen Händen.
Das waren Momente, in denen sie sich still anlächelten und zufrieden hätten sein können.
Aber Zufriedenheit war ihnen nicht bestimmt.
Manchmal sah Lola Filme von Frauen, die ihr ähnelten, die am Ende aber immer aus ihrem Elend errettet wurden, von schönen, stattlichen Männern, weil diese ihre wahre Schönheit erkannten. Komödien. Ihr Leben war das Gegenteil von lustig.
Lola saß stundenlang vor ihrem kleinen, abgeschabten Schminktisch, den sie von einer ihrer Arbeitgeberinnen geschenkt bekommen hatte. Sie strich sich über die älter werdenden Züge ihres Gesichtes und grübelte. Wie war es gekommen, dass sie sich selber in so ein Leben verstrickt hatte? Es war ja ihr Leben. Es war zerbrochen, ehe es angefangen hatte.
Die Träume vom Film waren nicht zu ende geträumt. Noch immer spukten sie in ihrem Kopf herum.
Sie schminkte sich sorgfältig, legte rote Lippen auf, während ihre Kinnpartien erst rundlicher, dann schlaffer wurden. Rougete sich die Wangen, auch noch, als sie einfielen vor Sorgen und Kummer.
Worte hallten in ihrem Kopf wieder: «Du wirst immer fetter. Schau dir deinen Hintern an!»
Lola Maria hatte Lipobello für diese Worte angespuckt: «Rasier dich, du Trunkenbold. Du Strolch hast mir meine Jugend geklaut!»
Bäng, die Töpfe schepperten, Krach, die Teller purzelten. Ohrfeigen, Schreie. Sie hassten sich. Liebe hatte sie geflohen. Wie denn auch nicht. Lola fühlte keine Sehnsucht in sich nach dem, was sie für Liebe hielt. Sie wollte andere Dinge. Aber nicht mit diesem Kerl dort. Sie erwachte aus ihren Tagträumen. Rechtzeitig. Nein, Lipobello würde es nicht sein. Er sah aus wie ein Verlierer, wenn auch ein recht hübscher. Sollte sich eine andere dumme Gans mit ihm einlassen.
Sah die Reihe junger Männer, die so faul an der Mauer lehnten, ein Bein an das Weiß gelehnt. Nein, so ein Leben wollte sie nicht. Sie würde ihren Weg schon gehen. Ganz sicher aber nicht auf einen wie Lipobello bauend. Gut, er hatte ein Motorrad, wenn man das Ding so nennen konnte. Doch Pedro, er hatte einen kleinen Wagen. Nicht viel schicker, aber immerhin vier Räder und ein Lenkrad - und ein Radio.
Mal sehen. Sie straffte die Schultern, wurde noch unnahbarer und malte sich aus, wie es werden würde mit Pedro und seinen blauen Augen. *
Blind Date
Klaus Köllisch
Eine Wahrheit kann erst wirken,
wenn der Empfänger für sie reif ist.
Christian Morgenstern
Verärgert zupfte der Macho an den Blütenblättern der dunkelroten Rose und sah alle zehn Sekunden mit verkniffenem Gesicht auf seine Schweizer Armbanduhr.
Nick konnte sich gut vorstellen, dass der Macho Warten hasste. Ganz besonders auf Frauen. Jeden Freitagabend saßen sie ein paar Meter voneinander entfernt an der Bar von Dantes Restaurant - Frankfurts neuem In-Lokal – und blickten durch das große Panoramafenster auf den Main. Trotz des Stimmenwirrwarrs, dem Klirren von Besteck und Geschirr und der Kellner, die eilig zwischen den enggestellten Tischen hin und her rannten, fühlte Nick sich im Dantes geborgen. Hier konnte er einfach sitzen, ohne etwas tun oder sagen zu müssen. Inmitten dieses Trubels, den er völlig ausblendete, wenn er seinen Gedanken nachhing, fand er seine Ruhe.
Im Gegensatz zu Nick blieb der Macho nicht lang alleine. Jeden Freitag betrat um 21:00 Uhr eine Frau die Bar, setzte sich zu ihm an die kreisrunde Theke und legte eine rote Rose neben seine auf das geölte Nussbaumholz. Es kam jedes Mal eine andere Frau und nach einer kurzen, angeregten Unterhaltung verließen beide das Dantes. Abgesehen von der Rose hatten die Frauen eine souveräne Eleganz und einen exquisiten Kleidungsstil gemeinsam. Hätte Nick Interesse an einer Beziehung gehabt, dann hätte er den Macho vielleicht gefragt, wo er diese Schönheiten fand. Aber seit der schmutzige Scheidungskrieg mit Julia seinen Freundeskreis und sein Bankkonto wie ein Hagelschauer ein Kornfeld verwüstet hatte, hielt Nick das zarte Geschlecht auf Abstand. Abgesehen davon konnte er den Macho in seinem sündhaft teuren Designeranzug nicht leiden. Jede affektierte Bewegung, jeder Satz mit diesem bornierten Augenaufschlag wirkte so überheblich, so arrogant, dass Nick schon beim Hinsehen keine Lust auf eine Unterhaltung hatte. Er verstand nicht, wieso sich diese gutaussehenden Frauen mit dem Macho trafen. Aber er verstand, warum sich der Macho schon nach einer Woche wieder auf die Suche machen musste. Nick schloss die Augen und sog genussvoll das teerhaltige Aroma des Glenkinchie ein, den er gefühlvoll in dem schweren Whiskeyglas schwenkte. Schottischer Whiskey roch am besten und davon war der Glenkinchie sein Favorit. Wie immer ließ er sich viel Zeit, das Aroma zu genießen, bevor er den ersten Schluck nahm.
«Was heißt das, du kommst später?», blaffte der Macho in sein Handy. Undeutlich hörte Nick eine Frauenstimme am anderen Ende. Die silbernen Zeiger der schwarzen Wanduhr, die über dem Tresen zwischen einer Sammlung exotischer Flaschen hing, zeigten zehn nach neun.
«Nein, ich warte nicht. Ich bin doch nicht blöd.», brauste der Macho auf. «Von mir aus kannst du bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich bin weg!»
Wütend klappte er mit einem lauten Schnappen sein Handy zu.
«Blöde Schlampe. Kauf‘ dir ‘ne Uhr», schimpfte er und warf schon fast verächtlich zwanzig Euro auf den Tresen, bevor er durch die Tür in die Winternacht verschwand.
Nick schüttelte den Kopf, roch an seinem Glenkinchie und sah nach draußen. Aufgewirbelt von kräftigen Windböen schwebten dicke, weiße Schneeflocken an dem großen Fenster vorbei. Die Dunkelheit dahinter war schwarz und undurchdringlich, als würde dort die Welt enden. Wir könnten die letzten Menschen auf dem Planeten sein und würden es nicht einmal merken, dachte Nick.
«Hallo, ich bin Isabell. Tut mir leid, dass ich zu spät bin.»
Nick schreckte aus seiner Träumerei hoch. Sah auf die Theke, wo neben der zerrupften Rose, die der Macho achtlos liegen gelassen hatte, eine zweite lag. Sah in ihr Lächeln, das eine Spur Unsicherheit zu verbergen suchte und verstand.
«Das ist eine Verwechslung», erwiderte er. «Ich bin nicht ...»
«Ich habe noch keine Winterreifen drauf und musste deshalb auf die U-Bahn warten. Wer rechnet schon damit, dass es im Dezember schneit», lachte sie unsicher und zuckte schelmisch mit den Schultern.
«Sie sind doch Max, oder?», fragte sie zögernd und zeigte auf seine Rose. Sie hatte schulterlange, fast schwarze Haare, die unter einem dunkelblauen Hut mit hoher Krempe hervorsahen und ihr als Pony tief in die braunen Augen fielen. Sie war anders als die Frauen, die der Macho normalerweise traf. Nicht so unnahbar perfekt. Ihr Blick fing ihn ein und plötzlich wollte Nick, dass sie blieb.
«Stimmt, ich bin Max», antwortete er leichtfertig und stand auf, um ihr aus dem Mantel zu helfen.
***
Die Nacht war eiskalt und sternenklar. Die Schneeflocken fielen immer dichter und blieben wie eine weiße Watteschicht auf Isabells dunkelblauem Hut liegen. Kurz nach Mitternacht waren sie als letzte Gäste vor die Tür gesetzt worden und gingen am Main entlang Richtung Innenstadt. Isabell fröstelte und instinktiv legte Nick einen Arm um sie und zog sie an sich. Wortlos strahlte sie ihn an und drückte sich in seine Umarmung.
Der Abend war wie im Flug vergangen. Kurzentschlossen hatte Nick einen Kellner mit fünfzig Euro überzeugt, ein Reserviert-Schild auf einem der Tische am Panoramafenster verschwinden zu lassen. Bei Kerzenschein begannen sie sich, wie von selbst, aufeinander einzulassen, als hätten sie ein Leben lang nur darauf gewartet. Als sie das Dantes verließen, fühlte Nick sich Isabell vertrauter als jedem anderen Menschen und war Hals über Kopf verliebt.
Wortlos gingen sie mit knirschenden Schritten durch eine weiße, leise Welt.
«Der erste Schnee ist immer der beste», sagte Nick. «Man spürt, wie die perfekte, unberührte Schneedecke die hektische Stadt zum Schweigen bringt.»
«Ja, es ist wunderbar», antwortete Isabell leise. «Danke, dass du mich nach Hause bringst und danke für den wunderbaren Abend.»
Sie betraten den Eisernen Steg und blieben mitten über dem Fluss am Geländer stehen. Aus dem schwarzen Wasser stieg weißer Nebel auf, der die beleuchteten Bankentürme in ein unwirkliches, diffuses Licht tauchte. Nick spürte das kalte Leder von Isabells Handschuh auf seiner unrasierten Wange, als sie seinen Kopf zu Seite drehte und ihn sanft auf die Lippen küsste. Sag‘ ihr endlich, dass du nicht Max bist, schoss es ihm durch den Kopf. Sie lachte leise, drängte sich an ihn und küsste ihn mit mehr Intensität.
«Komm‘», sagte sie lächelnd, «lass‘ uns gehen. Mir ist kalt.» Sie zog ihn mit sich, hakte sich bei ihm ein und sah ihn immer wieder lachend von der Seite an.
Sie ist wundervoll, dachte Nick verzweifelt. Und je wundervoller der Abend wurde, umso furchtbarer malte Nick sich ihre Reaktion aus, wenn er ihr beichtete, dass er sie schon mit einem seiner ersten Sätze angelogen hatte. Während sie Arm in Arm durch das dunkle Museumsuferviertel gingen, überlegte er fieberhaft, wie er ihr die Wahrheit sagen konnte, ohne dass sie sich betrogen fühlte.
Plötzlich blieb sie vor einem Haus aus der Gründerzeit stehen, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Ungeschickt stieß er mit der Stirn an den Rand ihres Hutes und wusste, dass seine Zeit abgelaufen war. Er holte zweimal tief Luft und setzte an, als sie ihm mit der Hand über die Wange strich.
«Komm‘ mit rein», sagte sie leise. «Ich will dich heute Nacht bei mir haben.»
Nick schoss eine Hitzewelle durch den Körper und er bekam keine Antwort raus. Eine Mischung aus Panik, Verzweiflung und Versuchung lähmte ihn komplett. Isabell kramte leise klirrend einen Schlüsselbund aus ihrer Handtasche, tastete in der Dunkelheit nach dem Schloss und öffnete die Haustür. Eine angenehme Wärme strömte ihm ins Gesicht als sie in den Hausflur trat und ihm die Tür aufhielt. Fragend sah sie ihn an.
«Hör‘ zu», fing er an, «ich ...»
«Du hast jetzt aber keine Hemmungen, weil das unser erstes Date ist?», unterbrach sie ihn ungläubig lachend und sah ihn verwundert mit großen Augen an. Nick seufzte und riss sich zusammen.
«Ich heiße nicht Max, sondern Nick», sprudelte es aus ihm heraus. «Max wollte nicht auf dich warten, er ist gegangen, bevor du gekommen bist. Wir beide waren gar nicht verabredet und das war auch nicht meine Rose.»
Nicks Knie wurden weich und er griff nach dem Briefkasten aus grauem Blech, der neben der Haustür an der Wand festgeschraubt war. Isabell setzte ihren Hut ab und der Schnee fiel im Hausflur auf die schwarz-grau gemusterten Fliesen.
«Ich weiß», antwortete sie und strich sich eine dunkle Strähne aus dem Gesicht. «Bis auf deinen Namen weiß ich das alles. Ich war nicht mit diesem Playboy verabredet, der ist nicht mein Stil. Seit ein paar Wochen sehe ich dich immer wieder im Dantes allein an der Bar sitzen. Genau wie den Playboy, der sich mit gelangweilten Karrierefrauen trifft. Ich wusste nie, ob und wie ich dich ansprechen sollte und wie du reagieren würdest. Bis der Playboy heute versetzt wurde und ein Rosenverkäufer vorbei kam.»
Nick war sprachlos. Fassungslos starrte er Isabell an.
«Ich weiß übrigens nicht, wie der Playboy heißt», sagte sie. «Max habe ich mir einfach ausgedacht. Und jetzt komm‘ endlich!»
Sich mit fremden Federn schmücken
Ev van der Gracht
Lügen haben kurze Beine,eine bleibt meist nicht alleine,eine zweite kommt hinzu.Lügner lügen immerzu.ev
Neulich bekam ich einen Anruf einer ehemaligen Freundin, ich nenne sie hier Edith. Sie weinte bitterlich und wollte sich bei mir entschuldigen.
Zur Vorgeschichte:
Edith ist eine Frau von 55 Jahren, 1,78 cm groß mit schwarz gefärbten Haaren, die sie streng zu einem Knoten am Hinterkopf gedreht trägt. Sie ist dünn wie ein Gerippe, weder vorn noch hinten findet man an ihr etwas zum Anfassen, aber sie findet sich schön. Edith ist seit drei Jahren Witwe und sucht nun einen Mann mit Geld. Ein eigenes Einkommen hat sie nicht, sie lebt von ihrer Witwenrente. So suchte sie erst in den Zeitungen und später in Zeitschriften, die bei ihrem Arzt auslagen, nach möglichen Partnern. Aber keine ihrer Briefe wurde beantwortet. Daraufhin fragte sie mich, welche Möglichkeiten es noch gäbe. Ich meinte zu ihr, sie solle es doch einmal im Internet versuchen. Sie hatte noch den alten PC von ihrem Mann, und zumindest konnte sie Mails beantworten. Sie bat mich um Hilfe und so erklärte ich ihr, dass sie dort erst nach Männern suchen könnte, nachdem sie sich eigenes Profil angelegt habe. Sie zögerte lange, da sie Angst hatte, es könne sie jemand Ungebetenes dort finden. Doch dann stimmte sie meinem Vorschlag zu und so erstellte ich ihr in einem Forum ihr eigenes Profil. Ich las ihr vor, was ich geschrieben hatte:
Frau - - 55 Jahre - - 1,78 cm - - verwitwet - - sehr schlank
Als sie das hörte, war sie entsetzt, diese Angaben wollte sie auf keinen Fall, es mussten andere sein. So gab ich widerstrebend die Daten ein, die sie mir angab:
Frau - - 50 Jahre - - 164 cm - - ledig
Sie bekam daraufhin reichlich Post, konnte aber viele Anfragen von vornherein ausschließen. Nach vier Wochen blieben zwei Herren übrig, mit denen sie Mails austauschte. Einer von ihnen, ein Herr mit Namen Anton, wollte ihre Telefonnummer, um ihre Stimme zu hören. Diese schrieb sie ihm auch und wartete auf seinen Anruf, der jedoch nie kam. Daraufhin schrieb sie ihm mehrere Mails, die er auch nicht beantwortete. Nach mehreren Wochen schrieb er ihr den Grund für sein Schweigen: Sie hätte ihn angelogen. Er wäre an ihrem Haus vorbeigefahren und hätte mit den Nachbarn gesprochen. Von denen hatte er dann erfahren, dass sie dort nur eine kleine Wohnung hat, doch kein Haus mit Garten, wie sie ihm geschrieben hätte.
Edith war sehr unglücklich über diesen Ausgang und weinte sich bei mir aus. Sie verstand überhaupt nicht, woher er gewusst hatte, wo sie wohnt. Ich erklärte ihr, dass ihre Adresse im Telefonbuch steht und man dadurch schnell fündig werden kann. Auch redete ich ihr ins Gewissen, bitte bei dem anderen Herrn bei der Wahrheit zu bleiben. Sie versprach es mir.
Nun hatte sie schon längere Zeit parallel dazu mit dem anderen Mann Kontakt, der sich Manfred nannte. Sie hatte einen guten Eindruck von ihm und hoffte, in ihm den Mann fürs Leben gefunden zu haben.
Nein, sie hatte ihm gegenüber nichts von ihren Wünschen geäußert. Auch wusste er noch nicht, dass sie eine Ehe hinter sich hatte, also seit drei Jahren Witwe war. Der Mailwechsel, der mehrmals die Woche stattfand, machte Edith übermütig, und sie steigerte sich immer mehr in eine eingebildete Liebe zu ihm hinein.Aber wie das so ist, nach sechs Monaten Briefwechsel wollte sie ihn endlich einmal persönlich kennenlernen. Er schrieb ihr, dass die Entfernung wohl zu groß sei, um nur für einen Kaffee 400 km zu fahren. Daraufhin wollte sie wenigstens ein Bild von ihm bekommen. Keiner wusste bisher seinen wahren Namen, sie kannten sich nur unter ihren Nicknamen. Er war Manfred und sie war Schneewittchen.
Nun also die Frage nach dem Bild. Manfred war erst sehr skeptisch, wollte nicht mit der Sprache heraus. Schrieb so etwas wie: «Kein Bild vorhanden», und er müsste erst zum Fotografen. Nach weiteren Wochen die Frage, ob es wirklich notwendig sei, dass sie sich sehen sollten, ihre Brieffreundschaft wäre doch wunderbar. Doch dann kam eines Tages eine Beschreibung seiner Person. So, wie in seinem Profil:
Mann - verwitwet - 1,89 cm - 85 kg - 59 Jahre - keine Kinder,
und zusätzlich noch die Angaben, dass er gern Rotwein trinke, nicht rauche, ein klassisches Aussehen habe usw.
Meine Freundin Edith war nun hin- und hergerissen. Sollte sie darauf bestehen ihn zu sehen? In ihrer Phantasie hatte sie sich ja schon ein Bild von ihm gemacht. Sie hatte sogar schon überlegt, ob sie nach Norddeutschland umziehen sollte, um ihm nahe zu sein, weil er dort wohnte. Doch dann hatte sie es wieder verworfen, weil er ja schrieb, dass er viel im Ausland unterwegs sei und sie nicht genau wusste, wo er überhaupt wohnte. Dann, nach weiteren Briefen bestand sie darauf, wenn schon keine reale Begegnung möglich sei, er ihr wenigstens ein Bild schicken solle.
Sie war durch ihre Erfahrung mit Anton sehr unsicher geworden und fragte mich, ob sie ihm dafür ihre Adresse geben könne. Dazu konnte ich ihr weder zu-, noch abraten, schließlich kannte ich die Feinheiten ihres Kontaktes nicht, und meinte nur, das müsse sie selber entscheiden.
Eines Tages bekam sie also sein Foto, und Edith war sehr erfreut. Alles stimmte, was er ihr von seinem Äußeren und sich geschrieben hatte, sogar die Angabe der Entfernung zu ihrem Wohnort.
Wieder vergingen einige Monate und die Mails nahmen die Wendung zu Liebesbotschaften. Nun wollte er sie persönlich kennenlernen. Auch von ihr hatte er bisher nur ein Foto gesehen.
So wurde ein Termin für ein Treffen vereinbart, und ich sollte als Anstandsdame mitgehen. Außerdem brauchte sie mich als Fahrerin, denn sie hatte weder Führerschein noch Auto.
Viel Lust dazu hatte ich nicht, aber Edith bestand darauf, sie könne doch nicht allein in ein Café gehen. Da ich jetzt auch neugierig geworden war, wie denn nun dieser Manfred ist, holte ich sie zu Hause ab. Sie war sehr aufgeregt, konnte kaum stillsitzen und redete in einem fort. Im Café angekommen suchten, wir uns einen kleinen Tisch am Fenster aus und ich bestellte uns Kaffee. Doch Edith wollte einen Tee, denn sicherlich würde Jan, wie Manfred wirklich hieß - Tee trinken wollen. Dann würde er gleich sehen, dass sie auch gerne Tee trinke.
Nachdem uns der Kaffee und der Tee gebracht wurden, trat ein gut aussehender, charismatischer Mann an unseren Tisch und begrüßte zuerst mich mit der Bemerkung: «Sie sehen genau so toll aus, wie auf Ihrem Foto. Ich kann gar nicht glauben, dass Sie schon 50 Jahre alt sein sollen.»
Ich war sprachlos. Was sollte ich sagen, ich sah von ihm zu Edith, die wie versteinert da saß, und bat ihn, an unserem Tisch Platz zu nehmen. Da sprang Edith plötzlich auf und lief weinend aus dem Café. Jan und ich aber hatten noch einen sehr netten Abend, an dem ich ihm gestand, dass ich sogar schon 70 Jahre alt bin. Er zeigte mir das Foto, das Edith ihm geschickt hatte und ich sah, dass es ein Foto von mir war.
Die Entschuldigung von Edith habe ich angenommen, aber ich werde sie trotzdem nicht mehr wiedersehen. Dafür treffe ich mich jetzt regelmäßig mit Jan.
Didderichs Irrtum
Hildegard Fillbrandt
Die Wahrheit kann auch eine Keule sein,
mit der man andere erschlägt.
Anatole France, 1844-1924
Es war ein ganz normaler Donnerstag, so normal, wie Donnerstage bei Didderich eben sind: sie unterschieden sich in nichts von allen anderen Werktagen. Und es waren auch nur ein paar dahin gesagte Worte, die Didderichs Welt ins Wanken brachten.
Es wird doch noch Regen geben, dachte Didderich. Es war ungewöhnlich schnell dunkel geworden, vor seinem Bürofenster zogen sich schwarze Wolken zusammen. Die letzten bunten Herbstblätter des Kastanienbaumes, die vor einer Stunde noch friedlich und golden in der Nachmittagsonne schimmerten, wirbelten aufgebracht durch die Luft.
Didderich sortierte seine Akten für den nächsten Tag, legte die Mappe griffbereit in die erste Schreibtischschublade, spitzte zwei Bleistifte an und pustete ein paar Krümel vom Tisch. Dann nahm er das silbergerahmte Foto in die Hand und betrachtete es versonnen und andächtig.
«Du kannst stolz auf mich sein, Rosi. Du könntest jederzeit wiederkommen. Ich habe nichts verändert, seit du weg bist. Sogar deine Kleider hängen noch im Schrank.» Didderich stellte das Bild mit einem wohligen Seufzer an seinen Platz zurück. Ja, seine Rosi. Sie war wie ein Mast, an den er sich klammerte, ohne es zu merken. Es verging kein Tag, an dem er sich nicht prüfte, ob seine Rosi mit ihm zufrieden wäre. Ebenso verhielt es sich mit seiner Firma. 35 Jahre und sieben Monate arbeitete er jetzt bei Hanssen & Sohn. Hier fühlte er sich sicher und geborgen, wie in einer großen Familie, war ein kleines Rad in einem gut funktionierenden System. Mehr brauchte er nicht. Didderich verschloss seine Schreibtischschubladen, zog seinen grauen Wollmantel an und verließ um 17.30 Uhr sein Büro.
Leise vor sich hinsummend durchwanderte er den langen Flur dem Ausgang zu. Plötzlich horchte er auf. War da nicht irgendwo sein Name genannt worden? Die Tür zu Kollege Brenneckes Büro war nur angelehnt. Während er noch darüber nachsann, ob er lauschen oder weitergehen sollte, lachte plötzlich jemand schallend und Brennecke gab zurück: «Ach, der Didderich! Den nimmt doch keiner wirklich ernst. Der wird nur geduldet, weil er schon seit Ewigkeiten hier arbeitet und es niemand übers Herz bringt, ihm zu sagen, dass seine Arbeitsmethode längst überholt ist. Ist ein armer Kerl. Er hat doch sonst nichts.»
Didderichs Herz krampfte sich zusammen. Eine heiße Welle stieg in ihm hoch, machte ihn schwindlig. Benommen taumelte er weiter, dieses abscheuliche Lachen in den Ohren. Ausgelacht hatten sie ihn! Einfach ausgelacht!
Das freundliche «Pünktlich wie immer, Herr Didderich», des Pförtners nahm er wie durch einen Schleier wahr. Es mutierte in seinen Gedanken zu einem hässlichen Grinsen. Nur raus hier! Nichts wie raus!
Draußen schlug ihm der Wind ins Gesicht, die ersten dicken Tropfen prasselten auf Didderich nieder. Er atmete tief durch und spannte seinen Taschenschirm auf. Der Wind zerrte jedoch so heftig daran, dass der Schirm nach oben klappte und sich verbog. Didderich warf ihn in den nächsten Papierkorb.
«Geduldet – armer Kerl – Arbeitsmethode überholt – er hat doch sonst nichts.» Wie ein Killerbienenschwarm schwirrten diese Satzbrocken in seinem Kopf herum. Sie ließen sich nicht abschütteln, schlugen immer unbarmherziger zu. Die Anerkennung in seiner geliebten Firma, die Freundlichkeit der Kollegen, hatte er sich das jahrelang eingebildet?
Die drei Minuten bis zur Bushaltestelle kamen Didderich wie eine Ewigkeit vor. «Sauwetter heute», begrüßte ihn lachend Busfahrer Paschke, der schon jahrelang den Bus der Linie 60 fuhr und immer guter Laune war. Didderich traute seinen fünf Sinnen nicht mehr. Waren Paschkes Ohren schon immer so groß gewesen, seine Nase so hässlich? Auch er spielt nur Theater!, durchfuhr es ihn. Er murmelte eine unverständliche Antwort und glaubte, einen verächtlichen Zug in Paschkes Gesicht entdeckt zu haben.
Didderich setzte sich auf seinen Stammplatz und flüchtete in Gedanken zu Rosi. Doch selbst Rosi entzog sich ihm, so sehr er sich auch mühte, ihr Gesicht ging in dem Wirbelsturm seiner Gedanken unter: Brennecke, das laute Lachen, der Pförtner, Paschke, Rosi, die Firma – alles schwirrte durcheinander, verzerrte sich, mischte sich neu zu immer absurderen Bildern. Und alle lachten, lachten …
«Alles in Ordnung, Herr Didderich.» Didderich schreckte hoch und blickte in Paschkes besorgtes Gesicht. Der Bus hatte in der Goethestraße angehalten, hier musste er raus. Inzwischen war der böige Wind einem satten Landregen gewichen. Didderich spürte die Nässe nicht, sah nichts, hörte nichts. Mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern trottete er mechanisch den Weg nach Hause. Etwas in ihm war zerbrochen, was ihn sein Leben so zufrieden hatte leben lassen.
Triefend nass und zitternd betrat Didderich seine kalte Wohnung. Er kochte sich nichts zu essen, schaltete nicht den Fernseher an, saß einfach nur da in seinem Sessel und starrte vor sich hin. Als ihn das Zittern immer heftiger schüttelte, schleppte er sich in die Küche, machte sich Wasser heiß und trank einen starken Grog, legte sich schließlich ins Bett.
Am nächsten Morgen verschlief Didderich, zum ersten Mal in seinem Leben. Er fühlte sich elend, betrogen und nutzlos. Seines inneren Halts beraubt, konnte er sich fortan zu nichts mehr aufraffen und verfiel nach und nach. Er kehrte nie wieder an seinen Arbeitsplatz zurück.
Die Maredo - Dame
Anne Lehniger
Ich sitze an dem großen Schreibtisch im Wohnzimmer. Mein linker Fuß wippt im Takt zu der Instrumentalmusik. Gefühlte hundertmal schaue ich auf die Uhr in der rechten Ecke des Computermonitors. Die Warterei macht mich ganz kirre.
Doch da knackt plötzlich der Schlüssel im Schloss und die Wohnungstür öffnet sich.
«Hallo, mein Engel!», ruft Paul vom Hausflur in den Raum hinein. Ich stürme durch die Küche und drücke ihn fest an mich. «Hey, mein Sternenprinz. Endlich bist du wieder da.»
Paul streichelt mir sanft über die Wange und antwortet,
«Ich war doch nur vier Tage auf Fortbildung und wir haben fast jeden Tag miteinander telefoniert!»
Ich schiebe ihn ein Stück von mir weg und mache einen Schmollmund. «Trotzdem», sage ich und füge augenzwinkernd hinzu, «es hat ja den ganzen Tag geregnet, es hätte ja auf dem Rückweg was passieren können und dann müsste ich einen neuen großen Jungen adoptieren.»
Paul kneift in mein Kinn und gibt mir einen Kuss auf den Mund. «Du, Gemeine, du.»
Er zieht sich die Schuhe aus, stellt die schwarze ausgebeulte Reisetasche auf den Küchenstuhl und lässt sich im Wohnzimmer auf die Couch plumpsen.
«Du glaubst nicht, was mir und zwei Seminarteilnehmern gestern passiert ist!»
Erwartungsfroh schaue ich ihn an. «Erzähl!»
«Wir waren gestern zum Abschluss bei Maredo essen. Und …»
«Was?», falle ich ihn mit weit aufgerissen Augen ins Wort. «In meinem Lieblingsrestaurant?»
«Ja.» Er verdreht die Augen. «Lass mich doch mal erzählen. Also, da saß nebenan so eine Frau ganz allein am Tisch. Wir haben sie nicht weiter beachtet. Aber als wir dann bezahlen wollten und die Kellnerin uns die Rechnung gab, waren wir geschockt über den hohen Betrag. Wir hatten gar nicht so viel gegessen. Da sagte uns die Bedienung, sie dachte, wir würden für die Dame am Nebentisch mitzahlen. Die Frau hätte ihr gesagt, dass wir befreundet wären und für sie die Rechnung begleichen würden.»
Ich schüttelte über soviel Dreistigkeit den Kopf. «Das geht doch nicht. Darauf kann sich das Personal doch nicht verlassen. Da muss man doch wenigstens sicherheitshalber mal nachfragen.»
Paul schaut mich ratlos an und kratzt sich am Hinterkopf. Mich irritiert seine Reaktion, aber meine Neugierde siegt und ich frage weiter: «War die Frau noch da?»
«Nein. Sie war vor uns gegangen.»
Ich glotze ihn wie ein kleines Kind an, das gerade eine unheimliche Geschichte hört. «Und? Was habt ihr dann gemacht?»
«Wir haben die Rechnung durch drei geteilt. Wir wollten … »
«Aber warum? Wie bescheuert ist das denn? Ich hätte die Polizei geholt», rief ich entrüstet.
Ein wenig genervt von meinen Unterbrechungen fährt er fort. «Wir wollten nicht so ein Riesending draus machen. Aber warte, es geht noch weiter. Als wir wieder auf der Straße waren, sind wir noch kurz im Park spazieren gegangen. Und da saß die Frau auf einer Bank. Wir sind zu ihr hin und haben sie zur Rede gestellt. Die Frau erzählte uns, ihr wäre es unangenehm gewesen, weil sie nicht genug Bargeld dabei gehabt hätte, um bezahlen zu können. Sie hat sich bei uns entschuldigt und gesagt, sie würde jetzt gleich zur Bank gehen, um uns das Geld zurückzugeben.»
«Hä? Kapier ich nicht. Bei Maredo kann man doch auch mit Karte zahlen?» Langsam wurde die ganze Geschichte absurd.
«Ja, das kam uns auch sehr komisch vor. Deshalb sind wir auch mit zu der Bank. Wir haben draußen gewartet und in der Zeit ihren Rucksack als Pfand behalten. Aber als sie nach zehn Minuten immer noch nicht zurück war, sind wir ihr nachgegangen und sie war nicht mehr da», sagt er jetzt fast schon im Flüsterton.
«Ist nicht dein Ernst. Wie bescheuert seid ihr denn? Ich wäre mit rein gegangen und hätte sie keine Sekunde aus den Augen gelassen. Außerdem ist es doch auch nachts beleuchtet und man kommt immer dort raus wo man auch reinkommt.» Mittlerweile ärgere ich mich schon über Pauls Dummheit.
«Ich kann mir das auch nicht erklären. Sie war einfach weg. Vielleicht gab es ja einen Hinterausgang. Aber wir haben noch ihren Rucksack gehabt. Als wir den Reißverschluss öffneten, waren da lauter Knochen drin. Und, was denkst du, von welchem Tier die waren?»
Jetzt bin ich völlig durcheinander. Was sollte das bei dieser ganzen Geschichte noch für eine Rolle spielen?
«Keine Ahnung. Von einem Schwein?»
«Nein. Sie waren von einem Bären. Von dem, den ich dir gerade aufgebunden habe.»
Kleine feste Schneebälle treffen besser
Maria Hertting:
Die Lüge ist wie ein Schneeball:
Je länger man sie wälzt, desto größer wird sie.
Martin Luther.
Ein Schneeball sollte gar nicht gewälzt werden. Klein und fest muss er sein und von Hand geformt, dann ist er am effektivsten. Er darf erschrecken, dem Werfer einen Vorteil verschaffen, verletzen sollte er nicht. Eine Schneeballschlacht ist ein faires Spiel.
Sicher gibt es den großen Ball, der so lange gewälzt wird, bis eine Lawine entsteht, also die große Lüge, mit der sich jemand in betrügerischer Absicht etwas aneignet oder die das Gegenüber bloßstellt. Viel häufiger aber sind es die kleinen Lügen, die andere zum Schmunzeln bringen. Sie gehören zum Menschen, wie seine Nase und seine Ohren. Diese Lügen haben die Evolution vorangetrieben. Die Menschheit wurde intelligenter durch sie.
Alle Primaten verschaffen sich durch kleine Lügen Vorteile. Südamerikanische Kapuzineraffen, die in der Rangordnung weit unten stehen, stoßen Warnschreie aus, auch wenn kein Feind in der Nähe ist. Diese Täuschung dient nur dem einen Zweck, das Futter zu stibitzen, wenn die Tiere flüchten. Triumph des Geistes über die Muskulatur. Dressierte Schimpansen sollen ihre Pfleger ebenfalls gelegentlich belügen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.
Die Fähigkeit zur Lüge liegt im Neo Cortex und ist somit ausschließlich eine Eigenschaft der Primaten. Die menschliche Sprache aber hat die Lüge erst zur Perfektion gebracht. Niemand versteht sich so gut aufs Lügen wie der Mensch. Es scheint, dass wir zum Lügen geboren sind. Wir können davon ausgehen, dass jeder Mensch lügt.
Ein Lügner denkt vorausschauend. Ein Kind, das seinen Eltern erklärt, es habe keine Hausaufgaben auf, weiß, wenn es das tut, werden ihm seine Eltern erlauben, spielen zu gehen, was sie nicht täten, wüssten sie, dass es noch seine Hausaufgaben machen muss. Dass die Lüge auffliegen könnte, kommt dem Lügner nicht in den Sinn. Lügner sind selbstbewusst. Die Wenigsten glauben, dass jemand ihre Lügen durchschaut. Wenn jemand lügt, gebraucht er seine Phantasie. Phantasie ist etwas, das nur dem Menschen eigen ist. Phantasie ist Lüge pur.
Jeder Schriftsteller lügt, wenn er eine Geschichte aufschreibt. Sie ist so, wie er sie erzählt, nicht wirklich passiert. Aber seien wir ehrlich: Eine Geschichte muss nicht wahr sein. Sie muss lustig, traurig oder spannend sein - eben unterhaltend.
Genauso unterhaltsam sind bisweilen Lügner. Wie sonst ist es zu erklären, dass immer wieder Menschen auf Betrügereien hereinfallen?
Die folgende Geschichte ist voll von kleinen Lügen und peinlichen Wahrheiten und gerade deshalb so menschlich.
Stefan hatte es stark erwischt – Windpocken. Er sah zum Fürchten aus. Mit großen traurigen Augen, den einzigen Stellen an seinem Körper, die frei vom Ausschlag waren, sah er seine große Schwester an. Die nahm ihn in den Arm: Windpocken hin, Windpocken her. Vermutlich hatte sie sich sowieso schon angesteckt. Eigentlich fand Tina, dass ihr kleiner Bruder schrecklich aussah – wie ein Zombie. Aber das konnte sie ihm nicht so unverblümt sagen. Manchmal ist die Wahrheit eben verletzend.
«Ist gar nicht so schlimm.» Sie strich ihm über den Kopf. Die Pocken saßen sogar unter den Haaren. Wie eklig. Schnell zog sie ihre Hand wieder zurück.
Mehrmals täglich bestäubte Claudia den gesamten Körper ihres Sohnes mit einem Puder, der den Juckreiz lindern sollte. Danach sah Stefan aus wie Max und Moritz nach dem Verlassen der Mehlkiste des Bäckers. Die Mutter saß ständig an Stefans Bett. Der wunderte sich, dass seine Mama, die Lehrerin war, nicht zur Arbeit ging.
«Warum gehst du nicht zur Schule?», fragte er neugierig.
Liebevoll nahm Claudia ihren bepockten Sohn in den Arm. «Ich habe um Befreiung vom Unterricht gebeten.»
Verwundert und empört sah Stefan die Mama an. «Ja, bist du denn in der Schule eingesperrt?»
«Aber nein», lachte Claudia. «Das sagt man nur so. Gemeint ist, dass man dienstfrei hat. Verstehst du? Man ist sozusagen von der Arbeit befreit.»
Stefan war erleichtert, dass niemand seine Mama ihrer Freiheit berauben wollte.
Nach einer Woche trockneten die Pocken ab. Man konnte den Schorf von der Haut abheben. Feine rote Stellen blieben zurück. Unter einigen Pocken bildeten sich kleine Vertiefungen. So auch unter der größten, die mitten auf Stefans Stirn gesessen hatte.
«Da bleibt eine Narbe», sagte Stefans Schwester und konnte ein schadenfrohes Grinsen nicht ganz unterdrücken.
«Was ist eine Narbe?», wollte Stefan wissen.
Tina besah sich ihre Finger und gab ihrem Gesicht einen emotionslosen Ausdruck. Sie war mit ihren elf Jahren ihrem kleinen Bruder, der gerade mal vier geworden war, geistig haushoch überlegen und kostete diesen Moment voll aus. «Na, so ein Loch in der Stirn!», sagte sie und piekte zur Unterstreichung des Gesagten, mit dem Zeigefinger in Stefans Stirn.
«Ein Loch?», wimmerte der, und seine Augen weiteten sich angstvoll wie zwei Ballons, in die Luft geblasen wird.
«Na ja, eine kleine Vertiefung», schwächte Tina ab, nachdem sie bemerkt hatte, was ihre unbedachten Worte bei ihrem Bruder ausgelöst hatten.
«Ich will kein Loch», sagte Stefan energisch und richtete sich in seinem Bettchen auf.
Als er anfing zu weinen, tat es Tina leid, aber nur für einen kurzen Moment. Schon meldete sich das kleine Teufelchen in ihr drinnen wieder. Sie holte einen Handspiegel aus dem Bad und hielt Stefan den vor sein entstelltes Gesicht.
«Siehst du?»
Entsetzt prallte der Kleine vor seinem eigenen Spiegelbild zurück.
«Siehst aus wie Dracula!», lachte Tina. Ein Glück, dass Stefan wie immer nichts verstand. «Musst halt die Haare in die Stirn kämmen, dann sieht man nichts», tröstete sie anschließend.
Jetzt konnte Stefan seine Tränen nicht mehr halten. Sie kullerten ohne sein Zutun die Wangen herunter.
«Warum hast du keine Windpocken?», schimpfte er unter Schluchzen. Es schien ihm nur gerecht, dass auch seine Schwester welche bekommen sollte. Schließlich teilten sie alles miteinander.
«Weiß nicht», antwortete die.
Trotz intensiver Suche hatte sie bis heute nicht eine einzige Pocke bei sich finden können.
«Windpocken sind sehr ansteckend», hatte die Kinderärztin gesagt. «Sie werden meterweit durch die Luft übertragen.»
Tina hob bedauernd die Schultern: «Vielleicht fühlen die Pocken sich nicht wohl bei mir.»
Bald ließ der Juckreiz nach und Stefan durfte nach draußen. Der Ausschlag sah zwar noch immer schrecklich aus, fand Tina, war aber nicht mehr ansteckend.
Vierzehn Tage, nachdem die letzten Anzeichen der Windpocken abgeklungen waren, bekam Stefan eine Bronchitis mit hohem Fieber. Bei dem angegriffenen Immunsystem war das kein Wunder. Da Claudia wieder arbeiten ging, musste die Großmutter eingesetzt werden. Niemand, außer Claudia, wurde allerdings mit Stefan fertig. Das sollte die Oma gleich am ersten Tag zu spüren bekommen.
Arme Großmutter. Ihr stand eine schwere Zeit bevor. Gleich früh morgens, als Claudia auf die Klingel gedrückt hatte, klammerte Stefan sich wie ein Buckelgeist an seine Mama und rief: «Nimm mich mit. Ich will nicht bei Oma bleiben.»
Die Großmutter streckte ihren freundlichen Kopf zur Tür heraus und fragte: «Wie geht es meinem Süßen denn heute?», dabei strich sie über Stefans Wuschelkopf. Eine Geste, die er absolut nicht ausstehen konnte.
«Schon besser», wollte Claudia die Situation entschärfen und schob Stefan energisch zur Tür hinein. «Er hat kaum noch Fieber.»
Prüfend legte die Oma ihre Hand auf Stefans Stirn. «Das kriegen wir wieder hin.»
Morgens war sie jedes Mal so zuversichtlich und frisch. Das änderte sich im Laufe des Tages. Der Junge verlangte ihr das Letzte ab. Wenn Claudia ihn nachmittags abholte, bekam sie etwas zu hören. So auch heute.
Die Großmutter deutete auf den Tisch: «Schau dir an, was dein Sohn mit mir gemacht hat!»
Stefan flog seiner Mama in die Arme, um klarzustellen: Hier gehöre ich hin, nicht zu dir, Omi. Claudia ließ ihren Blick über den Tisch schweifen: ein halbgefüllter Joghurtbecher, eine angebissene Banane, ein angetrunkenes Glas Orangensaft, ein angebissenes Stück Brot und das halbe Mittagessen, lieferten den Beweis, womit Stefan sich den Tag vertrieben hatte.
«Er hat wieder nicht essen wollen», beschwerte sich die Großmutter.
«Er wird schon nicht verhungern», wagte Claudia einen Einwand. Stefan schmiegte sich bei Mamas Worten noch dichter an sie und sah seine Oma an, als wollte er sagen: «Siehst du. Mama gibt mir recht.»
Claudia wollte das Gesagte zusätzlich unterstreichen, indem sie die Aussage einer kompetenteren Person hinzufügte . «Die Kinderärztin meinte Letztens, dass man ihn nicht zum Essen zwingen soll. Kinder wüssten allein, wann sie aufhören müssten.»
Die Großmutter, die - wie die meisten Omas - eine gemütliche Figur hatte, ließ dieses Argument nicht gelten. «Die ist ja selbst zu dünn.»
«Wer ist zu dünn!», vergewisserte Claudia sich vorsichtshalber. Sie ahnte jedoch, wen ihre Mutter meinte.
«Na, die Kinderärztin!»
«Findest du?» Claudia lächelte still vor sich hin. «Ich wäre froh, wenn ich solch tadellose Figur hätte.»
«Du? Ist das dein Ernst?» Die Großmutter sah ihre Tochter mitleidig von oben bis unten an und rümpfte die Nase. «Ich finde, auch dich noch zu dünn.»
Weil Claudia wusste, dass ihre Mutter in dieser Sache nicht zu belehren war, schwenkte sie auf ein anderes Thema über.
«Gab es sonst noch Probleme?»
«Stefan wollte nicht schlafen», beschwerte sich die Großmutter.
«Stimmt das?» Claudia sah ihren Sohn streng an. Der wechselte schnell den Platz und versteckte sich nun hinter Oma.
«Ja.» Oma war sichtlich erfreut, dass der Junge bei ihr Schutz suchte, wollte aber dennoch loswerden, was ihr schon die ganze Zeit auf der Seele lag. «Als ich einmal nach ihm sah, war er aufgestanden und hatte die Glasplatte von meinem Nachttisch zertrümmert.»
«Das sagst du mir so ganz nebenbei?» Claudia wurde weiß, griff nach dem Übeltäter und zerrte ihn hinter der Oma hervor. «Was sagst du dazu?»
Stefan war das schlechte Gewissen in Person. «Was kann ich dafür, wenn meine Augen nicht zufallen wollen!» Der Blick, den er seiner Mutter zuwarf, hätte den härtesten Stein erweichen können.
Oma kicherte.
«Und wer hat die Glasplatte kaputt gemacht?», fragte Claudia streng. Nur nicht nachgeben. Keine Schwäche zeigen.
Stefan machte das zerknirschteste Gesicht, das er konnte. Er musste sich mächtig anstrengen dafür, aber es gelang ihm, wie immer, perfekt.
«Na, wer? ... Ich warte!» Mama wurde ungeduldig. Lange konnte Stefan die Antwort nicht mehr hinauszögern.
«Der Teddy!», quetschte er zwischen den Zähnen heraus.
Oma kicherte wieder. Nur Claudia blieb ernst. Das war die einzige Möglichkeit, mit Stefan fertig zu werden.
«Das musst du mir genauer erklären.»
«Teddy wollte Licht machen. Da ist ihm die Lampe umgefallen und auf die Platte drauf.»
«Stefan, du sollst nicht lügen», mahnte Claudia.
Die Großmutter stellte sich schützend vor ihren Enkel. «Das Kind ist doch krank. Und einen Sprung hatte die Glasscheibe schon vorher», schwächte sie ab. Wahrscheinlich bereute sie, dass sie gepetzt hatte. Ein dankbarer Blick von Stefan begleitete ihre Worte. Nicht zu glauben. Der kleine Heuchler presste die Oma ganz fest an sich, so als könne nur sie allein ihm Schutz vor der schimpfenden Mama bieten.
«Na, wenn du meinst.» Claudia zuckte die Achseln. Wenn Stefan dieses Theater aufführte, schmolz Oma dahin wie ein Schokokuss, der zu lange in der Sonne gelegen hatte und war keinen vernünftigen Argumenten mehr zugänglich. Stefan atmete erleichtert auf. Mit feinen Antennen registrierte er, dass seine Mutter aufgegeben hatte.
«Sonst war er ganz lieb, der Kleine», fügte die Großmutter noch hinzu und tätschelte Stefans Kopf. Sie wollte vermeiden, dass ihrem Enkel zu Hause noch eine Strafpredigt drohte. Stefan strahlte sie an und gab ihr einen Schmatzer auf die Wange.
«Bis morgen», verkündete er, als er sein Selbstbewusstsein wiedererlangt hatte. Beschwingt wechselte er von Omas Hand zu Mamas, nachdem er sich vergewissert hatte, dass das Gewitter vorbei war.
Eine Woche später war die Nachuntersuchung bei der Ärztin. Stefan konnte noch so wild sein. Im Sprechzimmer verhielt er sich äußerst diszipliniert. Heute druckste er die ganze Zeit während der Untersuchung herum. Es war klar, dass er etwas loswerden wollte. Endlich fasste er sich ein Herz.
«Meine Oma hat gesagt: Du bist zu dünn», sagte er mit einem provokanten Blick auf die Ärztin, so als hätte er eben die wichtigste Nachricht der Welt verkündet.
Raus war es. Peinliche Stille. Claudia bekam einen knallroten Kopf.
Die Ärztin, die übrigens wirklich eine tadellose Figur hatte, horchte Stefan ungerührt weiter ab. Danach legte sie das Stethoskop zur Seite und schaute ihn freundlich an.
«Was geht denn deine Oma meine Figur an?», fragte sie.
Um weiteres Unheil zu vermeiden, griff Claudia rettend ein. «Meine Mutter meinte, Stefan sei zu dünn. Immer versucht sie, ihn zu mästen.»
«Ach so.» Die Ärztin lachte. «Das hast du wohl falsch verstanden.»
Stefan wollte protestieren aber ... irgendetwas in Mamas Gesicht hielt ihn zurück. Er verstand die Welt nicht mehr. Hatte Mama ihm nicht ausdrücklich eingeschärft, immer die Wahrheit zu sagen?
Wenn er ehrlich war, musste er zugeben, dass auch er manchmal log, aber doch nur bei ganz unwichtigen Dingen. Zum Glück hatte er ja seinen Teddy. Der nahm freiwillig jede Schandtat auf sich. Und niemand hatte je versucht, den kleinen Kerl zu bestrafen. Ein Glück, dass es ihn gab. Er wollte etwas gut machen, presste den stummen Freund fester an sich und flüsterte in dessen Ohr: «Ich hab’ dich lieb, Teddy.»
Der Liebe Zaubermacht
Peter Suska-Zerbes
Das ist der Liebe Zaubermacht,
das sie veredelt, was ihr Hauch berührt.
Aus Sappho von Franz Grillparzer
Hör mal, Sebastian! Du hast keine Ahnung, wie mein Vater sein kann. Der ist als Firmenbesitzer einen rauen Ton gewöhnt. Glaub mir! Wir können nicht einfach so zu mir nach Hause gehen, und so tun, als wenn wir uns schon ewig kennen würden.»
Der Siebzehnjährige nickte niedergeschlagen, starrte nur hinunter auf die Stadt, auf die sie von hier oben von der Gartenbank im Klostergarten eine schöne Aussicht hatten. Für einen Moment war er versucht, ihr zu sagen, dass ihr alter Herr nicht schlimmer sein könne, als sein eigener Vater, der kaum einen Tag nüchtern war.
«War, ja … ja auch nur so eine … Idee», stammelte Sebastian verlegen und fügte gleich erklärend hinzu:«Ich wollte ja eigentlich nur mal eure Villa sehen.»
«Versteh ich doch, Sebastian. Sobald er auf Geschäftsreise ist, kannst du zu uns kommen. Ganz klar. Versprochen!»
«Danke. Ich hätte schon gern gewusst, wie die reichen Leute so leben», wiederholte Sebastian, weil er irgendwie den Faden verloren hatte. Einen Moment später hätte er sich die Zunge dafür abbeißen können. Warum hatte er sich selbst so wenig im Griff?
Neidisch hatte er ihr die ganze Zeit zugehört, wie sie erzählte, dass sie in einer Villa mit Swimmingpool wohnte, und dass ihr Vater einer der reichsten Unternehmer in der Stadt wäre. Natürlich wollte er diesen Luxus unbedingt einmal sehen, hauste er doch selbst mit seiner Tante in einer kleinen Dreizimmerwohnung, draußen in der Sozialsiedlung, seitdem ihn sein Vater aus der Wohnung geworfen hatte. War wahrscheinlich besser so.
Verlegen warf Sebastian zunächst einen Blick auf ihre, dann auf seine Kleidung. Beide wirkten sie flott, jugendlich, aber bestimmt nicht reich und extravagant. In der Hinsicht waren sie sich sehr ähnlich.
Als sie seinen musternden Blick auf ihrer Kleidung bemerkte, näselte sie: «Jetzt bist du schon wie mein Vater. Eine junge Dame sollte viel mehr auf ihr Äußeres achten. Das sagt er ständig. Schon wegen des Personals und so.» Ihr sanftes Lächeln nahm ihrer Aussage die Härte, das Vorwurfsvolle.
«Vielleicht hat dein Vater ja gar nicht so Unrecht», meinte Sebastian.
«Ja, vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall super, wie du rumläufst.»
Sebastian erwiderte verlegen ihr Lächeln: «Ich wohne ja auch nicht in einer so vornehmen Gegend und habe auch keinen Vater, dem die halbe Stadt gehört.»
«Sebastian, ich mag es nicht, wenn man mich ständig anspricht, wie eine Dame aus besserem Haus. Warum müssen die Menschen ständig danach beurteilt werden, nach dem, was sie besitzen?»
Schlimmer ist, wenn sie nach dem beurteilt werden, was sie alles nicht haben, dachte Sebastian düster, aber er schwieg. Sie als wohlhabende Tochter würde ihn sowieso nie verstehen, wie es ist, sich jeden Tag Gedanken machen zu müssen, was man sich an dem Tag noch zum Essen leisten kann.
Eine Weile verlor sich jeder der beiden auf der eigenen Insel in seinen Gedanken und Träumen. Jeder weit weg. Unerreichbar in der eigenen Welt.
«Und, was machst du so?», fragte sie etwas unsicher. «Ich meine, beruflich und so.»
Gleich verlor Sebastian alle Farbe aus dem Gesicht, fing an zu stottern: «Kei… keine Ahnung. Mal dies, mal das. Was … was sich eben so ergibt.» Bevor sie auf die Idee kam, dieses Thema zu vertiefen, fragte er: «Und du?»
«Ich? Was meinst du?»
«Na, was du so machst? Wirst ja etwas mehr auf die Reihe bringen, als gutaussehende Jungs wie mich auf der Straße anzusprechen.»
Genaugenommen hatte er zwar sie vor zwei Stunden unten in der Fußgängerzone aufs gerade wohl angesprochen, ohne sich allerdings viel Hoffnung zu machen, bei ihr landen zu können. Solche, die so gut aussahen wie Nadine, hatten meistens einen festen Typen, und hinter so einem wie ihm, der die Lehre schon zweimal geschmissen hatte, der in seinem Leben schon soviel Mist gebaut hatte, waren die Mädels auch nicht gerade wild hinterher, jedenfalls nicht die, die sich für länger lohnten.
Er war es gewesen, der den neu angelegten Klostergarten vorschlug, nachdem sie sich eine Weile in der Stadt unterhalten hatten. «Eine Menge Bänke, wo man seine Ruhe hat», hatte er ihr erklärt. Nichts hatte er ihr davon gesagt, dass er bisher von dem neu eröffneten Garten auch nur gehört hatte, selbst noch nie dort gewesen war. Die Anlage war eher etwas für Touris und alte Leute. Das war auf jeden Fall bisher seine Meinung.
Nadine hatte ihm bei diesem Vorschlag nur einen schelmischen Blick zugeworfen, hatte genickt, vor sich hin geschmunzelt. «Okay! Können wir uns ja mal anschauen.»,
Seine Hoffnung, hier oberhalb der Stadt mit ihr allein sein zu können, wurde bereits enttäuscht, als sie hineingingen. «Auf dem Hauptbahnhof hätten wir wahrscheinlich mehr Ruhe gehabt», stöhnte er, als sie sich im Garten umschauten.