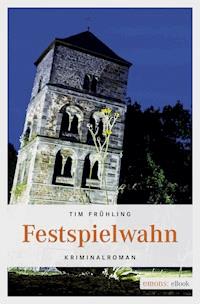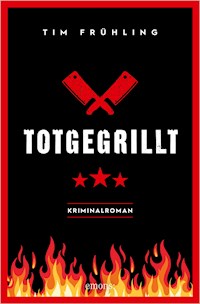8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Komplett verzichtbar, unglaublich unnütz – absolut unvergesslich! »Von meinem Kollegen Dingsbums kann ich mir seit drei Jahren den Vornamen nicht merken, aber ich weiß, dass er einen roten Renault Twingo fährt, den er laut Nummernschildumrandung im Autohaus Ziplinski gekauft hat. Von allen Klassenkameraden aus der Unterstufe kenne ich noch die Telefonnummern, rufe aber nie an, weil ich den Namen eh kein Gesicht zuordnen könnte.« Von einem, der sich immer nur an den unwichtigen Kram erinnern kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Tim Frühling
Nichts kann ich mir am besten merken
Fischer e-books
Für Basti, Kecki und Steffi
Vorwort
Ich habe jetzt doch ein bisschen die Sorge, Sie könnten mich für seltsam halten. Nachdem ich dieses Buch in Gänze noch mal durchgegangen bin, muss ich mir selbst einen Hang zum nörglerischen Besserwissertum beziehungsweise zur unnützen Schlaumeierei attestieren. Wie kann es sein, dass sich einer ohne Studium, strenggenommen sogar ohne anerkannte Ausbildung, hinsetzt und über Dutzende von Seiten Beobachtungen beschreibt, Erklärungen abgibt und ungefragt den Senf aus seiner Tube dazudrückt? Ich sag Ihnen, wie das sein kann: Wer mit offenen Augen und Ohren durch seine Heimat geht oder fährt, schnappt haufenweise Eindrücke auf. Wer sich darüberhinaus nicht nur aufs Aufschnappen, sondern auch aufs Hinterfragen einlässt, häuft im Laufe der Jahre ein krudes Sammelsurium an Wissen an, das weder bei einem Studium noch bei der täglichen Arbeit hilft und bei »Wer wird Millionär?« wahrscheinlich nicht mal für 500 Euro reichen würde. Es handelt sich dabei um kein mutwillig antrainiertes Wissen, sondern eher um eines, das einfach so im Vorbeihören und Vorbeilesen aufgeschnappt wurde. Ich nenne es mal Schnappwissen. Da ich nun aber meine Mitmenschen nicht permanent mit diesem Schnappwissen belästigen will, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mein dahingehendes (und allzu oft ausgebremstes) Mitteilungsbedürfnis anders zu kanalisieren. Ein Buch hielt ich für eine gute Idee. Während ich nämlich im Gespräch sofort bemerke, wann mein Schnappwissen zu langweilen anfängt, können Sie das Buch jederzeit diskret beiseitelegen, ohne dass ich es mitbekomme.
Nicht alle Daten und Fakten der folgenden Kapitel hatte ich ohne nachzuschlagen sofort parat, das gebe ich zu. Aber alle verarbeiteten Themen spukten mir schon lange im Kopf herum und wurden von mir als recherchierenswert erachtet. Denn nur, wer im Alltäglichen die kleinen Besonderheiten findet, kann das große Besondere im Nichtalltäglichen schätzen. Der französische Schriftsteller Antoine de Rivarol hat mit folgender Großkotzigkeit mal eine Lanze für das Alltägliche gebrochen: »Die außerordentlichen Geister wenden sich vor allem den alltäglichen, vertrauten Dingen zu, während den gewöhnlichen Köpfen nur die außerordentlichen Dinge auffallen.« Ich lade Sie deswegen auf eine Reise durch die deutsche und europäische Alltäglichkeit ein, bei der Sie sicher die eine oder andere Außerordentlichkeit entdecken werden und Ihren »gewöhnlichen Kopf« im Sinne de Rivarols zum »außerordentlichen Geist« pimpen können.
Eins noch: Sollte gerade Ihre Heimatstadt von mir im Folgenden verunglimpft werden, nehmen Sie es mir nicht krumm. Die meisten deutschen Städte haben sich ihr Gesicht nach 1945 ja nicht freiwillig ausgesucht.
Manchmal habe ich das Gefühl, im Laufe eines Tages doppelt so viele überflüssige Eindrücke wahrnehmen und abspeichern zu können wie normale Menschen. Ohnehin prasseln in der heutigen Zeit jede Menge Bilder, Fakten und Informationen auf unsere menschlichen Matschbirnen ein, wovon nur die wenigsten tatsächlich von Relevanz sind. In meinem Hirn vermute ich eine scharfe Trennkante, die eingehende Informationen in »wichtig« (Namen von Kollegen, Wiedererkennung von Gesichtern, mathematische Formeln zum Bestehen des Abiturs etc.) und »unwichtig« (Höhe von Bergen, Nummerierung von Bundesstraßen, Telefonvorwahlen etc.) dividiert. Das an sich ist ganz kommod. Ärgerlich ist allein, dass an das Bassin für die wichtigen Informationen offenbar ein riesiger Mülleimer angeschlossen ist, während die unwichtigen Fakten umgehend auf einer voluminösen Festplatte langzeitarchiviert werden.
Frappierend wurde dieses Ungleichgewicht bei einem Griechenlandurlaub deutlich: Ich verbrachte einen Nachmittag mit drei wirklich hübschen Mädchen beim Kurs »99 Worte Landessprache«. Am nächsten Tag begrüßten mich die drei mit einem freundlichen »Kaliméra«, woraufhin ich verwundert fragte, wo sie das denn gelernt hätten. Die drei Girls reagierten verstört und schnitten mich fortan. Wie sie ausgesehen hatten und hießen, habe ich offenkundig innerhalb von sechzehn Stunden vergessen. Bis heute erinnere ich mich allerdings, dass sie aus Sarstedt, Peine und Hildesheim-Himmelsthür kamen.
Von meinem Kollegen Dingsbums kann ich mir seit drei Jahren den Vornamen nicht merken, aber ich weiß, dass er einen roten Renault Twingo fährt, den er laut Nummernschildumrandung im Autohaus Ziplinski gekauft hat. Von allen Klassenkameraden aus der Unterstufe kenne ich noch die Telefonnummern, rufe aber nie an, weil ich den Namen eh kein Gesicht zuordnen könnte. Um es überspitzt auszudrücken: Informationen über Menschen sind schneller vergessen als gehört, andere, geographische Fakten beispielsweise oder Eindrücke saugen sich in meinem Oberstübchen dagegen so fest, dass die Magdeburger Halbkugeln ein Dreck dagegen sind.
Das ist nicht immer nur von Vorteil. Wenn man unglückseligerweise einen Tag in Ludwigshafen verbringt, wäre man froh, wenn man möglichst wenige Eindrücke in sich aufsaugen würde. Aber es ist nunmal so. Deswegen ist es wichtig, das Aufgesogene zu verarbeiten, zu bewerten und zu sortieren. Ist Ihnen zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass südlich von Ludwigshafen etwas völlig Unlogisches passiert? Schauen Sie sich mal eine Postleitzahlenkarte an – und Sie wissen, was ich meine. Eine etwas größere Handvoll Orte hat plötzlich eine Postleitzahl, die mit 7 beginnt. Rheinland-Pfalz und eine 7! Früher undenkbar. Aber nach der Wiedervereinigung musste das logische System der vierstelligen Postleitzahlen ja von einem unglückseligen, fünfstelligen vergewaltigt und niedergemacht werden. Selbst der freundliche, gelbe Handschuh namens Rolf, der die schwierige Aufgabe hatte, als Maskottchen über diesen Akt der postalischen Barbarei hinwegzutrösten, konnte meine Wut über die neuen Fünf-Ziffern-Monster nicht bändigen. Früher war – jedenfalls im Westen – alles so klar: Hinten eine Null – größerer Ort. Zwei Nullen – noch größer. Drei Nullen – unfassbar groß. Orte, die sich dann sogar noch mit einer weiteren zweistelligen Zahl hinter dem Ortsnamen schmückten, hatten es im Laufe der Geschichte echt zu was gebracht. Zustellbezirk hieß das im Fachjargon. 6000 Frankfurt 40 – das klingt doch schon wie ein Synonym für »freie Reichsstadt« oder »Krönungsort der Könige«. Wie klingt dagegen 65929 Frankfurt? Kaum besser als 65451 Kelsterbach? Eben.
Nicht nur dieses System der Logik wurde über Nacht außer Kraft gesetzt, auch mein antrainiertes Wissen, jede Postleitzahl mit mindestens einer Null am Schluss der richtigen Stadt zuordnen zu können, war reif für den Mülleimer oder fürs Vergessen – was mir leider nicht immer gelingt. Genauso absurd wie die 7 für Rheinland-Pfalz war die 8 für Teile Baden-Württembergs oder die 39 für den Norden Sachsen-Anhalts. Wenn einem die Wiedervereinigung schon sein Wissen raubt, will man doch wenigstens sofort erkennen können, was früher Zone war und was nicht. Deswegen fordere ich: Vorne die 0, die 1 oder die 9 → Zone; der Rest → West. Da höre ich übrigens gerade Beifall aus Franken aufbranden, die ihre kuschlige 8 gegen die unentschlossene Ost-West-Chimäre 9 tauschen mussten.
Wenigstens die Telefonvorwahlen sind noch ein sicherer Indikator dafür, wo der angerufene Fernsprecher steht. Wenn die Vorwahl mit 03 beginnt und sich danach eine Zahlenkette epischer Länge anschließt, landet man auf jeden Fall auf der ehemals besser ausgeleuchteten Seite des Eisernen Vorhangs.
Für seinen Gram mit den – Achtung: Wortspiel – Postleidzahlen ist Franken allerdings großzügig entschädigt worden. Hat es doch seit der Wiedervereinigung gefühlt mehr Autobahnkilometer als Einwohner. Schon im Mittelalter war es der größte Wunsch des Menschen, so schnell wie möglich von Schweinfurt nach Ilmenau zu kommen. Zwei lupenreine Metropolen – und Jahrhunderte lang nur über Trampelpfade miteinander verbunden. Bis 2003, um genau zu sein. In diesem glorreichen Jahr wurde nämlich Deutschlands längster Tunnel eröffnet: der Rennsteigtunnel. Bedarf und Kosten waren in den wilden Jahren nach dem Mauerfall zweitrangig, deswegen waren sinnlose und besonders teure Projekte schwer en vogue: der Rennsteigtunnel. Um wenigstens einen Teil der Kosten wieder reinzuholen, hat man sich entschieden, ein sinnloses Tempolimit von 80 Stundenkilometern zu verhängen. Sinnlos deswegen, weil ich fast noch nie zwei Autos gleichzeitig die 7,9 Kilometer lange Röhre habe durchfahren sehen: Karambolage-Gefahr daher eher gering.
Derselbe Feuereifer, der beim Bau unnötiger Routen an den Tag gelegt wurde, herrscht offenbar bei der vorsätzlichen Ignorierung dringenden Ausbaubedarfs. Und da tut sich besonders die Perle des deutschen Südostens hervor – Bayern. Natürlich ist der Bau von Bundesautobahnen Bundesangelegenheit, aber offenbar muss etwa vierzig Jahre irgendein bayernhassender Dämon im Verkehrsministerium gesessen haben, der von Hanns Seidel bis Horst Seehofer keinem Freistaatsvater standesgemäß ausgebaute Autobahnen genehmigte. Das grausamste Beispiel konsequenter Ausbauverweigerung fand sich jahrzehntelang an der A3 hinter der hessisch-bayrischen Grenze. Gleitet man rasant von Köln über Frankfurt Richtung Bajuwarien, so findet die gleitende Rasanz genau mit dem Erreichen desselben ein jähes Ende. Mit dem Passieren des Bundesland-Begrüßungsschildes verengt sich die Autobahn auf ein menschenunwürdiges Maß, strotzt vor unübersichtlichen Kurven und ist von Oktober bis Mai mit einer meterdicken Schneeschicht bedeckt. Das Wort »Standstreifen« ist ab der Aschaffenburger Mainseite kein Teil des gängigen Vokabulars mehr. Mittlerweile allerdings sind Bautrupps angerückt, um das Nadelöhr bis Nürnberg wenigstens partiell zu entschärfen. Aber mittlerweile hat ja auch die CSU keine absolute Mehrheit mehr – und da hat sich der Ministeriumsdämon vielleicht mal großzügig gezeigt.
Apropos Bundesland-Begrüßungsschild. Gibt es dafür eigentlich keinen Fachterminus? Es kann doch nicht angehen, dass alle paar hundert Kilometer in Deutschland ein Schild steht, das in der StVO nicht benamt wurde. Wenn ein armer Depp mit seiner Karre in eine Ampel rast, heißt es im Polizeireport: »Der Personenkraftwagen kollidierte mit der Lichtzeichenanlage aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.« Was nun, wenn jemand genau an einer Landesgrenze in ein Bundesland-Begrüßungsschild donnert? Das kann man so ja nicht schreiben, nachher versteht man’s sofort. Ich schlage daher als Wording für Polizei-Pressestuben das Wort »föderalistisches Eigenwerbesymbol eines Bundeslandes bzw. Freistaats« vor. Dann sind auch die Polizeimeldungen wieder das, was sie einmal waren, nämlich unverständlich: »Auf Höhe der ehem. GÜSt Marienborn verunfallte infolge Verstoßes gegen das BtMG der Fahrzeuglenker und kollidierte mit dem föderalistischen Eigenwerbesymbol des Landes Sachsen-Anhalt.«
Ach, und überhaupt: Sachsen-Anhalt. Früher grüßte den Autofahrer vom Straßenrand nur das neutrale Wappen des Landes, auf dem der Bär so lustig auf Backsteinzinnen balanciert. Heute weist ein anderes Schild den Einreisenden darauf hin, die Keimzelle des Einwohnerrückgangs erreicht zu haben: »Willkommen im Land der Frühaufsteher.« Sachsen-Anhaltiner! Was habt ihr euch dabei gedacht, beziehungsweise welche kokainistische Werbeagentur ist dafür verantwortlich? Eine windige Umfrage aus dem Jahr 2006 hatte ergeben, dass die Menschen zwischen Zeitz und Salzwedel im Schnitt tatsächlich neun Minuten eher aus dem Bett kriechen als im Rest der Republik. Aber wie rar müssen Alleinstellungsmerkmale in diesem Land gesät sein, wenn aus dieser Tatsache gleich eine ganze Kampagne gemacht wird? Freunde, wenn ihr schon beim Bild der Frühaufsteher bleiben wollt, dann schreibt doch wenigstens drauf: »Wer früher aufsteht, ist schneller weg.« Das hätte mehr Esprit und Witz, als man den Menschen des einzigen Bundeslandes ohne internationalen Verkehrsflughafen zutrauen würde.
Ich lobe mir Länder, die an ihrer Grenze schlicht und würdevoll mit ihrem Wappen grüßen. Hamburg oder Baden-Württemberg zum Beispiel. In Hessen hibbeln derart viele Bälger auf dem föderalistischen Eigenwerbesymbol herum, dass man sich nicht sicher sein kann, ob man eine Landesgrenze überfährt oder auf dem Hof einer Kinderwunschpraxis gelandet ist.
Eine besonders feine Idee hatte zeitweise übrigens das Saarland. Dort hießen Promis die Gäste auf den Schildern willkommen. Also Nicole. Denn außer der Grand-Prix-Siegerin von 1982 hatte das Beitrittsgebiet ja nie viel mehr an Promis zu bieten, außer Oskar Lafontaine vielleicht, der allerdings abschreckend auf die raren Investoren aus der Wirtschaft wirken könnte. Immerhin hat Saarbrücken einen internationalen Verkehrsflughafen (SCN), und Zweibrücken gleich den nächsten (ZQW). Zwischen den Airports liegt die gewaltige Distanz von dreißig Kilometern – der eine allerdings im Saarland, der andere in Rheinland-Pfalz. Wahrscheinlich hatte der Entscheidungsträger, der den Ausbau von Zweibrücken anordnete, ein Problem mit der Schlagersängerin Nicole, weswegen er nie gucken fahren konnte, ob nicht zufällig im Nachbarland schon ein internationaler Verkehrsflughafen vorhanden ist. Jedenfalls können sich die Einwohner Blieskastels, das genau zwischen SCN und ZQW liegt, rühmen, in der Region mit der höchsten Dichte an internationalen Verkehrsflughäfen zu wohnen. Und viel zu rühmen gab es in Blieskastel bisher nicht.
Wobei nahezu jeder Ort in Deutschland irgendeine Besonderheit hat, der ihn von der Masse abhebt. Und sei es nur die Lage. Was haben zum Beispiel List auf Sylt, Görlitz, Oberstdorf und Selfkant bei Aachen gemeinsam? Sie sind die Orte, die in Deutschland am weitesten nördlich, östlich, südlich und westlich liegen. Und damit die vier Mitglieder im Zipfelbund. Ja, dieses Wort klingt irgendwas zwischen erfunden, albern und anrüchig, ist aber existent. Der Zipfelbund präsentiert sich alljährlich auf den Feierlichkeiten zur deutschen Einheit, u.a. mit einer vierzipfeligen Wurst. Am Zipfelstand bekommt man außerdem den Zipfelpass, und wer nachweislich alle vier unterschiedlich sehenswerten Orte bereist hat, darf sich – naaaaa? – Zipfelstürmer nennen.
Aber auch Orte ohne geographische Extremlagen glänzen gelegentlich mit schönen Einzelleistungen. Hellschen-Heringsand-Unterschaar im Schleswig-Holsteinischen Kreis Dithmarschen ist der Ort mit dem längsten Namen Deutschlands, das bayrische Kirchdorf am Inn konnte mit seiner Lage an der kürzesten Bundesstraße (B340, Länge 600 Meter) protzen, und Dierfeld in Rheinland-Pfalz ist die eigenständige Gemeinde mit den wenigsten Einwohnern (acht).
Orte, die in die Liste der kleinsten eigenständigen Gemeinden kommen wollen, müssen zwangsläufig in Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein liegen, da nur in diesen Ländern Verbandsgemeinden den sonst üblichen Eingemeindungswahn verhindern konnten. Besonders heftig war der Eingemeindungsrausch in den siebziger Jahren in Nordrhein-Westfalen. Das Ruhrgebiet-Gesetz zum Beispiel (offiziell »Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Ruhrgebiet«) sorgte dafür, dass hässliche kleine Städte in hässliche große Städte eingemeindet wurden. Besonders gallig wurde darauf in Wattenscheid (jetzt Bochum), Kettwig (jetzt Essen) sowie in Gladbeck reagiert. Die stolze Heimatstadt des Schauspielers Armin Rohde sollte zusammen mit Kirchhellen der Stadt Bottrop zugeschlagen werden und fortan als Stadtteil ihr Leben fristen. Der scherzhafte Name des ungeliebten Neo-Konglomerats aus Gladbeck, Bottrop und Kirchhellen war Glabotki, es hielt nicht mal zwölf Monate.
Genauso erfolglos und realitätsfern war seinerzeit die Idee, aus Gießen und Wetzlar die Stadt »Lahn« zu bilden. Allerdings waren die Hessen doof genug, den Budenzauber zwei Jahre nach NRW zu veranstalten, zu einer Zeit also, als Politiker schon hätten ahnen können, dass Bürger keine bengalischen Freudenfeuer zünden, wenn man ihre Städte zusammenlegt, umkrempelt und umbenennt. Lahn hielt immerhin 31 Monate. Ein Bonbon hatten die Lahn-Macher fürs Auto fahrende Plebs allerdings im Ärmel: Das L! Ja, schließlich war Lahn nach der Zusammenlegung eine veritable Großstadt und hatte sich damit das begehrte einbuchstabige Autokennzeichen verdient. War halt auch Zufall, dass das L noch frei war. Denn eigentlich war es Leipzig zugedacht gewesen, aber zu Lahn-Zeiten (1977–1979) mochte eben noch niemand so recht an die Wiedervereinigung glauben. Daher kann sich Wetzlar eines Podestplatzes der größten Wendeverlierer sicher sein: Zuerst war das L futsch – und dann auch noch die Postleitzahl 6330. Herrlich klang die 6 am Anfang nach dem milden Klima Südhessens, nach Weinlauben und reifen Pfirsichen. Eingetauscht gegen eine 35576 zum Beispiel, die den Eindruck macht, als könnte man nach einer kürzeren S-Bahn-Fahrt die Nordsee erreichen.
Neben Postleitzahlen sind Autokennzeichen übrigens ein faszinierendes Hobby. Einige besonders prachtvolle Buchstabenkombinationen wurden kurz nach der Wende in den fünf »neuen« Bundesländern eingeführt. Ostdeutsche erkannte man nicht nur am Trabi oder am Wartburg, sondern auch an ihren vogelwilden Kennzeichen wie HHM, ASZ oder BSK (Hohenmölsen (heute Burgenlandkreis), Aue-Schwarzenberg (aktuell Erzgebirgskreis), Beeskow (mittlerweile Landkreis Oder-Spree). Zwei der drei ehemaligen Kreisstädte müssen so unbedeutend sein, dass meine Rechtschreibprüfung sie rot unterkräuselt. Leider erfolgte schon 1994 die erste Kreisreform in Ostdeutschland, deswegen laufen viele Kennzeichen aus. Wenn man sie noch sehen will, muss man ein Kfz erwischen, das zwischen 1990 und 1994 angemeldet wurde und bis heute nicht von einem Schlagloch verschluckt oder an einem Alleenbaum zersägt wurde. Kleinere Landkreise gingen in größeren auf, deren Kennzeichen aber oft nicht weniger albern sind. Meine aktuellen Lieblinge sind ABI und TDO. ABI hat nichts mit Reifeprüfung zu tun, sondern informiert darüber, dass die arme Wurst am Steuer den Kreis Anhalt-Bitterfeld seine Heimat nennen muss. TDO ist der Rekordhalter im Auseinanderklaffen zwischen Kennzeichen-Buchstabenkombination und Landkreisname. Steht TDO doch für Nordsachsen! Und weil alle drei ehemaligen Kreisstädte Berücksichtigung finden wollten, wurde aus Torgau, Delitzsch und Oschatz eben TDO. Um nicht ein Heer von Logopäden einstellen zu müssen, wurde als Kreisname dann allerdings Nordsachsen gewählt.
Wollen Sie auf einer Party mal richtig glänzen? Dann werfen Sie, wenn die Stimmung gerade abzuflachen droht, folgende Frage in die Runde: Welches ist das seltenste Autokennzeichen in Deutschland, das Privatpersonen bekommen können? Kommt keiner drauf, deswegen können Sie als kleinen Hint noch verraten, dass es weniger als 1000 Autos mit diesem Kennzeichen gibt. Hier die Lösung: BÜS. Steht für Büsingen am Hochrhein. Weswegen in Dreiteufelsnamen hat dieses Nest ein eigenes Kennzeichen?, werden die Partygäste staunend rufen, die sich auf das Quiz eingelassen haben. Ganz einfach: Weil Büsingen eine Exklave ist. Gänzlich umrundet von der Schweiz schillern die 1400 Einwohner der Gemeinde nur so vor Besonderheit: Sie haben zwei Postleitzahlen, eine schweizerische und eine deutsche, die Bauern erhalten eidgenössische Subventionen, und es gibt die billigste Tankstelle Deutschlands, die den Sprit nämlich zu schweizer Preisen verkaufen darf. Offiziell gehört Büsingen zum Kreis Konstanz, um die Zöllner aber schneller erkennen zu lassen, wer exterritorial beheimatet ist, wurde das BÜS erdacht. Ach, übrigens: Sollten Sie das Partyquiz mit einer Geldwette verbinden, verlange ich für diese Informationen Provision.
Vom kleinsten zum größten Landkreis: Lange baumelte diese Medaille über der Brust des Kreises Emsland in Niedersachsen. 300 Quadratkilometer größer als das Saarland, das soll erstmal einer nachmachen! Pah, sagten die wackeren Gebietsreformer Brandenburgs, das schaffen wir locker, und kreierten den Kreis Uckermark, noch mal 200 Quadratkilometer größer als das nicht enden wollende Emsland. Beeindruckend ist, dass auf diesem Latifundium gerade mal 130000 Menschen wohnen, knapp 40000 weniger als noch 1990. Aber auch dieser Ruhm war vergänglich: Mit der Reform in Mecklenburg-Vorpommern 2011 wechselte die Kreisgrößten-Medaille nach Neubrandenburg, Kreisstadt der neu geschaffenen Verwaltungseinheit »Landkreis Mecklenburgische Seenplatte« und wiederum fast doppelt so groß wie der bisherige Spitzenreiter. Aber unter uns: Für diesen neu geschaffenen Namenskoloss kann ein wenig Weitläufigkeit bei Ortsschild und Landschaft ja auch nicht schaden.
Kehren wir aber noch mal kurz in die Uckermark zurück: Der Sitz der Kreisverwaltung ist in der Karl-Marx-Straße in Prenzlau. Genau hier kommt nämlich die nächste Beobachtung ins Spiel, verbunden mit einer kühn aufgestellten These: Je linker die Ratsmehrheit, desto drastischer spiegelt sich das in der Benennung der Straßen wider. Dass die DDR es geliebt hat, Straßen, Gassen und Plätze nach Widerstandskämpfern, Hymnenschreibern und Helden der Arbeit zu benennen, ist eine abgestandene Erkenntnis. Dass aber auch im Westen bei der Straßenbenennung stark politisiert wird, dürfte vielen neu sein.
Mein Lieblingsbeispiel: Das hessische Reinheim zu Füßen des Odenwaldes. Hier würde sogar der berühmte Besenstiel gewählt werden, wenn er sich vorher das Parteibuch der SPD zugelegt hätte. Mit bewundernswerter Chuzpe haben die Ratsherren über die Jahrzehnte dafür gesorgt, dass schon beim ersten Blick auf den Stadtplan klar wird, wer hier das Zepter schwingt. Die Straßennamen sind ein Who’s who der letzten hundert Jahre Sozialdemokratie: August Bebel, Friedrich Ebert, Ernst Reuter, Erich Ollenhauer, Fritz Erler, Gustav Heinemann, Carlo Mierendorff, Willy Brandt und natürlich der große hessische Ministerpräsident Georg August Zinn. Der aufmerksame Leser stutzt jetzt und fragt: Wo ist Kurt Schumacher? Keine Sorge, nach dem wurde die kooperative Gesamtschule benannt. Ach ja, und weil manchem Reinheimer die SPD nicht links genug ist, kann sich der lustige Ort rühmen, noch echte DKP-Abgeordnete im Rat sitzen zu haben. Wahrscheinlich haben die dafür gesorgt, dass im Ortsteil Ueberau noch rasch eine Karl-Marx-Straße eingerichtet wurde.
Nun läge der Verdacht nahe, dass sich anderswo Orte mit CDU- oder CSU-Vorherrschaft rächen wollen für dieses kesse Verhalten. Seltsamerweise ist das nicht so. Im christdemokratischen Stammland Baden-Württemberg führt nur hier und da eine Konrad-Adenauer- oder eine Ludwig-Erhard-Straße ein schüchternes Dasein. Viel höher stehen hier im Straßennamenkurs biedere, apolitische Dinge wie Tüftler (Daimler, Bosch, Maybach, Benz), Berge (Feldberg, Rechberg, Achalm, Teck) oder Vögel (Amsel, Fink, Meise, Drossel). Schon der Buntspecht erscheint wegen seines nonkonformen Aussehens auf den wenigsten Stadtplänen. Haubenmeisen, die Punks unter den heimischen Vögeln? Undenkbar. Auch Flüsse, Baumarten und Seen werden im Südwesten für Straßennamen gerne herangezogen. Mit der Größe der Stadt steigt auch die Kreativität der Straßennamen, und die verwendeten Sujets werden zunehmend absurd.
In Stuttgart gibt es zum Beispiel ein Pilzviertel mit unterschiedlich erstrebenswerten Namen. Während Steinpilzweg und Trüffelweg nach einer Kolonie deutscher Fernsehköche klingen, ist der Hallimaschweg nur was für Nervenstarke. Erstens kann über den lautmalerischen Wohlklang des Namens gestritten werden, zweitens kann er bei schnellem Drüberhinweglesen für den Haschweg gehalten werden – und drittens ist es einfach unschicklich, Kuverts mit Giftpilzen zu adressieren. Bevor man in den Hallimaschweg zieht, könnte man sich genauso gut im Dioxinweg oder im Quecksilberweg niederlassen.
Davor sind die Stadtverwaltungen allerdings bisher zurückgescheut. Trotzdem gibt es Straßen, deren Name allein für einen Wertverfall der Immobilie sorgen kann. Sich zum Beispiel in der Remscheider Straße »Rotzkotten« niederzulassen, bedarf schon eines guten Humors. Auch die Bewohner der »Schlamasselgasse« in Amorbach oder des »Stinkbüttelsgang« im niedersächsischen Hanstedt werden sich im Lauf der Jahre ein dickes Fell zugelegt haben müssen. Gänzlich übertrieben haben es die Stadtväter Dingolfings mit der »Bischöflich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Straße«, die meines Wissens den Längenrekord unter den deutschen Straßennamen hält. Wenigstens ein Rekord für Dingolfing.
Viel erheblicher als der Name ist aus meiner Sicht allerdings das Schild, auf dem er prangt. Hier unterscheiden wir zweierlei Arten von Städten: Solche, die ein durchgehendes Design ihrer Straßenschilder haben und solche, die einfach irgendwas dranklatschen, Hauptsache, der Rettungswagen findet irgendwie zum Patienten. Musterbeispiel gelungenen Straßenamen-Designs ist eindeutig Berlin – da stimmt alles. Die Schilder dort sind leserlich, ordentlich eingefasst und strahlen jede Menge großstädtischer Grandezza aus. Das etwas altertümliche Schriftbild der Lettern »z« und »ß« fügt sich nahtlos in Altbaustraßen ein, auf dem Schild über dem eigentlichen Namen befinden sich oft Zusatzinfos über den Namenspaten. Schilder dieses Designs finden sich auch in Bonn, Göttingen und Bad Lauterberg im Harz, wobei in Bad Lauterberg trotz der hervorragenden Straßenschilder nur selten großstädtische Grandezza aufkommt. Im Ostteil Berlins gibt es Varianten, die zwar auch sauber eingefasst sind, im Schriftbild allerdings weniger begeistern. Sie wurden von der DDR-Führung in schmuckloserem Buchstabendesign ausgeführt.
An ausgewählten Plätzen versucht Berlin mittels historisierender Beschilderung das Flair vergangener Zeiten wiederzubeleben. Die Schriftart erinnert an die zwanziger Jahre und wird von einem Rechteck umrahmt, das jeweils an den Ecken abgerundet wurde, um den Schraubeneinfassungen außerhalb der Umrandung Platz zu lassen. Es haucht dem Besucher zu: »Schau, hier wo ich stehe, ist es gemütlich, ich bin so schön alt, dass Zille mich schon gesehen haben könnte«. Hier und da geht der Plan auf, beispielsweise in der Altstadt von Spandau. Auf einem baumlosen Platz zwischen Plattenbauten, Weltzeituhr und ehemaligem Centrum-Kaufhaus ist ein einzelnes Schild allerdings nicht in der Lage, die Zerstörungen des Krieges und die daran anschließende sozialistische Bauwut vergessen zu machen, und rangiert daher auf einer Skala irgendwo zwischen deplatziert und jämmerlich.
Neben Berlin überzeugen auch Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und natürlich München mit einheitlich beschilderten Straßen. Die Münchner Schilder sind der heimliche Star ihrer Gattung, immerhin hat es eins von ihnen – die »Lindenstraße« – zum Fernsehen geschafft! Eine hübsche Besonderheit bieten die Straßenschilder in Mainz: Die einen sind rot, die anderen blau. Was man für einen immerwährenden Fassenachtsspaß halten könnte, hat einen schlauen und triftigen Hintergrund. Seit fast 160 Jahren wird Ortsfremden so geholfen, sich im Großstadtdschungel zu orientieren. Die Straßen mit den blauen Schildern verlaufen parallel zum Rhein, die mit den roten führen vom Fluss weg. Natürlich ist das Wort »Großstadt-Dschungel« im Zusammenhang mit Mainz ein bisschen übertrieben, aber da der Rheinland-Pfälzer sonst nur Reben, Wald, die Mosel und Kurt Beck kennt, muss ihm Mainz krass urban vorkommen.
Die größte Beleidigung für Menschen mit einem Funken Anspruch an Straßenschilder ist Köln. Es fällt schwer, in Worte zu fassen, wie acht- und lieblos in dieser Fast-Millionenstadt mit der Beschilderung umgesprungen wird. Farbe, Größe, Form, Material und Schriftbild – völlig egal! Zartbesaitete Gemüter sollten die Domstadt in einem weiten Bogen umfahren, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, heulend in diesem zusammengewürfelten Straßenschilderschrottplatz zusammenzubrechen.
So weit kann es kommen, wenn man sich jahrhundertelang nur um den Bau und die Instandhaltung einer einzelnen Kirche kümmert und um sonst nichts. Ziehen wir noch mal Berlin zum Vergleich heran: Hier steht eine kaputte Kirche in der Einkaufsstraße einer stadtweit wohltuenden Straßenschilderharmonie entgegen. In Köln hingegen beleidigen an jeder Ecke schlampige Schilder das Auge – und diesem multiplen Beschilderungsversagen steht gerade mal ein halbwegs intakter Dom gegenüber. So kann’s kommen bei falscher Prioritätensetzung.
Dass das Nachkriegs-Köln, von dieser Kirche abgesehen, ein armseliger Haufen gekachelter Häuser ist, wurde in anderen schonungslosen Werken schon mit treffenden Worten geschildert. Dass sich der Kölner durch objektive Schilderungen von Außenstehenden die Liebe zu seiner Stadt nicht schmälern lässt, oder sie sich notfalls herbeitrinkt, ist ebenfalls eine Binsenweisheit. Die Frage, wie es zum heutigen Köln kommen konnte, ist aber noch nicht genügend aufbereitet worden. Auch hier vermute ich falsche Prioritätensetzung: Einen guten Ruf genießt beim Domstädter bis heute Konrad Adenauer. In seine Amtszeit als OB (1917–1933) fiel zum Beispiel die Errichtung des vielgerühmten Grüngürtels. In seine Amtszeit als deutscher Bundeskanzler (1949–1963) wiederum fiel der Wiederaufbau des Schlachtfelds innerhalb des Grüngürtels. Und nur eine kurze Dienstreise aus dem kuschligen Bonn hätte genügt, um dem ehemaligen Stadtvater zu zeigen, dass dreißig Kilometer rheinabwärts mächtig geschlampt wird. Aber vor lauter Wiederbewaffnung, Westbindung und Sozialistenhassschüren kam der alte Mann wohl nicht dazu, eine Depesche in die Nachbarstadt zu schicken mit der Message: »Keine Kachelhäuser, dafür schöne Straßenschilder!«
Auf der Habenseite des greisen Patriarchen steht allerdings, dass Deutschland gegen Ende seiner Amtszeit gewachsen ist – und zwar nicht nur um das Saargebiet. Sondern um einige Gemeinden und Gemeindeteile entlang der niederländischen Grenze. Heutzutage ist weitgehend unbekannt, dass unsere Nachbarn im Nordwesten bis 1963 hier und da immer wieder ein Stückchen Deutschland annektiert hielten, als Wiedergutmachung für die erlittenen Kriegsschäden. Insgesamt etwa siebzig Quadratkilometer, auf denen rund 10000 Menschen lebten, waren von dieser Regelung betroffen. Der größte Ort war Elten am Niederrhein, dessen Bewohner außergewöhnlich gutgelaunt auf die Zeit der »Niederländischen Auftragsverwaltung« zurückblicken. Nur selten zaubern Annexionen ein Lächeln ins Gesicht – in Elten schon. Denn sowohl die niederländische Regierung als auch die NRW-Oberen verwöhnten die 3600 Einwohner mit Fördergeldern, um sich im Falle eines endgültigen Verbleibens beim einen oder anderen Land der Sympathie dieses Spielballs der Geschichte sicher zu sein.
Die Rückgabe an Deutschland wurde mit der »Eltener Butternacht« gefeiert. Am Vorabend des 1. August 1963 fuhren Laster mit tonnenweise Butter aus niederländischen Eutern und sonstigen zollvergünstigten Waren nach Elten ein und wurden mit dem Schlag der Mitternachtsglocke deutsch und damit außergewöhnlich günstig zu erwerben.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es übrigens niederländische Bestrebungen, weit größere Teile Deutschlands zu annektieren, den sogenannten Bakker-Schut-Plan. Im weitreichendsten Falle wären sogar Köln, Münster und Osnabrück an die Niederlande gegangen. Holland-Ausdehner Frits Bakker-Schut hatte sogar schon Pläne für die Umbenennung deutscher Städte ausarbeiten lassen: Köln wäre zu Keulen geworden, Osnabrück zu Osnabrugge und Mönchengladbach zu Monniken-Glaadbeek. Die Alliierte Hohe Kommission lehnte den Plan aber mit der Begründung ab, Deutschland hätte mit den 14 Millionen Flüchtlingen aus dem Osten schon genug zu tun, da müssten nicht noch weitere aus dem Westen dazukommen. Erst nach längeren Diskussionen einigte man sich 1949 auf den damaligen Grenzverlauf.
Auch Belgien und Luxemburg streckten ihre Finger nach Ende des Krieges nach deutschem Territorium aus, stellten aber offenbar nach genauerer Überprüfung fest, dass ein paar Eifelweiler die Sache nicht entscheidend nach vorn bringen, und verwarfen die Pläne weitgehend.
Grenzverläufe sind meistens sinnlos. Allein an der Form Chiles sieht man, dass der liebe Gott das so nicht gewollt haben kann. Weniger kompromissbereit als die Verhandlungspartner aus Benelux haben sich nach dem Krieg die sozialistischen Grenzzieher gezeigt. Zwei Beispiele für menschengemachte Sinnlosigkeit sind Steinstücken und der Entenschnabel. Steinstücken war eine Exklave im Süden Berlins, ein etwa 1000 mal 300 Meter großer Flecken Land, der zum Westteil der Stadt gehörte, aber rundum von DDR umgeben war. Die rund dreihundert Einwohner schliefen mit dem großen Zeh fast schon in Potsdam, so nah verlief die Mauer an ihren Häusern. Jahrelang konnten die Steinstückener ihren Sprengel nur über eine Straße durch die DDR verlassen oder erreichen, über und über natürlich versehen mit behördlichen Auflagen. Erst Anfang der Siebziger konnten Politiker (West) den Politikern (Ost) ein paar sinnlose Wiesen zum Tausch gegen eine Straßenverbindung von Steinstücken nach Berlin aufschwatzen. Seitdem ragte die Exklave wie eine Faust in die DDR hinein, wobei der sich anschließende Arm die Straßenverbindung nach Berlin darstellte und etwa im Bereich der Schulter der Stadtteil Wannsee begann.
Ebenfalls aus der Anatomie entlehnt ist der Begriff Entenschnabel, der einen Wohnplatz ganz im Norden Berlins bezeichnet. Klingt süß, war aber noch absurder als Steinstücken. Hier ragte nämlich ein Stück DDR nach Westberlin hinein, was mit etwas gutem Willen oder hoher Dioptrienzahl auf der Landkarte für den Schnabel einer Ente gehalten werden konnte. (Straßenname heute: »Am Sandkrug«.)
Da in dem etwa einhundert Meter breiten und vierhundert Meter langen Schnabel zu DDR-Zeiten etwa zwanzig Häuser standen, kam ein Gebietsaustausch nicht in Frage. Die Bewohner lebten in der höchsten Sicherheitszone, die Sperranlagen und der Sicherheitsstreifen vor der eigentlichen Mauer waren deutlich schmaler als sonst üblich. Die flachen Einfamilienhäuser standen unter grellen Grenzschutzlaternen, die sie um das Dreifache überragten. Wenn das Leben im Entenschnabel sonst auch keinen einzigen Vorteil bot: Die Stromrechnung muss unschlagbar niedrig gewesen sein.
Das Gefühl, gut ausgeleuchtet, eingesperrt und beobachtet gewesen zu sein, wurde noch dadurch verstärkt, dass die nördlich verlaufende Westberliner Straße »Am Rosenanger« auf einem Hügel liegt. So konnten die Wessis mit Coca-Cola und Bananen in der Hand aus ihrer Hollywoodschaukel den schmalen Streifen sozialistischen Elends direkt überblicken und sich Tag für Tag darüber freuen, nicht zehn Meter weiter südlich leben zu müssen.