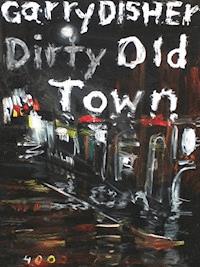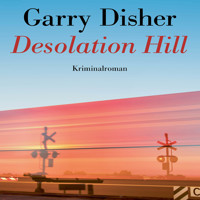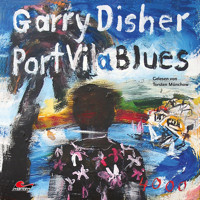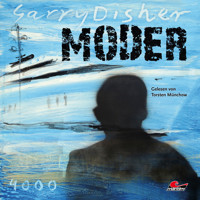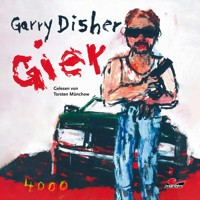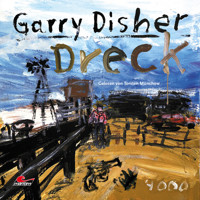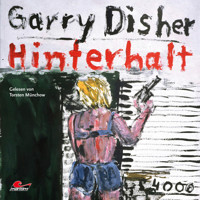Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PULP MASTER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pulp Master
- Sprache: Deutsch
Nach kurzer Liaison mit der Polizistin Liz Redding will Wyatt schnellstens untertauchen. Doch er trifft seinen Neffen Raymond wieder, der ihm den Raub einer Kunstsammlung schmackhaft machen kann. Doch Wyatt ahnt nicht, dass sein Neffe auch andere Deals am Laufen hat. In der Meerenge vor Tasmanien will er mit zwielichtigen Abenteurern eine versunkene Barke voll spanischer Goldmünzen bergen und nebenbei auch noch einen Klienten seines Anwalts aus der Untersuchungshaft befreien. Ist Wyatt bei der Einschätzung der unbekannten Faktoren diesmal ein fataler Fehler unterlaufen? Das lang erwartete Finale der Wyatt-Saga, des mit zwei Deutschen Krimipreisen ausgezeichneten Autors aus Down Under. Die Frage ist: War's das für Wyatt oder hat Garry Disher noch ein Eisen für ihn im Feuer?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Niederschlag
Ein Wyatt-Roman
Garry Disher
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREIßIG
EINUNDDREIßIG
ZWEIUNDDREIßIG
DREIUNDDREIßIG
VIERUNDDREIßIG
FÜNFUNDDREIßIG
SECHSUNDDREIßIG
SIEBENUNDDREIßIG
ACHTUNDDREIßIG
Impressum
Zum Autor
Zu den Übersetzern
Pulpmaster Backlist
PROLOG
Nach dem fünften Banküberfall ist er für die Zeitungen »der Buschbandit«. Ein Inspector der Polizei — nüchtern und unbeeindruckt vom Sog der Kameras — drückt es prosaischer aus: »Wir suchen nach einer männlichen Person, die bewaffnet und als gefährlich einzustufen ist. Die Vorgehensweise des Täters ist in allen Fällen die gleiche. Er sucht sich eine Kleinstadt-Bank in einem Gebiet, das den Westen und Südwesten Victorias und den Osten und Südosten South Australias umfasst. Er wählt einen Zeitpunkt, wo nur wenige Kunden da sind, wenn überhaupt, bedroht die Angestellten mit einer abgesägten Schrotflinte und fordert den Bargeldbestand aus den Kassen. Wir haben bisher keinerlei Hinweise auf einen Komplizen. Ich wiederhole: Diese Person ist bewaffnet. Auf keinen Fall sollte man sich ihr nähern.«
***
Es gibt Dinge, die der Inspector nicht erwähnt. Er sagt nicht, dass die Polizei außer Stande ist, eine Art Operationsbasis des Mannes zu lokalisieren. In Anbetracht des Gebietes, in dem er aktiv ist, könnte sich der Buschbandit in Mount Gambier, Bordertown, Horsham oder irgendwo am Murray River versteckt halten. Oder er operiert möglicherweise von Adelaide, wenn nicht sogar von Melbourne aus.
Der Inspector sagt nicht, wie effizient der Buschbandit ist. Als Erstes wäre da seine Flinte, ihr stumpfer Lauf, die schwarze, starrende Doppelmündung. Schrotflinten sagen jedem etwas, jeder kennt den verheerenden Schaden, den sie auf kurze Distanz anrichten können, die Streuung der Schrotgarbe, Kugeln, die ausschwärmen und verletzen wie Hornissen. Den matten Glanz des Metalls, den abgenutzten Kolben, den Geruch nach Waffenöl. Eine Flinte heißt dem Tod ins Auge sehen, also verhält man sich ruhig. Man legt sich flach auf den Boden, man leert die Kasse, man verzichtet auf Heldentum.
Dann wäre da der Bandit selbst. Die Aussagen von Zeugen aller fünf Überfälle stimmen überein. Der Mann sei groß und schlank, bewege sich geschmeidig. »Athletisch«, sagte ein Kassierer. »Machte keine Bewegung zu viel«, sagte ein anderer. Darüber hinaus gibt es keine genauere Beschreibung des Buschbanditen. Jedes Mal trug er etwas anderes — Anzug, Jeans und kariertes Hemd, Windjacke mit Reißverschluss und Hosen, Overall, Trainingsanzug. Und immer auch etwas, was die Aufmerksamkeit von seinem Gesicht ablenkte — Brille, Sonnenbrille, Baseballkappe, einen Akubra mit breiter Krempe, ein Heftpflaster.
Dann seine Wortkargheit, die es den Bankangestellten unmöglich machte, eine klare Vorstellung von seiner Stimme zu gewinnen. »Gesicht nach unten ... Tasche füllen, bitte kein Kleingeld ... Fuß weg vom Alarm ... nicht bewegen ... keiner folgt mir.« Es ist eine ruhige Stimme, mehr wissen Zeugen nicht zu sagen. Ruhig, gelassen, voller Verständnis — so lauten einige Begriffe, die sie benutzen. Und jung. Alle sind sich einig, dass er nicht älter als fünfundzwanzig sein kann.
Obwohl sie es nicht sagt — die Polizei glaubt, dass er kein Junkie ist. Anfänger und Junkies, unter Geschrei stürmen sie herein, halten Angestellte und Kunden pistolenschwingend in Schach, erzeugen so im Allgemeinen eine Atmosphäre der Panik und Unwägbarkeit, die zu Geiselnahme und Blutvergießen führen kann.
Es gilt als ausgemacht, dass der Mann eine große Ducati fährt. Nein, eine Kawasaki. Vielleicht eine Honda. Auf jeden Fall eine schwere Maschine. Mit viel Power und sehr schnell. Schwer zu verfolgen. Auf so einem Bock kann er bereits meilenweit weg sein, bevor der Alarm ausgelöst wird. Ob man einen Hubschrauber losschickt oder die Verfolgung per Auto aufnimmt, der Buschbandit braucht nur von der Straße zu rollen, hinter einen Eukalyptus oder ein Windrad, er braucht nur zu warten, bis die Gefahr vorüber ist.
Wo stellt er die Maschine unter? Die Polizei weiß keine Antwort darauf. Es kann überall sein. Vielleicht hat ihr Mann quer durchs ganze Land ein Dutzend Motorräder versteckt.
»Eins wissen wir mit Bestimmtheit«, sagt der Inspector, »irgendwann wird ihm ein Fehler unterlaufen. Und wir werden da sein, wenn es passiert.«
***
Es war eine dieser Weizen- und Wollestädte in einer staubigen Gegend. Dem Lokalblatt zufolge sollte sich die Parade zwischen zwölf und halb eins am Mittag die Hauptstraße hinunterbewegen, beim Traktorhändler links abbiegen, um sich anschließend in Richtung Ausstellungsgelände neben dem Elders-GM-Viehhof zu schlängeln. Es war der erste Jahrestag des Feuers, das am Australia Day in einem Gebiet von der Größe Luxemburgs gewütet und beinahe die Stadt zerstört hatte. Tatsächlich hatte sich die Feuerfront bis an den Rand der High School vorgearbeitet und ein mobiles Gebäude in Asche gelegt. Später hatte der Wind gedreht und — für die Jahreszeit unüblich — von Westen her Regen gebracht, doch da hatten die Hilfsdienste bereits eine gesamte Einheit und zwei Männer der freiwilligen Feuerwehr verloren. Der Vorsitzende der Kreisverwaltung hatte die Parade am Samstag abhalten wollen, aber die Wunden waren noch nicht verheilt, also hatten die Mitglieder der Kreisverwaltung für den Australia Day gestimmt, der dieses Jahr auf einen Freitag fiel.
In dem Manne, der als ›Buschbandit‹ populär wurde, hatten sich nie Empfindungen oder gar Stolz auf was auch immer geregt, doch er verstand es, Gefühle einzuordnen. Er ging die Hauptstraße entlang, machte Halt, um eine Zeitung, einen halben Liter Milch und ein Päckchen Zigaretten zu kaufen, das er nie rauchen würde. Ein beschriftetes Banner bewegte sich sacht im Wind, ein Dank an die freiwillige Feuerwehr. Zuschauer, ihre Kameras schussbereit, säumten die Straße, plauderten miteinander, scherzten. Die Hälfte von ihnen waren Farmer mit ihren Familien und der Buschbandit war heute einer von ihnen, ein freundlich lächelnder Farmer in Gummistiefeln, frisch gebügeltem Arbeitshemd und ebensolchen Hosen. Den speckigen Filzhut trug er in den Nacken geschoben. Der Mann sah abgearbeitet aus, müde. Und er war nicht der Einzige, der eine Sonnenbrille trug. Nur schien seine deplatziert: ein schmaler Streifen verspiegelten Glases über den Augen. Sie passte eher zu einem jugendlichen Rollerblader aus St Kilda oder Bondi oder Glenelg. Sollte jemand einen Gedanken daran verschwenden, käme er zu dem Schluss, dass der Mann einen exzentrischen Geschmack habe. Ganz gewiss jedoch war die Brille das Einzige, was sich von diesem Gesicht einprägte.
Er beobachtete, wie die Parade vorbeizog: Musiktruppe, Polizei, Feuerwehrleute, Rettungsdienste, die beiden Witwen auf der Rückbank eines schwarzen Mercedes. Zehn Minuten später war alles vorbei. Weitere zehn Minuten später lag die Hauptstraße wieder verlassen da, die letzten Zuschauer verschwanden um die Ecke und ließen das Stadtzentrum hinter sich. Es gab nur eine Bank, und der Bandit betrat sie um 12 Uhr 25, zog die abgesägte Schrotflinte aus seiner Einkaufstasche und verkündete, dass dies ein Banküberfall sei.
Es waren keine Kunden anwesend, nur zwei Kassiererinnen. Die eine sagte: »Oh nein.« Die andere erstarrte. Der Buschbandit richtete den Doppellauf der Flinte auf die, die gesprochen hatte. Sie könnte am ehesten Ärger machen, deshalb war seine Wahl auf sie gefallen. »Gesicht nach unten. Keinen Mucks«, sagte er.
Er sah zu, wie sie auf den Boden sank, sich ungelenk hinlegte und dabei mit einer Hand ihren Rock festhielt, um zu verhindern, dass er nach oben rutschte.
Die andere Kassiererin fixierte die Flinte, die sich jetzt in ihre Richtung bewegte, bis sie auf ihren Magen zielte. Der Bandit stellte seine Strohtasche auf den Tresen. »Voll machen.«
Freitag. Das bedeutete mehr Bargeld als sonst in der Kasse, jedoch nicht hinreichend genug, dass er damit ausgesorgt hätte. Aber das war nur so ein Gedanke am Rande, ein Warum-mach-ich-diese-Scheißjobs-Gedanke für düstere Stunden.
Er behielt die Kassiererin im Auge, die Flinte jetzt wieder auf die Frau am Boden gerichtet. Die Bedeutung war klar: Sie kriegt es ab, wenn Sie mich verladen.
Für einen Moment zögerte die Kassiererin.
»Na, wird’s bald?«, sagte der Bandit.
»Travellerschecks«, platzte sie heraus. »Wollen Sie die?«
Hunderte von Schecks, neu, unsigniert. Der Buschbandit konnte förmlich den Geruch nach neuem Papier und frischer Druckerschwärze wahrnehmen. Er würde sie Chaffey bringen. Im vorderen Teil seines Büros kümmerte sich Chaffey um Testamente, Eigentumsübertragungen und Revisionsverfahren, im hinteren zahlte er zwanzig Cent pro Dollar für alles, was der Buschbandit ihm brachte, ausgenommen Geld oder leicht absetzbare Beute.
»Ja«, sagte der Bandit zu der Kassiererin.
Als alles erledigt war und beide Frauen auf dem Boden lagen, sagte er: »Bleiben Sie bitte unten. Fünf Minuten.«
Die eine nickte, die Redselige sagte: »Ja«, aber da war der Mann längst verschwunden.
Das Motorrad stand auf der Ladefläche eines Lasters. Mit Hilfe von Schlamm und Dreck, mit Hilfe einiger beigebrachter Beulen und eines lädierten Scheinwerfers hatte der Bandit ein Farmer-Bike daraus gemacht. Gemächlich fuhr er mit dem Laster aus der Stadt, einen Ellbogen auf dem offenen Fenster, ein bekanntes Ärgernis für Busfahrer, Trucker und Handlungsreisende, und bald hatte die Landschaft ihn verschluckt, war die Erinnerung an ihn ausgelöscht.
Er stellte den Laster auf einem Feldweg ab und wechselte auf das Motorrad. Diesmal war es eine Honda und er hatte sie in Preston gestohlen. Auf seinem Weg zurück in die Stadt geriet er in einen Sturm, heftige Winde und peitschender Regen, doch am Abend stand er auf dem Balkon seines Apartments und blickte über Southgate und den Abschnitt des Yarra River zwischen dem Casino und der Princes Bridge.
Um acht Uhr ging er wieder hinaus in den Sturm und machte sich auf zum Casino, um herauszufinden, ob die zwölf Riesen, die er heute eingenommen hatte, sich vermehren ließen. Gegen Morgen würde er sich die Frühausgabe der Herald Sun beschaffen und damit eine weitere Buschbandit-Story für sein Album.
Buschbandit — das war sein Name in der Öffentlichkeit. Ray oder Raymond, so hatten ihn seine bereits verstorbenen Eltern genannt. Doch Raymond wollte einfach nur Wyatt genannt werden. Ein Name wie ein Peitschenhieb. Das gefiel ihm.
Aber sein Onkel hieß Wyatt.
EINS
Einhundert Kilometer südöstlich der City brachte der Kriminelle mit Namen Wyatt eine beschädigte Yacht aus der sturmdurchtosten See der Bass Strait in die ruhigeren Gewässer der Westernport Bay und beendete so eine siebentägige Reise mit Ausgangspunkt Port Vila. Es war 4 Uhr 15, kurz vor Morgengrauen. Nur fünf Stunden zuvor war der korrupte Polizist Springett über Bord gespült worden. Wyatts noch verbliebener Passagier, die Frau, die Springett in Port Vila verhaftet hatte, lag schlafend in ihrer Koje. Wyatt reffte die zerrissenen Segel und schaltete den Außenbordmotor an. Die Yacht tuckerte zwischen den roten und grünen Markierungen hindurch, folgte dem Kanal zu dem kleinen Landungssteg am Ufer vor Hastings. Liz Redding rührte sich nicht, nicht einmal als Wyatt Anker warf, seine Kleidung mit Hilfe einer wasserabweisenden Jacke zu einem Bündel schnürte, über Bord sprang und verschwand. Sie war so müde, so träge, stand zu sehr unter dem Einfluss von Mogadon, das er ihr zu diesem Zweck untergeschoben hatte.
Schlotternd mühte er sich aus dem Wasser. Im Schutze einer Stützmauer aus Beton frottierte er sich mit einem Handtuch von der Yacht, zog sich schnell an, linste dabei immer mal wieder über die Mauer, um nach Fischern, Streifenwagen oder Schlaflosen Ausschau zu halten. Hinter einer Abschirmung aus Uferbäumen schimmerte Straßenbeleuchtung; Verwaltungsgebäude, die im Licht der Natriumlampen gespenstisch weiß wirkten; Reihen verschlafener kleiner Häuser; ein Swimmingpool und ein Kiosk; eine Hütte am Anlegesteg, wo Fisch verkauft wurde; und zu seiner Linken ein dichter Wald aus Masten der Yachten, die hinter einem Sicherheitszaun gegen Wirbelstürme im Trockendock lagen.
Er brauchte einen Wagen.
Führe er jetzt los, wäre er zu einem Zeitpunkt in Melbourne, wo die meisten Leute vom Klingeln ihrer Wecker aus dem Schlaf gerissen wurden. Wäre sein Äußeres weniger auffällig — ein Fremder, der im Morgengrauen mit nassem Haar aus Richtung des Yachthafens kommt —, könnte er eines der hiesigen Taxis nehmen. Andererseits wäre da noch der Zug, der Bummelzug aus Stony Point mit Anschluss an den Melbourne-Express in Frankston, aber das bedeutete zu viele Faktoren, auf die er keinen Einfluss hatte und die ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen drohten — geänderte Abfahrtszeiten, neugierige Fahrkartenkontrolleure, defekte Schranken. Oder per Anhalter? Doch wer würde ihn mitnehmen? Wyatt wusste, dass sein düsterer Gesichtsausdruck, seine große, geschmeidige Gestalt, sein Erscheinen am Rande der Straße für jeden Autofahrer Gefahr und Zurückhaltung bedeutete.
Also blieb ihm nichts anderes übrig, als ein Auto zu stehlen, und zwar eines, das während der nächsten Stunden nicht vermisst würde.
Er machte sich auf den Weg. Unweit der Anlegestelle lag eine Gegend bescheidener Seitenstraßen, wo die Häuser dicht an dicht standen und die Familienkutschen in den Einfahrten parkten oder auf der Straße, sei es am Bordstein oder auf dem Grünstreifen. Doch als ein Hund bellte, trat Wyatt den Rückzug an.
Weit und breit keine Autowerkstätten. Er erinnerte sich, dass die meisten außerhalb von Hastings lagen. Man sah oft abgestellte Autos vor Autowerkstätten, die dazugehörigen Schlüssel hingen irgendwo drinnen an einem Brett.
Er ging zurück zum Landesteg. Vorhin hatte Wyatt den bunten Haufen aus Kombis und kleineren LKWs dort schlichtweg ignoriert — Fahrzeuge von Fischern, allesamt Rostlauben mit zusammengewürfelten Karosserieteilen und einem halben Dutzend Kfz-Aufklebern auf den Windschutzscheiben. Er stellte sich die Innenräume vor, die ausgeleierten Federungen, überquellende Aschenbecher, umherrollende Getränkedosen und die unzuverlässige Elektrik. Die Polizei von Hastings mochte ein Auge zudrücken und einem Fischer erlauben, ausschließlich zwischen seinem Wohnort und dem Landesteg zu pendeln, aber Wyatt bezweifelte, dass abgefahrene Reifen, Rost und gesplitterte Windschutzscheiben in Melbourne durchgehen würden.
Aber hatte er eine Wahl?
Allerdings konnte er das Risiko niedrig halten, wenn er zum Beispiel Springvale ansteuerte, war zwar auch ziemlich nah der Innenstadt, aber ein Ort, wo er nicht auffiele. Und dann von dort ein Taxi nehmen.
Vielleicht drei oder vier Taxifahrten — mal nach Norden, mal nach Süden, während er sich allmählich der City näherte, so dass jeder, der sich mit seiner Route beschäftigte, keinen Sinn darin sehen könnte — und dann mit der Straßenbahn zu einem großen Verkehrsknotenpunkt wie Kew Junction.
Wyatt sah auf seine Armbanduhr. 4 Uhr 35. Er hoffte, dass es für das erste einlaufende Fischerboot noch zu früh war. Er hoffte, die Mannschaft hätte beim Anlegen alle Hände voll zu tun, damit zusätzlich Zeit verginge, bis es einem von ihnen auffiel, dass seine alte Karre auf dem Parkplatz fehlte.
Wyatt ging die Reihe der Fahrzeuge entlang, probierte Fahrertüren, sah nach Zündschlüsseln. Die meisten Autos waren unverschlossen — schließlich gab es nichts, was sich zu stehlen lohnte —, aber Fehlanzeige bei den Zündschlüsseln.
Dann suchte er hinter Stoßstangen, zwischen Felgen und fand jede Menge Rost, jede Menge Schmutz. Er fand auch einen kleinen Metallbehälter von der Größe einer Streichholzschachtel, der von einem Magneten in der Felge eines Valiant-Kombi gehalten wurde.
Der Motor machte keine Schwierigkeiten. Er brummte los, und als er endlich ansprang, konnte Wyatt den Kolben schwingen, die Stößel rasseln hören und den Geruch des öligen Abgases einer schlechten Verbrennung riechen. Der Sitz sackte durch, Rückenschmerzen, ein steifer Nacken und steife Schultern schienen programmiert. Wyatt hielt sich fit, aber er war in den Vierzigern und achtete auf bestimmte Dinge wie Größe und Form von Autositzen, in die er sich setzte, oder Betten, in die er sich legte.
Aber die Scheinwerfer funktionierten, der linke war zwar höher eingestellt als der rechte, dafür aber fand Wyatt in den Rückwärtsgang, ohne ein Zahnrad im Getriebe zu lädieren. Die Tankuhr stand fast bei null. Entweder ist der Tank leer oder die Anzeige defekt, dachte er. Er konnte es sich nicht erlauben, irgendwo hier zu tanken. Zuerst musste er eine gewisse Distanz zwischen sich und diesem Ort herstellen.
Wyatt fuhr über Land nach Frankston. Im kalten Licht der Dämmerung wurde der Nebel sichtbar, hing in den Senken neben der Straße, über Bächen und Hügeln, schwebte als zarter Schleier über der Straße und zwang Wyatt zu blinzeln, als habe sich ein Film über seine Augen gelegt, den er entfernen musste. Er erinnerte sich an die Nebel seinerzeit auf der Mornington Peninsula. Es hatte Tage gegeben, da war er auf dem Rückweg von einem Überfall auf eine Bank oder einen Geldtransporter in diesen Nebel geraten. Das war die Zeit, bevor er die Flucht hatte antreten müssen. Und sie lag weit zurück.
Der Motor spuckte, bockte, spuckte wieder. Wenigstens funktionierte jetzt die Tankuhr. So holperte Wyatt durch die verwirrende Straßenführung Somervilles und auf die Shell-Tankstelle an der Frankston Road. Der Fischer hatte sich eine Entschädigung verdient: Wyatt tankte und goss einen Liter Öl in den Rachen des Motors.
Schließlich stellte er den Kombi in einer Seitenstraße nahe des Bahnübergangs in Springvale ab, nahm ein Taxi zum Westfield-Shopping-Center, ein zweites zum Taxistand vor Myer in Chadstone und ein drittes nach Nordlands in Doncaster. Mit jeder Fahrt fühlte er sich sicherer, als würde er die Spürhunde und Verfolger der Vergangenheit abhängen. In der Straßenbahn von Doncaster in die Innenstadt saßen jede Menge Arbeiter; es war warm und ruhig, und wenn ihn überhaupt jemand ansah, dann ohne jede Neugierde.
Er war todmüde und hatte Hunger. Am Swanston Walk gab es ein Café, das durchgehend geöffnet hatte. Hier konnte man Kaffee trinken bis zum Abwinken. Wyatt genehmigte sich drei Tassen und verspürte das Bedürfnis nach etwas Handfestem, also bestellte er sich ein Müsli, Rühreier und Vollkorntoast. Er sah auf seine Armbanduhr. Liz Redding lag in ihrer Koje mit Sicherheit noch im Tiefschlaf.
Gestärkt und mit federndem Gang ging er die Little Lonsdale Street entlang. Um 8.30 Uhr betrat er eine Telefonzelle an der Ecke Elizabeth Street und rief Heneker in der Pacific Mutual Insurance an.
Wie alle Telefonistinnen, mit denen Wyatt zu tun gehabt hatte, sprach auch diese mit einer besonderen Betonung, als wäre jegliche Feststellung eine Frage. »Tut mir leid? Mr. Heneker ist erst um neun da?«
Er hängte auf. Er spürte Verspannungen im Oberkörper, Nachwirkungen der nahezu klaustrophobischen Situation auf See. Dreißig Minuten totschlagen — er beschloss spazieren zu gehen. Während er durch die Straßen streifte, ohne Sinn für die Geschäfte, Autos oder Mitmenschen, ließ er die Reise mit Liz Redding Revue passieren. Alles lief auf eines hinaus: Er hatte ihren Kaffee mit Schlafmittel versetzt und sich aus dem Staub gemacht. Er hatte Vertrauen und Verlangen missbraucht. Die Konsequenz aus dergleichen liegt oftmals auf der Hand: Rien ne va plus.
Um 9.05 stand er wieder in der Telefonzelle und rief die Versicherung ein zweites Mal an. Heneker war von dem überbordenden Enthusiasmus seiner Branche. »Heneker hier, Mr. — «
Er wartete auf einen Namen. Wyatt nannte keinen. Stattdessen sagte er: »Ich habe die Asahi-Juwelen.«
Er sah den Mann vor sich, weißes Hemd, dunkler Anzug, pfeilschnelle Gedanken. Heneker hatte sich rasch gefasst. »Wollen wir das Wo, Wann und Wie erörtern?«
»Und das Wieviel«, ergänzte Wyatt.
»Wie konnte ich das vergessen«, sagte Heneker.
ZWEI
Es entsprach nicht ganz den Tatsachen, dass Wyatt die Asahi-Juwelen hatte. Er hatte ein Stück dabei, ein Collier aus Weißgold und einem Dutzend schwerer Smaragde, die restlichen Stücke — Ringe, Halsbänder, Broschen, Anhänger und Diademe — lagen noch immer im Safe der Yacht. Die Sammlung war zu umfangreich, um durch die Gegend getragen und zu wertvoll, um irgendwo zurückgelassen zu werden, sollten unerwartete Probleme das erfordern. Zudem hatte er nicht die Absicht, die Juwelen stückweise zu verhökern oder die Steine herausbrechen und die Fassungen einschmelzen zu lassen. Eine derartige Aktion erforderte Zeit und zu viele Mittelsmänner. Wyatt wollte die Asahi-Sammlung zügig abstoßen, für eine Pauschale, für die Summe, die die Versicherung als Belohnung ausgelobt hatte. Das Smaragdcollier war nur sein Köder. Es war das auffälligste Stück, eine Art Versprechen, und man konnte sich seiner schnell entledigen, wenn der Deal platzen sollte.
Wyatt ging die Elizabeth Street hinunter, in Gedanken beim Auf und Ab seines Lebens. Man hatte die Asahi-Sammlung im Rahmen einer Wanderausstellung aus einem japanischen Luxus-Kaufhaus in Melbourne gestohlen. Doch Wyatt war nicht der Täter — bei den wahren Tätern handelte es sich um Polizisten, die von Springett gelieferte Sicherheitsinformationen genutzt hatten. Liz Redding aber hatte Wyatt verdächtigt. Beide hatte es nach Port Vila verschlagen, wo Wyatt das Versteck der Sammlung entdeckt hatte. Er hatte Liz nie verraten, wo, nicht einmal auf der Rückreise, als aus ihnen beiden aus Räuber und Gendarm ein Liebespaar geworden war.
Selbst ein gemeinsames Leben hatte für ihn im Bereich des Möglichen gelegen. Doch letzten Endes war sie ein Cop und Wyatt ein Krimineller mit einer langen Vorgeschichte, die keiner genauen Untersuchung standhalten würde, und so war er abermals auf der Flucht.
Treffpunkt war ein Parkhaus an der Londsdale Street. Er ging hinein, begab sich in die dritte Ebene und streifte durchs Halbdunkel. Die Decke erschien ihm sehr niedrig, die Luft war verbraucht, abgasgeschwängert und voller schwer zu ortender Geräusche. Am deutlichsten hob sich ein gleichmäßiges, hohles Dröhnen ab.
Er bezog Posten hinter einem Betonpfeiler. Heneker hatte sich als groß, tendenziell dünn, mit blauem Anzug und einer Ausgabe des TIME in der Hand beschrieben. Als der Mann von der Versicherung endlich auftauchte, beobachtete Wyatt ihn einige Minuten lang. Heneker empfand offenkundig Unbehagen, hielt das Magazin gegen seine Brust, als gelte es, Pfeile damit abzuwehren. Wyatt nahm an, dass er ähnlich empfände, steckte er in Henekers Haut, und trat in das schwache Licht. »Mr. Heneker.«
Erleichtert drehte Heneker sich um. »Dachte schon, Sie kommen nicht mehr.« Er hustete. »Was haben Sie für mich?«
Wortlos reichte Wyatt ihm das Collier. Heneker nahm es, fuhr sich mit dem Ärmel über das Gesicht und sagte: »Eine Fälschung.«
Für eine Sekunde zögerte Wyatt. »Vielleicht sind die Lichtverhältnisse für Sie nicht ausreichend.«
Heneker sah sich nervös um, dann sagte er leise und mit konspirativem Unterton: »Sie verstehen nicht. Es ist eine Imitation. Es sind alles Imitationen, sämtliche Stücke der Sammlung.«
Wyatt sagte nichts. Er verlagerte sein Gewicht auf die Zehen, bereit, im Halbdunkel zu verschwinden.
»Vorzügliche Imitationen, keine Frage«, sagte Heneker und schien sich wieder gefangen zu haben. »Man muss schon Experte sein, ich meine, die Fassungen sind echt, allein das Weißgold ist einiges wert, aber die Steine sind samt und sonders erstklassige Fälschungen.« Er zuckte die Achseln. »Das Asahi-Management bekam kalte Füße. Man wollte die Versicherungsprämie für die echten Steine nicht bezahlen, also haben wir einen speziellen Deal für gefälschte Ausstellungsstücke gemacht. Die Sammlung tourte durch Neuseeland und Australien, ohne dass jemand davon wusste.«
»Und warum haben Sie mir nicht gleich am Telefon gesagt, dass ich mich verpissen soll?«
Heneker schwenkte das Collier in der Luft. »Das sind keine billigen Kopien. Hat zwanzig Riesen gekostet, sie anzufertigen. Wir wollen sie wieder zurück.«
»Wie viel?«
Heneker dachte nach, das schaukelnde Collier am Zeigefinger. »Ich bin berechtigt, fünf anzubieten.«
Wyatt lächelte ein Haifischlächeln, dann lachte er, ein hartes Bellen in vergifteten Luftschichten zwischen Betonboden und -decke. »Fünf? Heißt das hundert oder tausend?«
»Tausend«, erwiderte Heneker und steckte das Collier ein.
»Mein Gott!«
Wyatt drehte sich um, bereit, ins Dunkel abzutauchen.
»Sie kehren fünftausend Dollar einfach so den Rücken?«
Keine Antwort. Wyatt ging weiter. Heneker sagte ein wenig verzagt und auf Zeit spielend: »Ich hab die fünf Riesen dabei, in meiner Tasche.«
Wyatt blieb stehen, kam dann zurück und sagte völlig gelassen: »Folgender Deal: Sie geben mir die fünf Riesen und ich sage Ihnen, wo die restlichen Stücke sind.«
Heneker schüttelte den Kopf. »Sie müssen ziemlich verzweifelt sein, mein Freund. Zuerst bringen Sie mir die gesamte Asahi-Sammlung, dann bekommen Sie die fünftausend.«
Sie kamen, begleitet vom Geräusch quietschender Reifen auf der Rampe und von Ledersohlen auf Beton. Augenblicklich verlagerte Wyatt sein Gewicht, rammte Heneker ein Knie in den Unterleib und trat im nächsten Moment dem Mann gegen das Schienbein, der »Polizei! Auf den Boden! Polizei! Auf den Boden!« geschrien hatte.
Beide Männer gingen zu Boden. Wyatt griff den nächsten Cop an. Er hörte einen Knochen knacken und einen langgezogenen Schrei. Und dann rannte er inmitten dieses Lärms und Durcheinanders davon.
DREI
Wenn diese Leute auch nur die leiseste Ahnung hätten, dass ich der Buschbandit bin, dachte Raymond, sie würden sich in die Hosen pinkeln, ihre Drinks verschütten, ihre Toupets verlieren und so stark zittern, dass ihre Türme aus Jetons umfielen. Diese Männer mit rosiger, weicher Haut, die Frauen wie wettergegerbt durch Solarien und Diäten, sie sprachen überzeugt und selbstsicher — von Fusionen, unverhofften Gewinnen, Übernahmen, einstweiligen Verfügungen, Gerichtsverfahren, vom Kampf gegen Gewerkschaften —, aber das war alles nur heiße Luft. Manchmal war Raymond versucht, nur so aus Spaß seine abgesägte Schrotflinte zu ziehen, für das Vergnügen, Gier und Selbstzufriedenheit aus ihren Gesichtern zu tilgen, Gefängnis zu riskieren.
Doch nicht alle waren so. Raymond spielte an einem Roulettetisch der hohen Einsätze in der äußersten linken Ecke eines der oberen Salons. Sicherlich, es war ein Tisch, der den ganz normalen Spieler anzog, gelegentlich zog er aber auch den abgeklärten asiatischen Spieler an, der mit undurchdringlicher Miene ein Vermögen gewann oder verlor, ohne das Bedürfnis zu verspüren, es der ganzen Welt mitzuteilen, oder den Profi aus Europa oder den Staaten und manchmal den Geschäftsmann mittleren Alters, der auf seine Gesundheit achtete und kein Aufhebens davon machte, wie bedeutend er war.
Besagter Roulettetisch brachte Raymond Glück. Oder zumindest wusste er, dass es Unglück brachte, wechselte er zu einem der anderen Tische. Im Schnitt lag er vorn — ein Gewinn von zwölf Riesen in einer Nacht, ein Verlust von acht oder neun in einer anderen. Vor einer Woche hatte er fünfundzwanzig gewonnen. Zwei Nächte später hatte er dreißig verloren. Natürlich bedeutete dies, dass er ein ganz nettes Leben führte, aber viel Bares hatte er nicht in der Tasche. Heute Nacht lag er hinten, ein Großteil des Geldes aus dem Banküberfall war bereits draufgegangen.
Ein relativer Begriff, verlieren. Raymond hatte nie das Gefühl, in Rückstand zu geraten, nicht, solange er da draußen einfach einen weiteren Job durchziehen konnte, um seine Reserven aufzustocken. Von den Vorzügen ganz zu schweigen: Frauen und ihre lasziven Blicke, Bekanntschaften wie die mit Chaffey, den er beim Seven Eleven kennengelernt hatte, und das berauschende Land der Illusionen aus Smokings, knisternder weißer Baumwolle, schulterfreien Kleidern und mittendrin, im gedämpften künstlichen Tageslicht sein schmales Gesicht und die sensitiven Hände.
Eine Anzahl von Stammgästen spielte an diesem Tisch. Andere sahen lieber zu. Man kannte sich vom Sehen, aber in den letzten Wochen fand sich Raymond mehr und mehr in der Gesellschaft eines Mannes namens Brian Vallance und dessen Freundin, Allie Roden, wieder.
Er beobachtete sie jetzt, während er seine Jetons stapelte. Vallance, der beweglich und zupackend wirkte, hatte eine olivfarbene Haut, ein festes Kinn mit einem kurz geschnittenen grauen Bart und besaß das gesunde Aussehen eines Mannes, der sich viel an der frischen Luft bewegte. Aber Raymond war sich nicht sicher, ob er Vallance mochte. Knapp unterhalb der Oberfläche lauerte ein mürrisches Wesen, der Mund hatte einen vulgären Zug und in seiner Körpersprache gab sich Vallance zugeknöpft. Der Mann war um die fünfzig und das hieß, er war etwa fünfundzwanzig Jahre älter als seine Freundin.
Sie war eine Augenweide. Allie Roden und ihr volles kastanienbraunes Haar, das ihr fein geschnittenes Gesicht wie Flammen umspielte. In ihren grünen Augen lag eine Art sich langsam verzehrendes Feuer, sie hatte weiße Haut, eine wunderbare Figur und die Angewohnheit, den Kopf in den Nacken zu werfen und laut aufzulachen. Wenn sie das tat, hätte Raymond ihr am liebsten in den Hals gebissen.
Sie kam um den Tisch herum, während der Croupier sich auf die nächste Drehung der Roulettescheibe vorbereitete. Raymond fühlte ihre Hand, die kurz sein Handgelenk berührte, nahm Allies Duft wahr — einen Hauch einfacher Seife und Körperpuder —, während ihre Lippen sein Ohr streiften. »Lust auf einen Drink, wenn Sie hier fertig sind?«, murmelte sie.
Raymond wandte den Blick nicht von den Händen des Croupiers, nickte lediglich und spürte, wie Allie zurücktrat und ihre Finger sanft über seine Schulter fuhren. Als er wieder hinsah, stand sie hinter Vallance. Beide blickten ihn eindringlich an und Vallance ließ ein Grinsen aufblitzen.
Raymond spielte weiter, verlor, gewann, schob Jetons über den Tisch, zog Jetons zu sich heran. Dann gewann er fünf Riesen mit einem Spiel, für ihn das Signal, aufzuhören und mit Vallance und seiner Freundin einen Drink zu nehmen. Er hob eine Augenbraue, neigte den Kopf zur Seite und verließ den Tisch.
»Das war ein gewagtes Spiel«, meinte Allie, als sie um den Tisch herumkam, ihre schmale Hand unter Raymonds Arm schob und sich bei ihm einhakte.
Er mochte ihre etwas ungestüme Art, Zuneigung zu zeigen, ihre Offenherzigkeit. Niemand störte sich daran, am allerwenigsten Vallance. Vallance war weder besitzergreifend noch eifersüchtig. Raymond konnte allerdings nicht verstehen, was sie in ihm sah. Da waren zum einen die Frage des Alters, leichte Anflüge von Schwäche, andererseits ihre Energie und ihr Überschwang. Sie hatte Besseres verdient.
»Man gewinnt und man verliert«, sagte Raymond.
»Sie gewinnen öfter, als Sie verlieren, Ray«, bemerkte Vallance, der auf dem Weg zu einem abseits gelegenen Tisch in der Lounge Raymonds andere Seite in Beschlag genommen hatte. »Ich habe Sie beobachtet. Das war wie eine Lektion. Sie sind sehr umsichtig, sind kein Mann, der sein Geld wegwirft.«
Raymond gab sich gelassen. Er hatte nicht vor, Vallance zu eröffnen, dass er sich zehn Riesen von seinem Hehler, dem Anwalt Chaffey, geliehen hatte und dass die fünf, die ihm soeben zugeflossen waren, somit jemand anderem zustanden. Mit etwas Glück würde Chaffey ihm weitere fünf für die Travellerschecks zahlen und die Schulden wären komplett getilgt.
Sie setzten sich und bestellten Champagner zur Feier des Tages. Ihre Unterhaltung drehte sich um Geld und wie man Glücksspiel betreiben konnte, mit Sachverstand oder stümperhaft. Es stellte sich heraus, dass Raymond reich war, unabhängig, aus gutem Hause stammte und spielte, weil es ihm gefiel. »Ich kann es tun, ich kann’s aber auch lassen«, sagte er. Er war kein Trottel. Es war nichts Verzweifeltes oder Mitleiderregendes an Raymond Wyatt.
Man unterhielt sich, orderte für die nächste Runde gleich eine ganze Flasche Dom Perignon, und Raymond beteiligte sich nolens volens mehrheitlich an den zweihundert Dollar, die sie kostete. Unmissverständlich fuhr Allies nackter Fuß über seinen Knöchel und Ray spürte den elektrisierenden Druck ihres Schenkels, als sie sich vorbeugte und nach der Flasche langte. Zum ersten Mal kam Raymond der Gedanke, dass er Vallance mit ein paar geschickten Schachzügen das Mädchen abspenstig machen könnte.
Sie entspannten sich, und im warmen Schein der schier endlosen Nacht — nach Raymonds Dafürhalten musste draußen längst ein strahlender Tag angebrochen sein — schob Vallance eine Schuhcremedose über den Tisch. »Werfen Sie doch mal einen Blick hinein, junger Freund.«
Die Dose lag ziemlich schwer in Raymonds Hand — sollte es sich um Schuhcreme handeln, dann um eine sehr feste. Er schüttelte die Dose und etwas darin bewegte sich hin und her, seine Finger erspürten etwas von Gewicht, etwas Kompaktes.
»Machen Sie schon, es wird nicht gleich explodieren.«
Raymond drückte, wo Drücken stand, und der Deckel hob sich. Er nahm den Deckel ab, starrte hinein und sah, was das Gefühl in den Fingern erzeugt hatte.
»Eine Guinee aus dem Jahre 1799«, sagte Vallance, »und ein Florin, allerdings durch Salzwasser so sehr korrodiert, dass das Prägedatum nicht zu erkennen ist, grob geschätzt müsste es aber dasselbe Jahr sein. Dann ein Spanischer Silberdollar von 1810, und der mit dem Loch ist der Holey Dollar, etwa so selten wie ein Huhn auf drei Beinen.«
Er hielt kurz inne und fuhr dann fort. »Zu Hause habe ich eine Reisetasche, voll mit solchem Zeug. Und ich bin darüber hinaus der Einzige, der weiß, wo der Rest vergraben ist.«
Raymond beschlich etwas, eine Art starker Sehnsucht, eine vage Vorstellung von Abenteuern auf hoher See, Steinschlosspistolen und Schatztruhen. Er blickte Vallance verständnislos an.
»Warum zeigen Sie mir das?«
»Sie scheinen mir ein Mann zu sein, der weiß, wann man den Mund halten sollte.«
»Könnte sein.«
»Ich will nicht lange darum herumreden — Sie wären in der Lage, Allie und mir zu helfen.«
»Dann sollten Sie mir die ganze Geschichte erzählen«, erwiderte Raymond geduldig.
Er spürte wieder Allies Fuß. Gleichzeitig beugte sie sich vor und legte einen Arm um Vallance. Raymond sah, wie der Mann förmlich dahinschmolz und sein Kinn sanft an ihrem Kopf rieb. Sie sagte: »Es war Brians Job, Wracks ausfindig zu machen.«
Fast schon trotzig begann Vallance zu erzählen: »Bis vor einem Jahr habe ich für die Maritime Heritage Unit gearbeitet, Ray. Unsere Arbeit bestand darin, Wracks anhand alter Dokumente zu lokalisieren, bereits bekannte Wracks zu kartografieren und zu bergen oder andere vor Aasgeiern zu schützen. Man hatte sogar eine Polizistin für uns abgestellt. Es gehörte zu ihren Aufgaben, bei Sotheby’s und Christie’s nach gestohlenen Kunstgegenständen Ausschau zu halten.«
Raymond wartete, dass Vallance fortfuhr.
Wut trieb dem Mann die Röte ins Gesicht. »Ich wurde des Diebstahls von Artefakten beschuldigt, die noch nicht katalogisiert waren. Man beschuldigte mich, sie an einen privaten Interessenten verkauft zu haben. Alles Blödsinn. Sie konnten nichts beweisen. Aber ich hatte den Kanal voll und kündigte lieber, als noch länger für diese Mistkerle zu arbeiten.«
Natürlich hast du das, dachte Raymond. Du hast Scheiße gebaut und bist fast erwischt worden. Es war seltsam, aber er genoss es, den Erzählungen dieses Desperados zuzuhören, als könne man Vallance einzig deshalb vertrauen, weil er kriminell war.
Er sah, dass Allie Vallance’ Arm tätschelte. Das gedämpfte Licht zauberte einen fürsorglichen, weichen Ausdruck auf ihr Gesicht. Raymond fühlte, wie er Feuer fing. Geistesabwesend berührte er die Münze mit dem Loch in der Mitte.
»Wissen Sie was, Ray«, sagte Vallance, »die da gehört Ihnen, ob Sie uns nun unterstützen oder nicht. Ihr Kurswert ist nicht schlecht, steht bei etwa einhundertundfünfundsiebzig Dollar. Hören Sie mir fürs Erste nur zu, mehr will ich gar nicht. Es besteht keine Verpflichtung zu investieren.«
»Investieren?«
»Fünfzig Riesen könnten Ihnen fünf Millionen einbringen«, sagte Vallance.
VIER
Chaffey, der Anwalt, mühte sich auf seinem Stuhl nach vorn, Anstrengung zeigte sich auf seinem feisten, ungesund rosigen Gesicht. Beide Hände auf der Schreibtischplatte, stemmte er sich hoch in den Stand. Leicht schwankend, versperrte er nahezu die Sicht auf das Fenster und während er sich sein XXL-Jackett zuknöpfte, um Denise Meickle nach allen Vorgaben der Etikette aus seinem Büro geleiten zu können, warf er noch rasch einen Blick hinunter auf die Platanen und Straßenbahnschienen der St Kilda Road, auf das blitzende Chrom, auf die wie geschrumpft wirkenden Fußgänger, die Parkbänke und die Jugendlichen auf ihren Rollerblades und versuchte Zuversicht in seine Stimme zu legen, die er nicht hatte.
»Lassen Sie mich nur machen.«
Die Meickle war eine traurige Erscheinung, klein, farblos, dafür aber angriffslustig. Sie war in einen von Chaffeys Mandanten verliebt, Tony Steer, Einbrecher und Mörder und derzeit im Melbourne City Watchhouse inhaftiert. In Kürze sollte er dauerhaft in ein anderes Gefängnis verbracht werden und Denise Meickle wollte Chaffeys Unterstützung für eine Flucht aus der Anstalt.
»Zuerst«, sagte sie, wenig geneigt, jetzt zu gehen, obwohl sie bereits eine Stunde hier zugebracht und alles ein Dutzend Mal durchgekaut hatte, »müssen Sie sicherstellen, dass er in das Untersuchungsgefängnis in Sunshine verlegt wird. Manchmal werden sie zur Untersuchungshaft nach Pentridge gebracht, aber dort kriegen wir ihn nie und nimmer raus.«
Chaffey hatte Zweifel, dass man Steer aus dem Untersuchungsgefängnis würde herausholen können, ganz zu schweigen von Pentridge. »Lassen Sie mich nur machen«, sagte er wieder.
Meickle war im Gefängnis von Ararat als Gefängnispsychologin tätig gewesen, als die Sache mit Steer begonnen hatte. Vor dem Hintergrund komplexer Gefängnisstrukturen, die Bediensteten gleichermaßen Fürsorge- und Aufseherfunktionen diktierten, lief jemand wie Meickle schnell Gefahr, beide Rollen nicht mehr trennen zu können, sie miteinander zu verquicken. Besonders prekär war es für das Personal, einem Gefängnisinsassen einerseits seelischen Beistand zu leisten und ihn in der nächsten Minute einer Leibesvisitation unterziehen zu müssen. Als Psychologin war ihre Beziehung zu Steer selbstverständlich anderer Natur gewesen, die mangelnde Abgrenzung und Rollenverwechslung dennoch nicht weniger zwingend. »Wir werden Ihren Freund rausholen«, sagte Chaffey.
Sie wollte nicht gehen. Sie nahm ihre Finger zu Hilfe, damit Chaffey es auch wirklich verstand. »Also ... es läuft folgendermaßen: neuseeländische Pässe, für uns beide, ein Boot, das uns außer Landes bringt, und jemand, der mir hilft, Tony rauszuholen. Dafür zahlen wir Ihnen fünfzigtausend Dollar. Treiben Sie jemanden Gutes auf, jemand, der ein Auto fahren kann und die Nerven behält. Sie bezahlen ihn von Ihrem Anteil.« Sie stach mit dem Finger in Chaffeys imposante Taille. »Keine Verlade mit uns. Wenn doch, finden wir Sie.«
Chaffey nickte. Als Tony Steers Anwalt verwaltete er dessen Geld. Und er war schlau genug, den Mann nicht zu hintergehen. Steer war ein übler Typ, knallhart, fit, intelligent und von unerschütterlichem Selbstvertrauen. Chaffey dachte an die Heerscharen von Frauen, die sich mit männlichen Häftlingen anfreundeten. Nicht selten einsame Frauen, beflügelt von dem Gedanken an Wohltätigkeit, von Gott oder vom Mitleid. Viele von ihnen heirateten Mörder, warteten auf deren Entlassung und wurden für ihre Entsagungen umgebracht. Vielleicht erwartete Denise Meickle ein ähnliches Schicksal.
Er drängte sie zur Tür. »Ich werde mich sofort darum kümmern. Die Pässe, das Boot, alles kein Thema. Nur einen guten Mann zu finden erfordert einige Überlegungen.«
»Keine Junkies. Keine Unterbelichteten. Niemand mit Vorstrafen.«
»Wie ich bereits gesagt habe, ich werde mich sofort darum kümmern.«
»In zwei Wochen ist der Prozess. Wir haben also nicht viel Zeit.«
Als die Meickle endlich weg war, ging Chaffey in Gedanken eine Liste mit Namen durch: tot, im Knast, süchtig, zu spezialisiert. Also niemand, der infrage käme.
Das Telefon klingelte.
»Chafe? Hier ist Raymond. Wie sieht’s aus heute?«
Hier war jemand, den er so gar nicht auf der Liste hatte. »Raymond, alter Junge.« Chaffey sah auf seine Armbanduhr. »In dreißig Minuten?«