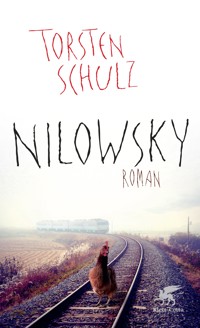
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Markus Bäcker ist alles andere als begeistert, als er mit seinen Eltern an den Rand von Berlin zieht. Dort blickt er vom dritten Stock ihres Eckhauses auf ein stinkendes Chemiewerk und vorbeiratternde Züge, die alles zum Vibrieren bringen. Erst als er Nilowsky kennenlernt, wird ihm die Gegend um den Bahndamm zur Heimat. Eine Heimat voller Merkwürdigkeiten und intensiver Erfahrungen. Dazu gehören kuriose Anwendungen von Vodoo-Ritualen, um der Liebe auf die Sprünge zu helfen. Erotische Annäherungen einer Frau, die nicht älter als dreizehn sein will, sowie perfide Vertrauensforderungen von Seiten Nilowskys, die ihn fast das Leben kosten. Abgründe und Höhepunkte des Erwachsenwerdens, die Markus Bäcker ein Leben lang nicht loslassen werden. Mit großer Intensität und viel Humor schildert Torsten Schulz eine eigenartige Dreiecksbeziehung in den Wirren der Pubertät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© Torsten Schulz
© 2013 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Unter Verwendung zweier Fotos von
Huhn: © Getty Images / Gary John Norman
Zug: © Topic Photo Agency / Corbis
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-93971-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10430-1
Dieses E-Book beruht auf der 1. Auflage 2013 der Printausgabe
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Informationen zum Autor
1
Einmal – wir kannten uns ein paar Wochen, aber ich weiß nicht, ob wir da schon Freunde waren – stand ich mit Nilowsky auf dem Bahndamm unter einer dieser Wolken, die vom Chemiewerk herüberkamen und grünlich gelb von den Schwefelabgasen waren. Nilowsky schloss die Augen und hielt das Gesicht nach oben, sodass für mich, der ich einen Kopf kleiner war als er, sein langer Hals noch länger und sein großer Adamsapfel, der bei jedem Schlucken eindrucksvoll hoch- und runterging, noch größer erschien. Er atmete tief ein und sagte: »Du musst diesen Gestank, den nach faulen Eiern, richtig einsaugen musst du den, und deine ganze Körperwärme, die ganze, die musst du zum Einsatz bringen, und dem Schwefelwasserstoff, dem bleibt dann nichts anderes übrig, als zu Wasser und zu Schwefeldioxid zu verbrennen. Das ist gesund und gibt dir Kraft. Und riechen tut es dann auch nicht mehr.«
Ich staunte über Nilowskys Chemiekenntnisse, obwohl mir der Zusammenhang nicht logisch vorkam. »Aber die Körperwärme«, wandte ich ein, »ist die denn so groß?«
»Die ist, wenn du willst, dass sie so groß ist, wenn du das unbedingt, wenn du das hundertprozentig willst, ist sie auch so groß. Das ist sie. Verstehst du, wie ich das meine?«
Ein Lächeln zog über sein Gesicht, und ich sagte, um seine Freude nicht zu stören: »Ja, ich verstehe.«
Ich schloss ebenfalls die Augen, hielt das Gesicht nach oben und atmete die stinkende Luft so tief ein, dass ich heftig husten musste und mich fast übergeben hätte. Nilowsky klopfte mir auf den Rücken und meinte: »Deine Körperwärme, die ist noch nicht groß genug. Aber das macht nichts, du hast es, wenigstens hast du es versucht.«
Ich öffnete die Augen und sah zu ihm hoch. Er lächelte mich an und sagte: »Komm! Wir gehen ein Stück.«
Ich folgte ihm an den Gleisen entlang, und er erklärte mir, dass man Schwefelwasserstoff aus Eisensulfid und Salzsäure herstellt und Eisensulfid nichts anderes sei als ein Gemisch aus Eisenpulver und Schwefelpulver, das erhitzt werden muss, um zu Eisensulfid zu werden. Ich dachte, hoffentlich ist bei dem, was ich eingeatmet habe, nicht noch ein bisschen Salzsäure dabei gewesen. Unwillkürlich begann ich wieder zu husten und spuckte auf die Gleise, um die Salzsäure loszuwerden, während Nilowsky weiter erklärte, dass dieser Schwefelwasserstoff zwar ziemlich giftig sei, aber gleichzeitig gut für die Blutdruckregelung.
»Wie geht denn das?«, fragte ich, »Gift für die Blutdruckregelung? Und was hat man denn von geregeltem Blutdruck, wenn man tot ist?«
»Das geht eben«, sagte er, »das ist, Chemie ist das eben. Außerdem: Warum soll man bei Gift, warum soll man da gleich tot sein? Jedenfalls du, du lebst doch auch noch. Und ich ebenfalls. Ich sowieso. Und so soll’s bleiben. Will ja noch heiraten, will ich. Und Kinder kriegen. Also zeugen, Kinder zeugen, damit du mich nicht falsch verstehst.« Er hielt inne, und plötzlich sagte er: »Pass auf, jetzt gleich, gleich kommt der Vierachtzehner, jetzt kann wieder Geld gedruckt werden!«
Er holte einen seiner vielen Groschen, die er immer bei sich trug, aus der Hosentasche und legte ihn auf die Schiene. Der Vierachtzehner kam, pünktlich auf die Minute, vier Uhr achtzehn, wie an jedem Nachmittag. Wir liefen ein Stück die Böschung hinunter, trotzdem riss uns der Zugwind fast die Haare vom Kopf. Ich presste meine Hände auf die Ohren, weil ich Angst hatte, taub zu werden. Nilowsky hingegen lachte laut, mit weit offenem Mund und steil nach oben ausgestreckten Armen. Kaum dass der Zug vorbei war, sprang er zu der Stelle, an der er den Groschen auf die Schiene gelegt hatte. Der Groschen war so platt, wie er nur platt sein konnte, und so rund und breit wie ein Markstück. Nilowsky sagte: »Jetzt ist er verwandelt, das ist er, und veredelt ist er, und Spuren von ihm, die bleiben, für immer bleiben die an den Rädern des Zuges, kleben bleiben die und fahren durch Deutschland, durch Frankreich fahren die, durch Spanien. Mein Groschen, die Spuren von meinem Groschen, bis nach Spanien und noch weiter.«
»Aber die Zugstrecke«, wandte ich ein, »führt doch von Nord nach Süd, nach Südost genauer gesagt, nicht nach West. So kann man’s auf dem Stadtplan sehen.«
»Denkst du etwa«, entgegnete Nilowsky, »man kann den Stadtplänen glauben? Das müsstest du doch eigentlich längst wissen mit deinen vierzehn Jahren, oder hast du noch nie was davon gehört, dass wir in einem Land leben, in dem Stadtpläne vom Staat gefälscht werden, hast du das noch nie gehört? Damit die Bevölkerung nie weiß, wo sie sich eigentlich befindet, ganz zu schweigen von den Zügen, die immer woanders hinfahren als auf den Plänen angezeigt. Hast du davon noch nichts gehört?«
»Nein«, antwortete ich und war mir sicher, dass es das einzig Richtige war, ihm in diesem Punkt nicht zu widersprechen. Stattdessen fragte ich: »Was machst du denn mit den verwandelten Groschen?«
»Was ich mit denen mache? Ganz einfach: Die sind mein Schatz, den hüte und beschütze ich, den Schatz, wie’s sich eben gehört. Dafür wird er mich beschützen, wenn’s drauf ankommt, das wirst du schon noch erleben, wirst du das.«
Er sagte es mit einem Trotz, dem etwas Optimistisches anhaftete, und ich dachte in diesem Moment daran, wie ich ihn, Reiner Nilowsky, ein paar Wochen zuvor überhaupt zum ersten Mal gesehen hatte. Kerzengerade hatte er hinterm Fenster vom Bahndamm-Eck gestanden, dessen Gardine zur Seite gezogen war. Er hatte ein Bierglas trocken geputzt und dabei neugierig abschätzend zu mir geschaut.
Ich war gerade von der Ladefläche des Umzugswagens gestiegen, doch bevor ich auf seinen Blick reagieren konnte, legte sich eine Hand auf seine Schulter. Ich sah nicht den Menschen, der zu dieser Hand gehörte, ich sah nur, wie die Hand ihn vom Fenster wegzog und Nilowsky sich zu diesem Ausdruck optimistischen Trotzes durchrang, den ich noch öfter an ihm wahrnehmen sollte.
2
Die Wohnung, in die wir, meine Eltern und ich, im September 1976 zogen, befand sich im dritten Stock des Eckhauses, in dem auch das Bahndamm-Eck war. Von meinem Zimmer aus sah ich den Bahndamm, kaum mehr als fünfzig Meter entfernt. Hundert Meter weiter stand das Chemiewerk, in dem mein Vater als leitender Ingenieur arbeitete. Diese neue, herausfordernde Arbeit, wie er sie nannte, auf dem Gebiet der Pharmazie, war der Grund für unseren Umzug gewesen. Ich hatte sein Fach, die Chemie, nie gemocht, nun aber hasste ich es. Ich hatte nicht aus Prenzlauer Berg fortziehen wollen, wo ich geboren worden war und mich wohl fühlte. Und schon gar nicht hatte ich an den Rand von Berlin gewollt, zu den laut ratternden Zügen, die das Eckhaus von unten bis oben zum Vibrieren brachten, zu den Schwefelabgasen, die sogar durch die Ritzen der geschlossenen Fenster drangen.
Nicht nur mein Vater, auch meine Mutter war glücklich mit dem Umzug. »Endlich mal ein kurzer Arbeitsweg«, sagte sie. »Und das bisschen Geruch – gar nicht der Rede wert.«
Kein Wunder, sie war Sekretärin in einem kleinen Büro gewesen, in dem es nach jahrzehntealten Aktenordnern roch. Jetzt arbeitete sie in diesem Chemiewerk als Chefsekretärin des Betriebsdirektors.
Von meinem Fenster aus sah ich meine Eltern, wie sie frohgemut, ja beinahe wie frisch verliebt das Haus verließen und durch die Bahndammunterführung in Richtung Chemiewerk gingen. Eine Stunde später musste ich zur Schule, in meine neue Klasse, in der ich ebenso wenig heimisch werden wollte wie in diesem Haus am Bahndamm. Nach der Schule fuhr ich ein ums andere Mal nach Prenzlauer Berg, um ehemalige Klassenkameraden zu treffen oder einfach durch die Straßen zu ziehen. Wenn ich abends von der S-Bahn-Endstation nach Hause lief, schaute ich bewusst nicht nach links und rechts, als sei jeder Blick auf meine neue Umgebung Verrat an meinen Gefühlen.
Eines späten Abends, drei Wochen nach unserem Umzug, war die Gardine des Kneipenfensters wieder zur Seite gezogen. Ich deutete das als Zeichen, und so kam ich ein Stück von meinem selbstverordneten Desinteresse ab und blickte durchs Fenster in die Kneipe. Ich sah Nilowsky hinterm Tresen Gläser spülen und Bier eingießen. Ich sah drei alte Männer an einem fleckigen Sprelacarttisch Karten spielen, ein vierter lag rücklings auf mehreren nebeneinandergestellten Stühlen. Er schnarchte, wie ich an den Bewegungen seines Mundes erkennen konnte. Einer der Kartenspieler rüttelte an ihm, aber der Mann schnarchte weiter. Nilowsky musste mich aus den Augenwinkeln wahrgenommen haben, denn er gab mir mit einer knappen Bewegung seines Kopfes ein Zeichen hereinzukommen. Als ich zögerte, lief er zur Tür hinaus und sagte: »Komm rein! Draußen servier ich kein Bier.«
Das hatte nichts von der Umständlichkeit, mit der er später oftmals redete. Das hatte den bärbeißigen Witz eines Wirtes oder eben eines Siebzehnjährigen, der so tut, als sei er ein Wirt.
»Wer bist du denn?«, rief mir einer der Kartenspieler zu, und der, der den Schlafenden gerüttelt hatte, sagte: »Setz dir zu uns!« Ich zog mir, überrascht wie ich war, einen Stuhl an den Tisch, und der dritte Kartenspieler fragte: »Kannste Skat?«
Mit dieser Frage schien die vorherige, wer ich sei, nicht mehr von Interesse zu sein. »Nein«, antwortete ich, »leider nicht.« Und Nilowsky rief vom Tresen rüber: »Der wohnt erst seit ein paar Tagen hier.« Das klang wie die Begründung dafür, dass ich nicht Skat spielen konnte. »Komm«, sagte er, »fass mal mit an!«
Er deutete auf den Schlafenden, und der, der ihn gerüttelt hatte, meinte: »Na, endlich. Wird ja Zeit, dass der wegkommt.«
»Du hältst ihn am Kopf, da hältst du ihn, ich zieh die Beine«, ordnete Nilowsky an. Ich nahm den Kopf in beide Hände, Nilowsky packte die Oberschenkel, und so hievten wir den langen, dürren Alten von den Stühlen herunter, während er weiterschlief und schnarchte, ohne dass sich sein riesiger Adamsapfel dabei bewegte.
»Der is so besoffen, der merkt von nischt wat«, sagte der, der von mir wissen wollte, ob ich Skat spielen kann, und der, der mich gefragt hatte, wer ich denn sei, meinte zu Nilowsky: »Wenn dein Alter weiter so säuft, is er bald für immer weg.«
Wir zogen Nilowskys Vater, Beine voran, durch einen dunklen Flur. Weil ich fürchtete, der Kopf des Alten könne vom Hals abreißen, bemühte ich mich, ruckartige Bewegungen zu vermeiden. Wir zogen ihn bis in sein Schlafzimmer, in dem es nach Bier und Schweiß und Zigarettenqualm stank. Dann hievten wir ihn aufs Bett, Nilowsky warf die Bettdecke über den Kopf des Vaters und sagte: »Könnte ihn umbringen, jetzt könnte ich das, wieder mal, wäre ganz einfach, ihn umzubringen, ganz einfach wäre das, einfach zudrücken, bis er keine Luft mehr kriegt. Aber würde schnell gehen, zu schnell würde das gehen, das Totsein, das wäre ja keine Qual für ihn, das wäre zu einfach, keine Qual ist nicht gut, hat er nicht verdient.«
Nilowsky nahm die Bettdecke vom Gesicht des Alten und erklärte: »Das war’s. Muss wieder nach vorne, muss ich.«
Ich folgte ihm in den Gastraum, in dem die Skatspieler neue Biere forderten, die Nilowsky sogleich zu zapfen begann. Zu mir sagte er nur noch: »Danke dir. Mach’s gut.«
Das klang so entschieden, dass ich, ohne ein Wort zu erwidern, hinausging. Ich fühlte mich gekränkt, denn ich hatte den Eindruck, er hatte mich nur hineingebeten, um seinen Vater wegzuschaffen.
Ich nahm mir vor, Nilowsky fortan nicht weiter zu beachten. Doch am nächsten Nachmittag beobachtete ich durch die offen stehende Kneipentür eine Szene, von der ich, schon als ich sie sah, wusste, dass ich sie wohl nie würde vergessen können: Ich sah, wie der Vater mit einem Feuerhaken auf seinen am Boden liegenden Sohn einschlug. Auf Rücken und Beine schlug er und auf die Arme, die Nilowsky schützend an den Kopf gepresst hatte. Im Rhythmus der Schläge brüllte der Vater: »Du hast mir nich anzufassen, is dir det klar, dass du mir nich anzufassen hast?« Nilowsky antwortete nicht. Er wimmerte vor sich hin, während der Alte abermals brüllte: »Ob dir det klar is, ein für allemal, dass du mir nich anzufassen hast?«
Ich rannte in den Hausflur und die Treppe hoch. Ich schämte mich, Zeuge dieser Demütigung geworden zu sein, die ich, weil ich noch nie verprügelt worden war – nicht von meinen Eltern, von niemandem –, im Grunde genommen gar nicht nachvollziehen konnte. Ich fragte mich, ob ich ihm irgendwie hätte beistehen müssen. Ob die offen stehende Kneipentür gewissermaßen eine Aufforderung gewesen war, etwas für ihn zu tun. Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben, wollte allein sein und schloss mich in mein Zimmer ein. Später rief mich meine Mutter zum Abendbrot. Als ich nicht reagierte, klopfte sie und rüttelte an der Tür. »Hast du was zu verbergen?«, fragte sie mich. »Oder warum schließt du ab?«
»Ich schließe ab, weil ich nicht hier wohnen will!«, schrie ich durch die geschlossene Tür, aber meine Mutter ging nicht darauf ein.
Mit Nilowsky sprach ich nie über das, was ich gesehen hatte, nicht einmal eine Andeutung machte ich. Ich fand auch nie heraus, ob er oder sein Vater mich überhaupt bemerkt hatten.
3
In den nächsten Tagen wagte ich mich nicht vor das Fenster oder die Tür der Kneipe. Wenn ich nach Hause kam, huschte ich in den Hauseingang und rannte die Treppe hoch, um so schnell wie möglich in unsere Wohnung zu gelangen. Vom Fenster meines Zimmers aus sah ich dann zum Chemiewerk hinüber und wünschte mir, dass es in Flammen aufgehen möge. Vielleicht reichte ja ein Leck in einer Rohrleitung, damit sich eine kleine Pfütze aus Säure bildete, die sich durch eine weggeworfene Zigarettenkippe in unaufhaltsames Feuer verwandelte. Meine Eltern sollten nicht sterben bei diesem Brand, aber ein für allemal nach Prenzlauer Berg zurückziehen.
Wenn sie sich am Abendbrottisch über ihre Arbeit unterhielten, tat ich so, als hörte ich überhaupt nicht hin. Einmal allerdings fiel es mir schwer, mein gespieltes Desinteresse aufrechtzuerhalten. »Ich frag mich«, sagte mein Vater, »weshalb die Afrikaner ausgerechnet zu uns ins Chemiewerk kommen müssen. Die begreifen noch nicht mal, was man ihnen erklärt, und am Ende lungern sie irgendwo rum, und man muss aufpassen, dass sie nicht heimlich saufen oder rauchen und die Sicherheit gefährden.«
»Das ist internationale Solidarität«, erwiderte meine Mutter. »Da läuft nicht immer alles so einfach. Dafür sind das eben Entwicklungsländer, aus denen die Menschen kommen.«
Die Afrikaner, so erfuhr ich aus dem weiteren Gespräch, waren schon seit fast vier Monaten in einer Wohnbaracke am Rande des Chemiewerks untergebracht. Und da internationale Solidarität offenbar eine Sache mit Geheimnissen war, wusste niemand im Werk, wie lange sie bleiben würden. Meinem Vater war aufgetragen worden, sie zu betreuen, und ich freute mich, dass zumindest diese Aufgabe ihm ausgesprochen missfiel.
Ein paar Nachmittage später suchte ich nach der Baracke. Es war nicht schwer, sie zu finden. Ich musste nur durch die Bahndammunterführung und etwa dreihundert Meter links entlang durch ein Waldstück, schließlich kam ich auf einen Trampelpfad, der direkt zu dem rotgelb angestrichenen Holzhaus führte. Die Abgase des Chemiewerks zogen über das Haus hinweg und vermischten sich mit einem daraus aufsteigenden stechenden Ingwerknoblauchgeruch, der den Schwefelgestank fast übertünchte. Diesen Geruch hatte ich bislang noch nicht gekannt. Er war so eigenartig und intensiv, dass ich mir sicher war, ihn nicht mehr zu vergessen.
Kein Mensch war zu sehen, nichtsdestotrotz hielt ich einen Abstand von mindestens dreißig Metern und verbarg mich außerdem hinter einem Baumstamm. Ich dachte: Möglicherweise wird einer dieser faulen, undisziplinierten Afrikaner irgendwann einmal seine Zigarettenkippe in eine Säurepfütze werfen. Havarie im Chemiewerk, das wäre was. Und dann hätten meine Eltern hier nichts mehr zu tun, und wir würden wegziehen.
Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir. »Na, suchste jemanden?« Es war Nilowskys Vater. Ein Grinsen, das mir irgendwie freundlich erschien, spielte um seinen Mund. Trotzdem jagten mir die vom Saufen verquollenen Augen in dem knochigen, rot geäderten Gesicht Angst ein. »Kann ick dir vielleicht helfen, wenne jemanden suchst?«
»Ich suche niemanden«, antwortete ich und bemühte mich um eine feste Stimme.
Das Grinsen von Nilowskys Vater wurde immer breiter. »Wenne die Neger sehen willst, musste später kommen. Die sind noch uff Arbeit. Aber die Weiber kochen schon.«
»Ich weiß, dass die noch auf Arbeit sind«, behauptete ich. Und Nilowskys Vater, kurz und bündig: »Klar weißte das. Dein älterer Herr is ja zuständig für die.«
Das klang wie eine Drohung, auf eine bestimmte Art aber auch respektvoll. Und dieses altmodische Dein älterer Herr – so hatte noch niemand meinen Vater bezeichnet. Am liebsten hätte ich den alten Nilowsky gefragt, was er denn eigentlich hier mache. Doch das traute ich mich nicht. Stattdessen sagte ich: »Ich bin nur auf ’m Spaziergang hier. Die Gegend erkunden.« Das hörte sich nach Rechtfertigung an, und darüber ärgerte ich mich. Nilowskys Vater nickte verständnisvoll. Sein Grinsen verschwand jedoch nicht.
»Na denn spazier mal schön weiter«, rief er, drehte sich um und ging den Trampelpfad zurück.
Ich wartete ein paar Minuten, dann machte ich ebenfalls kehrt. Als ich den Bahndamm passierte, entdeckte ich Nilowsky. Er saß an der Böschung und zählte Geldstücke in seiner Hand. Hoffentlich, dachte ich, bemerkt er mich nicht. In diesem Moment hob er den Kopf und schaute zu mir. Er stand auf, steckte die Geldstücke in seine Hosentasche und kam auf mich zu. Er hinkte etwas. Ich dachte sofort: Das kommt von den Schlägen mit dem Feuerhaken.
»Na, hat er dich gesehen, als du an der Baracke warst? Ist ja kein Wunder, wenn er dich gesehen hat. Ist ja immer an der Baracke, immer wieder ist er da. Aber drin ist er nie. Nie, der Feigling. Schleicht bloß immer rum, aber drin nie, immer nur rum um die Baracke. Die dreckige Sau.« Nilowsky hatte sich in Rage geredet. »Was hat er gesagt? Oder wollte er was von dir wissen, einfach nur irgendwas von dir wissen?«
»Er dachte, ich suche jemanden.«
Nilowsky lachte. »Was ich selber denk und tu, trau ich jedem andern zu. Kennst du nicht das Sprichwort?«
»Ja«, sagte ich. »Kenne ich.« Und Nilowsky: »Na also.« Er kam näher an mich heran. »Bist du nicht neugierig? Wenn ich dir so ’n Sprichwort sage und nichts weiter dazu?«
»Doch«, antwortete ich. Und Nilowsky darauf: »Komm mit!«
Ich folgte ihm an der Böschung entlang und versuchte, sein Hinken zu ignorieren. Aber je schneller er ging, desto stärker hinkte er, und umso weniger gelang es mir, nicht darauf zu achten.
»Ich werd’ dir was verraten«, sagte er. »Ich werd’ dir verraten, warum er immer an der Baracke herumschleicht. Kommst du nämlich nicht drauf, warum er da immer an der Baracke. Ohne reinzugehen, immer nur drum herum.« Nilowsky lachte schadenfroh und wiederholte abermals: »Immer nur drum herum, die Niete, die hässliche versoffene Niete.« Er kicherte hämisch. »Du glaubst es nicht, du glaubst es einfach nicht. Aber ich verrat es dir. Du warst, bei der Baracke warst du, und deshalb verrat ich es dir. Er ist nämlich, die dreckige Mistsau ist scharf, scharf wie Nachbars Lumpi. Kennst du nicht das Sprichwort? Auf Neger-Wally, die hat’s ihm angetan, auf die ist er scharf.«
Er blieb stehen und sah mich kurz an, prüfend, erwartungsvoll, ehe er weiterhinkte und ich ihm wieder folgte.
»Und Neger-Wally«, fragte ich, wobei mir die Frage mehr wie eine Feststellung vorkam, »die wohnt in der Baracke?«
»Nein«, antwortete Nilowsky. Es klang amüsiert: Wie könne ich nur auf so was kommen. »Neger-Wally, die wohnt auf der anderen Seite vom Chemiewerk, da wohnt Wally, auf der anderen Seite. Aber zu Besuch, sie ist oft zu Besuch in der Baracke. Bei den Afrikanern ist sie oft. In der Baracke, da kochen sie, und saufen tun sie und tanzen, und das ist noch nicht alles, was sie da machen in der Baracke, Wally und die Negermänner, und ein paar andere Frauen sind auch dabei. Mein Alter, der ist scharf auf Wally, aber er traut sich nicht rein in die Baracke. Und wenn er besoffen ist und die Kneipe zu und er glaubt, dass er allein ist, verflucht er sie. ›Geile Fotze‹, sagt er, ›du blöde geile Fotze‹, und reibt seinen Schwanz, die geile Sau. Bis es ihm kommt, reibt er seinen Schwanz. Und ich klau ihm die Groschen aus der Kasse, wenn er seinen Schwanz reibt und Wally ›Geile Fotze‹ nennt, und er kriegt das gar nicht mit, so geil ist er, die dreckige Mistsau.«
Nilowsky blieb wieder stehen und holte aus seiner Hosentasche eine Handvoll Groschen hervor. »Da, guck sie dir an die Groschen, alles meine jetzt. Aber du verrätst mich nicht, ist das klar!«
Er schaute mir in die Augen, bittend, drohend, ich hätte nicht sagen können, was von beidem überwog.
»Ist klar«, versicherte ich, wie jemand, der mit fester Stimme einem Befehl zustimmt.
Nilowsky nickte zufrieden, dankbar, wie mir schien. Dann sagte er, fast schroff: »So, muss jetzt allein sein. Hab zu tun.«
Wieder dieses abrupt Abschließende. Aber es irritierte mich nicht mehr. Es kam mir, seltsamerweise, fast schon vertraut vor.
»Klar«, sagte ich. »Bis bald, tschüss«, und ging, verwundert darüber, dass ich »Bis bald« gesagt hatte, davon. Ich wusste nicht, ob ich ihn denn tatsächlich bald wiederzusehen wünschte oder ob ich ihm nur Sympathie zeigen wollte, weil ich gesehen hatte, wie er verprügelt worden war und weil ich eigentlich Angst vor ihm hatte.
4
Es freute mich, dass ich mich meinen Eltern zum ersten Mal in meinem Leben überlegen fühlen konnte: Ich sah die faulen, undisziplinierten Afrikaner als meine Verbündeten an und diese Frau namens Neger-Wally gewissermaßen als eine Verbündete meiner Verbündeten. Meine Neugier, sie und die Afrikaner, wenigstens einige von ihnen, kennenzulernen, wuchs von Tag zu Tag. Allerdings wollte ich nicht wieder die Baracke beobachten und dabei von Nilowskys Vater überrascht werden. Am liebsten wäre ich einfach hineingegangen. Tür auf, hallo und rein. Doch das wagte ich nicht. Stattdessen hatte ich eine Idee, die zwar nicht besonders elegant war, aber auf Eleganz kam es mir auch nicht an. Ich ließ meinen Wohnungsschlüssel in meinem Zimmer liegen, um einen Vorwand zu haben, nach der Schule zu meiner Mutter ins Chemiewerk zu gehen und sie um ihren Schlüssel zu bitten.
»Junge, Junge«, sagte meine Mutter, »Schlüssel hast du ja noch nie vergessen. Nicht dass du uns jetzt noch schusslig wirst.«
»Könnte passieren«, erwiderte ich und täuschte Besorgnis vor.
»Bloß nicht«, meinte meine Mutter und gab mir ihren Schlüssel.
Ich verließ das Chefbüro und ging im Werk umher.
Natürlich achtete ich darauf, so wenig wie möglich gesehen zu werden. Ich verbarg mich hinter Pfeilern und Mauervorsprüngen, und auf einmal entdeckte ich drei schwarze Männer, nebeneinander auf einer Rohrleitung sitzend, die dicht über dem betonierten Boden verlief. Die drei waren vielleicht Anfang zwanzig, hatten große, runde Gesichter und breite, flache Nasen. Sie trugen blaue Arbeitsanzüge und kauten auf etwas herum, langsam und gleichmütig.
»Hallo«, sagte ich.
»Hallo«, antwortete der, der in der Mitte saß. »Gehen gleich wieder an Arbeit«, fügte er hinzu. »Nur kurz Pause.«
»Von mir aus«, sagte ich, »könnt ihr ruhig weiter Pause machen.«
Der Mittlere schmunzelte mir zu und meinte: »Ja. Ist gesund Pause.«
Er ist bestimmt der Sprecher der drei, dachte ich und wunderte mich deshalb nicht, dass mich die beiden anderen kaum beachteten. »Woher kommt ihr?«, fragte ich ihn.
»Mozambique«, meinte er. »Maputo, Hauptstadt. Sollen lernen. Chemiefacharbeiter. Internationale Solidarität von Proletariat. Deshalb Sozialismus und Revolution wird siegen in Afrika.«
Dieser Text wirkte wie auswendig gelernt, und ich hatte schon Lust zu sagen: Ich bin nicht euer Lehrer, mit mir müsst ihr nicht so reden. Stattdessen fragte ich: »Und warum, wenn das so ist, sitzt ihr hier rum?« Darauf der Sprecher: »Brauchen auch Pause für Revolution. So einfach.«
In meinen Ohren klang das schlüssig, geradezu logisch. Für meine Eltern jedoch, dachte ich, ist das natürlich unbegreiflich. Auf einmal kam mein Vater auf uns zu, wie aus dem Nichts. »Ich sehe wohl nicht richtig«, rief er den Mozambiquanern zu. »Macht euch an die Arbeit, aber fix!«
Die drei standen unverzüglich und ohne Widerrede auf, doch so eilig sie auch davongingen, sie behielten ihren Gleichmut.
»Und du?«, fragte mein Vater. »Was machst du hier seit über ’ner halben Stunde? Der Pförtner hat sich ganz aufgeregt bei mir gemeldet, sagte, du wolltest nur mal schnell den Wohnungsschlüssel holen und kommst einfach nicht zurück. Was soll das? Du kannst hier nicht ohne Erlaubnis … Was hast du mit den Afrikanern geredet?«
»Über dich«, antwortete ich, »haben wir geredet. Dass du nicht kapierst, dass Revolution und Pause zusammengehören. Dass du nur immer an deine Arbeit denkst und dass dir deshalb alle andern Menschen egal sind.«
Ich ging, ohne eine Reaktion abzuwarten. Ich wusste in diesem Moment schon, was mich am Abendbrottisch erwarten würde: ein pädagogisches Gespräch, wie meine Eltern das nannten.
»Ich arbeite deshalb so viel, damit es uns gut geht«, begann mein Vater. »Insofern«, fügte meine Mutter hinzu, »ist ihm seine Familie überhaupt nicht egal, das ist ja wohl klar.« – »Und die Mozambiquaner«, erläuterte mein Vater, »die sind eben anders als wir. Deshalb bleiben sie auch nach der Arbeit unter sich in ihrem Wohnheim.« – »Na ja«, korrigierte nun meine Mutter, »so ganz unter sich sind sie ja nicht. Oder wie soll man das mit den Frauen sehen, von denen sie sich verbotenerweise besuchen lassen?«
Ich wollte schon fragen, was für Frauen sie denn meine, doch mein Vater ließ mich nicht zu Wort kommen. »Und genau deshalb«, sagte er, »sollst du, weil du noch ein junger Mensch bist und abgesehen davon mit den Mozambiquanern sowieso nichts zu schaffen hast, am besten jeglichen Kontakt zu ihnen vermeiden.«
»Ja«, bekräftigte meine Mutter, »das ist das Beste für dich.« Und dann fragte sie: »Hast du denn eigentlich schon einen Freund in deiner Klasse?«
»Nein«, erwiderte ich.
»Und sonst, hier im Wohngebiet vielleicht?«, erkundigte sich mein Vater.
Ich überlegte kurz und sagte, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres: »Ja. Nilowsky, Reiner Nilowsky, der Sohn vom Wirt aus ’m Bahndamm-Eck.«
Meine Eltern schauten mich ungläubig an.
»Wie kommst du denn auf den?«, fragte mein Vater.
»Na, immerhin wohnt er im selben Haus wie wir«, antwortete ich.
»Der ist nun aber bestimmt nicht das richtige Milieu für dich«, meinte meine Mutter.
Ich stand auf und sagte: »Wenigstens meine Freunde darf ich mir doch noch aussuchen, oder?«
Ich ging in mein Zimmer. Freute mich, dass ich meine Eltern verblüfft hatte. Plötzlich aber hatte ich auch Angst: Was wäre, wenn meine Mutter zu Nilowsky ginge und ihm mitteilte, dass sie eine Freundschaft zwischen mir und ihm nicht wünsche? Ich hatte keine Ahnung, wie Nilowsky reagieren würde. Allein der Gedanke daran bereitete mir Unbehagen. Mir kam wieder in den Sinn, wie er bei offener Kneipentür von seinem Vater verprügelt worden war. Als Freund, sagte ich mir, hätte ich ihm helfen müssen, irgendwie. Vielleicht war das eine Prüfung für mich gewesen.
Mit diesem Gedanken lag ich nachts wach im Bett. Ich fragte mich auch, was die Mozambiquaner wohl von mir hielten. Könnte doch sein, dass sie mich als eine Art Aufpasser ansahen. Als einen Spion im Dienste meines Vaters. Auf einmal glaubte ich mich zu erinnern, dass der Sprecher der drei mich strafend angesehen hatte, bevor sie, von meinem Vater ermahnt, davongezogen waren.
An das Vibrieren, das die vorbeifahrenden Züge erzeugten, hatte ich mich inzwischen gewöhnt. Auch den Gestank vom Chemiewerk fand ich nicht mehr ganz so furchtbar. Aber dass ich mit meiner Neugier vielleicht als Spion oder sogar als Feind angesehen wurde, war nichts, woran ich mich hätte gewöhnen können.
5
Am nächsten Tag passte mich Nilowsky auf meinem Weg von der Schule nach Hause ab.
»Hallo, grüß dich«, sagte er betont lässig.
»Hallo«, erwiderte ich, bemüht, seinen Ton zu treffen.
»Roberto hat mir von dir erzählt«, fuhr Nilowsky fort, während wir nebeneinander hergingen und er immer noch ein wenig hinkte. »Ihr habt euch unterhalten. Er fand dich sehr nett.«
Roberto hieß er also, der Sprecher der drei Mozambiquaner. Dass er mich, warum auch immer, sehr nett fand, entspannte mich. »Danke. Ich fand ihn auch sehr nett.«
»Er war im Widerstand gegen die Kolonialherren«, berichtete Nilowsky. »Sie haben seine Mutter umgebracht. Wenn er zurück ist, wird er sie rächen.«
So wie Nilowsky das sagte, ließ er keinen Zweifel daran, dass Roberto das tun werde. »Die Kolonialherren«, meinte er weiter, »treiben nämlich immer noch ihr Unwesen, obwohl die Revolution gesiegt hat. Jedenfalls vergeht für Roberto kein Tag, an dem er nicht an seine Rache denkt, kein Tag.«
Nilowsky war ziemlich stolz auf den Mozambiquaner, ein Vorbild an Willenskraft. »Weißt du eigentlich«, fragte er, »warum es hier drei Grad wärmer ist als anderswo in Berlin?«
»Nein«, antwortete ich. »Ist das denn so?«
»Und ob das so ist. Also, zwei Grad wärmer ist es durch das Chemiewerk, ich meine die Schwefelabgase, die das Werk ausstößt, diese stinkenden Schwefelabgase. Aber woher das dritte Grad?« Er wartete keine Antwort ab, er rechnete wohl auch mit keiner. »Klar, das ist ein großes Geheimnis. Aber ich kenne es, das Geheimnis. Vor vier Monaten, da wurde es, um ein Grad wärmer wurde es da. Zu dieser Zeit, vor genau vier Monaten, sind sie hier angekommen, die Mozambiquaner, aus ihrer Hauptstadt Maputo, neun Mann. Das Holzhaus war vorher angestrichen worden, rotgelb, so hatte die Betriebsleitung das Holzhaus anstreichen lassen. Haben sich zuvor wahrscheinlich erkundigt, bei der FRELIMO, so nennen sich die Revolutionäre in Mozambique, wie die Baracke angestrichen werden soll. Aber dass es mit den Mozambiquanern wärmer wurde, genau ein Grad, das hat die Betriebsleitung nicht bemerkt, das hat niemand hier bemerkt. Nur ich, ich hab es bemerkt. Ein Grad, das haben sie nämlich mitgebracht, die Mozambiquaner, das eine einzige Grad. Niemand weiß das. Nur ich. Und du hältst dicht, ist das klar?«
Das nächste Geheimnis, das er mir anvertraute. »Ja, ich halte dicht«, versicherte ich.
»Gut.« Es klang tief befriedigt. »Würde auch gern im Chemiewerk lernen, das würde ich gern. Aber muss bei meinem Alten, muss ich lernen. Lehre in der Gastronomie, bei ihm. Soll die Kneipe übernehmen, wenn er mal nicht mehr ist. Wer nischt wird, wird Wirt. Kennst du nicht das Sprichwort? Aber ich werd’ schon noch was werden, kannst du Gift drauf nehmen.«
Mit dieser Bemerkung bog er in eine Nebenstraße ab und ging eilig davon. Ich sah ihm nach, seinen langen staksigen Beinen, den weit ausholenden Armen, und so sehr ich auch darauf achtete, er hinkte nicht mehr.
Noch am Abend desselben Tages fuhr ich mit einem Thermometer nach Treptow, nach Prenzlauer Berg, nach Pankow, und überall war es tatsächlich drei Grad kälter als in der Gegend um das Chemiewerk herum, in dem neun Mozambiquaner arbeiteten.
6
In den nächsten Wochen traf ich mich regelmäßig mit Nilowsky. Nicht vor oder gar in der Kneipe, nein, alle zwei, drei Tage passte er mich auf meinem Weg von der Schule nach Hause ab und ließ sich von mir begleiten. Meist liefen wir einfach in der Gegend umher, wobei es mir immer so vorkam, als hätte er einen genauen Plan für die Wege, die wir zurücklegten. Oft kamen wir auf diesen Wegen auch am Bahndamm vorbei, weit genug vom Bahndamm-Eck entfernt, sodass sein Vater uns nicht sehen konnte. Wenn wir am Bahndamm waren, erläuterte er, wann genau die Züge vorbeifuhren, auf die Minute genau konnte er das sagen. Einmal, als der Vierachtzehner kam, legte er wieder einen seiner Groschen auf die Schiene, und der Vierachtzehner fuhr ihn platt, so platt wie es nur möglich war, und nahm Spuren von ihm an seinen Rädern mit, nach Westdeutschland, nach Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal. Revolutionäre Spuren, sagte ich mir, für den kapitalistischen Teil Europas; bis das Meer kam, der Atlantische Ozean, und es nicht mehr weiterging. Auch wenn es mir nicht ganz logisch vorkam, dass die Züge, die Nilowskys Groschen verwandelten und veredelten, in Richtung Westen fuhren, begann ich, ihm zu glauben. Ich fragte mich, ob es ein Merkmal von Freundschaft sei, wenn man jemandem glaubt, obwohl es einem nicht ganz logisch erscheint.
Wir gingen stumm nebeneinander her. Es hatte beinahe etwas Feierliches. Ein paar Straßen weiter begann er von der Befreiung Afrikas zu reden und von der Ausrottung der letzten Kolonialherren. Die Namen der Länder, die er nannte – Angola, Äthiopien, Sambia, Mozambique, Uganda, Tansania –, klangen für mich wie Verheißungen, deren Erfüllung unmittelbar bevorstand. Vielleicht, sagte er, werde er in einem dieser Länder eines Tages ein Chemiewerk errichten, eines, das Lebensmittel produziere, in Form von Tabletten, damit in Afrika oder irgendwo sonst auf der Welt nie mehr Hunger herrsche. Er lachte und sagte: »Jedenfalls nicht so ein Chemiewerk wie bei uns hier, das nicht, auf keinen Fall. Nicht so eines, das Kopfschmerztabletten produziert und dabei so sehr stinkt, dass die Menschen Kopfschmerzen kriegen. Ist doch absurd, oder etwa nicht?«
»Ja«, antwortete ich, »das ist absurd«, und Nilowsky fuhr fort: »Oder Kneipen, die wird es in Afrika auch nicht geben, keine einzige Kneipe. Höchstens ein paar Restaurants, mit richtig gutem Essen, also, in diesem Fall mal keine Tabletten, sondern Hummer oder Antilopenfleisch, all so was, und alles mit Ingwer und Knoblauch, und zum Dessert – so nennt sich das, was man nach dem Essen isst – Papayas, Mangos und gebratene Bananen. Und nach dem Dessert, zur Verdauung, nur dazu, auch mal ein Gläschen Likör oder Weinbrand, aber nur ein Gläschen. Keinen Klaren, überhaupt keinen Fusel, auch kein Bier, denn davon kriegst du nur Kopfschmerzen, und um Kopfschmerztabletten zu produzieren, dafür werden die afrikanischen Chemiewerke zu schade sein. Klar, oder?«
»Klar, leuchtet mir ein.« Es leuchtete mir tatsächlich ein. Wozu, dachte ich, soll man Kopfschmerztabletten herstellen, wenn man stattdessen alle möglichen Ursachen von Kopfschmerzen beseitigen kann? Und plötzlich verstand ich auch, warum die Mozambiquaner im Chemiewerk hinterm Bahndamm faul und undiszipliniert waren. Sie hoben ihre Kräfte auf für die Produktion von Lebensmitteln in Tablettenform, so einfach war das. Ich erläuterte Nilowsky meinen Gedanken, und er sagte: »Siehst du, jetzt begreifst du auch, was Roberto mit ›Pause‹ und ›Revolution‹ meinte: Er macht jetzt Pause, um später, wenn er zurück in seiner Heimat ist, die Revolution weiterführen zu können, deshalb macht er Pause. Klare Sache, oder? Kapiert bloß keiner hier bei uns im Osten.«
Nilowskys Logik begann mich zu faszinieren. Sie war etwas Kostbares, das mir immer vertrauter wurde. »Die meisten von den Säufern im Bahndamm-Eck«, fuhr er fort, »sind Arbeiter im Chemiewerk, die meisten von denen, und nach Feierabend bekämpfen sie ihre Kopfschmerzen. Mit Bier und Schnaps und Skatspielen bekämpfen sie die. Das geht, solange geht das gut, bis sie frühmorgens aufwachen und die Kopfschmerzen stärker sind als am Feierabend. So kommt es, dass sie massenweise von den blöden Tabletten nehmen, die sie selber produzieren.«
»Dadurch«, ergänzte ich, »haben sie wenigstens immer gut zu tun, die Arbeiter, oder?«
»Genau so ist es«, bestätigte Nilowsky. »So langsam kommst du dahinter.«
»Und dein Alter?«, fragte ich.
»Mein Alter, der ist so versoffen, ist der, der hat die Kopfschmerzen schon weggesoffen.« Er grinste hämisch. »Ein Wunder, dass er es noch schafft, sich einen runterzuholen, so versoffen wie der ist. Muss so scharf sein auf Wally, so scharf muss der sein, aber hat keine Chance, keine bei Wally, nicht ein bisschen.«
»Dürfte ich denn«, fragte ich, »Wally mal kennenlernen oder wenigstens mal sehen?«
Nilowsky gab keine Antwort. Das war für mich Grund genug, nicht mehr nach Wally zu fragen. Sicherlich hätte ich ihr nachspionieren und sie beobachten können, wie sie in die Baracke ging oder die Baracke verließ, doch ich hatte Angst vor einer abermaligen Begegnung mit Nilowskys Vater. Vor allem aber hätte ich das Gefühl gehabt, gegen Nilowskys Willen zu verstoßen, und das wollte ich nicht.
7
Zwei Wochen später, an einem dunklen, verregneten Nachmittag Ende Oktober, sagte er, kaum dass er mich auf dem Nachhauseweg abgepasst hatte: »Muss zu Wally, muss ich. Soll ihr von Roberto was ausrichten. Willst du mitkommen?«
Ich antwortete nicht, sondern blieb einfach an seiner Seite. Wir gingen durch eine fast zwei Kilometer entfernt liegende Bahndammunterführung. Nachdem wir eine ganze Weile schweigend nebeneinander hergelaufen waren, sagte Nilowsky: »Niemand soll sehen, dass wir zu Wally gehen. Deshalb der Umweg.« Ich fühlte mich, als sei ich an einer geheimen Mission beteiligt; von mir aus hätte der Umweg noch größer sein können.
Schließlich standen wir vor einem vierstöckigen Haus, auf der anderen Seite des Chemiewerks. Nilowsky klopfte in einem bestimmten Rhythmus – zweimal lang, zweimal kurz – gegen eine heruntergelassene Jalousie im Erdgeschoss. Die Jalousie wurde hochgezogen und das Fenster geöffnet. Nilowsky stieg in die Wohnung, und ich folgte ihm.
Wally war klein und kräftig und Anfang fünfzig. Wie viele Frauen in dieser Zeit trug sie eine Kittelschürze aus Dederon. Ihre braune Haarfärbung war fast herausgewachsen aus den glatt nach hinten gekämmten grauen Haaren, die ihr einen Ausdruck von Strenge gaben. »So ein Mistwetter aber ooch«, sagte sie. »Will man nischt von mitkriegen.«
Sie ließ die Jalousie wieder herunter und fragte Nilowsky: »Wat willste? Und wen haste da mitjebracht?«
»Das ist ein Freund von mir. Der ist absolut vertrauenswürdig, ist er.«
Ich fühlte mich noch mehr als zuvor wie auf einer Geheimmission. Und dass mich Nilowsky als Freund bezeichnet hatte, trieb mir vor Freude die Tränen in die Augen. Zugleich ängstigte es mich, weil ich nicht wusste, was er mir als Freund alles zutrauen würde.
»Wusste gar nich, dass du Freunde hast«, sagte Wally, doch dann musste sie gesehen haben, wie sehr sie ihn mit dieser Bemerkung getroffen hatte, und schickte schnell hinterher: »Ick freu mir, dass du mal wieder jekomm bist. Ick freu mir sehr.«
Mit diesen Worten nahm sie Nilowsky in die Arme, der sich, damit das überhaupt möglich war, weit zu ihr hinabbeugte.
»Ich soll dir was von Roberto ausrichten«, sagte er und löste sich aus ihrer Umarmung.
»Wat will der mir denn ausrichten?«, fragte Wally, obwohl sie sich das, wie es den Anschein hatte, schon denken konnte.
»Er will, dass du wieder kommst. Das will er. Dass du wieder dabei bist, will er.«
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












