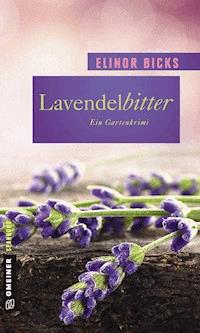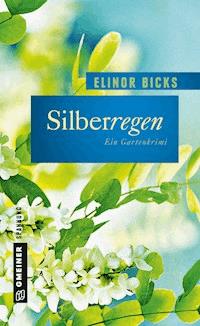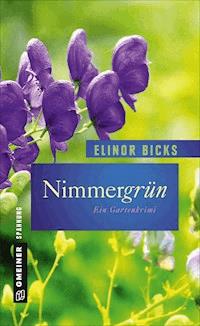
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lore Kukuk und Kommissar Roland Otto
- Sprache: Deutsch
Ein rätselhaftes Waldsterben beunruhigt die Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Kommissar Roland Otto ermittelt zunächst widerwillig. Doch dann kommen zwei Kinder zu Tode und es wird klar, dass ein mörderischer Erpresser am Werk ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die Ermittlungen führen Roland Otto und Lore Kukuk entlang des Hugenotten- und Waldenserpfades tief in die Vergangenheit. Und Lore erfährt etwas über ihre Vorfahren, das besser im Dunkeln geblieben wäre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elinor Bicks
Nimmergrün
Roman
Impressum
Ausgewählt von
Claudia Senghaas
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © time_lady / fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5266-6
Zitat
»Ja, der glückliche Erfolg, den die französischen Gärtner mit den verschiedensten Gartenprodukten und in der Blumenzucht erzielten, schien den Einheimischen an ein Wunder zu grenzen, und das Volk glaubte, sie wendeten geheime Zauberkünste an …«
Eduard Muret (1833 – 1904)
Prolog
Reggie streckte ihre Glieder und rutschte auf die andere Seite des Bettes, um mit dem Körper die Sonnenstrahlen aufzufangen, die durchs offene Fenster hereinfielen. Eine Weile lag sie so da, mit geschlossenen Augen, und stellte sich vor, dass es sich um die kalifornische Sonne handelte. Dann wieder gelangten das Gackern der Hühner und der Mistgeruch in ihr Bewusstsein und verwandelten den Sonnenschein in einen profanen Morgen im Odenwald.
Sie hatte einen irren Traum gehabt. Außerirdische hatten sie in ein Raumschiff entführt, doch statt zu starten, hatte das Ding nur gebrummt. »Wann fliegen wir los«, hatte Reggie immer wieder gefordert, in Erwartung auf das Abenteuer ihres Lebens, ohne jedoch eine Antwort zu bekommen. Reggie sah darin ein Zeichen. Sie musste es endlich anpacken. Auch ohne Geld und ohne den Segen vom Rest der Sippe. Reinhardt würde nachkommen, da war sie sich sicher, so sehr er sich aufregte und so viel die Alte auch Terror machte. Auf die anderen konnte sie eh verzichten. Sie musste es nur endlich anpacken.
Reggie wälzte sich an die Bettkante und strich die Haare aus dem Gesicht, die eine dringende Wäsche benötigten, wie sie feststellte. Sie tastete auf dem Fenstersims nach ihren Zigaretten, erwischte aber nur eine leere Zellophanhülle, die sie zerknüllte und in die Ecke feuerte.
Plötzlich wusste sie, dass es ganz leicht werden würde, sich von all dem hier zu verabschieden. Das Chaos hier, der Mangel an Privatsphäre, der ewige Streit ums Geld, all das würde ihr kein bisschen fehlen. Mühsam erhob sie sich von der Matratze und ging nach unten.
Die helle Sonne aus dem Obergeschoss blieb im Untergeschoss ausgesperrt. Im Wohnzimmer, wo die Vorhänge zugezogen waren, lagen die Leiber ihrer Mitbewohner kreuz und quer auf den beiden abgenutzten Sofas verteilt. Reinhardt mit seinen spitzen Knochen und dem Bart wie angespülter Seetang, neben ihm Robert mit seinem Buddhakörper, auf dem anderen Sofa Marja und Andrea mit ihren Zottelhaaren und den Indienkleidern, die sie niemals zu wechseln schienen.
Über allen hing der Zigarettennebel von vergangener Nacht.
»Sydney?«, rief Regina in die Stille und schauderte. Hier drinnen war es kühl. Reggie entdeckte ein halbvolles Päckchen Reval auf dem Tisch. Natürlich, sie hatten sich wieder an ihren Zigaretten bedient. Sie fummelte eine heraus und klemmte sie sich zwischen die Lippen. Sie ging in die Küche, um die Zigarette am Gasherd anzuzünden. Ein Blick auf den Herd bestärkte sie erneut. Es war nicht nur der verdreckte Herd. Die schmutzigen Matratzen mit der ständig wechselnden Besetzung, der ewige Mief nach Mist und nassen Tieren, der Kleinkrieg mit den Nachbarn. Verkrustete Platten, eingetrocknetes Geschirr … Es würde ihr leichtfallen fortzugehen. Wie zur Besiegelung nahm sie einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette und füllte sich Wein aus einer angebrochenen Flasche in eines der gebrauchten Gläser, die auf der Anrichte herumstanden. Reggies Gesicht wurde von einem Lächeln überflutet, während sie sich ihre Zukunft in den buntesten Farben ausmalte. Sonne, Freiheit und verwandte Seelen. Sie prostete einem imaginären Gegenüber zu, leerte den Wein mit einem Schluck und schüttelte sich anschließend.
Der Wein schmeckte so scheußlich, dass es ihr eine Gänsehaut den Rücken hinabtrieb. Sie nahm zwei, drei tiefe Züge und drückte die Zigarette in einem gebrauchten Teebeutel aus, der auf dem Herd lag.
Plötzlich wurde ihr Körper von einem merkwürdigen Kribbeln erfasst. Es begann am Zahnfleisch und breitete sich vom Mund über den Kopf bis über den ganzen Körper aus. Gleichzeitig wurde sie von einem Glücksgefühl durchdrungen, und ihr Körper hob an zu singen. Oder war es ein Brummen? So wie in dem Traum heute Nacht?
Reggie schüttelte sich. Vermutlich war sie einfach noch nicht richtig wach. Plötzlich stellte sich jedes einzelne Haar an ihrem Körper auf. Es fühlte sich an, als wüchse ihr ein Fell. Oder Federn. Voller Grauen betrachtete Reggie ihre Unterarme. Trotz des merkwürdigen Bodyfeelings gelangte sie ins Wohnzimmer, wo sie sich neben Reinhardt hinkniete und ihn heftig schüttelte.
Sein Körper schlackerte leblos hin und her. Jetzt wurde Reggie von Panik ergriffen, untermauert von einem irren Herzrasen.
Sie kroch hinüber zu Robert und versuchte ihn wachzurütteln. Vergebens. Sie wollte schreien, aber brachte nur ein Würgen hervor. Sie musste sich auf den Boden stützen. Eiswasser schoss durch Reggies Venen, und sie sehnte sich wie irre nach Wärme. Kalifornischer Wärme oder auch Odenwälder Wärme, egal. Sie quetschte sich zwischen Reinhardt und Robert, und als sie so dalag, spürte sie, dass deren Körper eiskalt waren. Regina fiel Stockwerke in die Tiefe, während eine Horde Todesreiter durch ihren Kopf galoppierte. Dann wurde ihr grün vor Augen.
Trügerische Saat
»Unverschämtheit.« Lore feuerte die braune Knolle zurück in den Gemüsekasten. Krummsiegel registrierte es mit Missbilligung. Durch das Fenster fiel ein milchiges Licht in den Raum des Burgmuseums der Veste Otzberg und illuminierte die schwebende Mähne des Museumsdirektors wie einen Heiligenschein. Mehr denn je wirkte er wie das Schlossgespenst, als das ihn Lore gern bezeichnete. Jetzt verzog sich sein Gesicht zu einem dünnlippigen Lächeln.
»Das müssen Sie schon schlucken. Die Hugenotten haben unseren Speiseplan um ein Vielfaches bereichert. Unter anderem auch um die Kartoffel.«
»Frechheit«, murmelte Lore. Es widerstrebte ihr immer noch, die Wahrheit über die Herkunft ihrer so geliebten Odenwälder Kartoffel zu akzeptieren. Wie einige andere unbequeme Tatsachen, die sie bei den Vorbereitungen der Hugenotten- und Waldenserausstellung erfahren hatte. Die Religionsflüchtlinge, die im 17. und 18. Jahrhundert eingewandert waren, hatten den Ackerbau und den Gartenbau der Deutschen gehörig revolutioniert, und damit einhergehend auch deren Ernährung. Denn die armen Bauern auf dem Lande ernährten sich zum Ende des 17. Jahrhunderts noch von Kraut und Rüben. Die Einwanderer dagegen kannten eine Vielzahl von Obst und Gemüsesorten wie Blumenkohl, Artischocken, grüne Bohnen, Spargel und Salate.
Das konnte Lore noch akzeptieren. Auch, dass die für die Frankfurter Grüne Soße typischen Küchenkräuter wie Borretsch, Estragon, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch Mitbringsel der Einwanderer sein sollten, konnte sie verkraften. Aber dass die Siedler sogar für die Einführung und Verbreitung der Kartoffel verantwortlich sein sollten, war zu viel. Die Kartoffel, die waschechte Odenwälder Kartoffel vom Franzosen? Also nein.
Krummsiegel nahm die Steige mit den Blumen und platzierte sie neben die Kiste mit den Gemüseexponaten.
»Das sieht doch toll aus.« Er stemmte die Hände in die Seiten und betrachtete das blühende Gemisch aus Tulpen, Narzissen, Kaiserkronen, Ranunkeln, Kirschlorbeer und anderen Blumen, ebenfalls alle eingeführt von hugenottischen Gärtnern.
Neben den Blumen befand sich der Quadratmeter Erde mit den Melonensamen, die unter der Glasglocke keimten. Eigentlich züchteten die Hugenotten ihre Melonen auf Mist, doch Lore hatte Krummsiegel verboten, ein originalgetreues Mistbeet im Museum nachzustellen.
Immerhin würde die Ministerin zur Ausstellungseröffnung erscheinen. »Wollen Sie, dass sie hernach riecht wie eine Jauchegrube?«, hatte Lore gesagt. Das Argument hatte Krummsiegel überzeugt.
Die Hugenotten- und Waldenserausstellung musste auf jeden Fall ein Erfolg werden. Denn sie ging einher mit der Einweihung des neuen Streckenabschnittes des Hugenotten- und Waldenserpfades bei Wembach. Der Kulturfernwanderweg mit dem imposanten Doppelnamen war ein paneuropäisches Projekt von enormer Bedeutung für die ganze Region.
»Der Hugenottenpfad ist der neue Jakobsweg«, so lautete die unterschwellige Botschaft der Hugenotten-Kommission, einer Gruppe von Landespolitikern, die sich seit 20 Jahren für den Ausbau des Weges und für eine Angliederung an den Geo-Naturpark Bergstraße starkmachten. All diese Bemühungen sollten nun gekrönt werden mit der feierlichen Eröffnung des neuen Streckenabschnittes und der Ausstellung, in 14 Tagen war es soweit.
Krummsiegel war peinlich genau darauf bedacht, dass die Ausstellung reibungslos verlief. Nicht nur wegen der Bedeutung für die Region. Sondern auch, weil er im Rahmen der Vorbereitungen herausgefunden hatte, dass seine Vorfahren von den Hugenotten abstammten und er entfernt mit der französischstämmigen Familie de Maizière verwandt war. Seitdem nervte er Lore fortwährend mit seinem Wissen und schmückte seine Reden immer wieder mit französischen ›Bonmots‹. Zudem konnte er sich die gesamten Errungenschaften der Hugenotten zugutehalten, während sie, Lore, dastand wie der Dorftrottel, der sich heute noch von Steckrübensuppe ernähren würde, wenn die Franzosen nicht gekommen wären.
Lore griff nach einem glasgerahmten Foto, um es an die Wand zu hängen. Es zeigte die Waldenserkolonie in Wembach, verschwommene Häuschen mit Giebeln und kleinen Gärten. Das Foto war 1899, zum 200-jährigen Bestehen der Kolonie aufgenommen worden. Die Waldenser waren neben den Hugenotten die zweite große Gruppe an protestantischen Flüchtlingen, die nach Deutschland eingewandert war, teilweise auf denselben Wegen wie die Hugenotten, weshalb der Pfad den Doppelnamen trug. 1699 hatten sich rund 50 Waldenserfamilien in Rohrbach und Wembach-Hahn niedergelassen.
Krummsiegel trat neben Lore und rückte das Foto zurecht. »Sehen Sie die Vorgärten vor den Häusern? Die waren so prächtig, dass die Deutschen an Sonntagen dahin pilgerten, um sie zu bewundern. Natürlich gab es viel Neid. Manche Einheimischen dachten, es gehe mit Hexerei zu, dass bei den Einwanderern alles so gut gedieh.«
»Jaja, dabei hatten alle einfach nur einen grünen Daumen«, seufzte Lore. Sie hatte Krummsiegels Belehrungen gründlich satt. Sie hängte das nächste Bild auf, wobei der kleine Aufhänger an dem Haken abglitt und ihr das Bild beinahe aus den Händen fiel. Krummsiegel sprang herbei, um es aufzufangen.
»Machen Sie mir keine Fisimatenten«, grinste er, wobei er das Wort urhessisch betonte. Lore rollte die Augen und rechnete fest damit, erneut mit der Entstehungsgeschichte des Ausdruckes belehrt zu werden. Doch offensichtlich hatte Krummsiegel ein Einsehen.
Ein zweiter Versuch, das Bild aufzuhängen, verursachte ein unangenehmes Kratzen, als Lore wieder an dem Haken abglitt. »Der Haken ist zu klein«, schimpfte sie.
Krummsiegel nahm ihr das Bild aus der Hand. »Nun lassen Sie Ihren Unmut wegen der Kartoffel doch nicht an unseren Exponaten aus.« Und wie um sie eines Besseren zu belehren, hängte er das Bild auf, wobei der Aufhänger vorbildlich über den Haken glitt. Beschwichtigend legte Krummsiegel seine Hand auf ihre Schulter. »Wir können beide stolz sein, denke ich.«
Lore duckte sich unter seinem Griff weg. »Kann ich jetzt gehen?«, fragte sie. Als Krummsiegel nickte verließ sie das Museum.
Als sie den Burghof überquerte, kam es ihr so vor, als werde sie zum ersten Mal in diesem Jahr vom Sommer berührt. Die Juniluft war mild, und ein Potpourri von Düften umhüllte sie wie ein flauschiger Mantel. Sommerblumen, Wiesen, das Korn aus den Feldern zusammen mit dem Waldgeruch der Bäume versetzten Lore wie in eine Trance. Als Mädchen hatte sie oft den anbrechenden Sommer gewittert, wobei ihr eine unbestimmte Sehnsucht fast die Brust zersprengte. Sehnsucht nach dem Erwachsensein, so hatte sie es gedeutet. Aber das sehnsuchtsvolle Ziehen hatte nicht aufgehört, obwohl sie heute mehr als erwachsen war.
Unwillkürlich musste sie an den Kommissar mit dem Bartschatten denken. Und an jene gemeinsame Nacht. Wenn Lore auch zugeben musste, dass eine Nacht innerhalb eines Jahres nicht gerade viel war, so hatte diese doch einen nachhaltigen Eindruck bei ihr hinterlassen. Voller süßer Erinnerungen. Lore hatte diese Nacht ausgekostet und jede Sekunde eingeatmet, in dem Wissen, dass sie das Aroma dieser Nacht für den Rest ihres Lebens abspeichern musste.
Denn eine Wiederholung würde es nicht geben. Konnte es nicht geben.
Lore wischte jeden weiteren Gedanken beiseite und betrat ihr Haus, das schräg gegenüber vom Burgmuseum lag. Drinnen war sie umgeben von den dicken Mauern der Veste Otzberg, die kaum etwas von der sommerlichen Wärme hindurch ließ. Sie trat auf die Terrasse, von wo aus sie den Blick über die blühende Pracht in ihrem Garten genoss. Blumen und Kräuter dufteten betörend. Zur Wiedergutmachung des Ärgers und der gefühlten Demütigung, der Lore durch die Hugenottenausstellung ausgesetzt war, hatte sie hin und wieder eines der Saatpflänzchen oder eine Blumenzwiebel, die für die Ausstellung gedacht waren, mitgehen lassen und in ihrem Garten eingepflanzt.
Jetzt blühten in ihrem Beet die Gladiolen mit dem Rittersporn um die Wette. Weiter rechts grünten einige der Küchenkräuter. Lores Sommervorrat für die Grüne Soße. Der Rhododendron entfaltete wie jedes Jahr seine pinke Farbenpracht in voller Stärke und leuchtete geradezu neonfarben.
Lore holte die Gießkanne, um die Pflanzen zu wässern. Die Erde staubte, als sie vom Wasserstrahl getroffen wurde. Lore ging bereits zum dritten Mal und nahm sich endgültig vor, einen Gartenschlauch anzuschaffen. Als sie von der unteren Seite an den Rhododendron herantrat, entdeckte sie etwas Merkwürdiges. Sie bog einen der Zweige zur Seite, um besser sehen zu können, und bekam einen Schreck. Die tabakbraunen Flecken, die sie letzte Woche an den Blättern und Blüten bemerkt hatte, hatten sich epidemieartig ausgebreitet. Die Pflanze war nun geradezu zerfressen von braunen Flecken. Und noch schlimmer, die Krankheit schien auf den nebenstehenden Oleander übergesprungen zu sein. Und auch die Blätter und Äste der Apfelbäumchen wiesen erste braune Flecken auf. Vereinzelt waren Blätter bereits abgefallen. Lore bekam Angst. Hatte sie mit den Hugenottensamen eine Krankheit eingeschleppt?
Sie knabberte an ihrer Unterlippe und überlegte, ob sie Krummsiegel informieren sollte. Aber das hieß, den Diebstahl zu gestehen, was sie auf keinen Fall wollte. Nein, sie musste selbst mit der Angelegenheit fertig werden.
Dann begann sie, die frisch gepflanzten Setzlinge aus der Erde zu rupfen. Bei den Beeten mit den Kräuterkeimlingen trug sie die obere Schicht Erde ab, verpackte diese in Mülltüten und versenkte sie tief im Restmüll. Nachdem sie das Gröbste entfernt hatte, ging sie zurück ins Haus und überlegte fieberhaft, was sie noch tun konnte.
Und ihr wurde klar, dass es nur einen Ausweg gab. Auch wenn sie dafür das Gelübde brechen musste, das sie nach dem Tod des Gärtners abgelegt hatte. Aber ein Gelübde, das man sich selbst gegeben hatte, konnte man ja auch selbst wieder lösen, oder?
Lore öffnete die Tür zum Keller und stieg die enge Betontreppe hinab. Die Lampe auf Höhe der leichten Treppenbiegung tauchte den Raum in ein trübes Licht. Im Vorratskeller lehnte die alte Holzleiter an der Wand. Lore befreite sie aus dem Gerümpel, hinter dem sie sich befand, und schleppte sie nach oben in den ersten Stock. Dort befand sich der Raum, den Lore immer noch Edels Zimmer nannte, obwohl die falsche Schwester inzwischen im Gefängnis einsaß und diesen Raum sicherlich niemals mehr bewohnen würde.
Später hatte Opa Gersprenz in diesem Raum gewohnt, und als Lore eintrat, glaubte sie, das Aroma getragener Kleidung und ausgetrockneter Bierflaschen wahrzunehmen. In der Decke des Raumes befand sich eine Luke. Mit dem dafür vorgesehenen Haken zog Lore die Luke auf und stellte die alte Leiter in die so gewonnene Öffnung. Die Leiter, die ursprünglich zu dem Konstrukt gehört hatte, existierte nur noch zur Hälfte. Den unteren Teil hatte Edel als Mädchen in einem Wutanfall abgeschlagen.
Lore stieg die Leiter hinauf auf den Dachboden. Hier oben war alles genau so, wie sie es in Erinnerung hatte. Die Luft war heiß, staubig, muffig mit einer Note nach altem Holz und Papier. In der Ecke befanden sich vier Kisten. Zwei mit alten Kleidern von Oma Kukuk und zwei Kisten mit altem Kram von Edel.
Lore öffnete den Karton. Eine alte Puppe befand sich darin, die Haare hatte Edel ihr rigoros abgeschnitten, Lore erinnerte sich daran, dass Edel Ärztin gespielt hatte und vorgab, die Puppe an einem Gehirntumor operieren zu müssen. Der Kopf war lädiert, ein Auge fehlte, wohl ein Kollateralschaden der Operation.
Die Puppe trug keine Kleider, sodass man ihre absurde Machart drastisch vor Augen geführt bekam. Die Arme und Beine waren aus hartem Plastik angefertigt, während der Leib aus Stoff bestand, der mit Schaumstoffwürfeln gefüllt war. Auf dem Rücken befand sich eine offene Stelle, an der die Würfel zum Vorschein traten. Das ungeübte Auge würde annehmen, dass der mürbe gewordene Stoff geplatzt war. Doch Lore wusste, dass es sich dabei um die Operationsnarbe handelte, Edel hatte sie mit groben Stichen vernäht. Lore legte die Puppe zurück. Weiter befand sich in der Kiste ein Pudel, dessen Fell aus einem festen Kunststoffmaterial angefertigt war. Beide Augen waren eingedrückt. Überhaupt befand sich kein einziges Spielzeug von Edel in der Kiste, das noch unversehrt war.
Hatte Edel sich damit im Grunde schon verraten? Brauchte man nur das Kinderspielzeug von den Menschen anzusehen, um beurteilen zu können, ob es sich um zukünftige Massenmörder handelte, die eine Bedrohung der Gesellschaft darstellten? War damals schon Edels furchtbare Wahrheit zutage getreten, und sie alle hatten weggesehen und sie in Kisten verpackt? Lore verstaute die Spielsachen und verschloss den Karton sorgfältig.
In dem zweiten Karton befanden sich Edels und Lores alte Schulsachen. Hefte und Bücher, zum Teil eingebunden in farbige Plastikumschläge, die sie schützen sollten, die sich aber meistens schon nach kurzer Nutzung lösten und im Schulranzen oder wie jetzt in der Kiste verknitterten. Lore fand ihr altes Schulmäppchen und zog es zwischen den Sachen heraus. Die Hülle war kariert in bunten Farben, schon das Äußere hatte sie damals fasziniert. Vorsichtig öffnete sie den Reißverschluss.
Hinter den ausgeleierten Gummihaltern steckten abgebrochene Stifte und ein Kuli ohne Mine. Der Platz für den einstigen Ratzefummel war leer, der Radiergummi längst verbraucht. Lore strich über das grüne, samtige Futter.
Sie erinnerte sich gut daran, wie es gewesen war, das Mäppchen zum ersten Mal in der Hand zu halten. Es war die Verheißung eines neuen Lebensabschnittes, der sich vor ihr öffnete. Die ersten Schritte zum Erwachsensein, und die Werkzeuge hierfür barg dieser Schatz. Hinter jedem der Gummis hatte einst ein brandneuer Stift gesteckt, ein Lineal mit makellos schimmernder Oberfläche, ein nagelneuer Radiergummi und, besonderes Heiligtum, ein Geha-Füller mit metallisch-blanker Feder.
Was hatte sie aus dem Leben gemacht, das mit dieser Handvoll Werkzeuge begonnen hatte? Oder vielmehr, was hatte das Leben aus ihr gemacht? Ihr war, als sei sie von einem Strudel fortgeschwemmt worden und jetzt mit gut 60 Jahren auf dem Dachboden von Oma Kukuk gelandet. Das war ihr Leben. Vergeudet oder nicht.
Lore steckte das Mäppchen zurück in den Karton. Auf der Suche nach Oma Kukuks Rezeptheft fuhren ihre Finger vorsichtig über die Buchrücken und Kanten der Hefte. Ohne dass sie hinsehen musste, fand sie, wonach sie suchte. War es der textile Rücken oder die eigenartige Energie, die das Büchlein ausstrahlte?
Zögernd zog sie es heraus und wog es in ihrer Hand, wobei ein eigenartiges Gefühl ihren Körper überzog. Seit der Angelegenheit mit dem Gärtner hatte Lore es vorgezogen, Omas Rezeptheft an einem nicht zugänglichen Ort aufzubewahren und das Gelübde abgelegt, das Wissen, das in ihm niedergelegt war, nie wieder anzuwenden. Ein Gelübde, das sie jetzt brechen musste. Aber es war ja für einen guten Zweck.
Sie erhob sich entschlossen, fast trotzig, und knickte gleich darauf ein. Von der langen Hocke war ihr Bein eingeschlafen und fühlte sich an wie unter einem dicken Verband. Nur langsam konnte sie sich in Richtung Luke bewegen, während kribbelnd das Leben zurückkam. Lore musste kurz warten, bis sie wieder Kontrolle über ihren Fuß hatte, bevor sie die Leiter nach unten klettern konnte.
Sie setzte sich an den Küchentisch und blätterte das fleckige Oktavheft langsam durch. Nicht nur Oma Kukuk, auch Lore hatte darin ihre Rezepte hinterlassen. Selbstverständlich waren Lores Mischanleitungen von völlig anderer Natur als die von Oma Kukuk, die man auch die Kukuksgärtnerin genannt hatte.
Sie hatte die Kräuter aus ihrem Garten dazu verwendet, um andere Menschen gesund zu machen. Lores Rezepte jedoch zielten auf eine andere Form von Heilung ab. Sie musste lächeln, als ihr Blick über die alten Bezeichnungen und Mengenangaben glitt. Absinth, Bilsenbier oder Tollkirschenschnaps, so lauteten ihre giftigen Schöpfungen. Mit dem Tollkirschenschnaps hatte sie Edels einstigen Freund Freddy erst auf einen Trip an den Hof von König Ludwig dem 14. geschickt und dann in die Psychiatrie.
Dann war lange gar nichts geschehen, bis zu dem Vorfall mit dem Gärtner und Opa Gersprenz. Damals hatte sie Omas Rezeptbuch durch zwei simple, aber äußerst wirkungsvolle Rezepte ergänzt. Um den Silberregen und den Orangefuchsigen Raukopf. Beide maximal heimtückisch. Der Staub des Silberregens entfaltete sofort seine toxische Wirkung, wenn man ihn einatmete. Der Orangefuchsige Raukopf dagegen, ein gelblicher Pilz, wirkte oft erst Tage oder Wochen nach der Einnahme, etwa durch Nierenversagen, nur in seltenen Fällen konnte ein Zusammenhang mit dem Verzehr des Pilzes festgestellt werden. Wie man im Falle des toten Opa Gersprenz gesehen hatte. All dies war Wissen, das keinesfalls in falsche Hände geraten durfte. Schon gar nicht in die des Kommissars mit dem Bartschatten.
Allein beim Gedanken an den Kommissar spürte Lore ein Erglühen ihrer Wangen. Es war wie verhext. Kaum waren sie sich näher gekommen, hatte sich schon wieder das Schicksal dazwischengedrängt. In Form des toten Opa Gersprenz und des toten Gärtners.
Lore seufzte, befeuchtete ihren Zeigefinger mit der Zunge und blätterte die widerspenstigen Seiten um. Diesmal suchte sie nichts gegen Krankheiten oder für Rauschzustände. Diesmal suchte sie etwas anderes. Oma Kukuks Rezeptbuch enthielt nicht nur Heilmittel für Mensch und Tier, sondern auch wirksame Mittel gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Milch gegen Mehltau, Spüli gegen Spinnmilben, Kohletabletten und Knoblauch gegen Stammfäule.
Aber um welche Krankheit handelte es sich nun in Lores Garten? Sie führte sich die Symptome noch einmal genau vor Augen. Braune Stellen an Rinde und Blättern, vereinzelt weiche Stellen. Vielleicht tatsächlich die Stammfäule. Hierfür empfahl Oma Kukuk folgende Vorgehensweise:
Schwammige Rinde entfernen.
Kohletabletten in Mörser zerstoßen, Knoblauch ohne Schale zerdrücken.
Zu einer Paste vermengen.
Auftragen mit einem festen Pinsel und dann nicht gießen, bis die Erde trocken ist.
Nach 4 Wochen die Stelle mit künstlicher Rinde bestreichen.
Allerdings waren bei Lores Pflanzen nicht nur der Stamm befallen, sondern auch die Blätter, sodass es sich nicht um eine reine Stammfäule handeln konnte. Dennoch schien Knoblauch zu den wirksamsten Mitteln zu gehören, denn jedes zweite Rezept von Oma Kukuk basierte darauf. Laut Oma Kukuk half der Wunderstoff sogar gegen Bienen. Im letzten Jahr, als Lore durch die benachbarte Robinie von einer regelrechten Bienenplage heimgesucht worden war, hatte sie tatsächlich die Gartenmöbel mit Knoblauch eingerieben. Die Folge war ein unerträglicher Gestank, von dem sich die Stechbiester jedoch nicht abhalten ließen. Die einzige Wirkung des Mittels war, dass Lores gesamte Gartenbestuhlung grausam stank – und das den ganzen Sommer lang. Nun gut, dachte Lore. In diesem Jahr hatte sie kein Problem mit den Bienen, da die Ursache des Ärgers, die Robinie, nicht mehr existierte. Sie war vom Gärtner abgesägt worden. Seine letzte Tat war eine gute.
Lore entschied sich für die Zubereitung eines Zwiebel-Knoblauch-Suds. Die Zutaten hatte sie im Haus, die Zubereitung war einfach, und den beiden Knollen wurden wahre Wunder in Sachen Keimhemmung nachgesagt.
Je 100g gehackte Zwiebeln und Knoblauch auf 5 Liter Wasser.
Aufkochen.
Nase zuhalten.
Auf die Pflanzen aufgeben.
Lore setzte den Sud auf, und alsbald verbreitete sich der Gestank im ganzen Haus. Lore band sich ein Tuch vor die Nase. Nach dem ersten Aufkochen nahm sie den Topf vom Herd und stellte ihn hinaus auf die Terrasse. Sie würde die Pflanzen damit besprühen, sobald die Brühe abgekühlt war.
Waldsterben
Revierförster Sigurd Pöhl lief mit ausholenden Schritten durch den Wald. Der Boden unter ihm gab weich und federnd nach, die Baumkronen über ihm strotzten nur so vor Lebenskraft, die Vögel pfiffen aus voller Kehle einen Lobgesang auf die Natur. Pöhl inhalierte die würzige Waldluft wie eine Droge. Am liebsten hätte er in den Gesang der Vögel eingestimmt. Aber er war nicht alleine. In seinem Rücken befand sich eine Truppe von selbsterklärten Spezialisten, Abgesandte der Kommission Hugenotten- und Waldenserpfad. Bei einigen handelte es sich um Politiker vom Landkreis, zwei von ihnen kamen sogar vom hessischen Ministerium. Vorsitzende, Beisitzende, Pöhl hatte sich deren Funktionen nicht merken können, auf jeden Fall waren es Tätigkeiten im Sitzen.
Eigentlich sollte Forstamtsleiter Kesselbeck die Herren führen, aber der hatte eine dringende ärztliche Untersuchung. Also hatte Pöhl für den Vorgesetzten einspringen müssen, und er gab sein Bestes, auch wenn er sich eingestehen musste, dass er sich besser in der Kommunikation mit Bäumen verstand als mit Menschen.
Daher war er sich auch nicht sicher, ob die Herren Städter wirklich so unwissend waren, wie sie sich gaben, oder ob sie ihre Unkenntnis nur vorspielten, um ihn zu prüfen. Seit Beginn ihrer Exkursion löcherten sie ihn unentwegt mit den dümmsten Fragen. Die Männer von der Hugenotten-Kommission waren gekommen, um sich in Sachen Fauna fit zu machen, um dann mit ihrem Wissen nächste Woche bei der Einweihung des Streckenabschnittes Eindruck bei der Ministerin für Umwelt und Naturschutz zu schinden.
Den Schreibtischtätern die Natur nahezubringen, war etwa so einfach, wie einem Elefanten Balletttanzen zu lehren. Pöhl war bereits der Mund trocken, und das Schwerste stand noch bevor. Er musste ihnen die verschiedenen Bäume erklären und erläutern, welche Rolle sie im pflanzensoziologischen System bildeten, dabei konnten sie keine Tanne von einem Laubbaum unterscheiden.
Pöhl blieb stehen und begann eine seiner vorbereiteten Erläuterungen. »Wir befinden uns hier in den typischen Waldgesellschaften von Eichen-Hainbuchen-Wäldern.« Pöhl entgingen nicht die spöttischen Blicke, die die Delegierten beim Wort Waldgesellschaften austauschten, doch er bemühte sich, unbeirrt fortzufahren.
»Die Stiel- und Traubeneichen bauen ein oberes Baumstockwerk auf, unter dem die schattenverträgliche Hainbuche ein zweites Stockwerk bildet. Die perfekte Ökonomie.«
Pöhl blickte in fragende Gesichter. »Was ist eine Hainbuche?«, fragte einer der Delegierten. Pöhl wies auf einen der umstehenden Bäume mit gräulich-weißem Stamm und erklärte den Unterschied zu Eichen mit ihrer schorfigen Rinde.
»Wie unterscheidet man die Hainbuche von der Rotbuche?«, fragte ein anderer. Pöhl verzichtete darauf zu erklären, dass die beiden Arten entgegen aller Erwartungen nicht miteinander verwandt waren, die Rotbuche zur Gattung der Buchengewächse gehörte.
»An der Farbe«, entgegnete er bissig. Im Hintergrund hörte er die anderen auf Kosten des Fragers witzeln.
Während er weiterging, verwies Pöhl gelegentlich auf eine Winterlinde, Vogelkirsche oder Esche, obwohl er sicher war, dass keiner der Delegierten später in der Lage sein würde, die entsprechende Baumart wiederzuerkennen.
»Oh, Tannen«, rief einer von ihnen, als sie an einer Fichtenschonung vorbeikamen. Pöhl verzichtete darauf, ihn zu korrigieren. Er hoffte inständig, dass die Gruppe es bei der Erläuterung der wichtigsten Baumarten bewenden lassen würde. Wenn er sie auch in Sachen Sträucher, Gräser und Moose aufklären musste, wären sie gezwungen, die Nacht im Wald zu biwakieren.
»Was ist das für ein Gras?«, fragte einer der Delegierten prompt und deutete auf eine Böschung mit Farnen.
»Wurmfarn, die am weitesten verbreitete Farnsorte«, erklärte Pöhl. »Der Wurmfarn erzeugt einen giftigen Wirkstoff, der Bandwürmer lähmt, ohne sie zu töten.« Auch hier wieder Lachen, wie nach einem schmutzigen Herrenwitz. Schade eigentlich, dass noch keine Pilzsaison war. Pöhl kannte eine Sorte, die schon allein beim Beschnuppern tödlich war.
Der Revierleiter ging weiter, wobei er die Zweige einer niedrigen Hainbuche beiseitebog. Er ließ sie just in dem Moment los, in dem der Delegierte hinter ihm aufschloss, sodass diesem die Zweige ins Gesicht schnalzten. »Entschuldigung.« Pöhl blickte nach vorn, damit niemand die Schadenfreude in seinem Gesicht lesen konnte.
Der Pfad, der zurück auf den Wanderweg führte, war überwuchert von herrlichstem Moos. Die Delegierten trampelten darüber hinweg, nicht ahnend, dass es allein elf verschiedene Moossorten gab, deren Namen sich Pöhl gerne genussvoll auf der Zunge zergehen ließ. Silber-Birnmoos, Brunnenlebermoos, sparriges Kranzmoos, gemeines Kurzbüchsenmoos. Einfach wunderbar.
Inzwischen schien der Wissensdurst der Herren allmählich gelöscht, denn nicht nur das Witzeln, auch die Fragen versickerten allmählich, und Pöhl konnte deutlicher die Waldgeräusche wahrnehmen. Das feine Knacken der Zweige unter den Füßen, das sumpfige Rascheln des feuchten Laubs, wenn Kleintiere durchs Unterholz huschten, das sanfte Rauschen der Blätter in den Baumkronen, obwohl kein Lüftchen ging. Jeder Quadratzentimeter war voller Leben und stets in Bewegung. Ganz anders als die Betonwelten der Stadtmenschen. Für die Delegierten war der Wald nicht mehr als eine Tapete, Kulisse für den Touristentrampelpfad, mit dem sie sich größtmöglichen Gewinn erhofften.
Die Heldentaten, die Pöhl in diesem Wald in den letzten 19 Jahren vollbracht hatte, nahm keiner von ihnen wahr. Die fein aufeinander abgestimmten Stockwerke. Die sorgsame Ausdünnung, damit neue Bäumchen die Chance bekamen, gen Himmel zu sprießen. Das sanfte Ausholzen der Fichten, die dem letzten Herbststurm zum Opfer gefallen waren. Pöhl nahm nahezu jedes Pflänzchen in seinem Revier bewusst wahr. Jetzt wurden seine Schätzchen den Touristenmassen preisgegeben, die im Frühjahr die Anemonen niedertrampeln würden und den Wald mit ihren Plastikflaschen verseuchten. Ganz zu schweigen von ihren Hunden, die seine Hasen und Füchse jagten.
Nein, Pöhl konnte nicht sagen, dass er glücklich darüber war, dass sein Waldabschnitt an den Hugenotten- und Waldenserpfad angegliedert worden war. Wenn es auch mehr Geld bedeutete. Unmengen Geldes sogar. Aber wie er die Menschheit kannte, würde das gerade mal genügen, den Müll und die Schäden, die die Horden verursachten, zu beseitigen.
Sie waren zurück auf dem Hauptpfad, und Pöhl wartete, bis die Gruppe, die durchs Gebüsch brach wie eine Herde Elefanten, wieder auf dem Weg angekommen war. Endlich konnten sie den Heimweg antreten.
»Was ist das denn?«, rief einer der Sesselpupser, gerade, als sie sich in Bewegung gesetzt hatten. Pöhl rollte mit den Augen. Hörte die dämliche Fragerei niemals auf? Genervt drehte er sich um.
Einer der Schreibtischtheoretiker deutete in die Krone einer circa 100-jährigen Eiche. Pöhl schob den Hut eine Handbreit nach hinten, um den Blick freizugeben. Die Blätter wiesen braune Flecken auf, oben zur Krone hin waren sie bereits vertrocknet und fielen ab. Und das, wo der Wonnemonat Mai gerade erst beendet war.
Pöhl nahm ein heruntergefallenes Blatt vom Boden auf, zerkrümelte es zwischen den Fingern und roch daran. »Das ist ein Blattpilz, völlig harmlos.«
Die Blicke der Delegierten blieben misstrauisch, allerdings dazu bereit, sich beruhigen zu lassen. »Heimwärts, meine Herren«, wies Pöhl die Truppe an und schickte sie voran. Nachdem sie an ihm vorbeigezogen waren, sammelte Pöhl unauffällig einige der infizierten Blätter und steckte sie in eine seiner Jackentaschen. Alle Gelassenheit war von ihm gewichen. Stattdessen fühlte er sich von einer Hitzewelle überflutet und hatte eine Scheißangst.
Hackordnung
Otto blinzelte in die milde Junisonne, die sich in den Scheiben seiner Terrassentür spiegelte. Das sanfte, milchige Licht passte so gar nicht zu dem derben Vorhaben, das er für diesen Nachmittag geplant hatte. Die grob gesägten Klötze aus Espenholz, die ihm Förster Pöhl gestern angeliefert hatte, mussten gehackt und aufgeschichtet werden, damit es über den Sommer trocknen konnte.
Otto griff das erste Scheit, legte es auf den Klotz, setzte die Axt in einem bestimmten Winkel an, konzentrierte sich und schlug zu. Die ersten Versuche gerieten etwas wackelig, immerhin war es gut ein Jahr her, seit er das letzte Holz gemacht hatte. Doch mit dem Hacken war es wie mit dem Fahrrad fahren. Nach wenigen Scheiten war er wieder voll drin und fand schnell zu seinem Rhythmus. Das Hacken geschah nun automatisch. Jedes Mal, wenn ein Stammstück auseinanderbrach, genoss er den harzigen Duft, den das frische Holz verströmte, wenn sich sein glänzendes, wohlriechendes Inneres zeigte. Den Schnittstellen sah man an, dass die Sägekette gut gefeilt war.
Mitten in seine kontemplative Tätigkeit platzte der Ton einer SMS. Otto zog sein Handy aus der Tasche. Der Text, den er auf dem Bildschirm las, beunruhigte ihn augenblicklich. Beate. Schon wieder. Otto hatte gehofft, er könne die Sache im Sande verlaufen lassen. Immerhin waren es nur wenige Nächte gewesen, die sie miteinander geteilt hatten. Aber offensichtlich hatte Beate sich verliebt. Jedenfalls verfolgte sie ihn mit der Hartnäckigkeit einer ambitionierten Tierschützerin, die sich vorgenommen hatte, ihn zu retten. Dabei stand er für Rettungsmaßnahmen gar nicht zur Verfügung. Er war nicht zu retten. Er war verschossen in die kratzbürstigste Frau im Landkreis. Aber was wollte er machen, er konnte nicht anders.
Und die Sache mit der Kukuk entwickelte sich gut. Nachdem Otto herausgefunden hatte, dass sie nicht mit diesem Erich liiert war, wie dieser behauptet hatte, und nachdem sich die Wogen um die tödlichen Unfälle in Lores Garten geglättet hatten, waren sie sich nähergekommen. Und Otto dachte dabei nicht nur an ausgiebige Kaffee- und Kuchennachmittage, sondern auch an eine besondere Nacht, die er in bester Erinnerung hatte und die er so schnell als möglich wiederholen wollte. Dies bedeutete jedoch, die Sache mit Beate möglichst schnell zu Ende zu bringen. Falls überhaupt etwas existiert hatte, das man zu Ende bringen konnte. Jedenfalls musste Otto verhindern, dass ihm diese Sache im Wege stand, wenn es eines Tages darum ging, die Geschichte zwischen ihm und Lore zum Blühen zu bringen.
Er studierte konzentriert die SMS, die sie ihm geschickt hatte und in der sie um ein Treffen bat. ›Treffe dich später im Tierheim‹, antwortete er und steckte das Handy zurück in die Tasche. Er hatte einfach den blöden Verdacht, dass sie im ungünstigsten Moment bei ihm auftauchen konnte und alles ruinierte.
Mit neuer Energie widmete sich Otto wieder seinem Holz. Er konnte sich gut erinnern, wie es damals gewesen war, das erste Mal Holz spalten. Vor zwei Jahren, nachdem er den neuen Ofen eingebaut hatte. Am Anfang hatte er sich angestellt wie eben jemand, der es nicht gewohnt ist, mit den Händen zu arbeiten. Mit ungeschickter Handhabe hatte er das Holz eher püriert als gespalten. Aber er war drangeblieben, und auf einmal hatte sich etwas verändert. Irgendwann begriffen seine Hände, ja sein ganzer Körper, was zu tun war. Das Zusammenspiel von Geschwindigkeit, Rhythmus und Präzision waren weit wichtiger als blinde Kraft. Mit etwas Übung fand er heraus, dass er die Schlaggeschwindigkeit erhöhen konnte, wenn er der Axt kurz vor dem Einschlag einen leichten Schwung nach innen gab. Überhaupt zählte beim Holzhacken in erster Linie die mentale Einstellung. Man konzentrierte sich weniger auf das Scheit als auf den Holzklotz oder die Stelle unter dem Scheit. Dann hieß es, nicht zögern oder zweifeln, sondern zuschlagen. Darin lag der große Reiz beim Holzhacken: Man überließ es seinem Gespür und den Körperkräften.
Das Holz hatte Otto geholfen. Besser als es jede Therapie vermocht hätte. Seine Arme waren stählerner, sein Oberkörper drahtiger geworden. Aber auch mental hatte sich etwas verändert. Das Holz hatte ihm eine archaische, männliche Gelassenheit verliehen, der Kopf wurde durch die Kombination aus Variation und Wiederholung angenehm leer.
Obwohl der Sommer gerade begonnen hatte und mit seinen frohen Farben und Düften pures Leben versprühte, konnte Otto die Heizsaison kaum abwarten. Es war ein unvergleichliches Gefühl, wenn der Ofen die behagliche Wärme abstrahlte und man vor dem Ofen jeden Meter, den man das Holz bewegt hatte, genießen konnte. Holz wärmt zweimal. Einmal beim Holz machen und einmal beim Feuern. Das Verwandeln von Holz in Wärme brachte ihn nicht nur in Kontakt mit seiner männlichen Natur, sondern auch der Natur. Man muss hinaus, wird konfrontiert mit der Kälte. Wieder im Warmen, überkam ihn eine tiefe Zufriedenheit. Bis das Holz im Ofen lag und ihn mit der behaglichen Wärme versorgte, hatte Otto bei einem Festmeter Holz viereinhalb Tonnen bewegt, hatte er einmal ausgerechnet. Einmal den Stamm zum Haus schleppen, auf die Säge hieven, die Stammstücke auf den Hauklotz legen, danach aufstapeln und schließlich im trockenen Zustand zum Ofen transportieren. Und wie viel angenehmer die Wärme des Holzes war im Vergleich zu schnöder Heizungswärme. Feuerwärme, so stellte er an Winterabenden fest, war wie Sonnenwärme, die sich auf der Haut ausbreitet, um dann in jeden Körperteil vorzudringen. Holz wärmt Körper und Seele. Es war, als finge ein Baum die Sonnenenergie vieler Jahre ein, um sie dann zusammen mit der Ruhe und der Behaglichkeit eines Waldes abzugeben. Otto begutachtete jedes Scheit, bevor er es auf dem Holzklotz platzierte. Die Klinge soll so wenige Jahresringe wie möglich kreuzen, sonst hat man gegen den natürlichen Verlauf der Holzfasern anzukämpfen. Gut ein Drittel hatte er geschafft. Er freute sich bereits auf das Stapeln, auch das war eine Kunst für sich.
Jeder Stapel trägt den Stempel des Erbauers, so sagten die kanadischen Holzfäller. Die Kunst bestand darin, das Holz dicht genug zu stapeln, dass es fest war, aber weit genug, dass sich kein Kondenswasser und damit Schimmel und Pilze in den Zwischenräumen bildeten. Eine Maus kann noch durch die Scheite passen, wenn aber die Katze hinterherspringen kann, ist es zu weit gestapelt.
Plötzlich flog das Scheit, das er gerade vor sich auf dem Klotz hatte und entzweischlagen wollte, in einem Riesenbogen durch die Luft. Otto musste sich wegducken, damit ihn das Holzstück nicht auf den Kopf traf. Er las das versprengte Holz auf und betrachtete es. Schon beim Schlagen mit der Axt hatte er bemerkt, dass das Holz ganz plötzlich keinerlei Widerstand mehr bot. Nun sah er, dass das Holz an manchen Stellen porös war wie Löschpapier. Er drückte mit dem Daumen in die weiche Stelle und hatte einen bräunlichen Schleim am Finger.
Otto ließ das Scheit fallen und wischte sich die Hand ab. Er untersuchte die anderen Holzklötze und fand auch auf ihnen die rätselhaften Flecken. Waren das Schädlinge? Oder eine merkwürdige Baumkrankheit? Otto stapelte die Holzklötze notdürftig an der Häuserwand und ging dann ins Haus, um sich zu duschen.
Brandbeschleuniger
Stefan Weißgerber schob ein Minzbonbon in den Mund und lockerte seine Krawatte. Das ungute Gefühl, das er mit sich herumtrug, seit er die erkrankte Stelle an dem Baum bei der Forstbegehung entdeckt hatte, manifestierte sich in seinem Mund als übler Geschmack.
Vor ihm auf dem Tisch befanden sich durchsichtige Tüten, in denen sich unappetitlich aussehende Zweige befanden, eine Bestätigung seiner Befürchtung, dass es schlimmer war, als dieser Waldschrat bei der Begehung zugegeben hatte. Weißgerber hatte genau genommen immer eine ungute Ahnung gehabt, was diese Hugenottensache anging. Schon damals, als sie die Höfe verkauft hatten und erst recht, als er zum Pressereferenten der Kommission berufen worden war. Die ganze Zeit war er von einer üblen Vorahnung besessen gewesen, die sich nun bestätigte.
Die Luft im Sitzungssaal des Kreisamts konnte man schneiden, der Geruch abgestandener Behörde mischte sich mit dem von billigem Rasierwasser. Forstamtsleiter Kesselbeck, sein Revierleiter Pöhl und die beiden Kreistagsabgeordneten Schaller und Franz schnatterten durcheinander wie wild gewordene Teichenten. Weißgerber hätte es vorgezogen, das Problem erst einmal in kleiner Runde zu diskutieren. Doch der Revierleiter hatte umgehend seinen Vorgesetzten Kesselbeck informiert, und dieser hatte zwei der Kreistagsabgeordneten eingeschaltet, ebenfalls Mitglieder der Hugenotten-Kommission und anwesend bei der Waldbegehung, die sie vor drei Tagen durchgeführt hatten.
Die Eröffnung des neu ausgebauten Streckenabschnittes zwischen Rohrbach und Wembach-Hahn stand bevor, in zwei Wochen wurde mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet, in Anwesenheit der Bundesministerin und einer Europaabgeordneten. Wenn sie es bis dahin nicht hinbekamen, eine gepflegte Naturlandschaft zu präsentieren, konnten sie die Fördersumme streichen.
»Meine Herren!« Weißgerber klopfte auf den Tisch. »Lassen Sie uns erst mal die Fakten sammeln, bevor wir alles Weitere diskutieren. Kesselbeck«, Weißgerber wandte sich an den Forstamtsleiter, »erklären Sie mir und den anderen Kollegen, worum es hier eigentlich geht.«
Kesselbeck zwinkerte nervös und wurde rot. Er hatte das Gesicht einer Bulldogge und das Gemüt eines Rehs, was den Umgang mit ihm zu einem irritierenden Erlebnis machte. So verlor Weißgerber nach wenigen stockenden, unzusammenhängend formulierten Ausführungen des Forstamtsleiters den Faden. Als Kesselbeck das Wort schließlich an Pöhl, den Revierleiter, weitergab, fiel Weißgerber das Herz gänzlich in die Hose. Der Waldschrat mit Filzhut und abgenutzter Wachsjacke hatte ihn schon bei der Begehung zur Weißglut getrieben. Als sich der Revierleiter erhob, stieß er ein Glas Wasser um. Peinlich berührt zog er aus der Hosentasche ein schmuddeliges Tuch, mit dem er versuchte aufzuwischen. Das Glas fiel dabei auf den Boden und zerschellte. Nun kniete der Kerl unter dem Tisch.