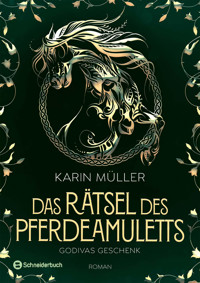12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schneiderbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Nordstern
- Sprache: Deutsch
Die14jährige Erla wandert im Sommer 1949 mit ihrer Mutter nach Island aus. Sie hat es schon in Deutschland nie leicht gehabt, weil sie Dinge sieht, die andere nicht wahrnehmen. Doch in dem fremden, neuen Land wird alles nur noch schwerer. Erla ist fassungslos über den dünnen Grat aus Respekt und abergläubischer Angst der Isländer vor dem Unsichtbaren Volk. Die Bauernfamilie, auf deren Hof sie arbeiten soll, treibt ein undurchsichtiges Spiel und schikaniert sie. Durch ein Missverständnis wird ihre Mutter weit entfernt untergebracht und selbst die Natur scheint sich gegen sie verschworen zu haben. Einzig die Pferde sind Erla Trost und Zuflucht. Mit ihnen erlebt sie ihre schönsten Momente, allen voran mit der Schimmelstute Drifa. Und da ist Flóki, der zu den Verborgenen gehört, und sie mit einer alten Kräuterfrau bekannt machen möchte. Erla gerät zusehends zwischen die Fronten - und dann überschlagen sich die Ereignisse.
»Neues Lesefutter für alle Pferdefans ab zwölf Jahre.«Neue Presse Hannover, 01.02.2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2020 Schneiderbuch in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Dieses Werk wurde vermittelt durch Agentur Brauer (Agentin: Ulrike Schuldes).
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783505143571
www.schneiderbuch.de Facebook: facebook.de/schneiderbuch Instagram: @schneiderbuchverlag
Prolog
Alles hier ist beseelt. Jeder Stein, jeder Strauch.
Die Berge atmen. Feuer und Eis.
Wo die Haut der Erde so dünn ist wie hier, da sind viele Grenzen fließend. Der Wind trägt ihre Lieder mit sich fort.
Die Húldu haben mich gelehrt, ihnen zu lauschen, sie zu verstehen. Aber was nützt uns das jetzt? Nun bin ich die Einzige, die diese Melodien noch spürt.
In der Tiefe schiebt sich träge ein Lavastrom voran.
Wärme und Schwefel steigen zu mir auf.
Da lauert etwas in der Schwärze. Ein rot glühendes Lachen will nach meiner Seele greifen. Ich werde fortgerissen in einem tosenden Strudel.
Ein Feuersturm. Salzig und trocken.
Heiß.
Kalt.
Dann ist da nichts.
Dunkelheit umhüllt mich. Ich sehe die Zukunft. Eine dunkle Zeit liegt vor uns.
Lange.
Viel zu lange.
Weil alles doppelt ist und auch wieder nicht.
Ich zittere. Friere.
Alles an mir schmerzt.
Ich weiß, wenn ich jetzt aufgebe, ist alles verloren. Ich muss meiner Bestimmung folgen. Den Schicksalsfäden, die die Nornen für uns weben. Kämpfen.
Und dann sehe ich sie, wie durch Nebel. Eine wird kommen, in der diese Lieder wieder singen werden.
Wenn ich eine sehr alte Frau bin. Noch so lange hin.
Aber es ist noch nicht verloren. Ich darf nicht aufgeben, nicht der Verzweiflung nachgeben, dem Kummer und der Schuld.
Mein eigenes Schluchzen weckt mich auf.
Und ich kann mich erst beruhigen, wenn ich den Stein zwischen meinen Fingern fühle. Er schimmert milchig grün.
Als hätte er ein geheimnisvolles Licht in seinem Inneren.
Ein Licht, das mich zu ihr führt. Und zu ihm.
Durch Zeit und Raum.
Durch den Nordsturm.
Durch die Nordnacht.
Wie ein Nordstern, der die Richtung vorgibt.
Ein Funken Hoffnung.
Der am Ende ein Feuer entfacht.
Sie rufen mich Jorúnn. Weltenwanderin. Weltenwandlerin.
Aber ich trage noch einen anderen Namen. Ich kann mich erinnern.
Erla. Meine Mutter rief mich Erla.
Dies ist meine Geschichte.
1. Island ahoi!
»Erla! Komm von der Reling weg! Das ist viel zu gefährlich. Du holst dir den Tod, Kind.« Um nicht umgeweht zu werden, klammert meine Mutter sich mit beiden Händen an der braun lackierten Holztür fest, die ins Innere des Schiffes führt. Sie ist ein bisschen bleich um die Nase, aber ihre Wangen glänzen rosig. Das macht die Kälte. Wir sind viel zu dünn angezogen für dieses Wetter, dabei tragen wir schon die wärmsten Sachen, die wir mitgenommen haben – übereinander.
»Nur noch einen Augenblick, Mutsch! Ich kann das Land schon sehen! Guck doch mal!« Ich kann meine Finger kaum noch spüren, aber das ist mir völlig egal. Schaumkronen tanzen über die Wellen. Und da vorn, in der Ferne, da sieht es so aus, als ob schroffe Felsen mit Schneehauben aus dem Meer wachsen. Ich kneife die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Das muss es sein. Island! Und gleich dahinter kommt der Nordpol, glaube ich.
Der Wind treibt mir Tränen ins Gesicht und wischt sie mit meinen eigenen rotblonden Haarsträhnen, die er mir aus der Wollmütze gestohlen hat, wieder fort. Die Fähre hebt und senkt sich, als ob wir auf dem Rücken eines Meeresungeheuers reiten würden. Jedes Mal, wenn wir in ein Tal fallen, plumpst mein Magen ein Stück mit, und wenn wir auf die nächste Woge hinaufgetragen werden, habe ich das Gefühl, ich könnte spielerisch die Möwen erreichen, die über uns kreischen. Ich fühle mich frei, so frei und leicht! Wenn ich den dicken, glatten Holm der Reling loslasse, könnte ich abheben und mit ihnen fliegen!
Neben mir übergibt sich jemand in die See. Ich habe keine Zeit für Übelkeit. Ich bin viel zu aufgeregt. Wir sind unterwegs in ein neues Leben. Mutsch hat versprochen, dass wir nie wieder Hunger haben werden. Keine zerbombten Kellerwohnungen mehr. Keine Kohlen klauen oder heimlich Rüben aus den Äckern ziehen müssen, damit wir etwas zu essen haben. Nie mehr vor den Hunden der Bauern wegrennen, draußen auf dem Land vor Lübeck, wo ich geboren wurde, vier Jahre bevor Hitler diesen wahnsinnigen Krieg begonnen hat.
Vier Jahre ist der Zweite Weltkrieg nun vorbei.
Ich bin vierzehn Jahre alt, und ich kann anpacken und hart arbeiten. Das ist der Grund, weswegen Herr Hrafn meiner Mutsch erlaubt hat, mich mitzubringen. Nicht, dass sie ohne mich gefahren wäre, aber andere Mütter mussten das.
Neben Mutsch in der Schlange vor dem isländischen Konsulat stand eine Frau, die ganz verzweifelt war, weil sie selbst auf Island keine unnützen Esser haben wollen in ihren Bauernhöfen. Sie musste ihren kleinen Sohn bei den Großeltern zurücklassen, sonst hätte sie die Stelle nicht bekommen. In einem Jahr will sie ihn nachholen, hat sie Mutsch erzählt. Oder wieder zurück nach Deutschland gehen, wenn sie bis dahin genug Geld gespart hat. Denn die Isländer zahlen gut. Sie müssen wirklich dringend Arbeitskräfte auf dem Land brauchen, wenn sie sie sogar mit dem Dampfschiff aus Deutschland holen.
Mutsch und ich wollen bleiben. Das wissen wir jetzt schon. Wohin sollen wir auch zurück? Wir haben keine Großeltern mehr. Das war keine Option für uns. Ich bin Halbwaise. Mein Vater ist tot, er ist bei einem Bombenangriff gestorben. Schon 1939. Zehn Jahre ist das her, ich kann mich kaum an sein Gesicht erinnern. Ich war noch so klein, sagt Mutsch, das sei normal, wir müssten nach vorne schauen.
»Auf Island gibt es Pferde«, sagte sie, als sie mir fünf Wochen zuvor von ihrem tollkühnen Plan erzählte. Sie hielt einen Zeitungsartikel aus den Lübecker Nachrichten in der Hand, und ihre Augen glänzten, trotz der dunklen Ringe darunter, zum ersten Mal seit vielen Monaten. »Der isländische Bauernverband sucht Arbeitskräfte, Erlakindchen, stell dir vor. Ledig, stark und gesund – als Landhelferinnen. Das kriegen wir schon hin, du und ich. Das schaffen wir auch noch.«
»Island?«, habe ich gefragt. »Wo liegt das? In der Sowjetischen Besatzungszone?«
»Dummchen«, hat Mutsch gelacht und mich herumgewirbelt. »Es ist weit weg von der Bundesrepublik und den Russen. Es ist ein Land auf einer Insel aus Eis, ganz oben im Norden. Vielleicht sehen wir Eskimos. Oder Pinguine?! Sie zahlen unglaublich gut, die isländischen Bauern, sogar die Überfahrt! Und wenn da so viel Schnee liegt, wie sie erzählt haben, dann kann das mit der Landwirtschaft auch nicht so schwer sein, oder? Ich habe oft beim Melken zugesehen, damals, zu Hause. Das sah ganz leicht aus. Wir geben einfach an, dass wir das können und Erfahrung haben. Ich laufe gleich morgen aufs Amt und beantrage unser Visum, und polizeiliche Führungszeugnisse brauchen wir auch und …«
Ich hörte gar nicht mehr richtig zu, ich suchte gleich nach meinem Koffer. Mutsch ist in Ostpreußen aufgewachsen, auf einem Gut. Da gab es nicht nur viele Kühe, sondern auch Trakehner, große, stolze Pferde. »Solche werden die Wikinger wohl auch haben«, sagte Mutsch. »Nur die Großen und Starken können in solch einem Land überleben.«
Aber wir hoffentlich auch.
Und jetzt stehen wir an Bord dieses Schiffes, der »Esja«, zusammen mit über zweihundert anderen jungen Frauen und Mädchen, die sich auf die Zeitungsannonce beworben haben und genommen wurden.
Ich habe mit Pferden noch nicht viel zu tun gehabt. Als ich klein war, gab es in unserer Straße ein Gespann mit zwei Kaltblütern, die haben die Malzsäcke in die Brauerei gezogen. Sie kamen fast jeden Tag an unserer Wohnung vorbei. Aber eines Morgens waren sie weg, zum Kriegsdienst eingezogen. Genau wie Papa. Und genau wie er kamen sie nie mehr zurück.
Die Frau neben mir stöhnt. Sie ist ganz grün im Gesicht. Sie sagt irgendwas zu mir, aber wegen des Sturms kann ich sie nicht verstehen. Also hangele ich mich näher zu ihr heran. Die Reling darf ich keinen Augenblick loslassen, sonst bläst der Wind mich um. Aber das ist nicht so einfach, mit den steif gefrorenen Fingern. Und es geht immer noch auf und ab über die Wellenkämme.
»Hast du ein Taschentuch?«, brüllt die Frau gegen das Tosen an.
Ich nicke und schlinge meinen Arm um ein dickes Schiffstau, damit ich eine Hand frei habe, um in meiner Jackentasche danach zu wühlen. Ich habe es ganz tief hineingestopft, damit ich es bloß nicht verliere, weil ich nur noch das eine habe. Mutsch hat es an den Ecken bunt gesäumt, und da, wo der Stoff inzwischen so dünn war, dass er gerissen ist, hat sie es gestopft und hübsch mit Blüten bestickt. Der Wind reißt mir das Baumwolltüchlein fast aus der Hand, aber die seekranke Frau nimmt es mir geschickt ab. Sie wischt sich damit über den Mund, doch dann muss sie schon wieder spucken und beugt sich tief über die Bande, als ob sie sich vor der schäumenden See verneigt.
Ich drehe mich rücksichtsvoll weg und erspähe Mutsch.
»Erla! Komm jetzt endlich!«, ruft sie erschöpft. Meine Mutter fällt fast um, als sie die Holztür mit dem runden Bullauge mit einer Hand loslässt, um mir den Arm entgegenzustrecken. Hat sie etwa die ganze Zeit hier draußen gestanden? Ihre Lippen sind blau gefroren, ihre nackten Beine unterm Rock krebsrot. Dabei ist Sommer! Wir haben den 9. Juni 1949, und in Hamburg war es warm und sonnig, als wir vor vier Tagen an Bord gingen.
Ich will mein Taschentuch wiederhaben, deshalb zögere ich einen Augenblick. Aber die Frau sieht sehr elend aus, also lasse ich es ihr, und Mutsch zieht mich an meinem Ärmel zurück in den Windschatten und ins Innere des Schiffs.
Drin werden wir herumgeworfen wie die Murmeln in einem Karton. Es riecht hier noch viel unangenehmer nach Erbrochenem, nach Kohle und nach Öl. Ich wäre lieber wieder an Deck, weil außer uns fast alle seekrank sind. Aber Mutsch will, dass ich mich aufwärme. Meine Finger stechen und brennen, als das Blut wieder auftaut. Ich möchte an Deck gehen und als Erste das Land erblicken.
»Wie lange dauert es noch, bis wir im Hafen sind?«, will ich wissen.
»Heute Abend werden wir da sein, haben sie gesagt. Also gedulde dich, junge Dame.«
Ich kichere, weil Mutsch mich junge Dame nennt. Dann schüttele ich den Kopf. »Nein, das kann nicht sein. Es ist ja noch so hell, und ich habe doch schon einen Streifen Land gesehen. Es kann nicht mehr lang bis zum Dunkelwerden dauern.«
Neben mir lacht ein hünenhafter junger Mann. So wie ihn stelle ich mir den Riesen Goliath vor. Mit einem dichten Bart und Händen wie Bratpfannen. »Es ist Sommer«, sagt er und grinst Mutsch und mich frech von der Seite an. »Da geht die Sonne bei uns nicht unter. Höchstens ein bisschen. Damit man gut sieht, wen man küsst.« Er schenkt mir ein Stückchen Brot. Mutschs Hand zuckt. Beinahe hätte sie ihm eine Ohrfeige gegeben. Das sehe ich genau. Aber das kann sie schlecht tun: Der Mann ist Isländer, und das gehört sich sicher noch weniger, wenn man fremd ist, dem Gastgeber gleich eine zu scheuern. »Wir müssen uns an die Sitten hier noch gewöhnen«, schärft sie mir leise ein und zieht mich am Kragen ein Stück fort von Goliath. Das Brot darf ich behalten.
Plötzlich kommt Bewegung in die Menschenmenge. Die Mischung aus Schweröl, Schweiß und anderen schlechten Gerüchen wird noch einmal intensiver. Irgendwo weint ein kleines Kind. Das Schiff schaukelt jetzt quer zu den Wellen. Das lässt auch Mutsch und mich ein bisschen gegen ein flaues Gefühl im Magen ankämpfen.
»Frische Luft?«, schlage ich vor. Diesmal hat sie nichts dagegen, aber sie zieht mich noch einmal zurück. »Wir nehmen unsere Sachen gleich mit.« Das ist keine Feststellung, sondern eine Aufforderung.
Viel besitzen wir nicht. Jede von uns hat ein Köfferchen und einen Leinensack. »Ist das wirklich schlau?«, frage ich trotzdem. »Bei dem Seegang?« Mutsch nickt. Sie zeigt aus dem Bullauge.
Ich quietsche begeistert. »Land! Ganz viel davon! Ich hatte recht. Wir sind gleich da! Gleich landen wir in Island! Da draußen wartet unser neues Leben, ist es nicht so?«
Mutsch lächelt mich müde, aber vorfreudig an. »Ja, Kindchen. Das ist wohl so. Lass dich kämmen. Wir wollen einen guten Eindruck machen. Und dann lass uns staunen gehen.«
Als ich hinausstürmen will, hält sie mich noch einmal zurück. Eindringlich sieht sie mich an. »Erla. Die … Dinge, die du manchmal siehst …« Sie räuspert sich und sieht sich um, ob uns auch niemand zuhört. »Diese Flausen behalten wir für uns, auch hier in diesem neuen Land, abgemacht?«
Ich nicke eilig. Ich will raus. Ich sehe keine Dinge, aber das habe ich Mutsch noch nie begreiflich machen können. Manchmal weiß ich, was geschehen wird. Ich weiß es einfach. Manchmal sehe ich Menschen und Tiere, die andere nicht wahrnehmen können – oder andere Wesen. Diesen Unsinn habe ich von Papa, sagt Mutsch. Im sogenannten Dritten Reich war es gefährlich, solche Sachen zu erzählen. Die Nazis hätten mich mitgenommen, sagt sie, und dass ich ihr mit diesen Flausen graue Haare gemacht hätte, seit ich klein war.
Aber eine alte Frau in den Trümmern hat mir einmal erzählt, das wären keine Flausen: Man nennt das eine Gabe, und ich hätte das Zweite Gesicht. Mutsch hat die alte Frau nicht gesehen, wie sie dasaß und so nett mit mir gesprochen hat. Also habe ich sie ihr beschrieben. Sie wurde kalkweiß im Gesicht und zog mich damals schnell weiter. Sie sagt Flausen dazu und will davon nichts wissen, und eine Backpfeife bekam ich auch. Die einzige in meinem Leben. Ich bin es also gewöhnt, allein zu sein.
Es dauert noch bis zum nächsten Tag, bis wir endlich von Bord dürfen. Zuerst müssen wir alle gründlich von einem Arzt und seinen Helferinnen untersucht werden. Mir dauert das viel zu lange. Als ich fertig bin, renne ich wieder nach draußen, alle Treppen hinauf bis zum obersten Deck, das ich erreichen kann, und bestaune die Hafenstadt aus der Höhe: kleine bunte Häuser, dahinter Berge und überall Wasser, aber kein einziger Baum. Unser Ankerplatz liegt weit weg vom Ufer, im Außenhafen.
Ein paar junge Männer sind zu uns herübergerudert und winken und lachen und rufen zu uns herauf. Ich und die anderen winken hinunter. »Wie Eskimos sehen die aber nicht aus!«, kichert jemand neben mir. Da stehen drei Mädchen, nur ein paar Jahre älter als ich. Tuschelnd rempeln sie sich an, zeigen auf die Jungs und albern herum. Als die einheimischen Jugendlichen abdrehen und die »Esja« umrunden, kreischen sie ihnen enttäuscht hinterher. Es dauert aber nicht lang, und die Boote wenden. Die Jungs kommen zurück, johlen und rufen und trinken ganz offensichtlich dabei reichlich Alkohol. Einer hat eine Gitarre und schmettert schmachtende Lieder. Die anderen werfen sogar Münzen zu uns hinauf. Was soll das denn? Das wird mir zu blöd. Als ich mich umdrehe, um hineinzugehen, sehe ich knapp über den Bergen am Horizont ein Licht tanzen. Nein, es tanzt nicht. Es steht da ganz ruhig. Der Abendstern. Man sieht ihn, obwohl es noch immer nicht dunkel ist. Für einen Moment werde ich ganz ruhig. Das Gelächter und Gejohle um mich herum verblasst zu einer summenden, weit entfernten Geräuschkulisse, wie ein Bienenstock ganz hinten im Garten.
»Hallo, Nordstern«, sage ich leise, und ich bilde mir ein, dass er blinkt, einmal lang aufleuchtet, wie um mir zu antworten. Wie das Licht eines Leuchtturms. Er wird mich führen, was immer auch geschieht. Ich weiß es einfach, und mich erfüllt tiefer Frieden.
Unbewusst hatte ich die Luft angehalten, jetzt atme ich tief aus und nehme ganz deutlich wieder meinen Herzschlag wahr, genau wie das unbeeindruckte Lärmen, Rempeln und Schubsen neben mir und um mich herum. Sie beachten mich nicht. Sie haben es nicht gespürt. Aber auf mich wartet etwas da draußen. Oder jemand. Eine Macht.
Ich gehe wieder hinein, meine Mutter suchen. Hoffentlich ist sie endlich fertig mit der Untersuchung. Ich will an Land. Warum müssen wir noch so lange warten?
Den Geruch und die Geräusche im Hafen werde ich nie vergessen. Als wir am nächsten Morgen endlich wieder festen Boden unter die Füße bekommen, riecht es nach Algen und Fisch und Feuer. Möwen kreischen uns einen Willkommensgruß. Ich sehe Fischerboote, Netze, Reusen, ein Fuhrwerk mit zwei kleinen, puscheligen Ponys, daneben eine riesige amerikanische Limousine. Es gibt viele schicke Autos hier und Männer mit Wollmützen und dicken Strickpullovern – aber immer noch keine Eskimos. Die Menschen sehen alle genauso aus wie wir – bis auf ein paar Jugendliche, die weiter weg zwischen ein paar Fässern warten und sich ducken, als ich ihnen zuwinke. Das sind nicht die von gestern. Sie tragen lustige Trachten, und anscheinend gehören ihnen die vier Ponys, die ich mit einem weiteren Burschen ein Stück weiter weg hinter großen Kisten mit Eis erspähe.
Mutsch zieht mich durchs Gedrängel, vorbei an Zeitungsreportern mit Kameras und Journalisten mit Mikrofonen. Es gibt eine Art Empfangskomitee für uns. Musik spielt, Kinder schwenken blaue Fahnen mit einem rotweißen Kreuz, ich nehme an, das ist die isländische Flagge. Alle reden auf uns ein. Alle rufen durcheinander. Jemand legt mir einen kratzigen Wollpullover um die Schultern. Mutsch bekommt von einer älteren Frau mit Tränen in den Augen einen dicken Schal geschenkt. Die Frau hat eine große Tüte mit Kleidung dabei und schenkt jedem daraus etwas im Vorübergehen.
Ein großer Mann im Anzug hat eine Liste und versucht durch all den Lärm, uns einzuteilen. Und alle starren uns an, als hätten sie noch nie so viele Frauen auf einmal gesehen. Das habe ich auch nicht. Ich strecke meine Nase in den grauen Himmel und muss lachen, weil es so schön ist, wieder die Erde zu spüren, auch wenn das Schiffschaukeln in mir noch immer anhält. Einer der Jungen rempelt mich an und versetzt mir einen kleinen Stromstoß.
»Entschuldige«, sage ich, und er reißt erschrocken die Augen auf. Dann grinst er, und in seinen sommersprossigen Wangen entstehen tiefe Grübchen.
Hast du Schokolade?, will er wissen.
Ich bin mir nicht sicher, ob er die Lippen bewegt hat. Bedächtig schüttele ich den Kopf. Niemand sonst scheint Notiz von ihm zu nehmen, und das Kribbeln in meinem Unterarm, an der Stelle, wo wir aneinandergestoßen sind, lässt nur sehr langsam nach. Also vermute ich, dass nur ich ihn sehe. Ich staune. »Hier oben gibt es euch auch?«, frage ich leise.
Mutsch soll mich nicht hören, sonst bekomme ich wieder Ärger, weil ich mit der Luft rede und die Leute deshalb einen falschen Eindruck von mir kriegen. »Ich habe ein Stück Brot geschenkt bekommen. Möchtest du die Hälfte haben?« Vorsichtig hole ich den Kanten aus meiner Jackentasche.
Der Junge streckt mir die Zunge heraus. Ich schneide ihm ebenfalls eine Grimasse, und er zieht ab. Seine Freunde mit den Ponys weiter hinten johlen.
Ich beschließe, ihn zu vergessen. Es macht mir überhaupt nichts aus, dass es jetzt anfängt zu regnen und kalt ist. So ist das wohl, wenn man am Nordpol wohnen will, also besser, wir gewöhnen uns gleich dran. Mutsch zieht mich mit sich fort, als sie unsere Namen hört. Ich verstehe kein Wort. Das Stimmengewirr in der fremden Sprache hört sich an wie Vogelzwitschern, das kleine Heft mit isländischen Floskeln, das wir an Bord bekommen haben, nützt mir überhaupt nichts. Aber ich will nicht gleich aufgeben.
Alle zusammen werden wir zuerst in eine Baracke geleitet, die man zu einer Art provisorischem Hotel für uns umfunktioniert hat. Hier werden wir also unsere erste Nacht auf Island verbringen. Meine Mutsch und ich strahlen uns an. Geschenke bekommen wir auch noch, die Isländer haben für uns Kleider gesammelt, die jetzt verteilt werden. Neben dem Pullover ergattere ich noch einen warmen Wollrock, Strümpfe und eine Strickjacke. Es ist wie Weihnachten. Und es gibt so viel zu essen! Suppe und Fisch, Eintopf und Sülze, Kartoffeln, Kohl und sauren Joghurt, den man hier oben Skyr nennt, mit frischen Beeren. Herrlich! Und dann sehen wir uns die Stadt an. Hier sind noch mehr von diesen großen amerikanischen Autos unterwegs. Die jungen Leute tanzen und feiern und reißen uns einfach mit. Mutsch und ich landen in einem Jazzclub. Ich finde es furchtbar laut und weiß gar nicht, ob ich hier sein dürfte. Aber Mutsch sagt nichts, also bin ich auch still. Sie stupst mich an und beginnt, fröhlich mit dem Fuß zu wippen, und dann wird sie auch schon zum Tanzen aufgefordert von einem hochgewachsenen Typen mit dunkelrotem Vollbart. Sie lacht und lässt sich von ihm herumwirbeln, und ich bleibe sitzen und sehe staunend zu, während ich Cola mit einem Strohhalm trinke. So ausgelassen habe ich meine Mutter noch nie gesehen!
Als mir jemand von hinten auf die Schulter tippt, weil er mit mir tanzen möchte, verschlucke ich mich vor Schreck an meinem Getränk. Ich muss niesen und husten und kann nicht sprechen. Also schüttele ich heftig den Kopf. Ich tanze doch nicht! Mit einem wildfremden Jungen noch dazu!
Am Abend, als wir in unser Hotel zurückkehren, kommen uns die drei kichernden jungen Frauen entgegen, die schon an Deck mit den Männern im Boot geflirtet hatten – jetzt gehen sie Arm in Arm mit ihnen. Staunend gaffe ich hinterher, aber Mutsch zieht mich weiter.
Mir fallen im Gehen die Augen zu, obwohl es immer noch hell ist. So hell, wie ein Regentag im Sommer eben sein kann, wenn es eigentlich schon stockfinstere Nacht sein müsste.
Es fällt mir schwer, zur Ruhe zu kommen. Zum einen wegen des Lichts und der Geräusche um uns herum, Murmeln, Kichern und Knarzen, zum anderen habe ich das Gefühl, als würde sich immer noch der Boden bewegen.
Genervt wickele ich mir irgendwann den kratzigen Pulloverärmel um den Kopf. Dann geht es, und das Schwanken in meinem Kopf wiegt mich in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Tag brechen wir endlich auf.
Mutsch versucht es auf Englisch mit dem breitschultrigen Kerl, der uns zu einem kleinen Fischerboot schiebt und unsere Koffer trägt. Ein weiterer Mann und vier junge Frauen begleiten uns. Ich glaube, einer von ihnen hatte ich mein Taschentuch geliehen.
»Hrafn«, sagt meine Mutter verzweifelt, versucht einen Blick auf seine Liste zu erhaschen und ergänzt gestenreich mit vielen Pausen in ihrem gebrochenen Englisch: »We. Must. To Hrafn.« Den Namen hat sie mir auch eingetrichtert. Das ist unser neuer Arbeitgeber, und dieser hier heißt nicht so!
»Rhapp«, grunzt der Mann und schlägt sich auf die Brust wie ein Gorilla. »Rhapp.« Er zeigt auf das Boot und bedeutet uns einzusteigen. Aber meine Mutter will nicht. Sie faltet den Brief vom isländischen Konsulat auseinander und hält ihn dem Mann unter die Nase.
»Was ist denn, Mutsch?«
»Himmel, der Kerl versteht mich nicht. Wir haben bereits einen Vertrag mit Herrn Hrafn. Wir können nicht mit ihm gehen!«
Der Isländer lacht dröhnend und zeigt von dem Brief auf sich. »Rhapp!«, sagt er und tippt sich auf die Brust.
»Mutsch, ich glaube, er ist der Herr Hrafn.« Ich lächle unseren neuen Dienstherrn schüchtern an. »Wir haben es nur nicht richtig ausgesprochen.«
»Rhapp«, nickt der Isländer bestätigend.
»Rhapp«, wiederholt Mutsch und lässt die Schultern fallen, als sie ergeben ins Boot klettert. »Wieso können wir nicht mit dem Milchwagen fahren, mit dem Auto oder von mir aus mit dem Flugzeug, wie die anderen? Der Himmel steh uns bei.«
Die Mähnen der vier Islandpferdebauschten sich im Wind. Das stetigeRauschen der Wellen unddas Trommeln ihrer Hufe auf dem nassenSand verschmolz zueiner wilden Musik in Flókis Ohren. Eigentlich war er zumSchafehüten eingeteilt. Aber in Reykjavík legte heute ein Schiffan. Eins von den ganz großen, deren Dampfwolken man schonvon weit draußen auf dem Meer sah. Er konnte nichtanders. Er musste sich seinen Freunden anschließen und in dieStadt reiten, an denHafen, auch wenn es einen halbenTag dauerte bis dorthin. Sie würdenvorsichtig sein. Außerdem, wersollte sie schon sehen? Das war schonlange nicht mehrvorgekommen. Und sie hatten Kadlin für ihr Abenteuer gewonnen.
DieSchwester seines Freundes Eldar ging bei der alten Jorúnn indie Lehre und konnte die Zeit beugen. Sie hatte esden Jungen versprochen, wenn sie ihr dafür Schokolade mitbrachten. Kadlinhatte eineSchwäche für Süßes. Und Eldar war vernarrt inKadlin, genau wie Torger und sein kleiner Bruder Einarr. Dasmit der Schokolade würde also kein Problem sein. Und dasmit den Schafen auch nicht: Flóki hatte Einarr dazu überredenkönnen, für ihn aufzupassen. Der Kleine hatte sich wie einSchneekönig über die verantwortungsvolle Aufgabe gefreut, die ihm die Großenübertragen hatten. Flóki lächelte. Er würde ihm auch etwas Schokolademitbringen. Oder irgendetwas anderes von den Menschen. Die waren sooolangsam in ihren Reaktionen und ihrer Wahrnehmung, sie würden esnicht einmal merken, wenn sie ihnen im Laufen die Schuhemopsen würden.
Sóley kam an seine Seite geritten und grinsteihn an. »Was trödelst du so, Flóki?«, neckte sie ihn. »Ist dein Pferd schon müde?«
»Selbst im Schlaf wären wirschneller als ihr«, behauptete er lachendund flüsterte seiner Stuteetwas ins Ohr. Brúna, die Braune hob den Kopfund tölteteso schnell davon, dass Sóleys Schecke in Galopp fiel, umdas Tempo zu halten. Sie setzten sich mühelos an dieSpitze ihrer kleinen Formation.
Oben auf der Klippe hob Kadlindie Arme. Flóki sah sich nach den anderen um. Dannwinkte er zu ihr hinauf und nickte.
Einen Wimpernschlag spätersahen sie bereits die Rauchwolken ausden Schornsteinen der Hafenstadtwie Finger in den grauen Abendhimmel ragen.
Sie baten diePferde, zusammen mit Torger hinter den großen Eiskisten der Fischerauf sie zu warten. Die anderen schlichen langsamnäher andie Menschengruppe am Hafen heran. Eldar und Sóley kicherten, alssie die seltsamen Kleider der Neuankömmlinge sahen, diedas Dampfschiffausspuckte. Aber alle staunten. So viele Frauen undMädchen, kaumMänner darunter, und alle sahen ziemlich ausgemergelt, müde und bleichaus. Was wollten die hier?
»Sollten wir dem Rat davon erzählen?«, wisperte Eldar.
»Die wissen sicher schon lange Bescheid«, flüsterte Sóley zurück.»Aber schaden kann es nicht.«
»Dann müssen wirzugeben, dass wir hier waren«, gab Flóki zu bedenken. »Wasist jetzt mit der Schokolade?«
»Wer fragt, der holt«, kicherte Sóley. »Oder traust du dich nicht?«
Statt einer Antwort rannteFlóki los. Unter den Fremden war ein Mädchen mit rotblondenZöpfen, die unter einer dünnen blauen Mütze hervorlugten. Sie sahdie ganze Zeit neugierig in ihre Richtung.Vielleicht war sieeine von ihnen? Aber wie sollte sich eine Húldu anBord der»Esja«verirren?
Er würde es herausfinden.
2. Fliegende Pinguine und blaue Mützen
Das Fischerboot tuckert einschläfernd vor sich hin. Herr Hrafn steuert es dicht an der Küste entlang. Mit Händen und Füßen gibt er uns zu verstehen, dass es seit Tagen sehr viel geregnet hat. Aber anscheinend ist es für die hiesigen Verhältnisse recht warm. Das ist also ein isländischer Sommertag. Grau der Himmel, grau die See und die allgegenwärtigen, scharfkantigen Felsen, dazwischen sattes Moosgrün und weit am Horizont Bergspitzen, auf denen Schnee liegt. Viel Schnee. Im Sommer. Mutsch kann es kaum glauben. Wir frieren beide um die Wette, obwohl wir uns dicht an die anderen Passagierinnen kuscheln und unsere gespendeten Jacken übergezogen haben. Die anderen Sachen haben wir in unser Köfferchen gepackt. Es ist ja immerhin Sommer, wer zieht da schon Wintersachen an, oder?
Die vier Frauen sind wie wir mit der »Esja« angekommen, und nun werden wir der Reihe nach auf unsere Bestimmungsorte verteilt.
Ein zweiter einheimischer Mann, der sich als Ingvar vorstellt und mich ganz unverfroren mustert, gibt uns eine nach Schaf stinkende Wolldecke, die Mutsch und ich uns dankbar umlegen. Es gibt keine richtigen Sitzgelegenheiten, aber keine von uns traut sich zu fragen, ob wir in die kleine Kajüte unter dem Steuerrad gehen könnten, wo es sicherlich wärmer ist. Außerdem möchten wir natürlich alles sehen. Und Mutsch wird noch dazu sehr leicht seekrank.
Die Kälte klettert gierig meine Beine hinauf. Wasser schwappt zwischen den Holzplanken herum. Meine Schuhe sind nass, und meine Füße fühlen sich an wie abgefroren. Mir knurrt der Magen, trotz des guten Frühstücks im Hotel. Wie gut, dass der seltsame Junge gestern das Brot nicht wollte. Verstohlen kneife ich mir ein paar Krümel davon ab und stecke sie in den Mund.
Mutsch versucht, unsere Sachen so auf herumliegende Netze und Taue zu retten, dass sie nicht völlig durchnässen.
Endlich flaut der schlimme Wind wenigstens etwas ab. Wir tuckern an Buchten vorbei, an denen Seehunde auf dunklem Sand schlummern. Andere bestehen einzig aus scharfkantigen Felsen. Über uns fliegen Möwen und eine andere, pummelige Vogelart mit dicken roten Schnäbeln, die ich noch nie gesehen habe. Sie stürzen sich lauthals kreischend in die Fluten, tauchen, sind einfach weg. Und dann plötzlich sehe ich sie die Wasseroberfläche durchstoßen und aus den Wellenkronen emporsteigen, bestimmt mit fünf oder sogar zehn Fischchen im Schnabel. Nirgends ist ein Mensch zu sehen, ab und zu einmal eine Hütte oder ein Haus. Dabei sehe ich öfter mal Rauch. Doch der scheint aus dem Boden zu kommen.
»Vielleicht gibt es hier Zwerge, und die kochen sich was«, denke ich laut.
Die anderen Mädchen kichern, und Mutsch stößt mich in die Seite. Wir hatten eine Abmachung, sagt ihr strenger Blick.
Ich bin ja schon still. Das Wellenschaukeln lässt mich wegdämmern. Zwischen meinen geschlossenen Lidern blinkt ab und zu ein Licht auf, mein Nordstern.
Ich werde erst wieder wach, als Mutsch mich wachrüttelt.
»Ich glaube, wir sind da«, flüstert sie mir zu.
Im Boot sitzen außer uns jetzt nur noch zwei Frauen. Ich habe nichts davon mitbekommen, wie und von wem die anderen Mädchen abgeholt wurden. Verschlafen reibe ich mir über die Augen.
Ingvar bedeutet mir mit Gesten, ihm mein Köfferchen und meinen Leinensack zu geben. Dann springt er ins Wasser, dabei sind wir mindestens noch dreißig Meter vom Strand weg! Die Brandung ist zu stark für das kleine Fischerboot, wir können nicht näher heran. Algen und Fetzen von Wasserpflanzen schwimmen in der aufgewühlten, schaumigen Brühe. Breit grinsend klopft Ingvar auf die Wandung des tanzenden Holzbootes. Das Wasser schwappt ihm über Bauch und Rücken, als er davonwatet. Ich schlucke. Soll ich da jetzt etwa hinterherhüpfen? Entgeistert starre ich von ihm zu Mutsch und wieder zurück und lasse zögernd ein Bein über die Reling gleiten. Herr Hrafn lacht und signalisiert mir, dass ich warten soll, bis Ingvar das Gepäck an Land gebracht hat.
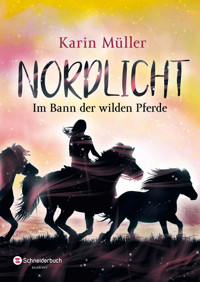

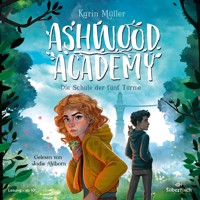



![Haustiere [Wieso? Weshalb? Warum? ERSTLESER Folge 12] - Karin Müller - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6a571bdcf21fd3a14260d301ec55d107/w200_u90.jpg)

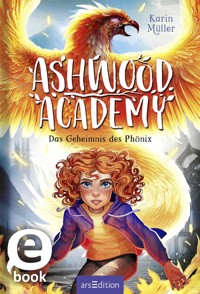

![Gefährliche Tiere [Wieso? Weshalb? Warum? ERSTLESER Folge 16] - Karin Müller - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c10a25e74908281ea7d5d19925efe1e9/w200_u90.jpg)