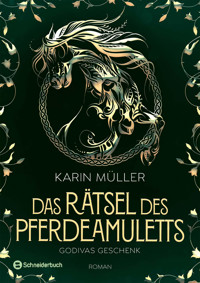9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schneiderbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Seahorse
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, die zum Scheitern verurteilt ist? Oder doch alle Grenzen überwindet? Shona und Cuan haben sich gefunden und Shona weiß, dass sie in ein Wasserpferd, einen Gestaltwandler, verliebt ist. Doch hat ihre Liebe eine Zukunft? Sowohl in Shonas Familie als auch auf der Seite der Wasserpferde scheinen alle eine große Gefahr in dieser Verbindung zu sehen. Was ist dran an dem Gerücht, dass die Wasserpferde für den Tod von Shonas Mutter verantwortlich sind? Shona weiß nicht mehr, wem sie wirklich trauen kann. Aber sie spürt, dass sie bald eine Entscheidung treffen muss. Eine Entscheidung für oder gegen ihre Gefühle. Romantische Mystery von Pferdeexpertin und Erfolgsautorin Karin Müller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Originalausgabe © 2023 Schneiderbuch in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Brauer. Cover- und Kartengestaltung von Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von AdobeStock und Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783505150517
www.schneiderbuch.de Facebook: facebook.de/schneiderbuch Instagram: @schneiderbuchverlag
Kapitel 1
Eilean Choraidh, Loch Eriboll, Sutherlandshire,Nordschottland
Der weiße Hengst spähte mit aufgesperrten Nüstern durch den sich auflösenden Nebel. Seine Muskeln zitterten vor Anstrengung, als sein Vorderhuf endlich Boden fand, er wieder stehen konnte. Seine Rippen hoben und senkten sich unter der Last des bewusstlosen Mädchens. Sie hatten es geschafft, das rettende Ufer der Insel erreicht. Jetzt musste Shona raus aus dem Wasser, so schnell wie möglich.
In ihrer Panik hatte sie ihn beinahe ertränkt. Ihr Gezappel, ihre Schreie hatten ihm Angst gemacht. Mehr als die Schüsse. Aber dann hatte sie irgendwann aufgehört zu strampeln, und das war noch beängstigender gewesen.
Seahorse schnaubte verhalten und inhalierte die salzhaltige Luft.
Die letzten verbliebenen Nebelschwaden zogen sich zurück, auf den See hinaus, wie verlässliche Begleiter, die nicht mehr gebraucht wurden. Am unteren Ende derInsel, hinter der halb verfallenen Mauer, grasten Schafe. Er konnte ihre strenge Witterung durch den Wind schmecken.
Im feinen Pudersand lagen ein paar Seehunde und genossen die ersten Sonnenstrahlen. Sonst war da niemand. Auch im See selbst schien alles friedlich. Kaum Wellengang. Der Meeresarm des Loch Eriboll war beinahe zu ruhig. Es wirkte sicher – so als ob nichts geschehen wäre.
Weit draußen nahm er ein paar Minkwale wahr. Fischerboote konnte er keine mehr sehen, nirgends die Anwesenheit eines Menschen wahrnehmen, auch nicht am jenseitigen Ufer. Sie waren alle fort.
Doch der Schrecken saß tief, auch wenn sie beide unverletzt geblieben waren. Dieses Mal.
Ganz langsam, Huftritt für Huftritt, ließ der Schimmel den Schutz des letzten ihn umgebenden Nebelfleckens hinter sich und wagte sich bis zum Wassersaum der kleinen Insel, die die Einheimischen Eilean Choraidh oder Horse Island nannten. Seine Hufe sanken tief in den nassen Ufersand ein. Das Schwappen des Wassers und das Knirschen des Untergrundes klangen unnatürlich laut. Er lauschte wieder und sah sich um.
Es gab keine Bäume auf dem hügeligen Eiland, nur ein paar Mauerreste und die Ruinen eines Gehöfts. Der Rest bestand aus Heide, Gras und Felsen. Seit den Dreißigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts galt die Pferdeinsel als unbewohnt. Und das war gut so.
Noch einmal blieb er stehen und witterte. Spielte lauschend mit den Ohren in alle Richtungen, über den See, aufs Festland. Nichts. Alles blieb ruhig. Sie hatten tatsächlich aufgegeben. Für den Moment zumindest.
Er widerstand dem Impuls, das Mädchen abzuwerfen und zu fliehen. Seine Instinkte kämpften darum, die Oberhand zu gewinnen. Sie sagten ihm, dass er die Nebel erneut rufen und mitten hineingaloppieren sollte. Dorthin zurückkehren, woher er stammte. Weit weg. Es war zu gefährlich auf dieser Seite, jetzt, da sie von seiner Existenz wussten – und deutlich gezeigt hatten, was sie mit ihm machen würden, wenn sie ihn kriegten.
Aber er würde Shona nicht im Stich lassen.
Er machte ihr keinen Vorwurf. Sie war ebenso schockiert gewesen wie er selbst, und doch hatte er geahnt, dass es eine Falle war. Irgendwo tief in sich drin.
Er hatte nur nicht wahrhaben wollen, dass es so kommen würde. Dass die Alten recht behalten hatten mit ihren Warnungen vor den Menschen. Von klein auf hatten sie ihm eingeschärft, dass sie Unglück brachten. Man kann ihnen nicht trauen, solange sie noch Grund unter den Füßen spüren. Er hasste diese Redensart. Nein. Nicht alle waren so. Und doch …
Wie sie ihn gejagt hatten! Drähte gespannt. Auf ihn geschossen! Ohne Rücksicht auf das Mädchen auf seinem Rücken … auf Shona.
Damit hatte er nicht gerechnet.
Er schnaubte noch einmal, diesmal voller Wut. Drehte sich zu dem Bündel auf seinem Rücken um und schnappte spielerisch nach dem nassen Stoff, nach einem herabhängenden Arm. Keine Reaktion. Mit seinem gesunden Bein patschte er ein paarmal ungestüm auf den feuchten Sand, hüpfte leicht mit der Hinterhand, um sie wachzurütteln. Sie rührte sich noch immer nicht. Das war nicht gut.
Sie brauchte den Jungen.
Schnell.
»Wir müssen vom Strand verschwinden. Meinst du, du schaffst das?«
Ich nicke abwesend. »Mir ist so kalt.«
Cuan sieht mich ernst an. Seine Worte dringen nur langsam zu mir durch, als wäre der Nebel, der die Insel umgibt, auch in meinem Kopf. Anscheinend hält er es für zu gefährlich, ein Feuer anzuzünden. Wir müssen also hoffen, dass die Sonne herauskommt, um uns zu wärmen.
Er hilft mir aufzustehen. Ich bin total wackelig auf den Beinen und schaffe es mit seiner Hilfe gerade mal ein paar Meter vom Strand herauf. Wir klettern über Kieselsteine und Felsen, bis wir hügeliges Grün erreichen. Ein paar Schafe starren uns neugierig an, aber ich bekomme alles nur halb mit. Meine Füße fordern meine ganze Aufmerksamkeit. Sie wollen mich noch nicht so richtig tragen. Mir ist schlecht von dem ganzen Salzwasser, das ich auf unserer Flucht geschluckt habe. Und parallel nimmt das Gedankenkarussell Fahrt auf. Ich bin beinahe ertrunken.
Mein Onkel Matthew hat auf uns geschossen.
Cuan ist Seahorse.
Seahorse ist ein Wasserpferd.
Der wunderschöne Kaltbluthengst – der Schimmel, den ich vor ein paar Wochen kennengelernt habe. Ich bin ihm direkt nach meiner Ankunft in den schottischen Highlands zum ersten Mal begegnet. Eigentlich sogar schon früher, bereits auf dem Weg zur Fitzgibbons Farm, auf der mein Onkel mit seinen Söhnen und seiner Schwester lebt. Kurz darauf habe ich Cuan zum ersten Mal getroffen.
Ich habe mich verliebt.
In beide.
Ohne zu ahnen, dass sie ein und derselbe sind.
Hier, an der windigen Nordspitze Schottlands, wohin mein Dad mich auf Rat des Schulpsychologen geschickt hat, weil mir die Großstadt nicht guttut – haha. Der Kontakt zu diesem Zweig meiner Familie sollte mir dabei helfen, zur Ruhe zu kommen. Und das hätte vielleicht sogar funktioniert. Aber heute haben sie auf ihn geschossen. Auf Seahorse.
Sie wollten ihn töten. Weil sie ihn für ein Monster halten. Was für ein wahnsinniger … bescheuerter … kranker … Aberglaube.
»Du musst raus aus den nassen Sachen.«
Cuans Stimme klingt weit weg. Mechanisch ziehe ich die Schuhe und Strümpfe aus und lasse es geschehen, dass er mir die Jeans, mein Shirt und meinen Hoodie abstreift, sehe dabei zu, wie er meine Klamotten zum Trocknen über ein paar Heidesträucher breitet. Meinen Hoodie hat er sich um die Hüfte geschlungen und die Ärmel verknotet.
Ich zittere am ganzen Leib, meine Zähne klappern. Habe ich einen Schock? Jedenfalls stehe ich völlig neben mir – also – sitze, um genau zu sein. Wann habe ich mich denn hingesetzt? Und wieso trägt Cuan meinen nassen Kapuzenpulli wie einen Kilt? Es fällt mir schwer, einen Zusammenhang zu seiner Nacktheit herzustellen.
»Warte kurz, bin gleich wieder da.« Er streichelt mir über die Schulter. Sein Blick ist besorgt.
»M-hm.« Ich nicke abwesend, die Arme um meine nackten, blau gefrorenen Knie geschlungen, und wiege mich vor und zurück. Dabei lasse ich die vorwitzigen Schafe nicht aus den Augen, die abwechselnd mich und unsere übrigen Kleidungsstücke beäugen, als ob sie nur darauf warten, sich einen kleinen Baumwollsnack einzuverleiben.
Ist das alles real? Ist es wirklich passiert oder habe ich einen dieser Albträume, die einem so echt vorkommen, dass man noch Tage später einen kalten Schauder spürt, wenn man daran zurückdenkt? Ich kneife mich in den Arm und beobachte, wie die Abdrücke meiner Fingernägel langsam verschwinden und die Haut wieder ihre normale Farbe annimmt.
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde, um begreifen zu können, dass mein Freund ein Wasserpferd ist. Eine mythologische Gestalt – ein Dämon, wie Tante Meghan überzeugt ist.
Aber er hat mich nicht gefressen. Er hat mich nicht ertränkt.
Er hat mich aus dem Wasser gezogen und gerettet.
Vor meinem eigenen Onkel.
Und meine Leber habe ich auch noch. Wieder und wieder kreisen diese Gedanken durch meinen Kopf. Onkel Matthew hat auf uns geschossen. Und ich bin schuld. Nein, Brodie ist schuld. Er hat uns verraten. Aber ich bin mehr schuld. Trotz allem.
Ich hätte ihm nicht vertrauen dürfen.
Ich hätte es ihm nicht erzählen dürfen. Und nicht auf Seahorse reiten. Damit fing es doch an.
Dann wäre das alles nicht passiert. Dann würde ich jetzt gemütlich auf der Fitzgibbons Farm sitzen und frühstücken, eine Partie Schach mit Meghan, meiner blinden Tante, spielen, ihr etwas vorlesen, Unkräuter aus dem Gemüsebeet zupfen oder irgendwas mit den Ponys unternehmen. Was man eben so macht in den Sommerferien, am nördlichsten Zipfel der Highlands, wenn man von der Schule geflogen ist und zum Nachdenken zur Verwandtschaft aufs Land geschickt wurde.
Stattdessen musste ich unbedingt angeben mit meinem wilden Clydesdale. Mit Seahorse, also eigentlich mit Cuan.
Der Junge, in den ich mich verknallt habe, ist kein umherstreifender Travellerjunge – und das würden mein Onkel und meine Tante schon schlimm genug finden –, sondern ein Wassergeist, ein Gestaltwandler, ein Each Uisge.
Ich lache hysterisch auf, weil das alles so absurd ist. Das Schaf, das sich am dichtesten in meine Nähe getraut hat, hebt erschrocken den Kopf aus dem Gras und blökt. Sofort antworten ihm drei oder vier andere.
Ich habe tausend Fragen an Cuan. Aber ich kann ihm keine einzige mehr stellen, weil mein Kopf das alles immer noch nicht gebacken kriegt.
Wie geht es Seahorse?, habe ich ihn vorhin am Strand der Insel gefragt, gleich, nachdem ich wach war, und mich hektisch nach dem Hengst umgedreht. Ist ihm was passiert?
Cuan hat mich nur angesehen, aus diesen dunklen ozeanblauen Augen. Es geht ihm gut. Es geht uns beiden gut, hat er ganz langsam gesagt, mir behutsam eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht gestrichen und mich an seiner Schulter weinen lassen, als ich kapiert habe, was ich da gefragt hatte.
Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Lange. Weil ich so eine Idiotin bin.
Ich würde wirklich einiges dafür geben, wenn ich jetzt bei einer Tasse heißem Tee an Meghans Spielbrett sitzen könnte – auch wenn ich bisher nie besonders viel Lust auf Schach hatte.
Aber diese Gedanken sind schrecklich unfair. Cuan und Seahorse, sie beide haben ihr Leben für mich riskiert. Also Schluss damit!
»Wir kriegen das schon hin«, erkläre ich dem verdutzten Schaf und sehe mich um. So leicht gebe ich nicht auf. Das ist eine meiner Regeln.
Meine nassen Sachen flattern im Wind. Ich sitze hier in Hemd, BH und Höschen. Die Sachen kleben mir auf der Haut, ich fröstele. Die Heidesträucher sind kniehoch, richtigen Windschutz gibt es nur hinter den Felsen oder vielleicht bei den Ruinen der verfallenen Gebäude, von denen nur noch die Außenmauern stehen. Dorthin ist Cuan verschwunden.
Auf dieser winzigen lang gezogenen Insel lebt schon lange niemand mehr. Ich frage mich, wie es jemals möglich war, und beneide die Schafe um ihre dicke Wolle.
Immerhin regnet es nicht. Positiv denken, Shona. Wir werden einen Weg finden. Zusammen. Cuan hat das auch gesagt. Jetzt beginnt auch noch mein Magen zu knurren.
Ich höre Schritte hinter mir, wische mir schnell über die Augen und drehe mich mit einem zittrigen Lächeln um.
Cuan kommt mit einer Wolldecke und einem großen Plastikbeutel zurück. Er trägt jetzt eine unförmige Cordhose. Im Gehen knöpft er ein Hemd zu, das ein bisschen so aussieht wie das Nachthemd von Rotkäppchens Großmutter.
»Danke!« Dankbar nehme ich die Decke entgegen und wickle mich darin ein. Sie riecht ein wenig muffig und kratzt, aber sie ist dick und verspricht Wärme.
Er geht ein paar Schritte zu den Wäscheleinenersatzbüschen und hängt meinen Hoodie dazu. Dann zeigt er zur Erklärung vage in die Richtung, aus der er eben gekommen ist. »Ich habe ein kleines Erdlager für Notfälle oben zwischen den Ruinen.«
»Ah, das erklärt den Geruch.« Lächelnd halte ich die Decke auf, damit er sich zu mir setzen kann. Ironie versteht er nicht besonders gut. »Und was hast du noch so in deinem Survival-Kit?«
Er hockt sich neben mich, zieht sich eine Ecke der Decke über die Schultern und hält mir die Tüte hin. »Hier sind trockene Kleider. Sie sind nicht neu oder so, aber du musst warm werden, damit du nicht krank wirst.« Er fördert ein Paar dicke Stricksocken, eine gelbe Jogginghose und ein braunes Sweatshirt zutage.
»Okay«, sage ich und stehe auf, um als Erstes in die Hose zu schlüpfen. Cuan stützt mich mit einer Hand. Dann drehe ich mich von ihm weg, ziehe mir das nasse Unterhemd und den BH über den Kopf und tausche beides gegen den Sweater. Fühlt sich sofort besser an.
»Wo hast du die Kleider her?«, frage ich und breite meine Sachen neben den anderen über einen Strauch.
»Hier und da«, gibt er ausweichend Auskunft. »Ein paar Konserven habe ich auch mitgebracht. Ich dachte, du hast vielleicht Hunger.«
»Bärenhunger!« Ich seufze und inspiziere sofort das Menü. »Weiße Bohnen in Tomatensoße, Ravioli und … Kürbispüree?«
Cuan sieht mich bestürzt an und greift nach der Tüte. »Warte. Wo sind denn die Kekse hin?« Erleichtert fördert er eine eingeschweißte Packung Butter Fingers zutage.
»Das ist ein guter Anfang«, sage ich und reiße sie auf. »Frühstück.«
Cuan hört die Ruderschläge zuerst. Ein monotones, rhythmisches Klatschen, gefolgt von dem knarzenden Geräusch, das Holz macht, wenn es über Holz reibt.
Panisch sehen wir uns an.
Cuan springt auf und zieht mich hoch. »Wir müssen uns verstecken. Schnell!«
Hastig pflücken wir die nassen Sachen von den Büschen, sammeln die Dosen und den Müll zusammen und rennen geduckt zwischen den Schafen hindurch auf die Ruinen zu.
Der Wind weht mir die leere Kekspackung aus der Hand. Ich will ihr hinterherlaufen, aber Cuan drängt mich weiter. »Keine Zeit, komm.«
Die Szene erinnert mich an unsere nächtliche Flucht vor Onkel Matthew neulich. Ist das wirklich erst ein paar Tage her? Es fühlt sich an wie ein ganz anderes Leben, als wir auf dem Festland vom Strand in die Hügel geflüchtet sind und uns rücklings in die Heide haben fallen lassen. Da hatte ich noch keine Ahnung, wer Cuan wirklich ist. Aber weiß ich das jetzt?
Wir rennen auf die Ruinen zu. Ich traue mich nicht, mich umzusehen. Mit einer Hand halte ich ein Klamottenbündel und Dosen vor meinen Bauch, an der anderen zieht Cuan mich mit sich.
Hinter einem verfallenen Mauerstück bleiben wir für einen Moment stehen. Ich habe Seitenstiche und meine Lunge brennt. Ich muss husten. Wahrscheinlich habe ich immer noch Wasser irgendwo in den Bronchien.
Cuan bückt sich und macht sich zwischen den Steinen und einer dornigen Hecke zu schaffen. Ächzend zieht er an irgendetwas im Boden – und plötzlich gähnt uns ein quadratisches dunkles Loch an. »Dort unten sind wir sicher«, flüstert er, springt hinein und verschwindet bis zur Hüfte. Nicht besonders tief also, aber unter die Erde? Gerade kommt die Sonne heraus. Ich schlucke und blicke zurück zum Strand. Die Felsen versperren die Sicht. Ich höre, wie Ruder eingeklappt werden, jemand ins Wasser springt und das Boot an Land zieht.
»Wenn du nicht gefunden werden willst, dann komm, Shona.«
Eine halbe Sekunde lang starre ich ihn an.
Habe ich denn eine Wahl?
Ich schlucke noch einmal, dann springe ich in Cuans ausgebreitete Arme.
Er zieht eine von Moos und Efeu überwucherte Holzplatte über uns und alles wird dunkel.
Kapitel 2
»Wer war das?«
Matthew Fitzgibbons starrte bewegungslos auf das Festnetztelefon. Er konnte nicht sagen, wie viele Minuten verstrichen waren, seit diese schnarrende Stimme mit dem seltsamen Akzent sich verabschiedet und aufgelegt hatte.
Sie lebte. Shona lebte. Von wo hatte der Mann angerufen? Im Hintergrund waren Pubgeräusche zu hören gewesen. Aus Thurso? Tongue? Oder von der Tankstelle in Durness? Klar, er konnte rüberfahren zum alten Hamish und ihn fragen, ob ihm jemand Besonderes aufgefallen war. Aber wie sollte er das begründen? Und was sollte es bringen?
Der Mann hatte sauer geklungen, darüber, dass er im Alleingang Jagd auf den Hengst gemacht hatte. Was hatte er denn erwartet? Eine Einladung zur Fotosafari?
Es war gründlich schiefgegangen, das stimmte natürlich. Er konnte froh sein, wenn niemand sonst mitbekommen hatte, was sich bei Sonnenaufgang am Loch Eriboll abgespielt hatte. Was würden die Leute denken, wenn das die Runde machte? Dass er jetzt auch übergeschnappt war, genau wie seine Schwester? Nein, schlimmer! Und das alles nur, weil seine Nichte heimlich reiten ging? Auf einem verwilderten Clydesdale?
Blind vor Zorn hatte er Jagd auf ein Pferd gemacht, Schnüre gespannt, er hatte geschossen, Amadain! Wie ein Geisteskranker – er hätte Shona dabei treffen können.
Was war nur in ihn gefahren? Das konnte er niemandem erklären. Er verstand es ja selbst nicht.
Statt Shona zu retten, hatte er alles nur schlimmer gemacht. Jetzt würde sie ihm nie wieder vertrauen.
Und doch würde er es wieder tun. Würde alles geben, um sie vor dem Schicksal ihrer seligen Mutter zu bewahren, alles. Aber sie war nicht tot. Sie lebte. Immerhin das. Das glaubte er dem rätselhaften Fremden, der so viel wusste und ihm vor wenigen Stunden den Hinweis auf Shona und den verdammten Hengst am Strand gegeben hatte.
Nach außen musste es so aussehen, als hätte er seine eigene Nichte erschießen wollen. Wollte der Fremde ihn jetzt damit erpressen? Hatte er in Wahrheit ihm eine Falle gestellt? Er hatte das Gegenteil behauptet. Dass er einen Plan habe, ihm helfen wolle. Aber ihm war nicht zu helfen. Matthew verbarg das Gesicht in seinen Händen und atmete stöhnend aus. A Dhia! Wie hatte das alles so fürchterlich schiefgehen können? Sie hatten Shona doch nur aufhalten wollen. Verhindern, dass sie mit diesem gottverdammten Teufelsvieh … Das Kind war so schrecklich naiv.
Wie sollte er damit weiterleben, dass er versagt hatte? Wie konnte er es Meghan und seinen Söhnen erklären? Wie Christopher beibringen, dass seine einzige Tochter in Gefahr war? Dass sie womöglich auf die gleiche unerträgliche Weise ums Leben kommen könnte wie Mhairi?
Was jetzt?
Der Fremde hatte seinen Namen nicht genannt, noch immer nicht. Das fiel ihm jetzt erst auf. Der Mann hatte offensichtlich alles mitangesehen. Zu viele Details hatte er ihm nennen können über das, was in den frühen Morgenstunden am Loch Eriboll geschehen war. Genau wie zuvor von dem angeblichen Angelausflug mit Brodie. Er wusste von Shona und dem Schimmel, vom Nebel, sogar von dem Gesang … Und er war wütend gewesen.
Spinner.
Es war einfach zu absurd, von einem Fremden mit der eigenen Theorie konfrontiert zu werden, da klang es völlig verrückt.
Was, wenn dieser Schimmel doch nur ein ganz normales Pferd war? Wenn er Wahn und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden konnte? Hatte er sich den anonymen Anrufer vielleicht selbst ausgedacht?
In der Zeitung standen manchmal Berichte über arme Irre, die Stimmen hörten oder sich Sachen einbildeten und dann furchtbare Dinge taten, um diese Bilder aus dem Kopf zu bekommen. So hatten die Ärzte damals im Prinzip auch bei Meghan reagiert – einen psychotischen Schub hatten sie das genannt. Vielleicht hatten sie recht gehabt, und nun hatte es ihn ebenfalls erwischt, den jüngeren Bruder? Geisteskrankheiten vererbten sich manchmal.
»Matthew?«
»M-hm«, machte er abwesend, völlig in seine Gedanken vertieft.
Dann schüttelte er energisch den Kopf. Aber der Schimmel war da gewesen, ein riesiges Vieh. Hunter hatte es mit Shona im Nebel verschwinden sehen. Und Brodie hatte es auch gesehen.
Er wollte so gern glauben, dass sie den Nebel genutzt und den See ganz durchschwommen hatten. Dann konnten sie inzwischen längst sonst wo sein – am Leben. Ein ganz normales Teenagerleben. Shona war ein ganz normaler Teenager im Ausnahmemodus. Und reiten konnte sie – wie der Teufel. Er bekam Gänsehaut, als er daran dachte, wie sicher sie auf dem Hengst gesessen hatte. Als wären die beiden eins geworden. Erneut schüttelte er unwillig den Kopf. Seine Gedanken kreisten und kreisten.
Kein Wunder, wenn sie getürmt war, weil ihr alles zu viel geworden war bei ihren durchgedrehten Verwandten in den Highlands. Ein ganz normales Pferd, ein ganz normales Mädchen. Der Fremde war der gefährliche Irre, nicht er.
Wie ein Ertrinkender klammerte er sich daran, dass seine Schwester Meghan ihn angesteckt, er sich alles eingebildet hatte, bis hin zu einem verrückten anonymen Anrufer. Schlimm genug, wenn er an die Konsequenzen dachte – er musste in die Stadt und mit so einem Gehirnklempner reden, möglichst unauffällig.
Matthew lachte bitter auf.
Dieser Anrufer hatte behauptet, dass das Wasserpferd Shona mitnehmen würde, in ein ominöses Reich hinter den Nebeln, wenn sie nicht gemeinsam handeln würden. Das war natürlich Schwachsinn. Diese Biester lebten auf dem Grund des Sees, dorthin brachten sie ihre Opfer. Und dann war alles zu spät.
Shona … Er sah sie die ganze Zeit vor sich. Ihre angsterfüllten, weit aufgerissenen Augen.
Brodie war so wütend gewesen. Und er war es noch. Der Junge kapierte nicht, was er da angestellt hatte, indem er seine Cousine zu diesem Ritt auch noch ermutigt hatte. Und nun war er aufgebrochen, um auf der verhexten Insel nach ihr zu suchen. Aber da würde er nichts finden.
Wasserpferde ließen einzig die Leber ihrer Opfer zurück. Matthew brachte es nicht übers Herz, seinen Jungs das zu sagen … Allerdings, von Mhairi hatten sie nicht einmal das gefunden … Alles wiederholte sich.
Wie gern wollte er glauben, dass es noch eine Chance für Shona gab. Dass sie noch lebte. Er musste den Fremden treffen. Vielleicht wusste der Kerl ja wirklich mehr über diese Biester als er und Meghan. Er musste herausfinden, was der Mann von ihm wollte – und von seiner Nichte und diesem dämonischen Pferd.
»Shona!«
Brodie ruft meinen Namen. Ich ziehe die Schultern hoch und balle unwillkürlich die Fäuste.
Ob er allein ist? Zumindest ist die Stimme meines Cousins die einzige, die ich höre. In unserem fürchterlich engen Erdversteck klingt er mal weiter weg, mal gefährlich nah. Mir stockt jedes Mal der Atem, wenn ich fürchte, dass er im nächsten Moment auf uns treten müsste. Cuan streichelt mir die ganze Zeit beruhigend über den Rücken.
Mit geschlossenen Augen kauere ich in seinen Armen und wage nicht, mich zu bewegen, obwohl mir schon nach wenigen Minuten der Arm einschläft. Es ist stickig hier drin und so wenig Platz, dass wir uns nicht mal ausstrecken könnten, wenn wir wollten. Aber ich zumindest will nicht. Ich spüre irgendwas Weiches an meinen Füßen und möchte definitiv nicht wissen, was das sein könnte.
Kommt der Geruch nach Moder und Erde von den alten Klamotten, von der Decke oder von den Wänden um uns herum? Gibt es hier Spinnen? Oder Asseln? Würmer? Mäuse? Nein, die würde man hören. Zumindest wird mir jetzt wieder warm.
Was will mein Cousin hier? Glaubt er wirklich, ich würde ihm antworten? Noch einmal bin ich bestimmt nicht so blöd, auf ihn hereinzufallen.
»Shona!« Dumpf schallt seine Stimme zu uns herunter. »Bist du hier irgendwo? Ich hatte keine Ahnung, was Dad vorhat. Ich habe ihm nichts erzählt, ehrlich nicht. Bitte komm raus! Ich will nur wissen, ob es dir gut geht. Bist du verletzt? Und was ist mit dem Pferd? Ich kann dir helfen.«
Ich presse die Kiefer aufeinander und balle die Fäuste.
»Wie kann er es wagen?«, zische ich, aber Cuan legt mir seine Hand auf den Mund. Sein Herz schlägt schneller als sonst. Ich spüre es ganz dicht an meinem und zwinge mich, ruhiger zu atmen. Im Moment überwiegt bei mir die Wut. Gutes Zeichen – das heißt, meine Energie kehrt zurück –, aber wir haben beide Angst. Ich löse seine Hand von meinem Mund und knete sie mit meinen Fingern.
»Shona?!« Die Schritte entfernen sich wieder. Brodies Stimme wird leiser.
Ganz vorsichtig bewege ich meinen Arm und bereue es sofort, weil eine Ameisenarmee durch meine Adern tobt.
»Alles okay?«, wispert Cuan.
Ich beiße die Zähne zusammen und nicke, auch wenn er es vermutlich nicht sehen kann, so stockdunkel, wie es hier ist.
»Geht schon«, antworte ich leise und ziehe die Decke fester um uns.
Man kann die Hand nicht vor Augen sehen. Es riecht nach Erde und stickiger, kühler Feuchtigkeit. Die einzig lebendige Wärme kommt von Cuans Körper.
Eine ganze Weile bleiben wir einfach liegen und schweigen. Cuan streichelt noch immer über meinen Rücken, und ich schmiege mich an seine Brust und zermartere mir das Hirn. Wir sind uns erst vor so kurzer Zeit begegnet, und doch fühlt es sich so an, als würden wir uns ewig kennen. Ich vertraue ihm. Und ich vertraue Seahorse – vielleicht sogar noch mehr. Doch das heißt nicht, dass ich nicht nach wie vor überfordert damit wäre, dass beide ein und derselbe sein sollen. Wie soll es jetzt weitergehen – mit uns und überhaupt?
Hier können wir nicht bleiben. Aber wo sollen wir hin? Wo soll ich hin? Auf keinen Fall gehe ich zurück auf die Farm. Das ist unvorstellbar, nach allem, was passiert ist. Schon bei dem Gedanken, den anderen zu begegnen – Matthew, Hunter, Brodie –, wird mir schlecht. Soll ich da einfach reinspazieren, so nach dem Motto Hey, ihr habt auf mein Pferd und mich geschossen, Schwamm drüber, was gibt’s zu Mittag? No way!
»Was denkst du?«, fragt Cuan irgendwann. Ganz sicher spürt er meine Unruhe in dieser drückenden, dunklen Enge, ich kann kaum still liegen bleiben.
»Nichts«, antworte ich im Reflex. Aber das stimmt natürlich nicht, und das weiß er auch. »Ich habe tausend Fragen«, gebe ich seufzend zu.
»Das kann ich mir denken«, sagt er leise und drückt mich kurz ein wenig fester. Er ist da, sagt mir diese Geste. Aber wer ist er? Wer ist dieser Junge wirklich? So viele Geheimnisse, so viel Neues, das ich nicht begreifen kann.
»Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll … Ist das hier dein Zuhause?«
Cuan lacht leise. »Dieses Erdloch hier? … Nein. Hier bewahre ich normalerweise nur Sachen auf, die ich nicht mit … nach drüben nehmen will.«
»Nach drüben? Aufs Festland?«
Er stockt wieder, bevor er antwortet. Ich höre ihn atmen, schwerer als eben. »Nein … oder, ja … auch. Das heißt …« Vorsichtig arbeitet er sich unter mir hervor und setzt sich auf, wobei er sich prompt den Kopf stößt. »Warte hier, ich sehe nach, ob die Luft rein ist.«
»Aber wenn sie dich erwischen!«
»Schh! Das werden sie nicht.« Cuan lüpft vorsichtig den Deckel unseres unterirdischen Verstecks und lauscht.
Ein Streifen hellen Lichts fällt herein. Geblendet kneife ich die Augen zusammen. Aber die frische Luft tut gut.
»Und dann erzählst du mir alles?«, flüstere ich.
»Schhhh!« Cuan streckt sich und schiebt das Moosdach ächzend ein Stück beiseite. Ich helfe ihm, so gut ich kann, ohne den genauen Mechanismus zu kennen und zu viel Deckung aufzugeben.
Ich beobachte, wie er die Nasenflügel bläht, vorsichtig den Kopf hebt und sich umsieht. Wie ein witterndes Pferd, muss ich unwillkürlich denken und streiche mir Gänsehaut von den Armen.
»Ich glaube, er ist weg.« Cuan klettert hinaus und hält mir eine Hand hin, um mich hochzuziehen. »Er scheint allein gewesen zu sein.«
Meine Knie zittern ein wenig, als ich der Bewegung seines Kopfes folge und im Schutz von Efeu und wilden Gräsern über die Mauer spähe. Eine einsame Gestalt rudert von der Insel weg. Brodie. Ich ducke mich schnell wieder, weil ich das Gefühl habe, dass er direkt in unsere Richtung sieht. Aber er müsste schon Adleraugen haben, um meinen Kopf auf die Entfernung zwischen den Steinen und all dem Grünzeug erkannt zu haben. Erleichtert drehe ich mich zu Cuan um, der gerade unsere zerknüllten Sachen aus dem Versteck holt und meinen BH befühlt.
»Sind noch nicht ganz trocken«, erklärt er verlegen.
»Schon okay«, sage ich und grinse. »Hast du das Loch gegraben?«
Er schüttelt den Kopf. »Nein. Das gibt es schon ewig. Ich habe es durch Zufall entdeckt, als ich mit dem Fuß drin hängen geblieben bin.« Ich folge seiner Kinnbewegung mit den Augen und entdecke eine zersplitterte Stelle im Holz, die notdürftig mit einem neueren Brett geflickt wurde. Ein Fuß kann dort allerdings nicht durchgebrochen sein, dafür ist das Loch zu klein. Es hat eher die Größe eines … Hufs. Und wenn ich die Augen zusammenkneife, erkenne ich auch ein paar kurze weiße Tierhaare. Zumindest bilde ich mir das ein.
Ich atme tief durch.
»Es ist … komisch, nicht wahr?« Cuan sieht mich unsicher an.
Ich nicke stumm. »Creepy irgendwie, wenn ich daran denke, dass ich … Was bist du, Cuan? Ich meine, bist du … mehr Pferd oder mehr Mensch? Ist das ein Fluch oder so was? Kann man das brechen, wie bei Die Schöne und das Biest?«
Jetzt bin ich es, die tomatenrot anläuft, kaum dass ich diesen Gedanken laut ausgesprochen habe. »Also, damit will ich nicht sagen, dass du … dass ich … Du bist ganz bestimmt kein Biest …« Hilflos breche ich ab.
Er grinst breit, und seine Augen glitzern fröhlich. »Sicher nicht? Da wärst du aber die Erste, die das nicht so sieht.«
»Vielleicht die Zweite«, rutscht es mir heraus.
Cuan sieht mich fragend an.
»Meine Mutter«, sage ich und hebe die Schultern. »Sie ist tot, verunglückt, als ich klein war. Es ist alles total verworren und undurchsichtig. Tante Meghan behauptet, ein Wasserpferd wäre schuld an allem. Ich habe natürlich kein Wort davon geglaubt, aber …«
Sein Gesichtsausdruck versteinert. »Das erklärt natürlich, wieso …« Er packt meinen Arm. »Meinst du, dein Onkel weiß, wer ich bin? Also was ich bin?«
Ich sehe ihn genauso erschrocken an wie er mich. »Ich habe ihm nichts gesagt, wenn du das meinst … nein! Ich hatte ja selber keine Ahnung, dass Seahorse kein gewöhnliches Pferd ist. Geschweige denn, dass du und er … Hey, du tust mir weh.«
Er lässt sofort los. »Entschuldige«, sagt er zerknirscht. »Das wollte ich nicht.«
»Schon gut.« Nachdenklich reibe ich meinen Arm. »Niemand weiß, dass du und der Schimmel …« Da fällt mir etwas anderes ein. »Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich Seahorse – dir – von der Sache mit meiner Mum erzählt habe. Heißt das, du bekommst nicht mit, was ich …?«
Cuan blickt abwesend in Richtung Festland hinüber. »Doch. Schon. Wenn auch irgendwie … verschwommen.« Er dreht sich zu mir um. »Ich erinnere mich an alles. Aber diese Dinge – die gesprochenen Worte vor allem – liegen schlafend in meinem Bewusstsein. Ich muss mich sehr konzentrieren, um Details von dem abzurufen, was du Seahorse gesagt hast. Der Name gefällt mir übrigens.«
»Tut er das?« Erstaunt hebe ich den Kopf. »Auf dem Berg neulich hatte ich nicht so den Eindruck.«
Er atmet tief aus. »Da hatte ich eher Sorge, dass du … dass genau so etwas passiert vermutlich.«
»Das ist irgendwie so, als ob du mein Tagebuch kennen würdest«, sage ich leise. »Ich habe Seahorse ziemlich oft mein Herz ausgeschüttet. Trotzdem ganz schön peinlich, was du jetzt alles von mir weißt. Und ich weiß immer noch kaum was von dir.«
»Du kannst mich alles fragen. Und mir immer noch alles sagen. Oder Seahorse, wenn dir das lieber ist.« Er macht einen Schritt auf mich zu, nimmt meine Hand und legt sie an sein Herz. »Hier drin bewahre ich jedes Wort. Hab keine Angst.«
»Hab ich auch nicht«, sage ich ein bisschen trotzig und ziehe meine Hand fort.
Er betrachtet mich nachdenklich. »Du warst sehr aufgewühlt an jenem Tag. Du hast ihm gesagt, dass deine Mutter sich vielleicht umgebracht hätte. Von Wasserpferden hast du nichts erwähnt«, sagt Cuan sanft.
Ich habe einen dicken Kloß im Hals. »Ja. So war es wohl. Du hast recht. Weißt du, was damals wirklich geschehen ist?« Auf einmal sehe ich wieder Tante Meghans Gesicht vor mir, während sie mir von den Ereignissen damals am Strand erzählte. »Hast du damit irgendwas zu tun?«
Erschüttert blickt er mich an.
»Entschuldige, das kam jetzt anders raus, als es gemeint war. Ich dachte nur, weil Tante Meghan … Sind denn alle Wasserpferde Clydesdales? Wie viele gibt es von euch? Wo lebt ihr? Und wie? Hier ja offensichtlich nicht. Wo ist meine Mum?«
Sein Adamsapfel hebt sich, als er schluckt, und seine Augen werden ganz dunkel.
»Ich habe keine Ahnung«, sagt er heiser. »Ich habe schon lange niemanden mehr … von meiner Art gesehen. Ich wollte, ich könnte dir helfen.«
»Weißt du nicht wenigstens irgendwas?« Heiße Tränen schießen mir in die Augen. Wütend wische ich sie weg.
Er schüttelt langsam den Kopf.
»Aber du bist doch ein Wasserpferd. Und sicher nicht das einzige auf der Welt. Also musst du …«
»Und du bist ein Mensch«, unterbricht er mich energisch. »Wissen Menschen alles über andere Menschen?«
Erschöpft schüttele ich den Kopf. »Nein. Natürlich nicht. Bis heute Morgen hätte ich geschworen, dass meine Tante einen Spleen hat und mein Onkel ganz normal ist. Jetzt scheint es, als wäre es genau umgekehrt. Irgendwie steht meine ganze Welt gerade kopf. Es tut mir leid.«
»Alles gut«, sagt er versöhnlich. »Es gibt nicht mehr so viele von uns. Wir Jungen sind ziemliche Einzelgänger und ich …« Er macht eine kleine Pause, und sein Blick wird leer. »Ich war schon eine Weile nicht mehr … zu Hause.«
»Oh«, mache ich betroffen. »Warum?«
Er zuckt mit den Schultern. »Du bist nicht die Einzige, die nicht so richtig weiß, wo sie hingehört. Aber vielleicht sollten wir uns lieber Gedanken darüber machen, was wir …« Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen, als er irgendetwas hinter mir fixiert.
»Was ist?«, frage ich und folge seinem Blick.
Auf einem Wiesenstück unterhalb von uns streiten sich zwei Schafe um einen khakifarbenen Gegenstand, der sich bei näherem Hinsehen als Rucksack herausstellt.
»Vorhin war der noch nicht da«, sagt er leise.
»Wo kommt er her?« Alarmiert sehe ich mich um.
»Dein Cousin muss ihn dagelassen haben. Sonst war ja niemand hier.«
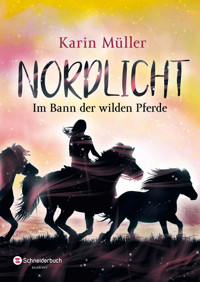

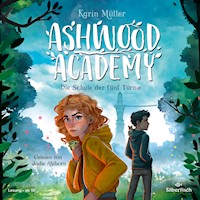



![Haustiere [Wieso? Weshalb? Warum? ERSTLESER Folge 12] - Karin Müller - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6a571bdcf21fd3a14260d301ec55d107/w200_u90.jpg)
![Gefährliche Tiere [Wieso? Weshalb? Warum? ERSTLESER Folge 16] - Karin Müller - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c10a25e74908281ea7d5d19925efe1e9/w200_u90.jpg)