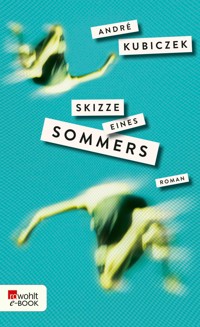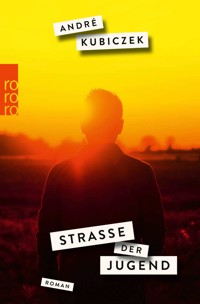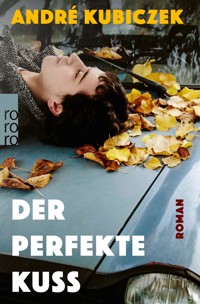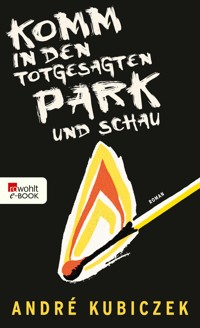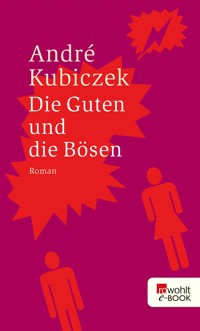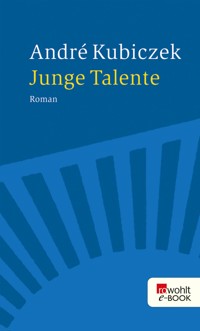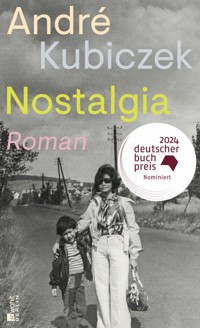
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1968: Teo, eine junge Laotin, kommt am Berliner Ostbahnhof an. Es ist die Liebe, die sie in die DDR führt, weit weg von ihrer Familie. Doch ihr neues Leben in Potsdam, scheinbar ein sozialistisches Idyll, ist schwer, und auch perfektes Deutsch kommt gegen die Fremdheit, die man sie als Asiatin jeden Tag spüren lässt, nicht an. – Weihnachten 1982: André, Teos Sohn, ist dreizehn und wünscht sich nur eines: den Schikanen seiner Lehrerin entgehen und möglichst nicht auffallen, was nicht so einfach ist als halblaotischer DDR-Bürger mit einem behinderten jüngeren Bruder. Trotzdem ist eigentlich alles ganz schön, solange seine Mutter nicht wieder krank wird, solange sein Bruder nicht ausrastet, solange die Mutter und die Großmutter sich vertragen. Doch dann erschüttern mehrere Schicksalsschläge die Familie. «Nostalgia», André Kubiczeks vielleicht persönlichstes Buch, handelt von seiner Beziehung zur Mutter, die versuchte, in der Fremde eine Heimat zu finden. Dabei entsteht ein etwas anderes Bild vom Leben in der DDR – aus migrantischer Perspektive. Ein Roman, der einfühlsam und voller Wärme von Vertrautheit, Fremdsein und Liebe über Kulturen und Vorurteile hinweg erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
André Kubiczek
Nostalgia
Roman
Über dieses Buch
1968: Teo, eine junge Laotin, kommt am Berliner Ostbahnhof an. Es ist die Liebe, die sie in die DDR führt, weit weg von ihrer Familie. Doch ihr neues Leben in Potsdam, scheinbar ein sozialistisches Idyll, ist schwer, und auch perfektes Deutsch kommt gegen die Fremdheit, die man sie als Asiatin jeden Tag spüren lässt, nicht an.
Weihnachten 1982: André, Teos Sohn, ist dreizehn und wünscht sich nur eines: den Schikanen seiner Lehrerin zu entgehen und möglichst nicht aufzufallen, was nicht so einfach ist als halblaotischer DDR-Bürger mit einem behinderten jüngeren Bruder. Trotzdem ist eigentlich alles ganz schön, solange seine Mutter nicht wieder krank wird, solange sein Bruder nicht ausrastet, solange die Mutter und die Großmutter sich vertragen. Doch dann erschüttern mehrere Schicksalsschläge die Familie.
«Nostalgia», André Kubiczeks vielleicht persönlichstes Buch, handelt von seiner Beziehung zur Mutter, die versuchte, in der Fremde eine Heimat zu finden. Dabei entsteht ein etwas anderes Bild vom Leben in der DDR – aus migrantischer Perspektive. Ein Roman, der einfühlsam und voller Wärme von Vertrautheit, Fremdsein und Liebe über Kulturen und Vorurteile hinweg erzählt.
Vita
André Kubiczek wurde 1969 als Sohn eines deutschen Vaters und einer laotischen Mutter in Potsdam geboren. 2002 erschien sein Debüt «Junge Talente», auf das mehrere hochgelobte Romane folgten. Er wurde mit dem Candide-Preis ausgezeichnet, «Skizze eines Sommers» (2016) stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschienen «Straße der Jugend» (2020) und «Der perfekte Kuss» (2022). André Kubiczek lebt in Berlin. Die «Berliner Zeitung» schrieb über ihn: «Er baut eine atmosphärische Dichte und Intensität auf, das ist die besondere Kunst dieses Autors.»
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung André Kubiczek
ISBN 978-3-644-01692-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Tochter Nike
Born
Born to be alive
(Born to be alive)
Patrick Hernandez
Erster Teil
1981
Noch mal raus
Es ist schon dunkel draußen, als er die Wohnung verlässt. Nichts hat er getan, seit er aus der Schule zurück ist, als auf den Augenblick zu warten, in dem er die Tür öffnen kann, um heute ein zweites Mal aus dem Haus zu treten.
Im orangefarbenen Licht der Laternen vor dem Block kann man den Schnee schräg fallen sehen, was bedeutet, dass es nicht nur kalt ist, sondern auch windig.
Bevor er zur Straßenbahn losläuft, bleibt er eine Weile unter der Überdachung stehen, ein Torbogen aus zwei senkrechten Betonplatten und einer waagerechten darüber. So kann sich sein Körper an die widrigen Bedingungen hier draußen gewöhnen, an die Minusgrade und den schneidenden Wind. Das ist genau wie beim Badengehen an einem heißen Sommertag.
Der Schnee von letzter Nacht ist geräumt. In großen Klumpen türmt er sich an Straßen und Wegen. Es sind ganze Reihen von Klumpen, Schneeklumpenreihen. Wie kleine Gebirgszüge sehen die Klumpen aus, wie Hügelketten. Die größten Erhebungen, die nun den Bordsteinrand bevölkern, messen um die sechzig bis achtzig Zentimeter. Die gehen ihm bis zur Hüfte, schätzt er.
‹Bevölkern›?
Das klingt komisch, überlegt er. Ist Schnee überhaupt in der Lage, einen Straßenrand zu bevölkern? Ob ein Wort passt, kann man herausfinden, indem man es sich eine Weile auf der Zunge zergehen lässt. Das hat ihm Papa beigebracht. Man muss es kurz untersuchen.
Woher kommt denn das Verb ‹bevölkern›?
Von ‹Völker›, klar.
‹Völker› wie in ‹Völkerverständigung›, ein Wort aus den Nachrichten, oder wie in ‹Völkerball›, ein Wort aus dem Sportunterricht. Der Sportlehrer hat ihnen das mal erklärt: Völkerball ist wie Krieg auf dem Sportplatz. Aber Völkerball ist besser als Krieg, denn der Kampf ist nur symbolisch. Wer Völkerball spielt, statt einen wirklichen Krieg zu führen mit Waffen, ist ein Freund des Friedens. Deswegen ist Völkerball, wenn man genauer hinguckt, ein Mittel zur Völkerverständigung. Oder so ähnlich.
Er selbst ist ziemlich gut im Völkerball. Seine Wurfkraft ist zwar begrenzt, weil seine Arme kürzer sind als die von Michael oder Jochen, doch ist er schneller als sie. Weil er außerdem klein ist, bietet er der anderen Mannschaft, die das feindliche Volk darstellt, weniger Abwurffläche als die meisten Mitschüler.
‹Völker› ist der Plural des Substantivs ‹Volk›.
Ein Volk ist eine Ansammlung von Menschen.
Am besten hat es Thomas beim Völkerball. Er ist nicht richtig groß und nicht richtig klein. Er ist einigermaßen flink, und sein Wurf ist ausreichend stark, stärker als der Durchschnitt. Darauf kommt es an, denn die, die noch schärfer werfen können als Thomas, sind viel langsamer beim Ausweichen.
Eine Familie, überlegt er, ist auch eine Ansammlung von Menschen. Was ist da jetzt der Unterschied zum Volk?
Volk ist eine große Ansammlung von Menschen, Familie dagegen eine kleine. Familie ist sogar die kleinstmögliche Ansammlung von Menschen, die zusammengehören. Oder ist es das Paar? Doch zwei Menschen allein sind noch keine Ansammlung. Eine Ansammlung ist ja im Prinzip das Gleiche wie eine Gruppe. Wäre auch ein Paar eine Ansammlung beziehungsweise Gruppe, würde man es doch nicht ‹Paar› nennen, sondern ‹Zweiergruppe›. Noch nie aber hat er seine Oma abends beim Fernsehen ausrufen hören: «Was für eine schöne Liebeszweiergruppe!»
Ein Ehepaar mit Kind dagegen ist durchaus eine Gruppe, denn schon ein Paar mit nur einem Kind hat das Recht, den Titel ‹Familie› zu führen.
Wenn Familie die kleinste Ansammlung zusammengehöriger Menschen ist, überlegt er, dann ist Volk die größte. In einer Familie sind alle miteinander verwandt. In einem Volk sind zwar auch einige mit einigen anderen verwandt, aber die entscheidende Gemeinsamkeit besteht doch darin, dass sie alle dieselbe Sprache sprechen. Von Natur aus. Seit sie klein sind. Die Mitglieder eines Volks haben alle dieselbe Sprache mit der Muttermilch eingesogen, weshalb diese Sprache Muttersprache genannt wird. Wahrscheinlich heißt sie eher so, weil sie einem von der Mutter beigebracht wird, denn die Mütter sind seit Menschengedenken fürs Reden mit den Babys zuständig. Die Väter dagegen eher für die Jagd. Ob das heute noch stimmt, kann jeder an den eigenen Eltern überprüfen.
In seinem Fall stimmt das noch. Also dass die Mutter mehr mit einem redet als der Vater, obwohl der natürlich nicht zur Jagd geht, wenn er morgens das Haus verlässt, sondern in die Akademie. Statt eines Speers führt er einen Aktenkoffer mit sich.
Dass das alles so gekommen ist, liegt an der Evolution, gegen die man sich nicht wehren kann. Die Evolution arbeitet im Verborgenen, und erst Millionen Jahre später, wenn man selbst längst tot ist, kann man sehen, was sie angerichtet hat. Dann gibt es plötzlich keine Dinosaurier mehr, und einigen Fischen sind Füße gewachsen, mit denen sie fortan an Land herumlaufen. Noch später lernen sie, aufrecht zu gehen, und sie lernen zu angeln, und eines Tages haben sie auch keine Scheu mehr, ihres ehemalig Gleichen zu verspeisen. Die Evolution ist das, was für Oma und Opa Gott ist. Man muss nicht daran glauben, aber sie wirkt trotzdem.
Als die Kinder noch Urmenschen waren, mussten sie viel mehr im Haushalt helfen als die Kinder heute, die hauptsächlich gut in der Schule sein sollen. Doch selbst wenn man gut in der Schule ist, garantiert das nicht automatisch Freizeit zum Lohn.
Er zum Beispiel muss trotzdem alle zwei Wochen in die Reinigung rüber nach Waldstadt I, und in die Kaufhalle muss er sogar alle zwei, drei Tage. Er muss jede Woche die Treppe wischen. Am Wochenende muss er in den Garten zum Unkrautjäten. Wenn die Jahreszeit ungünstig ist, muss er dort Johannis- und Stachelbeeren ernten, die auch reif noch so sauer sind, dass sie zur Strafe hängen bleiben sollten.
Weil sein Bruder zu doof ist, solche Sachen zu erledigen, bleibt auch dessen Anteil an der ganzen Arbeit an ihm kleben, denn alle sind ja froh, dass sein Bruder überhaupt noch lebt. Außerdem ist er die Woche über gar nicht mehr da, sondern in Glindow. Man muss das abwägen: Ein toter Bruder würde einem genauso wenig die Hälfte der Hausarbeit abnehmen, wie es der lebendige tut, der das nicht kann. Dann lieber so, wie es gerade ist.
Hoffentlich bleibt eine Weile alles so, wie es gerade ist.
Wäre er schlechter in der Schule, müsste er vielleicht weniger im Haushalt helfen und dürfte stattdessen in seinem Zimmer bleiben, um zu lernen. Andererseits müsste er sich ständig das Gemecker anhören wegen der vielen Zweien, die er nach Hause bringt. Das kann keiner wollen.
Weil Mama Deutsch erst gelernt hat, als sie schon erwachsen war, gehört sie nicht zum Volk, das hier ansässig ist. Andere Sprachen als die Muttersprache heißen Fremdsprachen, und für wen Deutsch eine Fremdsprache ist, der ist demzufolge ein Fremder auf dem Territorium, wo die Muttersprache gesprochen wird.
Das ist logisch, denn wäre es nicht logisch, hätte er es gar nicht kapieren können. Trotzdem ist es eigentlich Mist. Papa sagt nämlich, dass Mama Deutsch spricht ohne Akzent, was bedeutet, man kann ihr gar nicht anhören, dass Deutsch nicht die Muttersprache ist, die ihr einst vom Schicksal zugeteilt wurde. Denn das ist Laotisch. Doch das nützt ihr nichts, denn Mama sieht nicht aus wie jemand, der ohne Akzent Deutsch spricht. Bevor die Leute Mama reden hören, können sie Mama sehen, denn das Licht ist bekanntlich schneller als der Schall.
Die Mutter von Michael aus seiner Klasse ist Russin, das heißt Bürgerin der Sowjetunion. Sie spricht Deutsch mit viel Akzent. Doch zumindest von Weitem sieht sie aus, als würde sie Deutsch ohne Akzent sprechen. Irgendwie ist das ungerecht.
Mama gehört nicht richtig zum Volk der DDR-Bürger, obwohl sie einen entsprechenden Personalausweis besitzt. Doch was nützt ihr der? Sie kann doch nicht jedes Mal ihren Ausweis vorzeigen, wenn einer komisch guckt in der Kaufhalle oder in der Straßenbahn. Weil Mama nicht aussieht wie original von hier, sieht er leider auch nicht so aus. Das nennt sich Vererbung. Er besitzt noch nicht mal einen Personalausweis, den er vorzeigen könnte, wenn ihn die Leute anstarren. Erst in zwei Jahren kriegt er einen.
Weil Michaels Mutter von Weitem aussieht, als stamme sie original aus der DDR, sieht auch Michael so aus.
Statt sich an die Kälte zu gewöhnen wie gehofft, friert er immer mehr. Er zittert ja regelrecht! Bewegung würde vielleicht helfen, und ohnehin wird es langsam Zeit, dass er losgeht, denkt er und steigt die Betonstufen runter, die auf den kurzen Weg führen, der ihren Hauseingang mit dem Bürgersteig verbindet.
Der einzelne Mensch, das Paar, die Familie, das Volk: So ist die Reihenfolge in der Nahrungskette.
Quatsch, das ist das falsche Wort. Wäre ‹Hackordnung› richtiger?
Schon wenn man abends vor dem Einschlafen ganz normale Wörter halblaut vor sich hin sagt, fangen sie nach dem zwanzigsten Mal an, komisch zu klingen: Bett, Mond, Gardine. Nach dem circa dreißigsten Mal verlieren sie ihre Bedeutung und sind nicht mehr als Grunzlaute. Dann fühlt man sich in seinem Kinderzimmer in der warmen Neubauwohnung wie ein Neandertaler, und dann schläft man ein.
‹Hackordnung›.
Wer hackt denn da? Holzfäller hacken auf Bäume ein. Und Hühner hacken. Aber ein Huhn hackt dem anderen kein Auge aus, wie das Sprichwort sagt. Also hackt eher der Hahn nach den Hühnern. Oder hackt ein Hahn nach anderen Hähnen? Oder hackt der stärkste Hahn nach den schwächeren Hähnen, die sich nicht trauen, zurückzuhacken? Das könnte es sein. Papa benutzt das Wort oft, wenn er mit Mama über die Arbeit spricht. Die Hackordnung ist die Ordnung des Hackens, das Gesetz, wer nach wem hacken darf, ohne dass er was zurückkriegt. Doch was macht der zweitstärkste Hahn mit dem drittstärksten? Egal: Die Hackordnung ist die Rangordnung des Hackens.
Na, das ist doch genau das Wort, was er gesucht hat: ‹Rangordnung›. Was steht also noch über dem Volk in der Rangordnung? Abgesehen von der Evolution? Oder, in Omas und Opas Fall, abgesehen von Gott? Das kann ja nur eines sein: alle Völker zusammen. Aber wie lautet das Wort dafür? Für alle Menschen auf der Welt? Für alle Mitglieder ihrer eigenen Völker?
Es gibt für fast alles Komplizierte einen Begriff, der es kurz zusammenfasst, damit man es sich besser merken kann.
Alle Völker zusammen sind … der Völkerbund?
Nein, das war noch mal was anderes. Er hat das Wort schon öfter gehört, doch weiß gerade nicht mehr, was es bedeutet.
Noch ein Versuch: Alle Völker zusammen sind … die Volksgemeinschaft? Nein, das ist auch was anderes. Wenn überhaupt im Plural, die Völkergemeinschaft.
Sind alle Menschen zusammen dementsprechend die Menschengemeinschaft? Klingt komisch, könnte aber trotzdem hinhauen. Vielleicht eher: ‹Die Menschenheit›? Nein, da stimmt irgendwas nicht. Die Menschheit, wenn überhaupt, müsste es heißen. Genau: Die Menschheit ist das oberste Glied in der Hackordnung der Welt. Das ist so ein Wort, das man jeden Tag hundertmal hört, aber wenn man danach sucht, kommt man nicht drauf.
Alle Teilnehmer der Menschheit haben gemeinsam, dass sie von den Affen abstammen, die sich ihrerseits von denjenigen Fischen ableiten, die einst aus dem Meer gelaufen kamen. Das war es!
Er hat das gute Gefühl, ein kniffliges Rätsel gelöst zu haben. Er ist von ganz alleine drauf gekommen, nur mithilfe von Logik und Verstand. Papa wäre stolz auf ihn. Doch wie sollte er ihm davon erzählen? Er müsste umständlich ausholen, und dafür fehlt Papa die Zeit. Papa ist oft ungeduldig, denn meistens wartet in seinem Arbeitszimmer noch Arbeit auf ihn, die erledigt werden muss.
Nun braucht er nur noch die Ausgangsfrage zu beantworten, die ihn überhaupt auf das Lösungswort ‹Menschheit› gebracht hat, dann ist der Fall abgeschlossen. Genau so arbeitet Sherlock Holmes: ermitteln, eine Beweiskette bilden, Schlussfolgerungen ziehen und am Ende alles zusammenfassen am lodernden Kamin für Dr. Watson.
Können also Hügel aus zusammengeschobenem Schnee von gestern den Straßenrand bevölkern?
Nein, das können sie nicht. Bevölkern kann einen Ort nur etwas, das lebt, so, wie die Menschheit die Erde bevölkert.
Q.E.D., denkt er. Seit diesem Schuljahr haben sie neue Fächer dazubekommen. Zum Beispiel Chemie, Physik und Biologie. Und Englisch.
Jetzt, da das Problem geklärt ist, könnte er eigentlich losgehen, aber er weiß, dass er während der ersten Schritte noch stärker frieren wird als beim Stillstehen vor der Haustür, wo er dem schneidenden Wind weniger Angriffsfläche bietet. Er hätte die Trainingsjacke aus seinem Sportbeutel herausholen und unter den Parka ziehen sollen.
Mama und er haben den Parka schon im September gekauft, als es noch warm war. Der Parka ist grün, hat eine Kapuze und ein herausnehmbares Fell, das man mit Druckknöpfen an seiner Außenhülle befestigt. Es ist kein echtes Fell wie vom Bären oder Fuchs, es fasst sich eher an, als wäre ein großes Plüschtier gehäutet worden. Deshalb hält das Fell auch nicht so warm, wie ein echtes es wahrscheinlich täte, und im Nacken fängt es bereits an zu verfilzen. In den Ärmeln gibt es kein Fell, nur einen zweiten Ärmel aus dünnem Stoff, den man dort hineinknöpft und der beim Anziehen verrutscht oder sich verdreht, passt man nicht auf wie ein Schießhund. Der neue Parka hat jedoch einen Vorteil. Es handelt sich um eine Mehrzweckjacke, was bedeutet, dass man ihn auch in der Übergangszeit benutzen kann. Ohne das dämliche Fell ist er sogar relativ bequem. Außerdem sieht man in einem Parka nicht mehr aus wie ein kleines Kind. Kleine Kinder nämlich tragen Anoraks.
Letztes Jahr hatte auch er noch einen Anorak, aber immerhin einen aus dem Westen. So gut wie neu ist der, hat Oma gesagt, doch an den Bündchen gab es winzige, speckige Abreibungen. Der Anorak war dunkelblau und weiß und hatte breite Plastereißverschlüsse, die auch weiß waren. Mama hat gesagt, für einen Winter sei die noch gut, und Oma hat gesagt, dass das eine Skijacke ist, und Jungs und Mädchen würden die gleichermaßen tragen, aber die Jacke hat vorher Jutta gehört.
Oma ist Juttas Tante, weil Jutta die Tochter von Omas Bruder im Westen ist. Deshalb ist Papa der Cousin von Jutta, obwohl er viel älter ist als seine Cousine. Eigentlich ist das alles egal, denn Papa darf sich sowieso nicht mit Jutta treffen oder mit Juttas Vater, der sein Onkel ist, oder mit seiner eigenen Oma, denn die alle wohnen bei Hannover, und Westkontakte sind wegen seiner Arbeit streng verboten.
Es wäre besser, wenn Jutta ein Junge wäre. Dann gäbe es nicht immer diese Diskussionen wegen ihrer zu klein gewordenen Anziehsachen. Das Beste, was sie je geschickt hat, war eine Kiste mit Lego. Man konnte daraus gut ein Einfamilienhaus bauen, für ein Hochhaus haben die Steine nicht gereicht, obwohl es wirklich viele waren.
Am neuen Parka stört ihn neben dem komischen Fell am meisten, dass jeder Zweite in der Stadt den gleichen trägt, beziehungsweise weil Papa sagt, er solle nicht immer so schamlos übertreiben: jeder Dritte bis Vierte.
Allein bei ihnen in der 7b sind es zwei Jungs, Ralf und er. Jochen besitzt zwar auch einen Parka, aber der stammt von drüben und ist von C&A. Ein schwarzes Pferd, das sich aufbäumt, mit drei bunten Punkten ist das Erkennungszeichen von C&A, hat Jochen erklärt. Jochens Parka hat extra Ellbogenaufnäher, er ist olivgrün, und sein Fell hat die gleiche Farbe wie die Außenhülle in etwas heller.
Das Fell seines eigenen Parkas dagegen ist kackbraun. Das stammt nicht von ihm, das Wort. Papa hat ‹kackbraun› gesagt, als sie ihm abends nach dem Einkaufsbummel den neuen Parka vorgeführt haben. Papa hat das als Scherz gemeint, das war klar, aber Mama hat ihn angezischt und böse geguckt und dann was auf Russisch zu ihm gesagt, und da ist ihm das Lachen vergangen.
Wenn Mama und Papa nicht wollen, dass er sie versteht, unterhalten sie sich auf Russisch. Das können sie gut, weil sie in Moskau studiert haben. Man könnte sie für echte Sowjetbürger halten, nur dass Mama besser angezogen ist, und so stark geschminkt wie eine Sowjetfrau ist sie auch nicht.
Aleng, sein Bruder, versteht oft nicht mal was, wenn Deutsch geredet wird. Er hört einfach nicht hin, wenn er nicht hinhören will. Er tut auch nicht so, als würde er nichts hören, sondern er schaltet wirklich seine Ohren aus. Er ist der einzige Mensch, der das kann. Vielleicht sind seine Ohren ja immer auf Aus gestellt, und nur wenn er jemandem zuhören will, schaltet er sie extra ein.
Manchmal wäre er lieber in der Klasse 7a statt in der 7b, nicht nur wegen der vielen gleichen Parkas, sondern vor allem wegen Frau Rakotsche, ihrer Klassenlehrerin. Aber das ist ein eigenes Thema, das unnötig die besinnliche Zeit zerstört, die gerade beginnt.
Michael muss auch diesen Winter noch einen Anorak tragen, was komisch aussieht, denn er ist einer der größten Jungen in der 7b. Er ist breit und hat viele Muskeln, weil er dreimal pro Woche zum Rudertraining geht. Er behauptet, dass er das freiwillig macht, um übernächstes Jahr auf die KJS delegiert zu werden, eine Schule, auf der hauptsächlich Sport unterrichtet wird. Dann kann er später ins Ausland fahren und an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnehmen.
Der Anorak ist Michael mindestens eine Nummer zu klein. Wenn er die Arme hochreißt auf dem Pausenhof, rutschen ihm die Ärmel bis zu den Ellbogen hoch. Da wird einem schon beim Zugucken kalt. Auch den nackten Bauch kann man dann sehen, denn Pullover und Unterhemd rutschen mit nach oben.
So würde Mama ihn nie rumlaufen lassen: in zu kleinen Sachen oder mit Hochwasserhosen.
Thomas aus seiner Klasse hat einen echten Shell-Parka. Der ist länger als ein normaler, dunkelgrün und aus anderem Stoff. Shell ist eine große West-Firma für Benzin oder so was Ähnliches. Die DDR-Parkas, meint Thomas, sind schlecht gemachte Kopien. Das hat er gesagt, als es noch ziemlich warm war und man im Blouson zur Schule kommen konnte oder ganz ohne Jacke. Thomas ist da trotzdem schon im Shell-Parka aufgetaucht, und in seinem eigenen Kleiderschrank hing da leider auch längst diese nachgemachte Parka-Kopie mit kackbraunem Fell.
Wenn Mama nächsten September fragt, ob ihm die Wintersachen noch passen, wird er einfach behaupten, dass ihm der Parka zu klein geworden sei. Sie glaubt ihm auch, wenn er sagt, dass ihn die Schuhe anfangen zu drücken, ohne ewig und drei Tage an den Füßen herumzukneten, wie Oma das macht. Er kann nur beten, dass es Jutta in der Zwischenzeit nicht schafft, eine weitere Mädchenjacke zu schicken.
Wenigstens erspart ihm die warme Kapuze seines hässlichen Parkas, eine Bommelmütze tragen zu müssen. Bommelmütze ist neben Anorak ein weiteres untrügliches Zeichen für Kleinkind. Weil Michaels Anorak bloß eine dünne Kapuze für Notfälle besitzt, die man aus einer Geheimtasche im Kragen hervorpopeln muss, trägt er in diesem Winter immer noch Bommelmütze.
Letzte Woche, als es wie wahnsinnig geschneit hat in der großen Pause und Michael seine Mütze im Klassenraum vergessen hatte, musste er die Notfallkapuze aus seinem Anorakkragen aufsetzen. Sogar die Kapuzenbänder hat er unter seinem Kinn festgebunden, so eisig hat der Wind auf dem Schulhof gepfiffen.
Als es zum Unterricht klingelte, ist er nicht mit den anderen zurück in die Klasse, sondern in der ersten Etage zum Klo abgebogen, gegenüber dem Lehrerzimmer. Erst als schon alle neben ihren Bänken standen und auf die Meldung zum Unterricht warteten, kam er hereingestürzt. Statt den Anorak draußen auszuziehen und an den Haken zu hängen, damit er trocknen kann, hatte er ihn noch an. Selbst die Kapuze saß noch auf seinem Kopf, und im hellen Neonlicht konnte man jetzt sehen, wie sehr ihn die Kapuze verunstaltet. Vielleicht lag es an den Kapuzenbändern, die er zu fest unterm Kinn verschnürt hatte. Seine Stirn jedenfalls war ganz verschrumpelt, und die Augen waren halb zugedrückt. Sein Mund stand spitz nach vorne, und an den Seiten sind die Wangen rausgequollen. Komischerweise aber steckten seine Arme nicht mehr in den Ärmeln, weshalb der Anorak wie ein zu kurz geratener Umhang an ihm wirkte, fast wie bei Zorro, nur in Hellblau.
Michael hat sich hinter ihn gestellt, weil das im Sitzplan so festgelegt ist, und Kathrin, die Gruppenratsvorsitzende, hat Michael zwar komisch angeguckt, aber trotzdem hat sie Frau Rakotsche vorschriftsgemäß Meldung erstattet: «Die Klasse 7b ist vollständig zum Unterricht angetreten.»
«Für Frieden und Sozialismus», hat Frau Rakotsche vorn an der Tafel gerufen, «seid bereit!»
«Immer bereit», hat die 7b geantwortet.
Einige haben den rechten Arm zum Pioniergruß über dem Kopf angewinkelt. Die meisten lassen den Arm einfach an der Seite runterhängen, sogar bei einer wie Frau Rakotsche.
Mit Martin und Thomas haben sie ausgemacht, ‹Immer breit!› zu sagen statt ‹Immer bereit!›, woran er sich seitdem hält. Nicht, dass er es herausschreien würde, aber wenn alle anderen still wären, könnte man es deutlich hören.
Immer breit, hat Thomas erzählt, heißt nämlich: immer besoffen.
Weil Thomas zwei ältere Brüder hat, wird das schon stimmen.
«Setzen!», hat Frau Rakotsche gesagt, und alle haben sich hingesetzt. Als das Quietschen und Scharren der Stühle auf dem Linoleum beendet war, aber Frau Rakotsche trotzdem nicht zu sprechen anfing, konnte man merken, dass etwas nicht stimmt.
Er hat sich kurz umgedreht, und da stand immer noch Michael in seinem Anorakumhang. Sein Gesicht war jetzt nicht nur zusammengezogen, als hätte er in eine Zitrone gebissen, sondern obendrein rot angelaufen, als würde er gleich ersticken.
«Du siehst aus wie ein Riesenbaby, Michael», hat Frau Rakotsche endlich gesagt und ihren Blick durch den Klassenraum wandern lassen, doch niemand hat gelacht.
Frau Rakotsche trägt eine Brille, an deren Bügeln eine Kette aus nachgemachtem Gold befestigt ist. Frau Rakotsche trägt braune Röcke und altmodische Blusen, die aussehen, als stammten sie aus dem letzten Weltkrieg, von dem sie dauernd erzählt. Über die ausgeleierten Blusen zieht sie im Herbst und im Winter selbst gestrickte Pullover ohne Ärmel.
Es war ganz schnell vorbei mit dem Lachen über die Scherze von Frau Rakotsche, höchstens in der ersten Woche der fünften Klasse, als Frau Rakotsche frisch Fräulein Heumann abgelöst hatte, waren solche Sachen lustig. Heute lacht keiner mehr. Jeder weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er selber dran ist. Am häufigsten trifft es Anne und Susanne. Sie sind am weitesten entwickelt, denn sie besitzen bereits Brüste unter ihrer Kleidung. Mit eingefrorenem Lächeln um den Mund lassen sie die Beschimpfungen über sich ergehen. Man kann sehen, dass sie im Inneren die Augen verdrehen, während Frau Rakotsche hässlich auf sie einredet. Das bewundert er sehr. Es ist toll, wie sie das jede Woche aushalten. Wenn sie mal wirklich die Augen verdrehen, sieht es aus, als würden sie dabei im Inneren Kaugummi kauen.
Als sie im September, am ersten Schultag nach den großen Ferien, mit roten Lippen ankamen, hat Frau Rakotsche sie als Bordsteinschwalben beschimpft. Bestimmt zehn Minuten ging das so, ohne dass einer wusste, was das ist: Bordsteinschwalben. Schwalbe ist eine Mopedart, beziehungsweise ein Vogel, und Bordstein ist die Kante zur Straße, hinter der der Bürgersteig beginnt. Aber wie hängt das zusammen?
Sogar Thomas war da am Ende mit seinem Latein, Mama mit ihrer fremden Muttersprache wollte er nicht fragen, und Papa hat für solche Lappalien keine Zeit. Das ist ein Lieblingswort von Papa: ‹Lappalien›. Könnte im Prinzip auch ein Land sein: Volksrepublik Lappalien.
Eine Bordsteinschwalbe ist ein leichtes Mädchen, hat Thomas am nächsten Tag erzählt. Ach so, haben die anderen Jungs in der Hofpause gesagt, als wäre ihnen wenigstens bekannt, was ein leichtes Mädchen ist.
Wahrscheinlich ist das ein Mädchen, das leicht einen Jungen zum Freund bekommt, der ein Moped besitzt, hat er bei sich gedacht. Manchmal warten solche älteren Jungs, die bereits eine Lehre machen, vor der Schule auf die Mädchen aus der Zehnten.
«Herrgott, jetzt guck nicht wie die Kuh vorm neuen Tor», hat Frau Rakotsche als Nächstes ihn angepflaumt, «sondern hilf ihm lieber!»
Er ist aufgestanden. Er hat sich umgedreht: Wie soll er Michael denn helfen, hat er sich gefragt? Aber da hat sich Michael schon runtergebeugt wegen des Höhenunterschiedes zwischen ihnen und ihm das Kinn entgegengestreckt.
Jetzt konnte er den Knoten erkennen, zu dem die Enden der Kapuzenbänder verschmolzen waren, wahrscheinlich durch Michaels verzweifeltes Ziehen daran. Das waren keine ineinander verschlungenen Kapuzenbandstränge mehr, sondern ein einziger festgezurrter, harter, kleiner Ball, der getränkt war von Spucke. Und mehr Spucke kam von oben nachgeflossen, und Rotze aus der Nase hat sich unter die Spucke gemischt. Michaels ganzes Kinn war von einem schleimigen Film überzogen, und da sollte er hinfassen?
«Was ist denn nun?», hat Frau Rakotsche hinter ihm gemeckert.
Er wusste sofort: Das wird nie im Leben was. Trotzdem hat er mit Zeigefinger und Daumen der rechten Hand versucht, eine Stelle zu ertasten, an der sich der Knoten mit dem Daumennagel lockern lässt. Die Klasse hat sie beide angestarrt, hinten in der Ecke haben zwei Mädchen angefangen zu tuscheln.
«Ruhe», hat Frau Rakotsche geschrien, so laut, dass ihm vor Schreck der glitschige Knoten aus den Fingern gerutscht ist.
Eine Weile hat er so getan, als gäbe es eine Chance, diesen verfluchten Knoten zu lösen, und einfach weiter daran rumgefriemelt, bis Frau Rakotsche ganz ruhig gesagt hat: «Raus jetzt! Macht das gefälligst vor der Tür zu Ende! Ihr zerstört mir den ganzen Unterricht.»
Im Rausgehen hat er gerade noch sein Federmäppchen von der Bank fischen können. Wenn Mama ihn nicht zwingt, darin aufzuräumen, sammelt sich auf dem Grund allerlei Zeug an. Worauf er jetzt gehofft hat, war so was wie eine Büroklammer oder eine Sicherheitsnadel.
Im Treppenhaus haben sie sich erst mal ein paar Sekunden ausgeruht. Aus dem Raum von gegenüber hat man die tiefe Stimme von Herrn Stein gehört, den sie in der neunten Klasse als Mathelehrer kriegen. Herr Stein ist das Licht am Ende des Tunnels. Frau Rakotsche ist der Tunnel.
Im Federmäppchen hat er weder Büroklammer noch Sicherheitsnadel gefunden, aber dafür etwas viel Besseres, an das er gar nicht gedacht hatte: seinen Zirkel.
«Bitte vorsichtig», war überhaupt das Erste, was Michael an diesem Tag zu ihm gesagt hat, als er die Zirkelspitze an den schleimigen Knoten setzen wollte.
«Das klappt sowieso nicht.»
«Willst du es trotzdem probieren?»
Auch bei so etwas muss man abwägen: Rettet man die Kapuzenbänder, indem man eine Verletzung von Michaels Gesicht riskiert, oder lässt man es?
«Nein», hat er gesagt.
«Und jetzt?»
«Durchschneiden, wenn du mich fragst.»
«Wenn’s nicht anders geht.»
«Den Anorak kannst du trotzdem noch anziehen, nur die Kapuze hält dann nicht mehr richtig auf dem Kopf.»
«Der Anorak ist mir sowieso zu klein.»
«Könnte stimmen.»
«Na, dann mach es!»
«Durchschneiden?», hat er gefragt und den Zirkel weggelegt, der wie ein Dolch auf Michaels Kinn gerichtet war.
«Ja.»
«Hast du eine Schere?»
«Ist denn in deiner Federtasche keine?»
«In meiner Mappe ist eine, aber ich geh auf keinen Fall zu der Rakotsche rein, um die zu holen.»
«Ich auch nicht.»
«Warte mal», hat Michael gesagt und seinen Wohnungsschlüssel aus der Hosentasche gezogen. «Damit könnte es klappen.»
«Ich soll das Band durchrubbeln?»
«Ja», hat Michael gesagt, ihm die Schlüssel gegeben und dann den Kopf in den Nacken gelegt, damit er besser an das Kapuzenband kommt.
«Stillhalten musst du trotzdem», hat er gesagt und das Kapuzenband mit Zeigefinger und Daumen der linken Hand ein Stück von Michaels Kinn weggezogen und mit der rechten den Schlüssel angesetzt. Zweimal hat er zur Probe vorsichtig hin- und hergesägt und gemerkt, dass es mit ein bisschen mehr Druck tatsächlich klappen könnte, denn das Band war schon richtig weich durch die Spucke.
Keine drei Sekunden hat er mit der zerklüfteten Schlüsselkante an dem Kapuzenband sägen müssen, bevor die ersten Fasern durchtrennt waren.
«Nur ein dünner Faden noch», hat er gesagt, als Michael angefangen hat, schwer zu atmen, ja fast zu keuchen. Das macht es für den Mann an der Säge nicht unbedingt einfacher.
«Puh», hat Michael gemacht, als dann wirklich alle Fäden gerissen waren, und sich den Hals gerieben, als wäre er in letzter Sekunde vom Galgen abgeschnitten worden, und im nächsten Augenblick hat er schon wieder die Türklinke in der Hand gehabt, um unverzüglich in die Höhle des Löwen zurückzukehren.
«Ich geh erst aufs Klo zum Händewaschen», hat er zu Michael gesagt, denn das war bitter nötig.
«Okay», hat Michael gesagt, «ich komm mit», und dann sind sie zusammen über die leeren Flure und Aufgänge der Schule zu den Toiletten gegangen.
«Hast du geheult vorhin?», hat er gefragt, als sie nebeneinander an den Waschbecken standen und das warme Wasser über seine Hände floss.
Er hat ihn dabei im Spiegel angeguckt, statt den Kopf nach rechts zu drehen, wo der echte Michael war, denn über der Reihe von Waschbecken hängt ja eine Reihe von Spiegeln. Und weil an der gegenüberliegenden Seite des Waschraums die gleiche Reihe von Spiegeln über den Waschbecken hängt, kann man einen Blick in die Unendlichkeit werfen. Man muss nur das Spiegelbild seines eigenen Rückens im Spiegel direkt vor sich betrachten. Das ist ein bisschen unheimlich.
«Meine Mutter meint, dass sie deine Mutter kennt», hat Michael gesagt, statt zu antworten, was nichts anderes bedeuten konnte als: Ja, habe ich.
«Woher denn?», hat er gefragt.
«Aus der Akademie.»
«Warum bist du dann nie im Ferienlager?»
«Ich bin im Ferienlager von meinem Vater.»
«Und wo arbeitet der?»
«Beim Zoll.»
«Dann komm doch nächstes Jahr mit zu uns.»
«Ist das gut bei euch?»
«Geht so. Eigentlich schon.»
«Dann sag ich meiner Mutter, dass ich nächstes Jahr mit zu euch will.»
«Echt?»
«Warum denn nicht?», hat Michael gesagt, und dann haben sie sich mit nassen Ärmeln und triefenden Händen auf den Rückweg ins Klassenzimmer gemacht, weil die Handtücher im Waschraum immer vollgesogen sind bis zum Anschlag. Wenn man die aus Versehen benutzt, ist man hinterher nasser als zuvor.
Und man stinkt.
Gut, dass er meistens zu früh losgeht.
Das hat er von Papa geerbt, sagt Mama. Er kommt nie zu spät irgendwohin, jedenfalls nie ohne Absicht. Statt nach der letzten Bahn zu rennen, rennt er, wenn überhaupt, nach der vorvorletzten, weil er sogar zu früh für die vorletzte ist. Lieber aber lässt er die fahren und nimmt in aller Ruhe die vorletzte, was den Vorteil hat, dass er nur zehn Minuten zu früh ankommt statt gleich zwanzig. Im Sommer geht das ja noch mit den zwanzig Minuten, da kann man sich auf eine Bank setzen und lesen, im Winter jedoch muss man sich irgendwo drinnen einen Platz suchen wie im Kaufhaus auf dem Boulevard oder in der Volksbuchhandlung am Staudenhof. Kinder ohne Begleitung aber sind dort nicht gern gesehen. Kinder ohne Begleitung werden verdächtigt, kein Geld zu besitzen. Sie werden verdächtigt, herumzulungern, obwohl sie sich bloß kurz aufwärmen wollen.
In kleineren Geschäften sind, wenn man Pech hat, dann die Scheiben von innen beschlagen. Das kommt von der hohen Luftfeuchtigkeit, die die vielen anderen Menschen produzieren, die ebenfalls nur so tun, als würden sie einkaufen wollen. Manchmal ist es so schlimm, dass man überhaupt nicht mehr sehen kann, was in der Außenwelt vor sich geht. Hohe Luftfeuchtigkeit, hat Opa erzählt, erzeugt Schimmel, der auf die Bronchien geht. Weil Opa viel hustet, beschäftigt er sich viel mit Bronchien.
Oma sagt, dass Opas Husten vom Rauchen kommt: «Fünfunddreißig Jahre jeden Tag zwei Päckchen, stell dir das mal vor. Da hilft es auch nichts, dass er aufgehört hat, seit du auf der Welt bist.»
Opa aber sagt, sein Husten käme von der schlechten Luft in Thale, von den stinkenden Abgasen der Hütte, in der er noch ein Jahr lang arbeiten muss, bis er endlich fünfundsechzig ist und Rentner werden darf. Oma ist ja schon lange zu Hause.
«Als du auf die Welt gekommen bist», sagt Oma, «habe ich die Arbeit im Emaillierwerk aufgegeben.» Doch sie meint das nicht als Vorwurf, sondern rein sachlich.
Papa hat mal zu Mama gesagt, dass Opa langsam senil wird. Er hat es zufällig gehört, als er im Schlafanzug zum Gute-Nacht-Sagen ins Wohnzimmer gekommen ist, denn er klopft ja nicht an, bevor er da reingeht.
«Was ist denn senil?», hat er gefragt.
«Man wird vergesslich und redet wirres Zeug», hat Papa gesagt.
Mama und Papa rauchen zum Glück nicht.
Hat er aus Versehen ein Geschäft mit vollständig beschlagenen Scheiben betreten, hält er sofort die Luft an und begibt sich zügig zum Ausgang zurück. Dort bleibt er so lange in der Wärme stehen, bis er fast erstickt. Wenn er sowieso schon verschimmelte Luft in der Lunge hat, kann er sich wenigstens bis zur letzten Sekunde aufwärmen.
Wegen des gefährlichen Schimmels sollte man jeden Tag mindestens eine Stunde lang lüften, hat Opa erklärt. Dreißig Minuten morgens, bevor man zur Arbeit geht, und noch mal dreißig Minuten, wenn man zurück ist und bevor Oma den Kachelofen ein zweites Mal anheizt für den Abend.
Theoretisch kann Opa zwar besser heizen als Oma, aber im richtigen Leben lässt er ihr den Vortritt. Opa holt lieber die Kohlen aus dem Keller hoch und das Holz. Im hinteren Zimmer, wo Opas Schreibtisch steht und der große Geschirrschrank und das Kanapee für den Mittagsschlaf, befindet sich der Kohlekasten aus Metall. Er ist aus schwarzer Emaille mit aufgemalten Blumen und hat vorne eine Klappe, aus der man die Briketts mit einer Kohlenzange entnimmt. Sie hat einen verschnörkelten Griff wie die Kuchenzange beim Bäcker in Babelsberg, wo er mit Mama oft war, als sie noch am Hubertusdamm gelebt haben.
Neben dem Kohlekasten stehen zwei gefüllte Kohleeimer. Dafür zu sorgen, dass sie niemals leer werden, ist Opas Aufgabe im Haushalt, die er sich selbst zugeteilt hat. Deshalb ist er andauernd unten im Keller, um Nachschub zu besorgen. Opa achtet wie ein Schießhund darauf, dass Oma die Briketts mit der Zange aus dem Kohlekasten nimmt und nicht etwa aus einem der Kohleeimer, die danebenstehen. Denn die Kohleeimer, sagt Opa, dienen nur zum Auffüllen des Kohlekastens.
Oma sagt, Opa sei bloß so oft im Keller, weil dort der Rumtopf steht.
«Im Sommer, wenn wir keine Briketts brauchen, ist er trotzdem ständig da unten. Angeblich um Holz zu hacken für den Winter», sagt Oma.
Papa behauptet, Opa habe ihm mal wieder Quatsch erzählt, was das Lüften angeht, und dass er nur Energie verschwendet, wenn er jeden Tag vor der Schule eine halbe Stunde das Fenster aufreißt, zumal bei Minusgraden, wie sie im Moment herrschen. Papa weiß nicht, dass er dasselbe noch einmal am Nachmittag tut, wenn er gegen halb drei nach Hause kommt, denn da ist Papa auf der Arbeit. Sicherheitshalber öffnet er das Kinderzimmerfenster ein letztes Mal vor dem Schlafengehen, bevor er sich ins Bad begibt und danach ins Wohnzimmer, um den Eltern gute Nacht zu sagen.
Er werde mal ein Wörtchen mit Opa reden, jetzt über Weihnachten, hat Papa neulich gesagt, was er hoffentlich vergisst, denn sonst denkt Opa noch, dass er, sein eigener Enkel, ihn an Papa verraten hat, wenn auch nur aus Versehen.
Er zieht sich die Kapuze ein Stück tiefer in die Stirn und reguliert mit den Bändern ihren Sitz, sodass sie etwas enger an den Ohren liegt. Er kontrolliert, ob seine Hosenbeine nicht aus den gefütterten Winterstiefeln gerutscht sind und dass die Enden seines blau-weißen 1.-FC-Magdeburg-Schals, den er Oma zuliebe heute umgebunden hat, nicht unten aus dem Parka rausgucken. Dann endlich verlässt er den Torbogen aus Beton vor ihrem Hauseingang in der Robert-Neddermeyer-Straße 18.
Neddermeyer-Straße
Der Schnee von gestern Nacht ist zwar geräumt worden am Morgen, aber überall liegt wieder neuer. Auf der Straße ist er zu einer breiten Matschrinne zerfahren, auf dem Gehweg festgetreten zu einer zentimeterdicken Schicht, die im Laternenlicht glänzt, so glatt ist sie. Gleich nach der Schule sind die Kinder des Wohngebiets mit ihren Gleitschuhen an den Füßen losgezogen. Er hat es vom Kinderzimmerfenster aus beobachtet, halb verdeckt von der Gardine, damit ihn kein zufälliger Blick von unten trifft. Deshalb hat er auch das Licht ausgelassen, obwohl es schon kurz nach drei so dunkel war, dass er nicht mehr lesen konnte.
Unermüdlich sind die Kinder um den Block gefahren. Er kennt das selber vom Hubertusdamm, wo er all seine Freunde zurücklassen musste wegen des dämlichen Umzugs nach Waldstadt II. Dabei haben sie hier gerade ein Zimmer mehr, das sie nicht mal brauchen, seit Aleng die Woche über im Internat lebt. Die zweieinhalb Zimmer vom Hubertusdamm hätten doch völlig gereicht.
Das halbe Zimmer benutzt Papa zum Arbeiten. Es verfügt über neue Regale, die um seinen Schreibtisch errichtet sind. Papa sammelt darin Aktenordner, Schnellhefter und alte Zeitungen, die noch nicht ins Altpapier kommen, weil sie interessante Artikel enthalten könnten, die er ausschneiden will, wenn er mal Zeit findet. Er will sich ein Archiv bauen, hat Mama erzählt, mit Karteikarten in Kästen.
«Wie in der Kinderbibliothek musst du dir das vorstellen», hat Mama ihm das Prinzip zu erklären versucht, «alles ist alphabetisch nach Stichworten geordnet.»
Er hatte keine Lust, sich das vorzustellen. Dazu fand er die Idee von Papas eigenem Archiv nicht interessant genug.
Kein Wunder: «Lernt stark interessenbetont!», hat Frau Rakotsche in die Beurteilung auf seinem letzten Zeugnis geschrieben. Richtig stolz ist er darauf gewesen – zumal er diesmal nur zwei Zweien hatte, in Kunsterziehung und Musik –, bis Papa ihm am Abend die Augen geöffnet hat.
«Das ist gar nicht gut», hat er mit besorgter Miene gesagt und ungläubig auf die Beurteilung gesehen. «Das muss sich im nächsten Halbjahr ändern!» So beunruhigt ist Papa gewesen, dass es am Ende auch ihm die Freude an den vielen Einsen verhagelt hat.
Das Loben hat Mama am nächsten Tag erledigt. Zusammen mit Aleng sind sie in die Buchhandlung gefahren, und er durfte sich aussuchen, was er wollte. Fünf neue Bücher hat er bekommen. Denn es ist ja so: Je weniger Freunde einer besitzt, desto mehr Bücher benötigt er, um die Zeit bis zum Schlafengehen zu überbrücken. Auch Aleng war zufrieden mit seinen beiden Bilderbüchern.
Es ist ja ein beknacktes Vorurteil, dass geistig Behinderte nicht lesen und schreiben können. Aleng kann nämlich ganz gut schreiben, nur dass er für jeden Buchstaben ewig und drei Tage braucht. Es ist eher gemalte Druckschrift, weil er die einzelnen Buchstaben nicht verbinden kann. Für ein Wort wie ‹Oma› benötigt er eine halbe Minute. Aber man kann es groß und deutlich auf dem Blatt erkennen, und wenn man sagt: «Lies mal vor», dann legt er den Zeigefinger an das Wort, und er sagt, während sein Finger langsam vom O übers M zum A hinüberwandert: «Ooo-mmmmm-aaa.» Denn lesen kann Aleng gleichfalls. Nur die Zeilen dürfen nicht zu lang und die Schrift muss sehr groß sein. Er trägt nämlich eine Brille, die für eine Kinderbrille ziemlich dick ist. Als er sie frisch bekommen hat, war eines der Gläser mit Pflaster zugeklebt, sodass er noch weniger sehen konnte als ohnehin.
«Dein Bruder kommt nach meiner Mutter, und du kommst nach meinem Vater», sagt Mama immer zu ihm, «so wie ich.»
Oma aus Laos ist dick und kann schlecht gehen, denn sie hat insgesamt zwölf Kinder ans Licht der Welt gebracht. Außerdem hat sie bei derselben Aktion, bei der Opa aus Laos umgekommen ist, eine MPi-Salve abgekriegt. MPi ist die Abkürzung für Maschinenpistole, Maschinengewehr heißt abgekürzt MG. Mit einer MPi wird Pistolenmunition verschossen, bei einem MG sind es Gewehrpatronen.
Nach der Buchhandlung sind sie in die Broilerbar gleich um die Ecke gegangen. Jeder hat einen halben Broiler gekriegt mit Pommes frites, und weil das viel zu viel war, haben sie sich die Reste für später zum Kaltessen einpacken lassen. Mama hat am wenigsten geschafft, weshalb Papa eine fast komplette Broiler-Brust zum Abendbrot verzehren konnte. Nur die Haut sei wie Gummi, hat er gesagt. Alle essen am liebsten die knusprige Haut. Bis auf Mama. Mama isst am liebsten die Teile, an denen viele Knochen hängen.
Es macht schreckliche Geräusche, wenn sie das Fleisch abgeknabbert hat und sich dem Rest widmet, den normale Menschen auf den Knochenteller legen. Manchmal nimmt sie sogar ein abgenagtes Hühnerbein noch mal vom Knochenteller, um es mit ihren Kauwerkzeugen zu bearbeiten.
Diese Sitte hat sie aus ihrer anderen Heimat mitgebracht: Hühnerknochen aufbeißen, daran saugen und den Knorpel zerkauen, sodass man richtig Gänsehaut kriegt beim Zuhören. Papa hat erklärt, dass in armen Ländern wie Laos noch der letzte Rest vom Huhn verspeist wird, besonders das nahrhafte Knochenmark und die gesunde Knorpelmasse. Mama sagt, dass auch Oma aus Laos und ihr Mann am Anfang richtig arm gewesen seien, und wenn man als Armer einmal begonnen hat, Knochen auszusaugen und Knorpel zu verzehren, kann man später als Reicher nicht einfach wieder aufhören.
In der Broilerbar hat Mama sich nicht getraut, die Knochen zu knacken, obwohl Aleng und er ihr zugeflüstert haben: «Mach doch ruhig, Mama, es ist so laut hier, das hört sowieso keiner.» Heimlich aber war er trotzdem froh, dass sie damit bis zum Abendbrot gewartet hat.
Gerade fahren Papa und Mama mit dem Auto nach Glindow, um Aleng für die Weihnachts- und Neujahrstage abzuholen. Wie jeden Freitag, wenn er nach Hause kommt, wird Aleng seine Geschichten erzählen, von Erziehern und von Lehrern und von all den anderen Behinderten, die seine Freunde sind. Nie weiß er richtig, wen sein Bruder meint, wer sich hinter den ganzen Namen verbirgt. Aber eigentlich ist es ihm auch egal.
Der hat das gemacht, und dann hat der andere dies getan, und dann hat Frau Sowieso mit mir geschimpft, und zum Mittagessen gab es Suppe. So gehen die Geschichten von Aleng, die eher für Selbstgespräche taugen. Doch sie sind ja alle froh, dass Aleng überhaupt wieder reden kann nach dem langen Koma, und deshalb hört ihm jeder hier eine Weile zu, wenn er Freitagabend von seiner Woche im Internat berichtet.
Seine Gleitschuhe hat Mama beim Umzug weggeworfen, weil die morschen Lederbänder, mit denen man sie an den Stiefeln festmacht, nur noch an einem Faden hingen. Garantiert hätte es Ersatz gegeben im Sporthaus, aber er ist Mama nicht auf die Nerven gefallen damit, weil er insgeheim auf ein Paar Langlauf-Skier gehofft hat stattdessen.
«Waldstadt II heißt doch nicht umsonst so», hat Papa am Hubertusdamm gesagt, als sie schon auf den gepackten Kisten saßen, «das bedeutet doch, dass da, wo jetzt die neuen Wohnhäuser stehen, früher Wald war, und da, wo keine Häuser stehen, ist dann folglich was?»
«Straße?»
«Nein. Denk mal scharf nach!»
«Bürgersteig?»
«Unsinn, da ist natürlich immer noch Wald, unberührter Wald.»
«Hinter der Steinstraße hier bei uns steht auch Wald rum», hat er trotzig gesagt, aber gedacht hat er: Hier sind alle meine Freunde, und sie hatten fünf Jahre Zeit, sich an mich zu gewöhnen, sodass sie längst denken, ich wäre einer von ihnen.
«Aber der ist viel kleiner. Und die Autobahn geht mitten hindurch», hat Papa geantwortet. «Waldstadt II ist ein Wohngebiet mitten im Wald, ideal, um im Winter in aller Ruhe eine Runde Ski zu fahren. Keine Autobahn, auf die man stößt, keine Straße kilometerweit.»
«Ich hab gar keine Skier», hat er Papas Begeisterung dämpfen müssen.
«Warte mal ab», hat Papa geheimnisvoll gesagt, «noch ist nicht aller Tage Abend.» Dann ist er aufgestanden und aus dem Kinderzimmer gegangen, und die Aussprache war beendet.
«Skier in der Stadt lohnen sich nicht», hat Mama eine Woche nach dem Umzug gesagt, als seine Gleitschuhe längst auf dem Schrottplatz lagen.
Jetzt hat er überhaupt nichts, das er sich im Winter unter die Stiefel schnallen kann, denkt er, während er die Neddermeyer-Straße hinunterstapft Richtung Heinrich-Mann-Allee. Genau wo die beiden Straßen aufeinanderstoßen, liegt die Straßenbahnhaltestelle, die erste Etappe seiner heutigen Reise durch Sturm und Eis.
Jetzt besitzt er nur noch den Schlitten, um sich im Winter durch den Schnee zu bewegen, aber der Schlitten steht im Keller, und Papa, der den Kellerschlüssel verwaltet, hatte bisher keine Zeit, ihn hochzuholen. Selbst soll er das nicht machen, und er weiß genau, warum. Damit er nämlich nicht sieht, dass der Keller noch total zugerümpelt ist vom Umzug letztes Jahr.
Wenn am 27. Dezember noch gutes Winterwetter herrscht, kommen Jochen und Ralf vorbei. Sie wollen dann zusammen in den Wald. Falls es vorher zu tauen anfängt, kann er die Verabredung wieder abblasen. Beide haben ja Telefon.
Thomas besitzt zwar auch ein Telefon, aber der kriegt Westbesuch über Weihnachten. Komisch, dass man als Mitglied der Russischschule überhaupt Westverwandte haben darf. Seine eigenen Eltern dürfen das wegen der Akademie nicht, weshalb er niemals Jutta kennenlernen wird, um sich für ihre Skijacke und die Legokiste persönlich zu bedanken.
‹Russischschule› sollen sie eigentlich nicht sagen zu ihrer Schule, sondern ‹Polytechnische Oberschule mit erweitertem Russischunterricht›.
‹Russischschule› sagen nur die Gegner der Schule, behauptet Frau Eckert, ihre Direktorin. Die allergrößten Feinde sagen sogar ‹Russenschule›. Aus denen spricht der Neid, hat Frau Eckert an einem dieser Montagmorgen vor Unterrichtsbeginn erklärt, denn ihre Schule versammelt die hoffnungsvollsten jungen Talente der Stadt. Wenn man ein paar Jahre auf der Russischschule war, glaubt man, die Kinder von den anderen Schulen könnten alle nicht richtig lesen und schreiben.
«Da kommen sie wieder, die Russenknechte aus der Russenschule!», hat ihnen mal einer aus der Nachbarschule hinterhergerufen, der garantiert schon in der Zehnten war. Das müssen dem die Eltern beigebracht habe, denn so was Schlimmes fällt keinem Kind von selbst ein, nicht mal, wenn es schon ein halber Jugendlicher ist.
Hoffentlich kommen Jochen und Ralf nicht mit ihren Skiern, überlegt er, sonst muss er ihnen hinterherdackeln mit seinem Schlitten wie ein räudiger Hund. Vorausgesetzt, Papa hat den Schlitten bis dahin überhaupt aus dem Keller geholt.
Alleine einen Schlitten hinter sich herzuziehen ist jämmerlich. Am Hubertusdamm gab es ein paar Kinder, die das gemacht haben. Weil sie Einzelkinder waren oder ihre Geschwister zu klein oder zu groß, um mit ihnen zu spielen.
Henry war so jemand mit zu altem Bruder, sein bester Freund von gleich gegenüber. Aber Henry hatte zum ja Glück ihn, und er wiederum hatte zum Glück Henry, denn obwohl Aleng nur ein Jahr jünger ist als er selbst, taugt er nicht richtig zum Spielen, weil er geistig behindert ist. Das war er zwar nicht immer, doch jetzt ist er es eben.
Ein behinderter Bruder ist genauso untauglich zum Spielen wie ein Bruder, der ein Baby ist. Ein älterer Bruder kann einem immerhin Sachen beibringen, was man gut an Thomas sieht, der gleich zwei Stück davon hat.
Wenn er Aleng mit dem Schlitten zieht, sitzt der stocksteif hintendrauf und krallt sich an den Hörnern fest, aus Angst runterzufallen, sogar bei weniger als Schritttempo.
Wenn er fragt: «Wollen wir tauschen, und du ziehst mich?», antwortet Aleng: «Das schaff ich sowieso nicht.»
Dass sein Bruder das denkt, ist leider seine Schuld. Vor Ewigkeiten hat er mal heimlich mit den Hacken gebremst, während Aleng gezogen hat, und das muss sich bei ihm eingebrannt haben. Ein unbehindertes Kind würde es ein zweites Mal probieren, aber ein behindertes wie Aleng vertraut der schlechten Erfahrung, die es gemacht hat.
Was soll es, alles Gejammer hilft nicht. Tatsache ist: Er hat keine Gleitschuhe und keine Skier in diesem Winter! So was scheint zu passieren, wenn man langsam aus den Kinderschuhen wächst. Mit Matchbox-Autos spielen macht auch schon keinen Spaß mehr, ausgerechnet jetzt, wo er so viele davon besitzt wie nie zuvor.
Im Januar wird er dreizehn. Dann fehlt noch ein Jahr, und er kriegt den Personalausweis. Wenn das passiert, ist er mitten in der achten Klasse. Anfang der Achten werden sie von Thälmann-Pionieren zu FDJlern befördert, und zur Berufsberatung muss die Klasse dann auch, hat Frau Rakotsche letztens gesagt.
Außerdem kommen NVA-Offiziere vorbei, um die Jungs zu überreden, dass sie Berufssoldaten werden. Anne und Susanne haben sich gefreut, dass die Mädchen an diesen Nachmittagen freihaben, aber Frau Rakotsche hat ihnen sofort einen Strich durch die Rechnung gemacht: Selbst die Mädchen müssen das Gerede über sich ergehen lassen.
Anne und Susanne wissen schon jetzt, was sie werden wollen: Kellnerinnen. Da verdienen sie neben dem normalen Lohn mindestens genauso viel Trinkgeld obendrauf, haben sie gesagt. Am liebsten im Interhotel, direkt an der Havel, wo die Anlegestelle der Weißen Flotte ist. Im Interhotel nämlich gibt es von den Ausländern dort das Trinkgeld in Valuta, was der Oberbegriff für alles Geld aus dem Westen ist, wie er von Papa weiß. Zu Valuta zählen neben D-Mark Schweizer Franken, Pfund Sterling und natürlich Dollars. Valuta kann man in RGW-Geld eintauschen wie Rubel oder Zloty oder Mark der DDR, umgekehrt geht das nicht.
Thomas hat erzählt, dass der Kurs gerade bei eins zu fünfzehn steht, wenn man versucht, unter der Hand zu tauschen.
«Manchmal schießt der Kurs noch höher», hat Thomas erzählt, «dann kriegst du für eine einzige D-Mark zwanzig Mark von unserem Spielgeld.»
«Ich frage mich, warum ihr anderen die begehrten Plätze an unserer Schule wegnehmt, wenn ihr dann doch bloß Kellnerinnen werden wollt», hat Frau Rakotsche geschimpft.
Es ist noch nicht lange her, dass sie zu Beginn des Unterrichts Namen und Berufswunsch auf einen Schmierzettel schreiben mussten. Statt ihnen Mathe beizubringen, hat sich Frau Rakotsche die gesamte Stunde lang die Zettel durchgelesen und zu jedem einzelnen ihren Kommentar abgesondert.
«Na, damit wir unsere Gäste aus dem sozialistischen Ausland gut bewirten können», hat Susanne geantwortet.
«Besonders die aus der Sowjetunion», hat Anne ergänzt.
Da war Frau Rakotsche sprachlos.
Das nennt man Ironie.
Papa hat ihm beigebracht, was das ist: Man sagt etwas, aber so, dass jeder weiß, dass man das Gegenteil von dem meint, was die Worte eigentlich bedeuten. Als Zeichen für Ironie kann man zusätzlich die Augen verdrehen oder Gänsefüßchen in die Luft malen beim Reden. Oder man betont die Worte anders. Bei Menschen, die selber Ironie benutzen, muss man sich normalerweise nicht so das Gesicht verrenken, damit sie merken, was los ist.
Ironie ist eine mächtige Waffe! Bei Susanne und Anne hat sie bewirkt, dass Frau Rakotsche sie in Ruhe gelassen hat an diesem Tag.
Mama benutzt Ironie eher wie ein Laie, was daran liegt, dass sie in Laos nicht so gebräuchlich ist wie hier. Mama übertreibt es damit. Sogar Aleng merkt, dass sie das, was sie gesagt hat, anders meint, wenn sie versucht, ironisch zu reden.
Hundertsiebenundzwanzig D-Mark, erzählt Thomas, hat er gerade in seinem Sparschwein, was bei gutem Kurs 2540 Mark Ost sind. Alle zwei Wochen bringt er eine Packung Tic Tacs mit in die Schule, von der er seinen Freunden abgibt. Tic Tacs sind die Maßeinheit für die Beliebtheit bei Thomas, und wer beliebt ist bei Thomas, der ist automatisch beliebt in der Klasse. Das geht schon ewig so.
Wenn er selber mal Tic Tacs hat, von Oma aus dem Intershop oder von Jutta, nimmt er sie nicht in die Schule mit, sondern lutscht jeden Tag in seinem Zimmer eines für sich alleine. Orange schmeckt besser als Pfefferminze, das steht fest, und da ist er sich mit Thomas einig. Die leeren Schachteln sammelt er, bis Mama sie irgendwann findet und ohne zu fragen wegschmeißt, weil sie die Schachteln für Müll hält.
Am Hubertusdamm haben sie leere Tic-Tac-Schachteln als Magazine für ihre Erbsenpistolen benutzt. Das Magazin war gleichzeitig der Pistolengriff. Mit Lenkerband haben sie die Schachteln an den Lauf aus Holz geklebt, und wenn sie mit gezogenen Waffen durchs Gebüsch gerannt sind, hat bei jedem Schritt die Erbsenmunition geklappert. Das war eine schöne Zeit damals am Hubertusdamm.
Aleng ist es egal, ob eine Süßigkeit aus dem Westen stammt oder von hier und ob sie schön verpackt ist wie Kinderschokolade oder so hässlich wie Creck Süßtafel.
Wenn er Süßigkeiten findet, egal was, dann isst er sie komplett und unverzüglich auf. Da ist er wie ein Raubtier, das nicht anders kann angesichts der Gazelle. Weil er behindert ist, versteckt Aleng die leeren Verpackungen nicht, weshalb er immer erwischt wird nach einer solchen Schandtat.
Damit es keinen Ärger gibt, räumt mittlerweile er das Süßigkeitenpapier seines Bruders weg, wenn er es zufällig als Erster entdeckt. Der Trick besteht darin, es nicht ganz oben im Mülleimer zu platzieren, sondern eine Schicht weiter unten, wo die Eltern es nicht sofort sehen, auch wenn es eklig ist, deshalb im Müll rumwühlen zu müssen.
Seit Aleng vom Hocker gefallen ist und sich ein Loch in den Kopf geschlagen hat, sind die Süßigkeiten in der Wohnzimmerschrankwand eingeschlossen. Es war Sonntagvormittag, als das passiert ist. Papa war im Arbeitszimmer, Mama lag auf dem Sofa mit einem Buch, und er selbst hat im Kinderzimmer an seiner Eisenbahnplatte gebastelt, als es plötzlich fürchterlich geknallt hat. Er ist sofort aufgesprungen und in die Küche gerannt.
Aleng lag auf dem Boden, das Gesicht nach unten, und aus seinem Hinterkopf kam Blut. Er hat nicht gejammert, und er hat nicht geatmet.
Vielleicht ist mein Bruder jetzt endgültig tot, hat er gedacht.
Er hat sich gar nicht getraut, Aleng anzufassen. Vielleicht aber, hat er gedacht, glaubt Aleng von sich selbst, dass er tot sei, weil er so einen Sturz für nicht überlebbar hält, und rührt sich nur deshalb nicht. Fast im selben Moment hat er seinen Bruder laut ausatmen hören, dann hat Aleng tief Luft geholt und abermals den Atem angehalten.
Vielleicht dachte sein Bruder auch, Mama und Papa würden nicht schimpfen, weil sie erst denken, dass er tot ist, und wenn sie merken, dass er doch noch lebt, es aus Erleichterung einfach vergessen. Das hat im Prinzip ja schon mal geklappt bei seinem Koma damals.
Als Nächster kam Papa in die Küche gerannt.
«Der ist gar nicht tot», hat er geschrien, um Papa sofort die Angst zu nehmen. «Ich hab es selber gesehen: Gerade hat er geatmet. Der hat aber ein Loch im Kopf. Das muss genäht werden, sonst verblutet er.»
Papa hat sich hingekniet und beruhigend auf Aleng eingeredet, der eine Sekunde später aufgehört hat, weiter den Toten zu mimen. Da war endlich auch Mama in der Küche und hat gesagt, dass er versuchen soll aufzustehen, und dann hat sie das Loch im Kopf mit einem Jod-Wattebausch abgetupft. Aleng hat keine Miene verzogen, obwohl es mörderisch gebrannt haben muss, und als Nächstes hat Papa ausgerechnet ihn angemeckert, der doch als Erster am Unglücksort eingetroffen war, dass er endlich still sein und aufhören soll, die ganze Zeit von einem Loch im Kopf zu faseln und vom Verbluten.
Mit Aleng dagegen haben sie wirklich nicht geschimpft. Nur die Süßigkeiten wurden unter seinen misstrauischen Blicken später aus dem Hängeschrank entfernt, damit er lernt, dass er dort ab sofort nicht mehr zu suchen braucht. Denn was man mit eigenen Augen sieht, prägt sich besser ein, als wovon einem bloß erzählt wird.
«Er wird nur eine kleine Narbe behalten, wenn überhaupt», hat Mama beim Abendbrot gesagt, als das Blut aus Alengs Haaren gewaschen war und längst ein Pflaster auf dem Loch im Kopf klebte. Nur ein bisschen Kopfschmerzen hätte er noch, hat Aleng gesagt, aber die hat er eigentlich ständig, seit seine erste Operation schiefgegangen ist. Opa meint, die Kopfschmerzen kommen und gehen mit dem Wetter, doch wenn man Opa fragt, bei welchem Wetter sie kommen und bei welchem sie wieder gehen, ist er mit seinem Latein am Ende.
So viele Narben hat Aleng von den ganzen Operationen am Kopf, dass eine mehr den Kohl auch nicht fett macht. Die meisten Narben sind längliche, dicke Wülste, die speckig glänzen, weil keine Haare mehr darauf wachsen können. Wie Würmer sehen sie aus, die einst unter seiner Haut gelebt haben und nun tot sind. Zum Glück hat Aleng viele schöne, weiche Haare, die die kahlen Narben überdecken. Um die weichen Haare beneidet er Aleng. Seine eigenen Haare sind dick und strohig, und sie fangen seit Neuestem an, sich zu kräuseln, wenn er sie kämmt, was sie nicht glatter macht, sondern sie aufbauscht.
Überhaupt sieht sein Bruder viel weniger wie ein Chinese aus als er selbst. Alengs Augen sind auch nicht so schmal wie seine. Tauschen will er natürlich trotzdem nicht mit ihm.
Wenn ab nächster Woche Schokolade und Pfefferkuchen und all das andere Zeug offen auf den bunten Tellern und später unterm Weihnachtsbaum liegen, wird er wieder verstärkt Ausschau halten müssen nach Alengs Süßigkeitenpapier, um es bei Bedarf lautlos verschwinden zu lassen, denn gerade zu Weihnachten, sagt Oma, ist Harmonie wichtig.
«Berufssoldat wirst du sowieso nicht», hat Papa gesagt, als er zu Hause von den NVA-Offizieren erzählte, die in der Achten an ein paar Mittwochnachmittagen zu ihnen in die Schule kommen.
Frau Rakotsche nennt das ‹Jugendstunden›. Jugendstunden muss man absolvieren, um zur Jugendweihe zugelassen zu werden.
«Frau Rakotsche sagt, dass man leichter an die EOS delegiert wird, wenn man sich für Berufsoffizier entscheidet», hat er geantwortet.
«Du hast es nicht nötig, dir den Zugang zum Abitur auf diese Weise zu erschleichen», hat Papa streng gesagt. «Offizier ist ein wichtiger Beruf, aber es ist keiner für dich. Du wirst was Richtiges.»
Er hatte damals ‹Journalist› auf den Zettel für Frau Rakotsche geschrieben, doch Papa und Mama schwanken noch, was besser zu ihm passt: Journalist oder Außenwirtschaft.
Bei ‹Journalist› kann man Auslandskorrespondent werden, haben sie erzählt, und bei ‹Außenwirtschaft› kann man Handel treiben mit fernen Völkern, indem man W50 aus Ludwigsfelde gegen exotische Gewürze, seidige Stoffe und Edelsteine tauscht.
Übernächstes Jahr wird er vierzehn, dann ist die Kindheit Geschichte. Übernächstes Jahr ist von heute aus gesehen 1983. In zwei Wochen, nach Silvester, ist übernächstes Jahr 1984. Manchmal vergeht die Zeit sehr schnell, aber meistens vergeht sie ziemlich langsam.