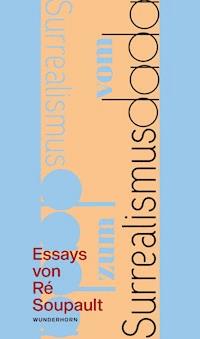Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Das Wunderhorn
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bublitz, Kolberg, Weimar, Berlin, Paris, Tunesien, Algerien, Nord-Mittel-Südamerika, New York, Basel, Paris - das sind nur einige Stationen in Ré Soupaults Leben als Bauhaus-Schülerin, Avantgarde-Filmerin, Modejournalistin, Modemacherin, Fotografin, Übersetzerin, Studentin bei Karl Jaspers, Radio-Essayistin, Schrifstellerin. Ihre Erinnerungen verfasste sie schon in den 1970er Jahren. Sie verarbeitete darin u.a. ihre Tagebücher. Mit ihrem unbestechlichen, klaren Blick ist sie eine besondere Zeitzeugin einer durch zwei Weltkriege geprägten Welt im Umbruch. Ihre Begegnungen u.a. mit Max Ernst, Johannes Itten, Otto Umbehr, Viking Eggeling, Werner Graeff, Man Ray, Paul Poiret, Fernand Léger, Philippe Soupault, Helen Hessel, Stéphane Hessel, Gisèle Freund, Kiki vom Montparnasse, Elsa Triolet, Claire Goll, Lisa Tetzner, Lotte Lenya, Kurt Weill, Walter Mehring, Erich Maria Remarque, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Kurt Schwitters, André Gide, vermitteln uns einen einmaligen Eindruck vom kulturellen Leben der europäischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Bis kurz vor ihrem Tod arbeitete sie an der Fortschreibung ihrer Erinnerungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2018 Nachlass Ré Soupault/VG Bild-Kunst, Bonn
© 2018 Verlag Das Wunderhorn GmbH
Rohrbacher Straße 18
D-69115 Heidelberg
www.wunderhorn.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Titelabbildung: Ré Soupault, Basel 1950
Gestaltung & Satz: Leonard Keidel
eISBN: 978-3-88423-589-8
Ré Soupault
Nur das Geistige zählt
Vom Bauhaus in die Welt. Erinnerungen
Herausgegeben von Manfred Metzner
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Pommern
Weimar
Berlin und Viking Eggeling
Paris
Tunesien
Tunis
Algier
New York
Mittel- und Südamerika
New York
Swarthmore
New York
Schweiz/Carona
Paris/Berlin
Basel
New York
RE SOUPAULT (1901–1996) Leben/Ausstellungen/Publikationen
Personenregister
Vorwort des Herausgebers*
Ré Soupault verfasste einen Teil ihrer Erinnerungen in den 1970er Jahren als Briefe an ihre Nichte. Dieser erste Teil reicht bis 1949. Nachdem wir Ré und Philippe Soupault 1981 kennengelernt hatten und die deutschen Verleger von Philippe Soupault geworden waren, zeigte sie mir diese Briefe und wir überlegten, wie sie diese zu einem umfassenderen biographischen Text gestalten könnte. Sie arbeitete daraufhin Textstellen um, überprüfte sie mit ihren Tagebüchern, ergänzte den Text mit ihr wichtigen Stellen aus diesen. Ihre Tagebücher schrieb sie bis Anfang der 1990er Jahre zum Teil auf einer Remington und einer Olivetti Lettera 22, abwechselnd in Deutsch und Französisch, oder von Hand (z.B. ihre Aufzeichnungen der Vorlesungen, die sie von 1951–1954 bei Karl Jaspers in Basel besuchte), oder sie notierte Tagesabläufe, Besuche, Korrespondenzen in kleine Jahreskalender. Auch schrieb sie umfangreiche Reisetagebücher. Ab 1948 arbeitete sie in Basel und ab 1955 in Paris als Übersetzerin, Radio-Essayistin, Schriftstellerin und Herausgeberin von Märchen-Sammlungen.
Bis kurz vor ihrem Tod 1996 beschäftigte sie sich mit der Fortschreibung ihrer Erinnerungen.
Im Personenregister habe ich zu Personen, deren Tätigkeit oder deren Umfeld nicht aus dem Text hervorgeht, Kurzinformationen hinzugefügt.
*Manfred Metzner lebt als Verleger in Heidelberg. Er ist Nachlassverwalter und Herausgeber des Werks von Ré Soupault. Zuletzt: Ré Soupault, Katakomben der Seele. Westdeutschlands Vertriebenen- und Flüchtlingsproblem 1950 (2016).
Selbstporträt, Buenos Aires, 31. Januar 1944, im Hintergrund Gisèle Freund und Jacques Rémy (s. Seite 131).
Pommern
Es gibt zwei Wege im Leben: der eine führt nach außen: Karriere, Geltung, Besitz… der andere nach innen: Arbeit, aber ohne Rücksicht auf äußeren Erfolg, schöpferische Arbeit, die ihren Lohn in sich selbst findet. Der Gedanke richtet sich auf die geistigen Errungenschaften des Menschen, dem Forschen nach dem Sinn des Lebens. Beispiele dafür sind die Philosophen der Antike, vor allem die Griechen. Es gehören dazu auch die sogenannten Religions-gründer wie Jesus und Buddha.
Eine solche Lebenshaltung bestimmt zugleich den Umgang mit anderen Menschen: niemandem die eigene Erkenntnis aufdrängen, die Persönlichkeit des anderen anerkennen, ihm mit Toleranz und Sympathie begegnen.
Es gibt kein anderes Glück für den Menschen als das, was er in sich selbst findet. Der Schriftsteller Nicolas Chamfort, der sich 1794 (während des Terrors) das Leben nahm, hat es richtig gesagt: »Le bonheur n’est pas chose aisée: il est très difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs«. (»Das Glück ist kein leichtes Ding: sehr schwer, es in uns zu finden, und unmöglich, es anderswo zu finden.«)
Dieses Wort stellt Schopenhauer seinen »Aphorismen zur Lebensweisheit« voran.
Die anderen Menschen ändern zu wollen, ist vergebliche Mühe. Uns selbst aber können wir bis zu einem gewissen Grade ändern. Dabei hilft das Unterscheidenlernen zwischen vergänglichen und unvergänglichen Dingen. Spinoza begann ein Philosoph zu werden, als er erkannte, daß es sich nicht lohne, vergängliches Gut zu erwerben. »Ich suchte nach dem unvergänglichen Gut«, schrieb er.
Aber genug von allgemeinen Betrachtungen. Ich glaube, ich hörte zum ersten Mal von Schopenhauer durch Walter Ebach. Meine Zeichenlehrerin – sie hieß Fräulein Wimmer – am Kolberger Lyzeum, nahm bei ihm Privatstunden in Philosophie. Aber damals kannte ich ihn noch nicht persönlich.
Fräulein Wimmer war vielleicht die einzige vernünftige Person unter allen Professoren der Schule. Auch hieß es, sie sei Sozialistin, was man damals nicht laut sagen durfte. Wir lebten in einer Zeit (zwischen 1918 und 1920 hat sich dies alles zugetragen), wo es den Begriff »Kommunismus« noch gar nicht gab. Der Sozialismus war noch der Bürgerschreck.
Also mit Fräulein Wimmer ließ es sich gut reden. Sie gab Privatstunden im Zeichnen und da ich immer eine Eins im Zeichnen hatte, beteiligte ich mich an ihren Privatstunden. Wir bildeten eine kleine Gruppe. Es ging mir weniger ums Zeichnen, als um Gespräche mit einer vernünftigen Person. Wir zeichneten am Hafen oder draußen in der Natur. Jeder hatte seinen kleinen Klappschemel und diese Stunden waren Lichtblicke in einer sehr düsteren Welt. Denn es war das Ende des Ersten Weltkrieges. Die Blockade, Mangel an allem. Wenigstens hatte mit der Niederlage das tägliche Morden aufgehört. Aber wie sah die Zukunft aus? Mein Ziel war damals – denn ein Ziel mußte man ja haben – Lyzeumslehrerin zu werden.
Nachdem 1917 mein Bruder Werner gefallen war, kam meine Schwester für einige Zeit nach Kolberg, »damit ich nicht allein war«. Sie wohnte in einer Familienpension, deren Besitzerin ein Fräulein Röpke (oder so ähnlich) war. Diese Pension lag am Viktoriaplatz und ich wohnte nahe davon, Viktoriastraße 9. Meine »Pensionsmutter« hieß Frau Dietz. Sie war die Witwe eines sehr wohlhabenden Kaufmanns, mußte aber jetzt Zimmer an Lyzeumsschülerinnen vermieten, weil sie offenbar ganz verarmt war. Es hieß, daß ein ungeratener Sohn, der in Südafrika das Weite gesucht hatte, an dem Ruin der Familie Schuld hatte. Aber Frau Dietz hatte auch eine Tochter, die der Mutter in rührender Weise beistand. Fräulein Dietz – sie war unsympathisch und unschön, aber der Schein trügt manchmal – arbeitete in einem Lazarett, und zwar in leitender Stellung. So half sie ihrer Mutter mit Lebensmitteln, die das große Problem (neben Kleidung und Heizung) jener Zeit waren. Wir waren drei in einem Zimmer. Mit mir zusammen waren Käte Plack und Edith Engel.
In der Pension Röpke waren viele Gäste. Jedenfalls erinnere ich mich an einen großen Eßtisch. Da war zum Beispiel ein Geschwisterpaar – vielleicht aus Berlin, aber ich bin nicht sicher – : Fräulein Jung und ihr Bruder, ein Biologe, glaube ich. Der Direktor des einzigen Warenhauses in Kolberg. Er hieß Seitz. In diesem Warenhaus war auch eine Schneiderwerkstatt, die »Haute couture« von Kolberg. Meine Schwester ließ sich dort ein sogenanntes »Schneiderkostüm« arbeiten. Ein großes Ereignis in solchen Mangelzeiten. Ich erinnere mich, daß es mausgrau war, mit enger Taille und – wie es damals Mode war – mit langem Rock.
In dieser Pension wohnte auch der Studienassessor Walter Ebach. Vielleicht aß er auch nur dort, dessen bin ich nicht ganz sicher. Jedenfalls sah ich ihn hier zum ersten Mal, nachdem ich schon von ihm gehört hatte. Er galt als ungewöhnlich intelligent. Seine philosophischen Schlußfolgerungen waren immer von höchster Überzeugungskraft. Außerdem war er entschieden sozialistisch angehaucht, also seine Denkweise sehr fortschrittlich. Das Niveau der meisten Professoren – jedenfalls was das Lyzeum betraf – war katastrophal. Ich will hier nicht von meinem Englischlehrer sprechen – er hieß Tiemens – der sich durch einen anrüchigen Konformismus auszeichnete. Z. B. verlangte er von den Schülerinnen, daß er auf der Straße mit einem »Knicks« gegrüßt wurde. Heute ist sicher sogar die Erinnerung an solche vorsintflutlichen Vorschriften verschwunden. Die meisten von uns wichen dem »Knicks« aus (es ist richtig, daß nur Herr Tiemens ihn verlangte), indem sie die Straße überquerten oder sich umwandten, wenn dieser Englischlehrer auftauchte. Was der dann in der nächsten Stunde erwähnte. Wirklich ein großer Dummkopf. Er hatte feuchte Froschhände und bestand darauf, daß vor den Ferien jede ihm die Hand geben mußte.
Der Direktor, Professor Roedtke, war der einzige Lichtblick in dieser Schule. Mit ihm konnte man reden. Er hatte Verständnis für junge Menschen, die in der allgemeinen Not ja nicht das geringste Vergnügen kannten. Siegesfeiern, Vaterlandslieder, Klappern mit den Holzsandalen (lederne Schuhe gab es schon längst nicht mehr), ungeheizte Zimmer, Schlange stehen nach ein paar Bonbons, die sofort an die Front geschickt wurden: das waren die Zerstreuungen damals. Allerdings gab es den »Wandervogel«1. Unsere Turnlehrerin, namens Katherin, war die Führerin. Ob man wollte oder nicht: jeder mußte dem »Wandervogel« beitreten. Ich wollte übrigens gern, wenn nur nicht die weiten Märsche am Sonntag gewesen wären. Katherin war sehr groß und mager und hatte lange Beine; ihr Tempo war dem entsprechend. Mit Rucksack, Kochtopf und Gitarre ging es bei Morgengrauen los. Man atmete auf, wenn das Wetter manchmal diese Sonntagsmärsche verhinderte. Aber an einen sehr schönen Ausflug erinnere ich mich. Es war Sommer und die Sonne schien. Auf den Dünen von Horst – einem kleinen Fischerdorf an der Ostsee – machten wir Rast und die Arbeit für die Kocherei wurde eingeteilt: die einen machten Feuer, die andern sammelten Holz; einige suchten nach etwas Essbarem. Meistens waren es Kartoffeln, vielleicht, wenn wir Glück hatten, rückten die Bäuerinnen ein Stückchen Speck und ein paar Eier heraus. Meistens ging es mit Kartoffeln. Und dann wurde gesungen mit Gitarrebegleitung. Aber wenn man abends nach Hause kam, fiel man vor Müdigkeit um. Katherin übertrieb: sie wollte uns abhärten.
Einmal fragte mich Fräulein Wimmer, was ich nach dem Reifezeugnis machen wollte. Ich sagte ihr, vielleicht ohne besondere Begeisterung, daß ich wohl Lehrerin werden würde. Sie fand, das sei keine sehr gute Idee. Ob ich nicht lieber meine Zeichenbegabung ausbilden wollte? In Wirklichkeit war es mir gleich, was ich machen würde, nur frei wollte ich sein. In der Hoffnungslosigkeit dieses Kriegsendes war alles grau: nirgends ein Lichtblick. Da zeigte mir Fräulein Wimmer das Manifest von Gropius. Das Bauhaus. Da war eine Idee, mehr noch ein Ideal: keinen Unterschied mehr zwischen Handwerkern und Künstlern. Alle zusammen, in einer neuen Gemeinschaft, wollten die »Kathedrale« der Zukunft bauen. Da wollte ich mitmachen.
Aber Fräulein Wimmer war vielleicht ein wenig erschrocken über meine Begeisterung, denn sie sagte, sie hätte das Bauhaus in Weimar besucht und ihr schien, daß die Idee von Gropius eine Utopie sei. Sie fand, eine Kunstschule in Berlin wäre geeigneter. Außerdem wäre in Weimar nur Platz für höchstens 100 Schüler und es würde sicher schwer sein, aufgenommen zu werden.
Nun, ich versuchte es trotzdem. Man mußte Arbeiten einreichen und einige Fragen beantworten. Und dann kam die Antwort. Sie war positiv. Mir lag mehr an der neuen Gemeinschaft als an der Ausbildung meines Maltalentes. Aber meine Eltern sahen sicher nur die Aussicht auf eine Karriere als Malerin. Im Frühjahr, zum Sommersemester 1921, brachte meine Mutter mich nach Weimar. Ich weiß nicht, woher sie die Adresse des Martha-und Marien-Heimes2 hatte, wo sie mich einmietete.
Aber ich muß noch einmal auf Kolberg zurückkommen. Während der Sommerferien – ich erinnere mich nicht mehr, welches Jahr es war – starb die unglückliche Frau Dietz und ihr folgte in kurzem Abstand die Tochter. Ich kam in eine andere Pension, an die ich keine gute Erinnerung habe. Mutter und Tochter, die in kleinen Verhältnissen lebten, wirtschafteten dort. Das Haus lag Roonstraße 7, ein ganz hübsches Villenviertel. Ich erinnere mich an den Winter mit Kältegraden, die bis zu 20 bis 30 Grad unter Null lagen. Und keine Heizung. Da bekam ich eine Angina, lag im Bett mit Fieber und die einzige Wärme war meine Körperwärme. Die Schluckbeschwerden waren so schlimm, daß ich vor jedem Schlucken meinen ganzen Mut zusammennehmen mußte. Es fehlte an jeder Pflege. Aber ans Sterben dachte ich nicht, obwohl ich damals sicher sehr nahe am Tode vorbeigegangen bin. Es war dieser Winter, als die Ostsee bis zum Horizont zugefroren war, als die Grippe anfing zu wüten und 800.000 Kinder in Deutschland starben. Weil sie physisch ohne Widerstand waren. Als ich die Angina überstanden hatte und in die Schule zurückkam, waren zwei von meinen Klassenkameradinnen gestorben. Besonders um eine trauerte ich, denn ich traf sie immer auf dem Schulweg und ich mochte sie. Sie hieß, wie ich, Erna, Erna Kutschera (vielleicht ist der Name nicht richtig geschrieben, aber so wurde er ausgesprochen).
Es gelang mir, die Pension zu wechseln. Von den Schwestern Firus, Ziegelschanze 1, wurde nur gut gesprochen. Und hier fand ich bei »Tante Liesbeth und Tante Martha« wirklich ein Heim. Tante Martha gab Klavierunterricht – bis dahin war ich Schülerin bei Fräulein Kummerow, hinter dem Dom, gewesen und jetzt wurde mit Tante Martha musiziert. Meine Zimmergenossin sang und ich begleitete. Am schönsten aber war es, wenn Tante Liesbeth mir ihre Photos aus China zeigte, wo eine ihrer Schwestern mit einem Konsul verheiratet gewesen war. Bei dieser Schwester hatte sie viele Jahre verbracht. Sie war also weit gereist und man merkte es ihr an. Sie machte mir zwei Geschenke: einen Mondstein und einen Pfirsichkern, in den ein chinesischer Künstler einen Buddhatempel geschnitzt hatte. Aber in meinem späteren sehr bewegten Leben sind mir diese kostbaren kleinen Geschenke verloren gegangen. Ich bewahre Tante Liesbeth und Tante Martha große Dankbarkeit. Leider hatten wir nicht Gelegenheit, uns wiederzusehen, und ich weiß nicht, wie das Ende ihres Lebens war.
Am Ende ihres Aufenthaltes in der Pension Röpke sagte mir meine Schwester, daß sie mit Walter Ebach heimlich verlobt wäre. Ich erinnere mich nur sehr dunkel an ihre Hochzeit, wo auch Freunde von Dr. Ebach eingeladen waren. Einer dieser Freunde, Hanns Grütters, hatte mich sehr beeindruckt, durch seine Intelligenz und Weltoffenheit. Für mich begann nun die erste Etappe meines Lebens in der Freiheit.
Hinzufügen möchte ich hier aber noch ein kurzes Porträt von Walter Ebach. Je näher man ihn kannte, desto mehr faszinierte er durch seine Intelligenz, die sich nicht nur in seiner gründlichen Kenntnis der Philosophie vom Altertum bis zur Neuzeit äußerte, sondern vor allem durch eigenes Denken. Er war antimilitaristisch und antiimperialistisch. Zugleich war er ein genialer Pianist. Er spielte Beethoven, Mozart, Chopin und andere wie ein Virtuose. Das konnte ich ganz gut beurteilen, da ich selbst von Kind auf Klavierstunden hatte und zu jener Zeit eine Mozart- oder Beethoven-Sonate einigermaßen zustande brachte. Aber ich konnte nie auswendig spielen. Dagegen las ich leicht vom Blatt. Was mich nun bei Walter erstaunte, war die Tatsache, daß er alles – und das Repertoire war sehr reich – auswendig spielte. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Wie arbeitete sein Gedächtnis? War es rein musikalisch oder beruhte es auf einem optischen Erinnerungsvermögen? Nun, es war optisch bedingt. Er hat es mir erklärt. Er las eine Partitur, und die Seiten prägten sich seinem »inneren Blick« so genau ein, daß er quasi die Noten las ohne sie zu sehen. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich eine solche Fähigkeit bewunderte. Einmal, in Claras Höhe während der Sommerferien, kam ich über den Hof, der sehr groß war und hörte durch die offenen Fenster Klavierspielen: es waren die »Spanischen Tänze« von Moritz Moszkowski. Die Erinnerung an diesen Sommertag und an die Musik ist so präzise in meiner Erinnerung lebendig, daß ich nur die Augen zu schließen brauche und ich höre die Melodien.
Ich weiß, man hat Walter vorgeworfen, daß er seine großen Begabungen nicht ausgenutzt hätte. Ich glaube, daß er einerseits zu sehr Philosoph war, um sich auf den »Jahrmarkt der Eitelkeiten« zu begeben; andererseits vermute ich, daß seine Arbeit als Studienrat ihn zu sehr beanspruchte. Der Durchschnitt der Schüler hatte ein ziemlich niedriges Niveau und das muß ihn sehr angestrengt haben. Ich verdanke ihm viel. Dabei darf ich nicht das Schachspiel vergessen. Auch darin war er genial. Ich habe ihn gesehen, wie er simultan gegen zwanzig und mehr Partner spielte und gewann. Mit einem Blick erfaßte er die Lage der Partie und zog entsprechend. Von ihm habe ich Schachspielen gelernt, was mir heute zur Entspannung nach den Mühen des Tages dient.
Unter normalen – oder relativ normalen – Lebensbedingungen (denn es war schon die Nazizeit) sah ich Walter zum letzten Mal in Schneidemühl3, wo ich auf einer Durchreise Station machte. Er hatte in seinem Zimmer eine Menge Aquarien, sammelte Fische aus allen Ländern der Welt. Darunter waren seltene Arten, wunderschön und oft winzig klein. Er kannte alle ihre Namen. Diese Sammlerbegeisterung war sicher eine Art von Flucht vor den politischen Zuständen in Deutschland, die seine Arbeit im Gymnasium erheblich erschwert haben müssen. Aber der Flügel war noch da, nur erinnere ich mich nicht, ihn spielen gehört zu haben. Dann sah ich ihn nach dem Zusammenbruch 1947 in Berlin. Er war auf der Insel Rügen, wo er, glaube ich, ein Internat leitete. Wir trafen uns in Berlin, wo ich ihn mit einer jungen Amerikanerin – Barbara Johnson – bekannt machte. Barbara war in Uniform. Ich kannte sie vom Swarthmore-College, USA, wo sie im letzten Kriegsjahr Philippes Schülerin gewesen war. Jetzt gehörte sie zu der amerikanischen Organisation, die die Deutschen zu »Demokraten« nach amerikanischem Muster »umerziehen« sollten. Sie und ihre Kollegen hielten sich für sehr wichtig, und ich muß sagen, daß ich erstaunt war über so viel Naivität. Sieger spielen meistens eine sehr undankbare Rolle in der Geschichte. Sie werden später nicht gern an ihr Verhalten den Besiegten gegenüber erinnert. Nun, da war gerade ein Meeting von diesen »Erziehern zur Demokratie«, und ich machte Walter mit Barbara bekannt, die ihm vorschlug, bei diesem Meeting zu sprechen. Er tat es und sprach über »Freiheit«. Es herrschte totale Stille in dem Raum, wo sich Amerikaner, Deutsche und sicher auch eine Anzahl von russischen Spionen befanden. In seinen Ausführungen über Freiheit übertraf Walter sich selbst und gab in sehr treffenden Andeutungen den Amerikanern sowie allen Anwesenden eine Lehre, die jedem hätte nützen können, und vielleicht auch manch einen zum Nachdenken angeregt hat.
Zum letzten Mal sah ich Walter in Wittlich bei Trier. Er, Oma Leni und Peter waren aus der Ostzone geflüchtet, längere Zeit im Auffanglager zurückgehalten – durch diese Lager mußte jeder Flüchtling gehen, was gewiss ein schwerer seelischer Schock war. Endlich hatte man in Wittlich, da er ja geborener Rheinländer war, einen Platz für ihn gefunden. Ich glaube, er unterrichtete Geschichte am dortigen Gymnasium. Sie hausten in einer ungeheizten Wohnung des kleinen Ortes, spärlich möbliert. Die bitteren Erlebnisse der letzten Jahre hatten ihn schwer mitgenommen. Da war kein Flügel mehr, also auch keine Musik, und die beginnende Krankheit machte ihm zu schaffen. Ich selbst hatte schwere Jahre, ohne festen Wohnsitz, war ich heute hier, morgen da, wo ich Arbeit fand. So hatten wir uns aus den Augen verloren und ich erhielt die Nachricht von seinem Tode eine ganze Zeitlang später.
Anmerkungen des Herausgebers:
1Wandervogel, Jugendbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts am Gymnasium Steglitz entstanden war und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erhebliche Impulse in der Reformpädagogik und Lebensreformbewegung setzte.
2Martha-und Marien-Heim, heute das Hotel Amalienhof, Amalienstraße 2 in Weimar.
3Schneidemühl: heute Pila (Polen)
Weimar
Zum ersten Mal begegnete ich einer Welt, die mir im Vergleich mit Pommern-Preußen menschlicher erschien. In Weimar lebte noch etwas von der alten Zeit. Heute ist mir klar, daß hundert Jahre in der Geschichte, sofern der Krieg nicht alles zerstört hat, nicht viel sind. Da war das Goethe-Haus, genau so erhalten, wie zu Goethes Lebzeiten. Sein Gartenhaus in dem wunderschönen Park mit den alten Bäumen und dem kleinen Fluß, der Ilm, das Schloß, das Haus von Liszt, wo seine Haushälterin – jetzt alt, zu seinen Lebzeiten ein junges Mädchen – noch von dem täglichen Leben des bewunderten Mannes erzählte, als wäre es gestern gewesen. Sie wußte von jedem Gegenstand etwas zu erzählen. Und man ging überall aus und ein, wie man wollte. Nach dem Martha-und Marien-Heim, wo ich etwa 6 Monate wohnte, zog ich zu einer alten Dame, die in ihrer Jugend Schülerin von Liszt gewesen war. Sie hatte gewiß zu dem wohlhabenden Bürgerstand gehört – Fräulein Sälzer hieß sie. Jetzt, durch die Not, vor allem durch die Inflation, verarmt, vermietete sie Zimmer.
Aber zuerst war ich also im Martha-und Marien-Heim. Die Osterferien waren noch nicht zu Ende und ich durchstreifte gleich einmal die Gegend. Meine Mutter war schon am nächsten Tag wieder nach Hause gefahren. Und nun war ich ganz mir selbst überlassen. Ich war schon damals gern allein. Langeweile ist mir immer fremd gewesen. Es gab immer etwas zu denken, zu lesen, zu arbeiten. Mein erster Weg war in die Kunstschulstraße, um mir die Gebäude meiner künftigen Schule näher anzusehen. Entfernungen gab es nicht in Weimar. Man brauchte nur die Straße hinaufzugehen – wie sie hieß, habe ich vergessen, und schon befand man sich in der Kunstschulstraße. Eine kurze Straße, die nur wenige Wohnhäuser hatte. Die großen Gebäude rechts und links waren das Bauhaus. Bevor ich aber den Haupteingang erreichte, sah ich ein Schild, auf dem in großer weißer Schrift auf schwarzem Grund ›Kantine‹ geschrieben stand. Es war zwar schon etwa drei Uhr nachmittags, aber ich dachte, vielleicht gibt es doch noch etwas zu essen. Denn man hatte immer Hunger. Ich fand den Eingang zur Kantine, eine Art von Baracke. Die Eingangstür öffnete sich direkt auf einen großen Raum, in dem Tische und Bänke standen. Aber er war leer. Nur hinten in einer Ecke links saß ein junger Mann – er konnte um Mitte dreißig sein. Er trug eine sogenannte Russenbluse, wie sie damals beliebt war, als Zeichen einer antibürgerlichen Gesinnung. Er las, glaube ich oder vielleicht zeichnete er auch. Als er mich in der offenen Tür stehen sah, redete er mich an: »Mädchen, bist du neu?« Etwas schüchtern sagte ich »ja.« »Hast du Hunger?« fragte er gleich weiter in einem vielversprechenden Ton, worauf ich gleich »ja« sagte. Darauf stand er auf, schritt diagonal durch den Raum und klopfte an einen Schalter, der sich auch gleich öffnete. »Habt ihr noch was zu essen?« fragte er. »Da ist ’ne neue.« Ich bekam einen Teller mit gebratenen Kartoffelschalen und Quark. Das war sehr gut und ich aß mit bestem Appetit. Es war nicht nur die Lebensmittelknappheit, die die Kartoffelschalen in der Bauhausküche verwenden ließ, sondern der Mazdaznan-Einfluß von Itten und Muche, die proklamierten, daß die eigentliche Nährkraft der Kartoffel in der Schale liege. Dieser hilfsbereite Bauhäusler hieß Josef Albers. Er brachte es später in den USA zu großem Ruhm als Kunstpädagoge und Maler. Von Itten inspiriert, hatte er seine eigene Vorkurs-Methode ausgearbeitet, die Erfolg hatte. Albers war ein guter Kamerad, sehr aktiv und begabt. Wenn im Herbst das sogenannte »Drachenfest« stattfand, bei dem jeder aus Papier, Draht und Hölzern seinen Drachen produzierte, die wir dann, sobald der Wind günstig war, steigen ließen, hatte er immer die größten und buntesten, wahre Kunstwerke. Dieses Drachenfest fand außerhalb der Stadt, auf einem Hügel statt und war wirklich eine Sehenswürdigkeit.
Erna Niemeyer um 1924
Aber was war denn eigentlich so Besonderes an diesem Bauhaus, daß Kinder sich mit ihren Eltern entzweiten, um in dieser Gemeinschaft zu leben? Es war unter uns ein Geist lebendig: einer für alle, alle für einen. Ein Ideal hatte uns zusammengeführt: weg von den Vorurteilen einer bürgerlichen Welt, die von dem preußischen Militarismus beherrscht wurde und den Menschen erstickte. Der verlorene Krieg, die materielle und seelische Not wurde diesem Militarismus und diesem Bürgertum angekreidet. Nicht, daß man viel darüber sprach, aber unsere ganze Lebens- und Denkweise war darauf gegründet: neu anfangen, alles, was gewesen war, über Bord werfen, sich nicht dreinreden lassen. Wir waren zwischen 80 und 100, aus vielen Ländern: Ungarn, Polen, Russland, Österreich. Es gab unter uns weder nationale noch rassische noch soziale Unterschiede: wir waren eben Bauhäusler. Noch heute würde es keinem aus jenen Anfangsjahren einfallen, den andern mit »Sie« anzureden. Albers hatte mich gleich in den Ton eingeführt, der unter uns üblich war.
Die Professoren – sie wurden »Meister« genannt – lebten am Rande unserer Gemeinschaft. Sie wurden nicht mit »Du« angeredet. Menschlich am nächsten, glaube ich, stand uns Oskar Schlemmer. Aber den größten Einfluß als Lehrer hatte Johannes Itten. Es erübrigt sich, viel aus seinem Vorkurs zu erzählen, weil das heute jedem bekannt ist. Man muß nur bedenken, welch eine Entdeckung dieser Unterricht für den einzelnen war. Denn bisher waren ja die Kunstschulen darauf ausgerichtet, dem Schüler gewisse Mal- und Zeichenroutinen beizubringen, von denen abzugehen niemandem eingefallen wäre. Und bei Itten geschah etwas, was uns befreite. Wir lernten nicht malen, sondern lernten neu sehen, neu denken und zugleich lernten wir uns selber kennen. Der Mensch war ja in den Akademien und Universitäten immer beiseite gelassen worden. Und jetzt rückte der Mensch in den Mittelpunkt. Daß man keine Bilder malen konnte, ohne eine Technik zu erwerben, war uns klar, aber jeder sollte sich seine eigene Technik erwerben. Da war die Geschichte von dem chinesischen Tuschemaler, der zu seiner Zeit sehr berühmt war. Und da kam ein reicher Kaufherr und bestellte bei dem Maler ein Bild: es sollte einen Hahn darstellen. Der Preis wurde vereinbart, nur die Wartezeit schien dem Käufer zu lang. Drei Jahre brauche er, sagte der Maler, um das Bild zu malen. Nach drei Jahren kommt der Kaufherr, um sein Bild zu holen. Der Maler sieht ihn zuerst verständnislos an. Dann erinnert er sich, nimmt Papier, Pinsel und Farben und in wenigen Minuten entsteht das schönste Bild von einem Hahn. Der Kaufherr ist empört: drei Jahre lang hat er ihn warten lassen, während er einige Minuten braucht, um das Bild zu malen? Der Künstler öffnet eine Tür und zeigt ihm Stapel von Studien. Er hatte den Hahn studiert, so daß er so lebendig vor seinem inneren Auge stand, daß ein paar Pinselstriche genügten, um ihn zu malen. Diese Maler verstanden, sich mit dem Objekt zu identifizieren.
Erna Niemeyer: Licht-und Schattenstudie (Vorkurs Itten), 1922
Itten hatte seinen Freund Georg Muche ans Bauhaus geholt. Er war der jüngste unter den Meistern. Beide lebten nach Mazdaznan: Atemübungen, mönchische Lebensweise. Sie kleideten sich auch wie Mönche: der eine braun, der andere grau und im Frühjahr machten sie eine Knoblauchkur, was sicher körperlich und geistig sehr gesund war, nur verbreiteten sie dann einen unerträglichen Geruch. Einziger Versammlungsort war damals die Kantine. Hier wurde fast jeden Abend lebhaft diskutiert oder auch getanzt. Itten, der vor dem Bauhaus schon in Wien seine eigene Schule gehabt hatte, brachte eine ganze Anzahl von seinen Schülern mit. Sie wurden von uns kurz »die Wiener« genannt. Ideen wurden in Hülle und Fülle vorgebracht, aber es mangelte an Geld und an materiellen Mitteln. Die Weimarer Stadtväter waren uns nicht wohlgesinnt und doch hing das Bauhaus von ihnen ab. Übrigens hatten die Meister meines Erachtens weniger Einfluß als man später im allgemeinen vorgab, weil ja unter ihnen berühmte Künstler waren wie Klee und Kandinsky. Tatsächlichen und ganz bewußten Einfluß hatte Itten. Als ich ihn später, in den sechziger Jahren in Zürich wiedersah – ich habe hier in Frankreich mehrmals über ihn geschrieben – sagte er mir: »Mir lag daran, den jungen Menschen etwas fürs Leben zu geben. Es war aber gar nicht leicht, mit all dem Neuen fertig zu werden, besonders unter den katastrophalen materiellen Verhältnissen. Gropius sagte uns: Sie werden hier ins Wasser geworfen und müssen versuchen, zu schwimmen.«
Mit Itten konnte man etwas anfangen, aber Klee zum Beispiel. Ich erinnere mich, als er im Frühjahr 1922 mit seinem Unterricht begann, der übrigens fakultativ war. Aber jeder wollte natürlich dabei sein. Wir saßen alle gespannt zur festgesetzten Zeit in einem der großen Ateliers und warteten auf den berühmten Künstler. Die Tür wurde leise geöffnet und ein kleiner Mann kam herein. Er sah uns gar nicht an, blieb nicht weit von der Tür neben einer schwarzen Tafel stehen und zog ein kleines Heft aus der Tasche. Darin begann er zu lesen. Es war die Rede vom Kosmos, von den Planeten, die um die Sonne kreisen und zwei von ihnen verlassen plötzlich die vorgeschriebene Bahn und bewegen sich auf einander zu. Bis die Katastrophe eintritt und sie zusammenstoßen. Was geschieht dann? Fragte er. Bitte zeichnen sie das. Solche Dinge können natürlich verhängnisvoll sein für junge Menschen. Ich meine, sie können völlig durcheinander geraten. Ich war vernünftig genug, diesen Kursus gleich abzubrechen. Die meisten anderen auch. Klee behielt, glaube ich, einen Schüler, der genau so malte wie sein Meister. Ein großer Künstler ist selten ein guter Lehrer. Zwar entwickelte Klee später eine Unterrichtslehre, die er – wenn ich nicht irre – unter dem Titel »Pädagogisches Skizzenbuch« veröffentlichte. Aber ich habe mir diese Theorien nicht näher angesehen.
Anders war es mit Kandinsky. Von ihm gab es ein Buch: »Über das Geistige in der Kunst«. Er kam 1922 ans Bauhaus, begann aber nicht mit einem Malkursus. Die Ideen, die er in seinem Buch entwickelte, faszinierten uns. Man konnte mit ihm sprechen, ihn fragen. Er hatte mit Franz Marc vor dem Krieg den »Blauen Reiter« gegründet. Das war eine Publikation, die regelmäßig erscheinen sollte – tatsächlich aber nur einmal erschienen war, da der Krieg ausbrach, Kandinsky, als Russe, nach Russland zurückkehrte, Franz Marc Soldat wurde und 1916 fiel. Unter dem Namen »Der blaue Reiter« fanden auch Ausstellungen von moderner Kunst statt. Kandinsky war ja der erste, der abstrakt malte. »Der Blaue Reiter« war ein Begriff, der die Synthese aller Künste bedeutete, also Malerei, Musik, Tanz, Skulptur – jeden künstlerischen Ausdruck – auf den gleichen Nenner brachte. Auch Volkskunst wurde einbezogen. Und schon war der Film im Anzug, der abstrakte Film, die »optische Musik«. Bevor ich davon erzähle, muß ich noch Kandinskys fundamentale Idee von der »inneren Notwendigkeit« erwähnen. Er hat das einmal an einem Beispiel klar gemacht. In der Dekorationswerkstatt sollte ein Wandschirm bemalt werden. Einer der Schüler, er hieß George und lebt heute in London, hatte auf den vierteiligen Wandschirm den Weg der Sonne gemalt: vom Aufgang bis zum Untergang. Das Ganze wirkte etwas japanisch. Kandinsky sah sich die Arbeit aufmerksam an. Dann sagte er: »Finden Sie nicht, daß Auffassung und Ausführung japanisch wirken?« George gab das zu. »Aber Sie sind doch kein Japaner«, sagte Kandinsky. »Nein, aber ich kann mich gut in die Seele eines Japaners versetzen.« Das war nun aber gegen das Gesetz der »inneren Notwendigkeit«. Das war Imitation, aber keine aus dem wahren Ursprung entstandene schöpferische Arbeit.
Bei Itten war das Interesse für asiatische Philosophie geweckt worden und als ich einmal mit einer Freundin in Jena war, lernte ich durch sie den Professor Schmidt kennen, Nachfolger von Haeckel, dem Monisten. Er zeigte uns Haeckels Bibliothek und da fand ich ein Buch in Sanskritschrift. Das machte mir einen so tiefen Eindruck, daß ich mir sagte: es muß doch möglich sein, diese Schrift zu lesen und zu verstehen. Der Zufall wollte, daß gerade ein Lehrstuhl für Sanskrit an der Universität gegründet worden war. Professor Slotty aus Prag las Sanskrit. Ich trug mich sofort als Hörerin ein und kam zweimal in der Woche mit meinem Fahrrad nach Jena. Der Hinweg war leicht, weil die letzten fünf Kilometer bergab gingen, aber zurück… da mußte ich schieben. Wir waren nicht in der besten physischen Verfassung, aber die Begeisterung für die Sache siegte. Zwei Semester habe ich das durchgehalten und erreichte, daß ich – wenn auch mit Mühe – einen Begriff von dieser Philosophensprache bekam. Diesem Studium verdanke ich meine Lebensdevise: die Habsucht ist die Ursache allen Übels (lobhah papasya karanam). Natürlich geschah dieses Studium nur nebenbei. Ich war ja am Bauhaus und nach dem Itten-Vorkurs, den ich zweimal mitmachte, mußte ich schließlich doch eine Werkstatt wählen. Ich hatte keine besondere Vorliebe, ein Zeichen, daß ich meinen Weg noch nicht gefunden hatte. Mehr aus Verlegenheit trat ich in die Weberei ein. Das hätte auch ganz gut sein können, wenn wir das Handwerk gründlich gelernt hätten. Aber das Bauhaus war arm, hatte keine eigenen Webstühle und die Werkmeisterin, Fräulein Börner, war zugleich die Besitzerin dieser Webstühle. Sie fürchtete, daß die Anfänger ihr die Ketten kaputt machten und so kam es nie dazu, daß man lernte, eine Kette aufzulegen. Schließlich zog ich mich an einen Teppichwebstuhl zurück und knüpfte meine Sanskrit-Weisheit – denn die Sanskritschrift ist sehr schön – in die abstrakte Farbkomposition hinein. Muche war Formenmeister und er ließ sich immer erklären, was das eine oder andere Zeichen bedeutete.
Das Jahr 1922 war zugleich das Jahr des Erscheinens von Theo van Doesburg in Weimar. Er gehörte zu Mondrians Gruppe der Konstruktivisten, gab eine Zeitschrift »De Stijl« heraus (in Holland), war überhaupt Mondrians Propagandist. Da das Bauhaus im Mittelpunkt der modernen Kunstentwicklung stand, wollte Doesburg eine Art von Revolution heraufbeschwören, weil er fand, daß Itten die Bauhäusler auf einen Irrweg führte. Die Parole war »Funktionalismus«, »Konstruktivismus«. Itten lehrte uns, daß zwischen Schwarz und Weiß sowie zwischen den dunkelsten und hellsten Farbtönen unzählige Schattierungen liegen, was an Hand unserer Hell-Dunkel-Studien zur Genüge bewiesen war. Doesburg, als Konstruktivist, erklärte, es gäbe nur ein Blau, ein Gelb, ein Rot, ein Grün usw. Das fanden wir höchstens anmaßend, aber nicht ernst zu nehmen. Doesburg machte großen Lärm in Weimar. Er mietete zu seinen Vorträgen Säle, und wir amüsierten uns köstlich über das Geschrei gegen Itten und für den Konstruktivismus. Nelly, die Frau von Doesburg, spielte dazu konstruktivistische Musik, was sich so äußerte, daß sie Disharmonien auf gut Glück auf dem Flügel zum Besten gab. Sie war sehr schick, geschminkt, genauer gesagt angemalt, was wir sehr lustig fanden. Denn dies brachte etwas von der Pariser Atmosphäre, wo es in den zwanziger Jahren quasi als Kunst betrieben wurde, sich zu schminken. So hatte zum Beispiel Kiki vom Montparnasse, die ich später kennen lernte, ihre Schminkgeheimnisse, die sie selbst ihrer besten Freundin nicht verriet. Nun, der Krieg gegen Itten forderte diesen natürlich zu Gegenmaßnahmen heraus. Die weitaus größte Menge der Schüler war für Itten. Nur vier verließen das Bauhaus, um mit Doesburg Radau zu machen. Itten sagte über Doesburg: »Ein Mann, der ein schwarzes Hemd trägt, hat auch eine schwarze Seele.« Denn Doesburg wollte auch in seiner Erscheinung extravagant sein. Zu dem schwarzen Hemd trug er eine weiße Fliege. Als ich in den sechziger Jahren Itten an diesen Ausspruch erinnerte, sagte er mir, das wüßte er zwar nicht mehr, aber das stimme sicher, daß er’s gesagt hätte, weil es ihm ähnlich sehe.
Nun, Doesburg hatte zwar die Schlacht nicht gewonnen. Das Bauhaus lehnte ihn ab. Aber andererseits waren Ittens Feinde – die miesen Kleinbürger von Weimar – durch diese Attacken angeregt worden, und Gropius selbst hatte genug von diesen ewigen Streitereien. Als Itten 1923 vorschlug, das Bauhaus zu verlassen, akzeptierte Gropius. Mit Itten war eine Phase des Bauhauses abgeschlossen. Meines Erachtens war es die Periode, die alle Fundamente für die weitere Entwicklung dieser Schule gelegt hatte. Tatsächlich inspirierten sich die späteren Vorkurslehrer wie Albers, Moholy, Schmidt usw. bei ihm. Itten machte dann später seine eigene Schule in Berlin, die großen Zulauf hatte. Aber Berlin war nicht Weimar. Auch die Zeiten hatten sich geändert. Was Forschung und Entdeckung während der Gründungsjahre genannt werden konnte, war nun Routine geworden, die zwar immer noch ihr Gutes hatte, aber sicher nicht mehr die Wirkung hervorbrachte wie in den ersten Bauhausjahren.
Aus welchem Grunde die jungen Menschen auch ans Bauhaus gekommen waren, ob aus Idealismus, aus dem Wunsch, bei einem modernen Architekten, Maler oder Bildhauer in die Lehre zu gehen oder sogar nur aus Neugierde – das gab es auch: sie wurden alle hineingezogen in diesen Schmelztiegel, der den Menschen veränderte. Weimar war ein Kreuzweg geworden, wo sich alles, was in Kunst und Literatur, in Dichtkunst, Musik oder Tanz einen Namen hatte, traf. Meine Werkstatt war also die Weberei, aber ich sagte schon, daß ich sie nicht aus Begeisterung gewählt hatte, sondern weil eine Werkstatt am Bauhaus obligatorisch war und für die Wandmalerei oder die Tischlerei zum Beispiel fühlte ich mich körperlich nicht kräftig genug.
Meine engste Freundin zu jener Zeit war Grete Rühle, deren Vater sozialistischer Abgeordneter unter Wilhelm II. gewesen war, Freund von Liebknecht und Rosa Luxemburg. Wenn Grete von all diesen Leuten erzählte, von dem Leben, das die Familie oft hatte führen müssen, illegal, sich verstecken, heute hier morgen da, erkannte ich, daß diese Leute einen starken Glauben an ein Ideal haben mußten, um das zu ertragen. Ihr Vater, Freund von Lenin, war sehr bald nach dem Krieg in Russland gewesen. Wenn ich aber gedacht hatte, daß nun die Wünsche dieser Revolutionäre mit der russischen Revolution erfüllt wären, dann hatte ich mich gründlich geirrt, denn Rühle war schwer enttäuscht aus Russland zurückgekommen. Resultat: er zog sich ganz vom politischen Leben zurück, heiratete (Gretes Mutter war schon lange tot) eine reiche Tschechin und lebte in der Nähe von Dresden in einer Villa, wo er Bücher über Soziologie – oder jedenfalls in dieser Richtung – schrieb. Ich war einmal ein paar Wochen mit Grete bei ihren Eltern. Ganz in der Nähe wohnte auch Karl Sternheim, der berühmte Bühnenautor, und so kam ich indirekt durch das Bauhaus auch mit Kreisen in Berührung, die sehr interessant waren, wenn sie auch nichts mit dem Bauhaus zu tun hatten. Ja, Rühle machte sich immer ein wenig lustig über »Mazdaznan«. »Mazdaznan – laßt das man«, sagte er gern.
Aber Grete blieb nicht lange am Bauhaus, und wir haben uns später leider aus den Augen verloren. Wir waren ja noch sehr jung und jede suchte ihren Weg. Und doch hat Grete ein wenig Schicksal in meinem Leben gespielt, denn 1923 – es war das Jahr der Bauhaus-Ausstellung, wovon noch die Rede sein wird – sagte sie mir: hast du nicht Lust, acht bis zehn Tage nach Berlin zu fahren? Sie hatte nämlich ständig ein Zimmer in Berlin, was aber oft leer stand. Nun schlug sie mir vor, in ihrem Zimmer zu wohnen, da sie etwas anderes vorhatte. Ich brauchte also nur das Reisegeld. Vierter Klasse war nicht teuer. Also, auf nach Berlin. Ich weiß nicht mehr, ob es die Osterferien waren oder die Pfingstferien. Ich sagte schon, daß ich gern allein war und so hatte ich diese Reise ganz allein unternommen. Zwar hatte ich verschiedene Empfehlungen an Leute in Berlin, die dem Bauhaus nahe standen, aber ich zog vor, zu bummeln, mir das Kaiser-Friedrich-Museum anzusehen und die Hauptstadt kennen zu lernen. Der Zufall aber wollte es, daß ich einen Bauhauskameraden traf, der mit Doesburg und großem Hallo das Bauhaus verlassen hatte und nun in Berlin seinen Weg suchte, mit Doesburg und den Konstruktivisten.
Er hieß Werner Graeff und lebt heute in Essen. Wir machten einen gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt und kamen über den Wittenbergplatz. Werner zeigte auf ein schräges Atelierfenster in Richtung Bayreuther Straße und sagte, dort wohne ein schwedischer Künstler namens Viking Eggeling, ein sehr interessanter Mann. »Was macht er?« fragte ich. Und Graeff erklärte mir, was der mache, sei etwas ganz Neues, nämlich, er zeichne sozusagen mit Licht auf die dunkle Leinwand, bringe einfache geometrische Formen und Linien in einen durch Proportion, Zahlenverhältnisse und Lichtstärke geschaffenen Rhythmus. Daraus entstehe so etwas wie eine Lichtmusik fürs Auge. Diese Beschreibung fand ich faszinierend. »Wo kann man das sehen?« fragte ich. »Vielleicht bei ihm«, sagte Graeff, »gehen wir mal hinauf, vielleicht ist er zu Hause.« Ich war sehr beeindruckt, daß Graeff einen so bedeutenden Künstler nahe genug kannte, um schon am Vormittag – es war etwa 11 Uhr – einen improvisierten Besuch bei ihm zu machen, noch dazu in Begleitung einer fremden Person. Das Haus befand sich Ecke Bayreuther- und Wormser Straße, Wormser Straße 6 a. Wir stiegen sechs Treppen hinauf und Werner klopfte energisch an die Tür, hinter der sich nichts rührte. Er gab aber nicht auf, und tatsächlich fragte endlich eine verschlafene Stimme: wer ist da? Graeff gab sich zu erkennen und bald öffnete sich die Tür. Eggeling war mittelgroß, blond und blauäugig, nicht mehr jung, damals schon über vierzig Jahre alt. Als er zwei Jahre später starb, war er 45.
Eggeling war ein Visionär, der sein Leben lang auf der Suche nach dem Absoluten gewesen war, nie – oder nur sehr vorübergehend – ohne Geldnot gelebt hatte. Er litt seit vielen Jahren an Schlaflosigkeit und konnte nur schlafen, wenn er Gardenal nahm. Auch behauptete er, daß die Ärzte es ihm empfahlen, weil es besser sei, Schlafmittel zu nehmen, als nicht zu schlafen. In dem ärmlich möblierten Atelier fielen die Entwürfe für den abstrakten Film auf, die auf Papierrollen gezeichnet, mit Reiszwecken an den Wänden befestigt waren. Einer weißen Wand gegenüber stand ein kleiner Kino-Projektionsapparat auf einer Holzkonsole befestigt, dessen Handkurbel Eggeling selbst betätigte. Er befand sich zu jener Zeit in einer verzweifelten Lage – wie sicher schon oft in seinem Leben. Er war besessen von seiner Idee, ohne die geringsten technischen Kenntnisse zu ihrer Realisierung zu haben und war daher für die Arbeit, die am Tricktisch stattfand, auf einen Operateur angewiesen, der stundenweise bezahlt werden mußte. Aber das Geld, das ihm seine Familie in Schweden geliehen hatte, um zu experimentieren, ging zu Ende und er konnte den Operateur nicht mehr bezahlen, der übrigens nichts zustande gebracht hatte, weil er solchen Ideen total fremd gegenüberstand. Eggeling wußte seine Idee so plausibel zu machen, daß ich – jung und unerfahren – nur mit Begeisterung, ohne jegliche Kritik, zuhörte. Daß ich am Bauhaus war, galt für Eggeling wahrscheinlich als ein Zeichen des Schicksals. Ich sollte der rettende Engel werden, der ihm bei der Ausführung seiner Ideen half. Es hatte natürlich etwas Verlockendes, denn hier war vielleicht – so dachte ich in meiner Naivität – ein Weg für mich, der ganz neu war und mich mehr interessierte als Teppichweberei.
Seite aus dem Manuskript »Erinnerungen an Viking Eggeling«