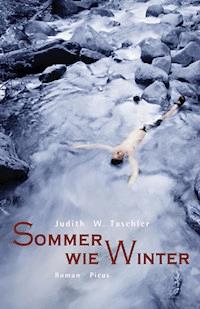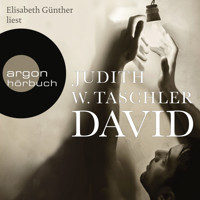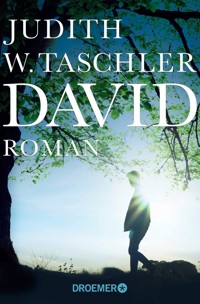Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue große Roman von Judith W. Taschler, die es „versteht, den Leser zu fesseln.“ Sebastian Fasthuber, Falter Elisabeth ist das jüngste der vier Brugger-Kinder. Im Ersten Weltkrieg arbeitet sie als Lazarettschwester, nach dem Krieg studiert sie Medizin. Sie heiratet den Sohn einer alteingesessenen Wiener Ärztefamilie, der versehrt von der Südfront zurückgekehrt ist. Die beiden führen gemeinsam eine Praxis. Elisabeth kann die Augen nicht verschließen vor dem Elend der Frauen, die in ihrer Verzweiflung eine Engelmacherin aufsuchen. Sie muss sich die Frage stellen, wie weit sie bereit ist zu gehen … Eine besonders enge Beziehung hat sie zu ihrem Bruder Eugen, sie ist die Einzige, die von seiner Affäre mit der Frau seines Zwillingsbruders Carl weiß. Als Eugen eine Familie vor der SS versteckt, wird er selbst zum Gesuchten. War es Carl, der ihn verraten hat?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der neue große Roman von Judith W. Taschler, die es »versteht, den Leser zu fesseln.« Sebastian Fasthuber, FalterElisabeth ist das jüngste der vier Brugger-Kinder. Im Ersten Weltkrieg arbeitet sie als Lazarettschwester, nach dem Krieg studiert sie Medizin. Sie heiratet den Sohn einer alteingesessenen Wiener Ärztefamilie, der versehrt von der Südfront zurückgekehrt ist. Die beiden führen gemeinsam eine Praxis. Elisabeth kann die Augen nicht verschließen vor dem Elend der Frauen, die in ihrer Verzweiflung eine Engelmacherin aufsuchen. Sie muss sich die Frage stellen, wie weit sie bereit ist zu gehen … Eine besonders enge Beziehung hat sie zu ihrem Bruder Eugen, sie ist die Einzige, die von seiner Affäre mit der Frau seines Zwillingsbruders Carl weiß. Als Eugen eine Familie vor der SS versteckt, wird er selbst zum Gesuchten. War es Carl, der ihn verraten hat?
Judith W. Taschler
Nur nachts ist es hell
Roman
Paul Zsolnay Verlag
1
In den Zeitungen stand, dass Wirbel gemacht werden sollte.
Und weil mich das interessierte, fuhr ich mit der Straßenbahn in die Innenstadt, um mir den Wirbel anzusehen. Eine Menge Leute waren auf der Straße unterwegs, vor allem junge, auffallend viele Männer waren unter ihnen. Das beeindruckte mich. Es ging eine Kraft von den Marschierenden aus, die mich anzog, ich überlegte sogar, mich unter sie zu mischen, blieb dann aber am Straßenrand stehen und schaute zu. Einige reckten die Fäuste gegen den Himmel. Sie schrien im Chor, immer die gleichen Wörter, ich konnte sie nicht verstehen. Die Luft war klirrend kalt, und ich sah die kleinen Atemwolken vor dem Gesicht derjenigen, die an mir vorbeimarschierten. Drei Männer — ein Pfarrer, ein Richter und ein Arzt — zogen einen großen Schubkarren, auf diesem befand sich ein großer hölzerner Käfig. Darin stand aufrecht eine Frau. Sie trug Sträflingskleidung, auf dem Kopf eine Stoffkappe, sie hielt sich rechts und links an den Stäben fest. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Einem älteren Paar neben mir war das Missfallen offen anzusehen, und ich verspürte plötzlich ein Schamgefühl darüber, mich bei den Gaffern aufzuhalten, anstatt mitten im Geschehen zu sein.
Wenige Meter von mir entfernt befragte ein junger Mann einige Passanten. Er trug nur einen dünnen Ledermantel über seinem geblümten Hemd, ich sah ihn schon mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegen. Während er den Leuten ein Mikrofon unter die Nase hielt, filmte hinter ihm stehend ein weiterer Mann das Interview, die beiden waren vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
»Was denken Sie darüber? Was sagen Sie dazu?«, fragte der Reporter. Eine detailliertere Frage fiel ihm offenbar nicht ein.
Die beiden kamen in meine Richtung, ich wandte mich ab und ging Richtung Straßenbahnhaltestelle. Als ich zurückschaute, sah ich, dass der Schubkarren angehalten worden war und die Frau begonnen hatte, mit einer Axt die Stäbe zu zerschlagen. Daneben wurde ein Plakat in die Höhe gehalten, darauf stand geschrieben: Kinder sollen glücklich sein.
In der Straßenbahn dachte ich dann, dass mich die Aktion mehr angesprochen hätte, wenn sie nicht derart reißerisch und theatralisch gewesen wäre. Plakate mit Informationen, Fakten, wären mir lieber gewesen als ein Käfig, der zerhackt wurde, ich hatte mit Exzentrik schon immer wenig anfangen können. Ich sagte mir: Du darfst nicht von dir ausgehen, es ist eine Angelegenheit der jungen Leute. Und wie heißt es so schön? Der Zweck heiligt das Mittel.
Diese Protestkundgebung fand vor fast einem Jahr, im Dezember 1972, statt. Am Abend dann überkam mich das heulende Elend, ich muss zugeben, es war eine Menge Alkohol im Spiel. Es war nicht so, dass mich die Demonstration derart aufgewühlt hätte, so schnell wühlt mich nichts auf, das kannst du mir glauben, und schon gar nicht eine Aktion, der — im Nachhinein betrachtet — sogar etwas Lächerliches anhaftet. Als ich in die Wohnung kam, läutete das Telefon, am anderen Ende der Leitung hustete und nieste meine Freundin, sie war zu verkühlt, um vorbeizukommen, so wie sie es an den meisten Samstagen tat. Franzi — Franzisca Auersperg — ist vier Jahre jünger als ich, wir haben uns vor über fünfzig Jahren an der Universität kennengelernt. Du wirst sie sicherlich bald kennenlernen und du wirst sie mögen. Früher besuchten wir Konzerte, gingen ins Theater, ins Kino oder einfach nur gut essen, aber in den letzten Jahren hat sich eingebürgert, dass sie zu mir kommt oder ich zu ihr. Es ist uns vieles zu mühsam geworden, und wir finden es gemütlicher, zu Hause beieinander zu sitzen, manchmal laden wir noch eine oder zwei weitere Freundinnen ein.
Ich war enttäuscht. Ich brauchte jemanden zum Reden, wollte vom Gesehenen berichten und von meinen ambivalenten Empfindungen darüber. Außerdem hatte ich eine Flasche Schlumberger, frisches Dinkelbrot, verschiedene Aufstriche, Käse, für uns gekauft. Ich wusste nicht recht, was ich mit dem unerwartet einsamen Abend anfangen sollte, ich rief meine Schwiegertochter an, sie hob nicht ab. Die Künstlerin im Käfig, in der lachhaften Sträflingsbekleidung — als wäre das Ganze ein Faschingsumzug und keine Demonstration für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs —, ging mir nicht aus dem Kopf. Ihr theatralischer Gesichtsausdruck, als sie die Axt nahm und begann, damit die Stäbe zu zerschlagen, Herrgott! Als würde man so der Sache gerecht werden. Mit einer Heftigkeit überkamen mich Erinnerungen, ich schenkte mir ein Glas Sekt ein und schnell ein zweites. Erinnerungen und Alkohol sind eine fatale Kombination.
Aus der Schublade des Schreibtisches holte ich ein Heft, weil ich dachte, es würde mir helfen, wenn ich meine Gedanken niederschrieb. Eigentlich war es kein Heft, sondern ein Buch, eines mit vielen leeren linierten Seiten und einem schönen Bild vorne am Einband, nämlich Gustav Klimts Der Kuss. Ich hatte mich schon länger mit dem Gedanken getragen, ein paar Dinge aus meinem Leben aufzuschreiben, weshalb ich dieses Buch vor Jahren gekauft hatte, in der Schreibwarenhandlung wurde es als meistverkauftes Tagebuch angepriesen. Nicht weil ich dachte, mein Leben würde irgendjemanden interessieren, ich hoffte, meine Selbstgespräche dadurch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Sie waren mir unendlich peinlich, seitdem ich erkannt hatte, dass ich nicht nur in der Wohnung mit mir redete — dort frönte ich ihnen wie einem wohltuenden, entspannenden Laster —, sondern auch in der Straßenbahn, im Geschäft, auf offener Straße. Ich war der Meinung gewesen, ich hätte mich unter Kontrolle, sobald ich die Tür meiner Wohnung hinter mir zuzog.
Ich habe beschlossen, über mein Leben zu schreiben. Macht damit, was Ihr wollt, liebe Nachkommenschaft!, schrieb ich zügig auf die erste Seite. Danach folgten ein paar Sätze über den Krieg, der in uns steckt, dass ich ein Mädchen gewesen war, als der erste große Krieg ausbrach, und eine alte Frau, als der zweite endete, und dass ich in der Zwischenzeit als Ärztin an anderen Fronten zu kämpfen hatte.
Weiter kam ich nicht. Weil ich nämlich schneller trank, als ich schrieb. Tränen verwischten das Geschriebene, ich weinte um meine Mutter, um alle Frauen und vor allem um mich, ich zerfloss in Selbstmitleid und flennte tatsächlich wie ein kleines Kind. Glaub mir, ich bin nicht nahe am Wasser gebaut! Nach ein paar Sätzen legte ich den Stift zur Seite, meine Ergüsse waren mir zu pathetisch. Ich saß da, vor mir das aufgeschlagene Buch, heulte Rotz und Wasser und schalt mich selbst eine gefühlsduselige Kuh.
So viel zu deiner Frage, wann ich das letzte Mal geweint habe.
2
Ich hatte das Glück, behütet aufwachsen zu dürfen, mein Vater war ein wohlhabender Kaufmann und Händler. Ich war das Nesthäkchen und das Lieblingskind meiner Mutter, die Zwillinge Carl und Eugen waren zwölf Jahre älter als ich und Gustav fünf Jahre, er stand mir in meiner Jugend am nächsten.
Weil in meiner Familie Bildung etwas zählte, durfte ich eine Höhere Schule in der Stadt besuchen. Ich war heftig in meinen Geschichtelehrer verliebt. Als ich neunzehn war, fand ein folgenschweres Attentat in Sarajevo statt, daraufhin geriet unsere Welt aus den Fugen. In den folgenden vier Jahren arbeitete ich als Krankenschwester in verschiedenen Lazaretten. Gustav fiel in Galizien. Nach dem Kriegsende war ich eine andere. Ich wollte Medizin studieren, und obwohl meine Familie aufgeschlossen war, war sie dagegen. Eine Frau, die als Ärztin arbeitete? So viel zählte Bildung doch wieder nicht. Es sollte mir genug sein, Krankenschwester zu sein und später zu heiraten.
Was ich auch rasch tat: Ich heiratete einen Kommilitonen meines gefallenen Bruders. Georg war versehrt aus dem Krieg heimgekehrt, ihm fehlte der linke Arm. Er war der Einzige, der meinen Wunsch, Medizin zu studieren, unterstützte. Nein, falsch, auch mein Bruder Eugen hielt in dieser Sache zu mir. Er forderte die Erlaubnis für mich von meinem Vater und von Carl, der das Elternhaus und den väterlichen Betrieb übernommen hatte. Ich sehe deine erstaunten Augen, ich weiß, dir hat man immer etwas anderes erzählt. Über Carl reden wir morgen. Oder übermorgen. Und auch darüber, was Eugen im Gegenzug dafür aufgab. Er kam oft zu Besuch nach Wien, wir verstanden uns gut und liebten beide das Nachtleben. Und Eugen liebte Luzia, die Frau seines Zwillingsbruders. Meine Schwiegerfamilie war sehr einflussreich, weshalb ich an der Universität von bestimmten Professoren weniger schikaniert wurde als andere Studentinnen, wie zum Beispiel meine Freundin Franzi. Als ich dann Ärztin war, gab es mitunter Zeiten, in denen ich mir wünschte, ich wäre Krankenschwester geblieben.
Georg und ich waren glücklich — in den ersten Jahren. Ich wünschte mir eine Tochter und bekam zwei Söhne. Meine Mutter lebte bei uns und kümmerte sich um Haushalt und Kindererziehung. Ohne sie wäre ich verloren gewesen. Meine kleinen Buben nannten ihre Großmutter »Mamie«, sie liebten sie heiß. Den ganzen Tag hieß es Mamie, lies uns etwas vor, Mamie, spiel mit uns Verstecken!
Gemeinsam mit meinem Mann übernahm ich die Praxis für Allgemeinmedizin vom Schwiegervater. Ich arbeitete viel und ging völlig in meinem Beruf auf. Es war eine schöne Zeit, ich fühlte mich gebraucht und privilegiert. Es war eine harte Zeit, ich konnte nicht wegsehen, all das Elend, es war zum Aus-der-Haut-Fahren, mir war es zu wenig, Lungen abzuhorchen, Säuglingen auf die Welt zu helfen. Ich war nicht vorsichtig genug, mein Name wurde mit bestimmten Kreisen in Zusammenhang gebracht, ich kam für zwei Tage ins Gefängnis. Es war ein Skandal und kostete mich beinahe meine Ehe.
Ich hatte einen Geliebten. Meine Mutter starb 1937. Ein Jahr später marschierte Adolf Hitler in Wien ein und wieder eineinhalb Jahre später befanden wir uns im zweiten großen Krieg. Zwanzig Jahre zuvor hatten die Kriegsverhandlungen vom ersten stattgefunden. Nur zwanzig Jahre, das ist ein bisschen mehr als ein Drittel eines Lebens! Es kam mir vor, als wäre ich zurückkatapultiert worden in meine Jugend, als habe die Zeit aus Versehen den Rückwärtsgang eingelegt und wäre im Sommer 1914 abrupt zum Stehen gekommen. Wieder große Töne der Machthaber im Rundfunk und unerträgliche Euphorie, die Leute wurden offenbar nicht klüger. Unser ältester Sohn wurde eingezogen und an die Ostfront abkommandiert. In der Schule hatte er so gerne von Friedrich I., mit dem Beinamen Barbarossa, gehört, jetzt verschluckte ihn die Operation Barbarossa: Im November 1941 erhielten wir die Vermisstenmeldung. Mein Mann ertrug den Gedanken nicht und griff zu seiner Walther. Um einer Einberufung an die Front zu entgehen, meldete sich der Jüngste freiwillig als Übersetzer für die SS. Ich arbeitete ein halbes Jahr in einem Feldlazarett in Russland.
Weil unaufhörlich Bomben auf Wien fielen, verbrachte ich das Frühjahr 1945 auf dem Land, in meinem Elternhaus, dort gab es nur Frauen: meine Schwägerin, meine Nichte, eine jüdische Familie, die aus der Mutter und den zwei Töchtern bestand, und mich. Wir warteten auf die Rückkehr der Männer. Genau einen Monat später wurde der Krieg offiziell für beendet erklärt. Scharenweise zogen Kriegsheimkehrer durch die Dörfer, und die Russen bezogen die Ämter in den größeren und kleineren Städten.
Beruflich begann eine arbeitsame Zeit für mich, ich gestaltete die Praxis neu und stellte eine junge Ärztin ein, mein privates Leben verlief ruhig. Mein Sohn kehrte 1949 aus der Kriegsgefangenschaft heim. Er hatte sich nicht angekündigt, er stand einfach vor der Tür. Ich glaube, das war das vorletzte Mal, dass ich heulte wie ein Schlosshund. An einem warmen Herbsttag im Jahr 1954 starb mein Bruder Eugen; kurze Zeit darauf übergab ich die Ordination an meine Nachfolgerin. Zur Pensionierung schenkte mir mein Sohn einen Welpen. Eine meiner letzten Tätigkeiten als Ärztin war das Ausstellen des Rezeptes für ein Verhütungsmittel. Die »Anovlar«, eingeschweißt in silbernes Stanniolpapier, war groß wie eine Linse und grün wie eine Erbse. Die Antibabypille war ein Jahr zuvor in Österreich auf den Markt gekommen — ich bezeichne das als Revolution —, die Mondlandung sieben Jahre später war nichts dagegen. Ich habe sie trotzdem im Fernsehen verfolgt, gemeinsam mit meinem Sohn, der Schwiegertochter und deren Kindern, ein paar Freunden, meinem Hund und einem Glas Sekt.
Das ist die Kurzfassung meines Lebens.
3
Du willst wissen, was mir als erstes einfällt, wenn ich zurückschaue?
Ich sehe vor mir: Ein Mann, in Arbeitskleidung, sitzt allein am Küchentisch, es ist Nacht. Mit seiner schönen geschwungenen Handschrift schreibt er Briefe, er hält immer wieder inne, lauscht zur Tür hin, schließlich beendet er sie und faltet sie sorgfältig. Er verlässt den Raum, wirft einen letzten Blick zurück und zieht die Tür mit Nachdruck hinter sich zu. Langsam geht er durch den Hausflur, er verlässt das Haus und stellt fest, dass es leicht zu schneien begonnen hat. Schweren Schrittes geht er zu einem Auto, steigt ein und fährt los, im Rückspiegel sieht er das Haus kleiner werden.
Wie seltsam eigentlich. Was ich soeben geschildert habe, habe ich nicht wirklich gesehen, ich bin nicht dabei gewesen. Aber ich habe es mir so oft vorgestellt, dass sich dieses Bild, wie der Mann in der nächtlichen Küche Briefe schreibt, in mein Gedächtnis gebrannt hat und zu einer Erinnerung geworden ist. Letztendlich ist das, woran man sich erinnert, nicht immer dasselbe wie das, was man selbst erlebt hat.
Es gibt noch weitere Bilder, die vor meinem geistigen Auge auftauchen, wenn ich mich in der Vergangenheit verliere, sie sind nicht in dieser Reihenfolge geschehen:
Das durchscheinende Gesicht einer alten Frau, verschwindend klein auf einem großen Polster mit rot-weiß-kariertem Bezug, die Augen gequält und rastlos.
Braungebrannte muskulöse Arme über mir, die Hände fest auf meinen Schultern, dichtes brünettes Haar fällt ins Gesicht.
Zwei nackte Buben, vor Freude kreischend, in einem mit Wasser gefüllten Holzzuber unter einem blühenden Apfelbaum.
Ein Mann und eine Frau, tanzend in einer nächtlichen Bar, so viel hingebungsvolle Sinnlichkeit ist zwischen ihnen spürbar, ich kann den Blick nicht abwenden.
Ein großes Steak wird resolut in kleine Stücke zerteilt, das Messer knirscht auf dem Teller.
Der Widerschein von fernen Artilleriefeuern, flackernd an der Decke eines Zugwaggons.
Der Mann, der in dieser Winternacht in seiner Küche Abschiedsbriefe für seine Familie schrieb, war mein Bruder Carl. Ihm war bewusst, er würde sie nicht wiedersehen. Zeitlebens spielte er keine große Rolle in meinem Leben, von allen Familienmitgliedern kannte ich ihn am wenigsten. Carl hatte das Elternhaus übernommen, ich sah ihn, wenn ich mit meinen Kindern einige Tage dort verbrachte. Nach Wien, um mich zu besuchen, kam er kaum. Er war freundlich, zurückhaltend, ernst, eher wortkarg, es war immer sein Zwillingsbruder Eugen gewesen, dem ich mich näher fühlte. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, kommt mir Carl in den Sinn.
Ich schaue oft zurück, ja, ich rede viel mit mir selbst und ich schaue viel zurück. So ist das, seitdem mir bewusst wurde, dass ich am Ende des Lebens angekommen bin, nicht des Lebens an sich — ich war damals knapp über fünfundsechzig und hoffte natürlich noch auf ein paar Jahre, tue es immer noch —, ich meine damit das Ende jeder Wahrscheinlichkeit einer Veränderung im Leben.
Aber es ist besser, ich beginne von vorne.
4
An meine ersten zwölf, dreizehn Jahre habe ich nicht viele Erinnerungen. Das Heimatdorf in der Provinz, unscheinbar, du kennst es, auch du bist dort aufgewachsen. Kann man das überhaupt sagen von einem Dorf: unscheinbar? Es war damals noch kleiner, als es heute ist, nicht einmal tausend Leute waren ansässig. Die weite Talsenke, durch die ein Bach fließt, umgeben nur von Wiesen und Wäldern, idyllisch. Das geräumige helle Haus mit der Holzveranda, komfortabel und gemütlich. Mein Vater selbst hatte es geplant, er hatte als junger Mann die Welt gesehen und wollte eine Bauweise, die sich abhob von anderen in der Gegend, er verabscheute winzige finstere Kammern. Von außen wirkte es wie eine trutzige schiefe Burg, weil das neue Haus direkt an die alte — niedrigere — Mühle angebaut worden war. Mein Vater, ein erfolgreicher Kaufmann, konnte seiner Familie vieles bieten, mehr als es damals in einem kleinen Dorf üblich war. Mir fehlte es an nichts und außerdem wurde ich geliebt. Mein Elternhaus in diesem Tal — die Hofmühle —, abgelegen vom Dorf, war wie ein Kokon voller Fürsorge und Behaglichkeit für mich. Meine Brüder füllten den Kokon mit Temperament und Späßen, meine Mutter mit Sinn für das Schöne und mein Vater mit Wissensdrang.
Heute wird die Zeit, in der ich geboren wurde, in den Büchern als Belle Époque verklärt. Einmal las ich folgende Zeilen, deren ungefährer Wortlaut lautete: »Die Jahrzehnte ab 1880 waren nicht nur sicher und politisch friedvoll, es gab zudem Aufschwung und Neuerungen in vielen Bereichen, technologisch, in der Medizin, wirtschaftlich, gesellschaftlich, in den Künsten. Alles pulsierte, überall war eine schöpferische Kraft spürbar.«
Diese schöpferische, pulsierende Kraft konnte ich förmlich spüren. Mein Vater hatte eine Unmenge Zeitungen und Wissenschaftsmagazine abonniert, die er sorgfältig studierte, außerdem kam er viel herum. Er war interessiert und ein guter Erzähler, er berichtete gern von Gesehenem und Gelesenem. Ich hing an seinen Lippen. Durch ihn bekam ich mit, wie rasant sich die Welt veränderte.
Natürlich gab es die andere Seite der Medaille, ich sah sie als Kind nicht. Die Fabrikarbeiter in den Elendsvierteln, die einen Hungerlohn bekamen und keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hatten, hätten diese Zeit rückblickend wohl kaum als »Schöne Epoche« bezeichnet. Damit wurde ich erst später konfrontiert, in Wien.
Ich erinnere mich daran, dass ich zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr manchmal an Angstzuständen und Albträumen litt. Ich hatte das Gefühl, ein Teil von mir würde fehlen, als hätte jemand mit Gewalt meine zweite Hälfte von mir getrennt. Das Gefühl war körperlich und durchdringend. Mit sechs, sieben war ich überzeugt davon, eine Zwillingsschwester gehabt zu haben. Meine Mutter verneinte das. Ich fühlte mich einsam und war weinerlich, obwohl ich tagtäglich von vielen Leuten umgeben war, nicht nur von meiner Familie. Für den Haushalt hatten wir Personal, und auch die Angestellten des Kaufhauses gingen bei uns ein und aus. Ich kannte sie alle mit Vornamen, einige aßen sogar mit uns zu Mittag. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen, mein Vater mochte das, meine Mutter machte der Trubel wahnsinnig. In den Nächten war ich unruhig und wachte oft schreiend auf, in meinen wirren Albträumen war ich alleine, regelrecht ausgesetzt fühlte ich mich. Ich war auf der Suche nach jemand Bestimmtem, wusste aber nicht, wer die Person sein sollte, die ich so verzweifelt gesucht hatte. Meine Mutter schlief deshalb oft bei mir. Erst im siebten Lebensjahr begann ich, allein in meinem Zimmer zu schlafen, ich zwang mich dazu, meine Ängste zu überwinden. Ich wollte meinem Vater gefallen.
Später dann, in meinem neunten, zehnten Lebensjahr, war ich trotzig, schnell erregt. Ein Zorn, von dem ich das Gefühl hatte, er würde mich innerlich zerreißen, überkam mich schnell, ich zwang mich jedes Mal, ihn zu unterdrücken, was mir meistens nicht gelang. Es reichte, wenn Gustav ein hänselndes Wort sagte oder mein Vater mich beim Essen ignorierte, um mich für Stunden todunglücklich und wütend zu machen. Mein Vater war wesentlich älter als meine Mutter; als ich zur Welt kam, war er bereits siebenundvierzig. In meiner Kindheit nahm er mich kaum wahr. Er, den ich vergötterte, und die Brüder, die ich bewunderte, bildeten eine Einheit, diese war unerreichbar für mich, und das machte mich rasend. Meine Mutter war überglücklich über die Geburt einer Tochter gewesen, zumindest wurde mir das so gesagt, sie selbst stritt es immer ab, vor allem, wenn Gustav dabei war. Sie verwöhnte mich, ich liebte sie und hing an ihr, aber ihre Welt erschien mir eng, die des Vaters hingegen aufregend. Ich war sozusagen der Augapfel der Mutter, der ständig aus den Augenwinkeln die Brüder beobachtete und den Vater belauschte.
Ich tat alles, um von ihm gesehen zu werden, und wünschte mir nicht nur, dass er mir Aufmerksamkeit schenkte, sondern auch Gutes von mir dachte. In seinen Augen zählten Wissbegierde, Neugier der Welt gegenüber, Mitgefühl für Menschen, mit denen es das Leben schlechter gemeint hatte. Also gab ich mich klug und interessiert. Ich begann viel zu lesen, zu lernen, und es beruhigte mich, eine Klarheit breitete sich in meinem Kopf aus. Es war, als würde ich meinen Verstand entdecken und Gefallen an ihm finden, oder er an mir. Meine Entwicklung nahm mein Vater mit Wohlwollen zur Kenntnis, und er entschied, dass ich weiter zur Schule gehen sollte. Aus diesem Grund kam ich mit dreizehn nach Wien.
An wenige Erlebnisse in meiner Kindheit erinnere ich mich ganz konkret.
War ich sechs oder sieben? Ich bin mir nicht sicher, in welchem Sommer es passierte, ich weiß nur, es war heiß und drückend, mehrere Wochen hintereinander regnete es nicht. Mir machten die Temperaturen nichts aus — auch heute nicht —, aber die Erwachsenen konnten nicht aufhören zu jammern und zu stöhnen. Verwandte meiner Mutter waren aus Wien zu Besuch, um der Hitze in der Großstadt zu entkommen. Ich betrat das Wohnzimmer, Sonnenlicht schien durch die Fenster und machte Staubkörner sichtbar, Cousin Wilhelm, sechs Jahre älter als ich, fläzte sich auf dem Sofa. Als ich bei ihm vorbeiging, zog er mich auf seinen Schoß. Niemand störte sich daran, auch ich nicht, es war nichts Ungewöhnliches, wenn der Cousin die kleine Cousine herzte. Er fing an, mich zwischen meinen Beinen zu reiben, und ich legte meine Hände auf seine Knie. Ein seltsam warmes Gefühl stellte sich ein, es war gedämpfte Erregung und gleichzeitig die Empfindung des Verbotenen. Nach einer Weile rutschte ich von seinem Schoß und ging weg. Ich habe sie nie vergessen, diese verstohlene Berührung im Vorübergehen, sie war meine erste sexuelle Erfahrung. Es war nicht traumatisch, es war neu, und die Neugier hinterließ einen deutlichen Eindruck in meinem Gedächtnis. Später wurde mir bewusst: Wäre ich nicht gegangen, wäre ich nicht imstande gewesen, meinen eigenen Willen zu behalten, hätte die Sache vielleicht eine durchaus unschöne Erinnerung hinterlassen. Ich muss also im Umgang mit anderen willensstark gewesen sein. Wie war ich noch als Kind? Ich war sehr empfindsam, ich glaube, ihr würdet heute sensibel dazu sagen, ich konnte Stimmungen von anderen gut wahrnehmen. Alles ging mir nahe, ohne dass ich es zeigen wollte. Ich war hoffnungslos ernsthaft, ohne die Distanz der Ironie oder die Begabung, meine Gefühle zu verbergen. Das kam alles erst später.
Das Zweite, woran ich mich gut erinnern kann, ist der Abschied von meinem Bruder Eugen. Er war zwanzig Jahre alt, als er nach Amerika ging, ich war zu dem Zeitpunkt acht.
Eugen war mir der Liebste von den Brüdern. Während Gustav mich aus Eifersucht hänselte und Carl — der ernste, verantwortungsvolle Carl — mich vor lauter Pflichten nicht wahrnahm, war Eugen der Einzige, der sich mit mir abgab. Natürlich nicht viel, es war nicht so, dass er sich täglich lange mit mir beschäftigte. Ich wuchs in einer Zeit auf, in der Kinder die Aufgabe der Mutter oder einer Angestellten waren und sich im Hintergrund zu halten hatten. Aber Eugen wandte sich bei den Mahlzeiten auch an mich, um mit mir zu plaudern, er interessierte sich für meine Spiele, er nahm mich mit auf Spaziergänge. Ja, es kann sein, dass ich ihn verkläre.
Eines Tages teilte er uns überraschend mit, dass er nach Amerika gehen werde, und da er — heimlich — bereits alles Notwendige dafür veranlasst hatte, stand seine Abreise schon bald bevor.
»Es ist nur für ein paar Jahre«, versicherte er, nachdem die Fassungslosigkeit des Vaters — und auch die seiner Geschwister — offensichtlich war.
Mir verschlug es bei seiner Ankündigung die Sprache, eine unglaubliche Wut kroch in mir hoch. Ich weiß noch heute, dass Carl, weiß im Gesicht und ohne ein Wort zu sagen, vom Stuhl aufstand und den Raum verließ. Wir spürten alle, dass Eugen nicht vorhatte, so schnell wiederzukommen, dass es eine Auswanderung war. Er hatte offensichtlich nicht den Mut, uns das zu sagen.
Eugen wollte nicht, dass wir ihn zum Bahnhof begleiteten, und verabschiedete sich zu Hause von uns. Ich klammerte mich an ihn, der Vater musste mich schließlich mit Gewalt von ihm lösen, und die Mutter brauchte lange, um mich zu beruhigen. Zu dieser Zeit begann meine Trotzphase.
Erst Monate später erfuhren wir aus einem Brief, dass die Zugfahrt nach Bremerhaven zwei Tage lang gedauert, er dort den Schnelldampfer »Kronprinz Wilhelm« bestiegen, dass er die Prüfungen in der Einwanderungsbehörde auf Ellis Island mit Bravour gemeistert hatte und ihm das Leben in Milwaukee, Wisconsin, sehr zusagte. Es waren sachliche Zeilen, die nur dazu dienten zu informieren, mehr nicht. Kein Wort davon, dass er die Heimat oder die Familie vermisste, keine Frage nach unserem Befinden oder die Bitte nach einem Brief. In der Folge kamen nicht viele Briefe, es waren etwa zwei im Jahr. In allen erzählte er nur kurz, wo er sich gerade aufhielt und was er arbeitete, manchmal schilderte er einige Beobachtungen.
Ein weiteres Erlebnis ist mir im Gedächtnis geblieben, wobei ich mich sicherlich nur deshalb daran erinnern kann, weil mir oft davon erzählt wurde. Es ist quasi eine Erinnerung an eine oft erzählte Erinnerung. Ich war dreieinhalb, als sich meine Eltern mit mir zum Bahnhof aufmachten und wir mit dem Zug nach Linz fuhren.
Ein fünfundzwanzigjähriger Italiener hatte die Kaiserin — nach der ich benannt worden war — an einem See in der Schweiz mit einer Feile erstochen. Auf dem kurzen Weg vom Hotel zur Schiffsanlegestelle rammte ihr Luigi Lucheni eine Feile in die Brust, schnell und kräftig. Eigentlich hatte er den Herzog von Orleans ermorden wollen, aber dessen Besuch in Genf war kurzfristig abgesagt worden. Lucheni bezeichnete sich selbst als Anarchisten, sein Hass auf alles Aristokratische war groß.
»Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen«, waren seine Worte.
Die über acht Zentimeter lange Stichwunde ging in Höhe der vierten Rippe durch die Lunge und durch die ganze Breite des Herzens der Kaiserin. Trotzdem eilte die Sechzigjährige weiter und erreichte das Schiff. An Deck wurde sie ohnmächtig, kam aber schnell wieder zu sich und sprach sogar einige Worte, nachdem die Hofdame ihr Korsett geöffnet hatte. Später fragten sich die Mediziner, wie es möglich war, dass die Kaiserin mit einer so schweren, sich quer durch das Herz ziehenden Wunde noch auf das Schiff eilen und sogar noch reden konnte. Kann man erstochen werden, ohne es zu merken? Ich beschäftigte mich viel damit, ist eine Berufskrankheit. Die Antwort auf dieses medizinische Rätsel liefert wahrscheinlich das starre Korsett. Da es Bauch und Becken zusammendrückte, befand sich viel Blut im Oberkörper, nach dem Öffnen floss diese Reserve schnell ab, das Blut verteilte sich im ganzen Körper. Nun befand sich ungewöhnlich wenig Blut in Herznähe und durch den Schock wurde dem Herzen auch zu wenig Sauerstoff zugeführt. Das Herz begann zu fibrillieren, es zog sich zusammen und war völlig ineffizient.
Lucheni triumphierte bei seiner Verhaftung, später, 1910, beging er in seiner Zelle — er wurde in Dunkelhaft gehalten — Selbstmord. Er erhängte sich mit seinem Gürtel, obwohl es Zweifel gibt an der offiziellen Version, auf jeden Fall war das Gefängnispersonal erleichtert, er war ein unbequemer Insasse. Weißt du, dass sein Kopf aus wissenschaftlichen Gründen aufgehoben wurde und im Narrenturm ausgestellt ist? Ach Herrgott, ich schweife ab!
Mein Vater war ernst und traurig, als wäre die Tragödie ihm passiert und nicht dem Kaiserhaus. Sein Gesichtsausdruck machte mir Angst. In Linz standen wir inmitten vieler anderer Menschen auf einem Bahnsteig und warteten. Ein Zug fuhr langsam ein und kam mit sehr lautem quietschendem Geräusch zum Stehen. Ich presste weinend meine Hände auf die Ohren, mein Vater hob mich auf seine Schultern. Unmittelbar vor uns öffnete sich die Schiebetür eines Waggons, der Sarg, bedeckt mit einem dunklen Tuch aus Damast, befand sich nicht einmal drei Meter von uns entfernt. Mein Vater salutierte, und die Männer in seiner Nähe taten es ihm nach, die Frauen senkten ihre Köpfe. Nach kurzer Zeit wurde die Schiebetür wieder geschlossen, der Zug fuhr langsam aus dem Bahnhof und die Leute zerstreuten sich allmählich. Jahrelang stellte ich mir die tote Kaiserin im Sarg liegend vor, sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid, die Hände waren gefaltet und aus ihrem Herzen ragte senkrecht die Feile. Ich hatte auch Albträume von ihr. Im Sarg liegend öffnete die Kaiserin plötzlich die Augen, sah mich starr an und sagte, während ich den Blick nicht von der Feile wenden konnte: »Bist du heute schon an der frischen Luft gewesen?«
Das war meine Kindheit, an viel mehr erinnere ich mich nicht.
Ich denke selten nostalgisch an sie. Nicht weil es keine gute Kindheit gewesen wäre — im Gegenteil! —, sondern weil mir Leute zuwider sind, die darin steckengeblieben sind und sich in schwadronierenden, verklärenden Ergüssen darüber ergehen. Oder in verunglimpfenden.
Zu dem gemacht, was ich heute bin, hat mich meine Jugendzeit in der Stadt mit Sicherheit mehr als meine Kindheit im Dorf. Wenn man überhaupt eine derartige Behauptung aufstellen kann: Ein Lebensabschnitt macht dich zu etwas.
5
»Ich habe eine Wohnung in Wien gekauft«, verkündete der Vater eines Abends, nachdem er von einer mehrtägigen Geschäftsreise zurückgekommen war.
Das war im Sommer 1908, ich war dreizehn. Er musste sich bereits länger mit dem Gedanken getragen und sich nach etwas Passendem umgesehen haben. Ich wusste damals nicht und weiß es auch heute nicht, ob dieser Wohnungskauf — in einer noblen Gegend — für ihn eine Bagatelle gewesen war oder ob es ihn Mühe gekostet hatte, das Geld aufzubringen, oder ob er sich gar dabei finanziell übernommen hatte. Ich erinnere mich nur daran, dass es in unserer Familie keine Selbstverständlichkeit darstellte, sondern eine wirklich große Sache war, aber wahrscheinlich eher deshalb, weil die Trennung der Familie bevorstand.
Wochenlang herrschte Aufregung und eine fröhliche Aufbruchsstimmung, sie steckte sogar den Vater an. Gustav sollte Medizin studieren, es war sein Wunsch, seitdem er zwölf war, und ich die Höhere Schule besuchen. Der Vater wollte nicht, dass sein jüngster Sohn in Untermiete bei fremden Leuten lebte, und der Gedanke, dass seine Tochter das ganze Jahr über bei Klosterschwestern untergebracht war, war ihm ein noch größeres Gräuel. Die Mutter würde die meiste Zeit bei uns wohnen, das hatte er so entschieden, ich war ihm zu jung, um nur unter der Aufsicht einer Haushälterin zu stehen. Und Gustav, sein Liebling, sollte das Studentenleben genießen und sich nicht verantwortlich für die kleine Schwester fühlen müssen. Ich glaube, das war in Wahrheit der Hauptgrund.
Zu Beginn des Septembers 1908 reisten wir mit unseren Koffern und Truhen nach Wien. Er selbst blieb im Dorf mit Carl, seiner Schwester und deren Mann. Es mag seltsam klingen, aber die räumliche Distanz schuf eine Nähe zwischen meinen Eltern, die ich zuvor vermisst hatte.
Wir waren im Alltag ein gutes Dreigespann, meine Mutter, Gustav und ich. Wir fühlten uns wohl in Wien, es herrschte eine gelöste Stimmung. Die Mutter wirkte wie eine andere Person. Wir erkannten sie manchmal kaum wieder, sie summte vor sich hin, sie war entspannt, im Dorf war sie mit leidender Miene durch das große Haus gehuscht, die meiste Zeit müde, kopfwehgeplagt und leicht gereizt. Sie, die es im Dorf schwer ertragen hatte, dass sie nie ihre Ruhe hatte, begann Bekannte einzuladen, saß mit ihnen bei Kaffee und Kuchen zusammen und sprach über Mode, Buchneuerscheinungen, aktuelle Theaterinszenierungen oder widmete sich einfach dem Klatsch und Tratsch.
Eigentlich waren wir zu viert, die Dippold — oder Dippi, wie ich sie bald nannte —, führte unseren Haushalt, sie kam frühmorgens und verließ uns am Abend wieder. Sie war Mitte vierzig, Verwandte hatten sie empfohlen, sie sei eine hervorragende Köchin, hieß es, fleißig, mit angenehmem, liebevollem Wesen, obendrein diskret. Meine Mutter entschied sich vor allem aus dem einen Grund für sie: Sie benötigte keine Unterkunft bei uns. Dippi war verheiratet, jedoch kinderlos, und lebte mit ihrem Mann in einer kleinen Wohnung, die sich in Fußnähe zu unserer befand. Die permanente Anwesenheit einer fremden Person wäre meiner Mutter zuwider gewesen.
Ich besuchte das Lyzeum in der Rahlgasse, das fünfzehn Jahre zuvor vom Verein für erweiterte Frauenbildung gegründet worden war, es war das erste Gymnasium für Mädchen in Wien. Es umfasste anfangs sechs Schulstufen anstelle von acht — vom zwölften bis zum achzehnten Lebensjahr — und wurde mit der Matura abgeschlossen. Ich gehörte zu den ersten Jahrgängen, welche diese im Haus ablegen durften, vorher hatten die Schülerinnen die Reifeprüfung als Externistinnen in einem Knabengymnasium absolvieren müssen.
Was ich am meisten genoss, war, dass ich von Mädchen umgeben war, ich war mit einem dominanten Vater, drei Brüdern und vielen männlichen Angestellten im elterlichen Betrieb aufgewachsen. Ich schloss schnell Freundschaften. Mit der Tochter eines Hotelbesitzers verbrachte ich am meisten Zeit, sie war — wie ich — ein Jahr älter als die anderen Mädchen und hatte eine lebendige, lustige Art. Das Hotel Nordbahn befand sich im zweiten Bezirk von Wien, Emma bewohnte mit ihren Eltern einige Zimmer in der zweiten Etage. Sie kam gerne zu uns, weil sie das Hoteltreiben satt hatte, ich hingegen fand genau das spannend. Am liebsten saß ich in der Eingangshalle und beobachtete die ein- und ausgehenden Leute, ich versuchte Alter, Familienstand, Wohnort und Beruf zu erraten. Wenn ein Gast unser besonderes Interesse geweckt hatte, löcherten wir den Rezeptionisten nach Einzelheiten.
Emma heiratete noch während des Krieges einen Bankangestellten und zog mit ihm nach Graz. Ihr Mann war untauglich und wurde an der Heimatfront, im Versorgungsamt, eingesetzt. Unmittelbar nach dem Krieg, im Frühling 1919, sah ich sie das erste Mal wieder, sie war zu Besuch bei ihren Eltern in Wien. Wir saßen in einem Café, sie plapperte unentwegt von ihrer kleinen Tochter, von der Einrichtung des Hauses, das sie gerade bezog, weil die alte Wohnung zu klein geworden war, so als hätte es keine vier Jahre Krieg gegeben. Sie war mir fremd geworden. Ich hielt ihr Geplapper nicht aus, stand auf und ging, ohne mich zu verabschieden. Später tat es mir leid, ich schrieb ihr einen Brief und entschuldigte mich, aber sie beantwortete ihn nicht.
Viel Prägendes erlebte ich nicht in meiner Schulzeit.
Abgesehen vom Biologie- und Geschichteunterricht ist mir das Gefühl der Langeweile, das ich in den meisten Fächern empfand, am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben. Gustav hatte ein Gymnasium in Linz besucht, und an den Wochenenden hatte ich mir seine Bücher geschnappt, darin gelesen und ihn mit Fragen gelöchert. Ich war dem Schulstoff voraus, gab mich in den ersten Wochen siebengescheit und vorlaut und brachte einige Lehrer auf die Palme. Sie maßregelten mich, danach verhielt ich mich ruhig. Das Fach, das ich am wenigsten mochte, war Französisch, sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die die Sprache in ihrer Jugend gelernt hatte und immer noch beherrschte, weil sie französische Romane las. Ich bevorzugte die naturwissenschaftlichen Fächer: Biologie, Chemie, Physik. Und ab dem vierten Schuljahr auch Geschichte, was einzig und allein am Lehrer lag. Er hieß Horvath.
Eine der wenigen Lehrerinnen an der Schule unterrichtete uns in Biologie. Ich weiß noch, dass deshalb in den ersten Stunden eine gewisse Aufregung herrschte. Wir waren begeistert von dem Gedanken, dass eine Frau uns unterrichten würde und dann auch noch in einem naturwissenschaftlichen Fach! Sie war auf der Universität gewesen! Alleine dafür bewunderten wir sie. Sie hieß Marie Varga und war Mitte zwanzig, eine kleine, zarte Person. Nach einem Jahr Studium der Medizin hatte sie zu Biologie gewechselt, es gab Gerüchte, dass sie Schwierigkeiten mit dem Professor der einführenden Anatomievorlesung gehabt hatte. Der Mann war sehr in sie verliebt gewesen, und sie hatte den Mut gehabt, ihn abzuweisen, daraufhin hatte er ihr das Studium zur Hölle gemacht. Dass eine Frau an der Universität keinen Mann abweisen musste, um es schwer zu haben, kam uns nicht in den Sinn. Aber niemand wusste Genaueres, weshalb sie eine Aura des Geheimnisvollen umgab. Sie war streng mit uns, aber gerecht, mit dem Stoff, den sie mit leiser Stimme vortrug, ging sie zügig vor. Ihr Wissen war beeindruckend. Einige der Eltern beschwerten sich, dass der Unterricht zu universitär war, daraufhin änderte sie — zu meinem Leidwesen — das Vortragstempo.
In den beiden letzten Schuljahren unterrichtete uns ein junger Lehrer, der frisch von der Universität an unsere Schule gekommen war, in Geschichte. Sein Name war Richard Horvath, er war nur wenige Jahre älter als wir. Der Direktor der Schule war ein entfernter Verwandter von ihm, der den jungen Mann — er kam aus ärmlichen Verhältnissen — unterstützen wollte.
Seine Art zu unterrichten war unkonventionell. Er saß nicht hinter dem Tisch, sondern seitwärts auf dem Tisch oder ging im Klassenzimmer auf und ab. Die Stunde begann er mit den Worten »Meine Lieben«, wobei er die Hände vor seinem Mund faltete. Er las gern Biographien, seiner Meinung nach war ein Verständnis vieler Entwicklungen nicht möglich, ohne über das Leben des jeweiligen Herrschers Bescheid zu wissen. Immer wieder baute er amüsante und pikante Details aus deren Leben geschickt in den Unterricht ein, er wusste, wie er die Aufmerksamkeit selbst der uninteressiertesten Schülerin erlangen konnte.
»Hätte Napoleon sich nicht in seine Joséphine verliebt, wäre er vermutlich nicht Kommandierender General der Armee geworden, und die Geschichte Frankreichs, nein, ganz Europas wäre anders verlaufen, als wir sie kennen«, sagte er. »Joséphine de Beauharnais hatte Charme und sie kannte in Paris Gott und die Welt, genauer gesagt die Männerwelt« — die Schüchternen unter uns liefen rot an, der Rest kicherte — »und sie öffnete dem jungen ungehobelten Korsen die Türen zu ranghohen Politikern. Ohne sie hätte er kaum die nötige Akzeptanz in der französischen Politik und Gesellschaft erlangt. Übrigens musste sie ihm immer eigenhändig heiße Schokolade zubereiten, er liebte dieses Kindergetränk, und er liebte ihren Geruch, er verlangte von ihr, dass sie sich tagelang nicht wusch, bevor er heimkehrte.« Daraufhin liefen alle rot an, selbst diejenigen, die nicht aufhörten zu kichern.
Er erzählte von Alexander dem Großen und dessen närrischer Liebe zu einem Pferd, das er wie einen Freund behandelte, von Dschinghis Khan, der einen Nachrichtendienst einführte und der am liebsten die Witwen seiner ermordeten Feinde heiratete, bis er selbst den Überblick verlor, von Peter dem Großen, den sein Blasenleiden wie verrückt nervte, das ihn schließlich frühzeitig ins Grab beförderte.
Horvath veranschaulichte uns mit diesen Exkursen, dass die Mächtigen keine göttlichen, unfehlbaren Wesen waren, sondern menschlich wie wir, und dass es an uns war, sie zu hinterfragen. Denn er hatte moderne politische Ansichten, mit denen er nicht hinter dem Berg hielt, mit einigen Aussagen schockierte er uns regelrecht. Er sprach von Demokratie, gewählten Regierungen und propagierte die Verfassung der föderalen Republik in Nordamerika, den Vereinigten Staaten. Er sprach vom Frauenwahlrecht und fragte uns, ob wir nicht maßlos empört darüber wären, dass wir nicht wählen durften. Er fragte uns, ob uns bewusst wäre, in welch bitterer Armut die Mehrheit der Menschheit lebte, und das auch vor unserer Haustür.
»Bildung ist der einzige Weg, um sich aus dem Elend zu befreien! Aber es gehört nicht zur Vision eines Herrschers von Gottes Gnaden, mündige, gebildete Bürger als Untertanen zu haben. Unterdrückung und Ausbeutung funktionieren besser bei ungebildeten Menschen«, sagte er.
Erst nachdem er vom Direktor gemahnt worden war, weil sich einige Eltern über »den Sozialdemokraten« beschwert hatten, wurde er etwas zurückhaltender.
In den meisten anderen Fächern las eine Schülerin einen Absatz im Schulbuch laut vor, eine andere gab ihn mit eigenen Worten wieder, und der Lehrer ergänzte abschließend mit ein paar Anmerkungen oder einer Zusammenfassung. Was sich dann wiederholte. Nicht so bei Horvath. Er strahlte über das ganze Gesicht und gestikulierte heftig und ausladend, wenn er etwas erzählte, das ihn begeisterte; er zog eine finstere Miene, sprach leise, krümmte sich, wenn ihm das zu Berichtende missfiel. So als würde er die von ihm erzählten geschichtlichen Ereignisse unmittelbar an seinem eigenen Leib erfahren. Er riss uns mit, sein Spüren übertrug sich auf uns, wir lauschten — oft mit offenem Mund —, fieberten mit, hielten die Luft an, hatten Gänsehaut.
Ich schwärmte für ihn, und wie ich für ihn schwärmte! Alle taten das. Bei den meisten legte sich das nach einer Weile, nicht so bei mir. Bei mir wurde es zu einer heftigen Verliebtheit, die ich mitunter als quälend empfand, ich lief ziellos durch die Stadt, nur in der Hoffnung, zufällig auf ihn zu treffen. In Tagträumen saßen wir gemeinsam auf einer Parkbank, er gestand mir seine Liebe — dabei hielt er meine Hand — und dann küsste er mich.
6
Jeden Sommer machten die Eltern, Gustav und ich eine längere Reise. Wir fuhren in die Schweiz an den Genfersee, nach Luzern, an den See im slowenischen Bled, ins Salzkammergut. Mein Vater liebte die Berge, meine Mutter die Seen. Den Vater entspannten lange Wanderungen, meine Mutter konnte stundenlang mit einem Buch am See sitzen.
Nur einmal fuhren wir nach Italien ans Meer, weil Gustav und ich nicht aufgehört hatten zu drängen, wir blieben zwei Wochen in Grado und machten Ausflüge nach Venedig. Im Jahr darauf fuhren wir wieder an den Attersee, meinen Eltern war das Treiben am Meer, das Salzwasser, der Sand, die Hitze zu anstrengend.
Der Vater begleitete uns und blieb. Zuvor war er immer erst in den letzten Tagen zu uns gestoßen, er war im Geschäft unabkömmlich, hieß es, nun war es Carl, der zu Hause nach dem Rechten sah. Wir waren zu viert, und trotzdem — das klingt vielleicht eigenartig — war es, als ob niemand fehlen würde, die Familie war vollständig.
Die Zwillinge waren nicht einmal ein Jahr nach der Heirat zur Welt gekommen, in einer Zeit also, in der die Eltern frisch verliebt gewesen sein müssen. Und war die Zeit mit dem erstgeborenen Kind — in dem Fall waren es zwei — nicht die, welche man besonders in Erinnerung behielt, weil alles neu und aufregend war? Aber wenn wir beieinandersaßen und die Rede auf vergangene Zeiten kam, irgendwelche Anekdoten von der Familie, von uns als kleinen Kindern, erzählt wurden, ging es immer nur um uns, um Gustav und mich, als ob es Carl und Eugen nicht geben würde. Das Gefühl hatte ich schon manchmal im Elternhaus — von klein auf — gehabt. In den Urlauben empfand ich es besonders stark. Ich stellte es mir bildlich vor: blauer Himmel, Sonnenschein, Lichtung im Wald, kleiner Pavillon. Wir vier sitzen darin und unterhalten uns angeregt, es herrscht Harmonie und Einverständnis, wir sind völlig aufeinander konzentriert. Die Zwillinge stehen draußen, wobei Carl ganz in der Nähe ist und zu uns hereinschaut; offen schaut er dem Vater, der Mutter ins Gesicht, als warte er auf die Erlaubnis, zu uns kommen zu dürfen. Eugen steht in einigen Metern Entfernung, die Hände lässig in den Hosentaschen blickt er in die entgegengesetzte Richtung, uns den Rücken zukehrend.
Dabei kann ich nicht sagen, dass mein Vater ein angespanntes Verhältnis zu seinen ältesten Söhnen gehabt hätte, im Gegenteil. Die Distanziertheit ging eher von meiner Mutter aus, und mein Vater, der sie durchaus zur Kenntnis nahm, akzeptierte sie, ohne dagegenzuhalten. Er übernahm sie sogar bis zu einem gewissen Grad. Ich fragte mich, ob die Eltern die Zwillinge weniger liebten als Gustav und mich, und wenn das der Fall war, welchen Grund es dafür gab. Aber gleichzeitig spürte ich, dass es nicht an zu wenig Liebe lag, sondern dass etwas vor Gustav und mir passiert war, etwas, wovon wir ausgeschlossen waren. In den ersten Ehejahren musste etwas vorgefallen sein, was die Mutter — und auch der Vater — ausblenden wollten. Manchmal schimpfte ich mich in Gedanken selbst: Hör auf, dich hineinzusteigern in Dinge, die du dir zusammenfantasierst! Du siehst ja Gespenster!
Den Rest des Sommers verbrachte ich — so wie auch die Weihnachts- und Osterferien — mit der Mutter im Elternhaus im Mühlviertel. Gustav blieb allein in der Stadt oder machte mit seinen Freunden noch eine kleine Reise. Der Vater war gegenüber seinem studierenden Sohn äußerst spendabel.
Obwohl die Wohnung ihm gehörte und er somit der Hausherr war, verhielt mein Vater sich wie ein Gast, wenn er geschäftlich in Wien zu tun hatte und bei uns wohnte. Er gab keine Anweisungen und mischte sich in nichts ein. Ich glaube, er genoss diese Rolle. Er wurde auf das Herzlichste empfangen und verwöhnt, die Dippi kochte seine Lieblingsspeisen, die Mutter begleitete er zu Konzerten, ins Theater zu gehen, weigerte er sich. Meine Mutter liebte kulturelle Veranstaltungen, aber mein Vater konnte wenig damit anfangen. Er bevorzugte es, wenn wir Gäste hatten, mit denen er diskutieren konnte: Mutters Verwandtschaft — er schätzte vor allem ihren Bruder Wilhelm, der die väterliche Kunsttischlerei übernommen hatte —, seine Geschäftspartner mit ihren Familien, aber vor allem Gustavs Freunde.
Im Rückblick erscheinen mir diese Jahre in Wien wie ein einziges lebhaftes Gespräch. Wir saßen im Wohnzimmer am großen Tisch, aßen, tranken, redeten. Das heißt, die anderen redeten, ich war diejenige, die sich ruhig verhielt, um nicht ins Bett geschickt zu werden, später wurde ich gerne geduldet. Die Gespräche mit Gustav und seinen Kommilitonen hatten es meinem Vater angetan, er war so sichtlich stolz auf seinen Sohn — der erste Student in der Familie —, nie habe ich ihn so glücklich erlebt wie an diesen Abenden. Er war nicht nur neugierig auf die jungen Leute und deren Sicht der Welt, er mochte sie und nahm sie ernst. Und sie wiederum schätzten ihn, den Sohn eines einfachen Müllers aus einer hinteren Provinz der Monarchie. Sie hörten ihm gerne zu, wenn er erzählte, und das konnte er gut: mit Esprit erzählen. Erst in seinen letzten Lebensjahren veränderte sich das, er verstummte zunehmend.
»Wie geht es eurem alten Herrn?«, wurden Gustav und ich nicht selten gefragt, wenn unser Vater bereits eine Weile nicht mehr in Wien gewesen war.
Du musst wissen, mein Vater hatte zwölf Jahre lang in der k. u. k. Kriegsmarine gedient und dabei die Welt gesehen. Nach der Rückkehr in sein Heimatdorf bewies er Mut, indem er nicht — wie es von ihm, dem einzigen Sohn, erwartet wurde — in die Fußstapfen seines Vaters trat, sondern ein Handelsgeschäft eröffnete. Mit einem alten Frachtkahn auf der Donau begann er, Waren jeder Art in seine Heimat zu verschiffen, innerhalb weniger Jahre war er der größte Händler in der Region.
Debattiert wurde über alles Mögliche, manchmal waren der alte Herr und die jungen Leute nicht einer Meinung, vor allem wenn es um Politik ging. Die Gespräche verfolgte ich aufmerksam und interessiert. Im Kopf hatte ich dabei natürlich Horvath und wie ich ihn in den nächsten Tagen mit bestimmten Aussagen im Unterricht beeindrucken konnte.
Mein Vater war überzeugter Monarchist, er war dem Kaiser treu ergeben, keine seiner Entscheidungen stellte er in Frage. Die jungen Leute hingegen waren kritischer. Einige sahen in dem greisen Monarchen einen Bürokraten und keinen weisen Politiker, bestimmte Neuerungen gingen ihnen zu langsam, auch die Idee des Nationalstaates ließ sie nicht unberührt und sogar über die Vorzüge einer demokratischen Republik wurde diskutiert.
»Wo kämen wir da hin?«, fragte mein Vater. »Eine Demokratie erzeugt keine selbstlosen Diener des Volkes, sondern eine dumme Masse an Machtausübern. Sie ist eine Tyrannei der Mehrheit. Alles wird verzögert und verläuft im Sande, Demokratien erlauben keine Visionen. Auch kein wahres Verantwortungsgefühl. Verantwortlichkeiten werden so lange zwischen den Volksvertretern hin- und hergeschoben, bis letztlich keiner mehr verantwortlich ist. Bei einem Herrscher ist das nicht möglich. Das Ideal des mündigen Bürgers ist ohnehin eine Schimäre.«
»Wir betrachten uns als mündige Bürger«, sagte Gustav.
»Die Mehrheit ist es nicht«, antwortete mein Vater, und ich musste an Horvaths Ausführungen denken.
Es gab unterschiedliche Lebensphilosophien, die immer wieder zur Sprache kamen. Der Leitsatz meines Vaters lautete: Jeder ist verpflichtet, das Beste in seinem Leben zu geben, um Leid in seinem Umfeld zu verringern, um die Menschheit vorwärtszubringen, aber stets in den für ihn vorgegebenen Möglichkeiten. Welchen Platz man im Leben bekommen habe, das liege einzig und allein in der Hand Gottes.
Die jungen Männer sagten: »Das Leben ist ein Geschenk, um das niemand gebeten hat. Dennoch hat der denkende Mensch die philosophische Pflicht, das Wesen des Lebens wie auch die damit einhergehenden Bedingungen zu erforschen. Ganz gleich, wohin den Einzelnen diese Betrachtungen führen, sei es zum Dienst am Gemeinwohl, zu einer hedonistischen Lebensweise, zu Einsiedelei, zu Suizid oder was auch immer.«
Meinem Vater ging wiederum dieser Ansatz zu weit. Er glaubte an die Anwendung des Denkens auf das Leben, vertrat aber die Auffassung, dass das Resultat nur eines sein konnte: »Der Mensch kommt zur Welt, um sie zu einer besseren zu machen, jegliches Handeln sollte von moralischen Prinzipien geleitet sein.«
Auch wenn sich manchmal ein regelrechtes Streitgespräch entwickelte, ging man spät in der Nacht lachend und schulterklopfend auseinander.
Eine Diskussion ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Nicht weil es hitziger als sonst herging, sondern weil sich an dem Abend ein Freund meines Bruders, der mir bisher nicht sonderlich aufgefallen war, stärker als sonst einbrachte und zwar offensichtlich, weil er mich beeindrucken wollte.
Ich kannte ihn schon eine Weile, aber nur flüchtig, ich weiß nicht mehr, wann genau Gustav seinen Freund Georg — sie hatten einander im Kurs über Laryngologie kennengelernt — zum ersten Mal mit zu uns nach Hause brachte. Georg Tichy war ein Jahr jünger als Gustav, er stammte aus einer Wiener Ärztefamilie. Sein Vater führte eine Ordination für Allgemeinmedizin, sein Onkel war eine sogenannte Koryphäe an der Universitätsklinik.
Das Gespräch begann mit der scherzhaften Frage meines Vaters: »Na Elisabeth, was hat euer Geschichtelehrer letztens mit euch besprochen?«
Mein Vater fragte mich bei seinen Besuchen über die einzelnen Fächer aus und hatte mitbekommen, dass ich mich — seit ich einen neuen, engagierten Lehrer hatte — neuerdings für Geschichte interessierte. Er goutierte das, mit den Einstellungen Horvaths war er allerdings selten einverstanden. Weshalb ich diese immer weniger kundtat. Ich wollte vermeiden, dass ich Horvaths Ansichten — die mir näherstanden als die meines Vaters — zu verteidigen begann und darüber mit meinem Vater in Streit geriet. Womöglich hätte er noch gemerkt, dass ich in den Lehrer verliebt war, und das wollte ich schon gar nicht.