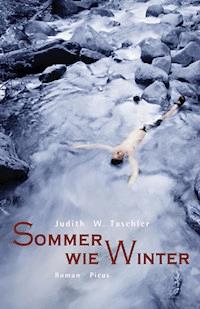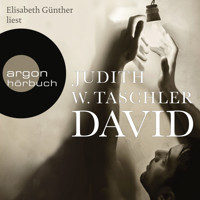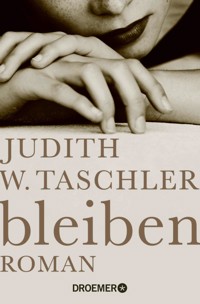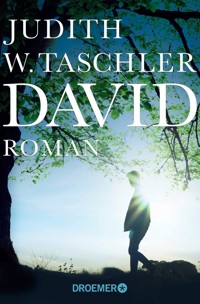
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem viel rezensierten erfolgreichen Spiegel-Bestseller "bleiben" legt die renommierte und preisgekrönte Innsbrucker Autorin Judith W. Taschler mit einem Roman nach, der literarisches Niveau mit einer klaren, unverwechselbaren Sprache verbindet, die von Literaturkritikerin Christine Westermann hochgelobt wird. »Ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues Buch der Autorin erscheint, weil ich ihre Art zu schreiben sehr schätze.« Christine Westermann, WDR2. Anspruchsvoll, raffiniert und psychologisch dicht schreibt die Bestseller-Autorin in ihrem Roman "David" über Familienbeziehungen, Identität, Adoption und die großen Wendepunkte im Leben Jan genießt sein Leben in vollen Zügen, hat aber Angst vor der Liebe. Mit achtzehn verliert er seine Mutter bei einem tragischen Auto-Unfall, ein halbes Jahr später erhält er einen verstörenden Brief, durch den sein bisheriges Leben - seine Herkunft und Identität - auf den Kopf gestellt wird. In seinem ersten Lebensjahr soll sein Name David gewesen sein. Er wurde nach einem Mann benannt, der vor vielen Jahren aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte und seiner Frau einen Baum, einen Davidsahorn, als Geschenk mitbrachte, bevor er starb. Dieser Baum war es, gegen den das Auto seiner Mutter schlitterte. In ihm sind die Initialen "R", "E" und "V" eingeritzt. Was Jan schlussendlich über seine Herkunft und Familiengeschichte erfährt, erzählt Judith W. Taschler gewohnt mehrstimmig, sprachlich virtuos und mit der ihr eigenen unaufgeregten Empathie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Judith W. Taschler
David
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Stundenlang ist der dreiundzwanzigjährige Jan im Winter allein in der verschneiten Landschaft unterwegs, auf der Suche nach innerem Frieden. Erst seiner Freundin Sophie gelingt es, Jan zum Reden zu bringen. Ihr vertraut er an, was er seit fünf Jahren mit sich herum trägt: Damals ist seine Adoptivmutter tödlich verunglückt – nur glaubt Jan nicht, dass es ein Unfall war. Ihm scheint, als hätte Elie ihren Wagen mit voller Absicht gegen jenen Baum gelenkt, in dessen Rinde die Initialen »R«, »E« und »V« eingeritzt sind. Ein halbes Jahr nach diesem Unfall erhielt er einen verstörenden Brief, durch den sein bisheriges Leben aus den Fugen geriet.
Durch Sophies Zuspruch ermutigt, macht Jan nun die Besitzerin des verwahrlosten Grundstücks ausfindig, auf dem der Baum steht. Was der junge Mann schlussendlich über sich selbst und seine Herkunft erfährt, erzählt Judith W. Taschler gewohnt mehrstimmig und sprachlich virtuos.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Für Sophia, Helena und Philipp
Prolog
Ihr Auto lag auf dem Dach, und sie hing mit dem Kopf nach unten im Sitzgurt.
Zuerst wusste er nicht einmal, dass es ihr Auto war, als er begann, es vom Schnee frei zu machen. Anfangs erkannte man nicht einmal, dass es sich überhaupt um ein Auto handelte. Aber irgendwie war da eine Ahnung, die immer stärker wurde und ihn in Panik versetzte, während er mit den Händen grub. Er trug keine Handschuhe und keine Winterjacke, nur Sportsachen, weil er gerade beim Laufen gewesen war. Ihm war ein riesiges, unförmiges Ding weit unterhalb der Straße, neben einem Baum aufgefallen, und spontan war er den Hang hinuntergelaufen.
In den letzten zwei Tagen und Nächten hatte es ohne Unterbrechung geschneit, der leichte, flockige Neuschnee reichte ihm stellenweise bis zur Hüfte. Dieser ließ sich Gott sei Dank leicht entfernen, und schnell kam ein Reifen zum Vorschein. Er wischte an der Seite herum und entdeckte die rote Farbe. In dem Augenblick war ihm klar, es war ihr neues Auto, sie hatte es erst vor wenigen Wochen im Autohaus ihres Bruders gekauft. Dem Verkaufsgespräch hatte er eine Weile zugehört. Die Fachsimpelei der beiden hatte ihn amüsiert, und er hatte sich gefreut, dass sich die beiden wieder näherkamen.
Er ließ sich auf die Knie niederfallen, versank bis zum Bauch im Schnee und kratzte keuchend das Fenster frei. Mittlerweile war er klatschnass. Kurz flackerte in ihm die Hoffnung hoch, das Auto möge leer sein. Sie war unverletzt geblieben, hatte es geschafft herauszukriechen, war zur Straße hochgegangen, wo jemand sie mitgenommen hatte. Aber wohin? Wo sollte sie sein? Sie war vor zwei Tagen weggefahren, und niemand hatte sie seither gesehen. Er beugte sich hinab und sah in das Innere des Autos.
Eigenartig verrenkt hing sie da, als hätte sie noch versucht, sich aus dieser Kopfüberlage zu befreien. Ihr Kopf wirkte klein, als wäre er geschrumpft, und ihre Schultern so schmal wie die eines Kindes. Ihr Mund war leicht geöffnet, ihre Augen blickten starr durch ihn hindurch.
Er versuchte, die Beifahrertür zu öffnen, dann die Fahrertür, schaffte es aber nicht. Weil er sein Handy nicht bei sich hatte, lief er los, zurück in den Ort. Er überlegte, ein Auto anzuhalten, tat es dann aber doch nicht, er wusste, dass jede Hilfe zu spät kommen würde und dass er eine Leiche gesehen hatte.
Eins
Magdalena kam gegen drei Uhr nachmittags an.
Anfangs schaffte sie es nicht, das Auto zu verlassen, sie saß da und starrte durch die Windschutzscheibe das Haus an. Die Magenschmerzen, die sie seit Stunden quälten, erreichten ihren Höhepunkt.
Wann war sie zum letzten Mal hier gewesen? Vor neun Jahren?
Ja, richtig, vor neun Jahren. Mit Thomas und den Kindern. Valerie war vier gewesen, Julia fünf, Oliver acht. Sie waren im Urlaub gewesen, in Apulien, und auf der Rückfahrt hatten sie haltgemacht, beim Haus ihrer Großmutter. Weil Thomas es sich wünschte.
»Na, komm schon«, drängte er, »wenigstens ein Mal möchte ich sehen, wo du aufgewachsen bist.«
Sie wollte damals nicht, verspürte kein Bedürfnis, die Heimreise zu verlängern, sie war müde, und alles, was sie wollte, war nach Hause kommen. Den Ort ihrer Kindheit hätte sie zwar gerne wiedergesehen – sie war seit mehr als zehn Jahren nicht mehr dort gewesen –, aber ohne die Familie im Schlepptau, und vor allem nicht nach einem anstrengenden Urlaub. Sie hatte drei Wochen lang die Kinder beschäftigt, Animateurin gespielt, Thomas hatte sich hinter seinen Büchern verschanzt.
Sie picknickten im Garten, legten eine Decke ins hohe Gras, und Thomas versuchte ein bisschen zu schlafen. Valerie lief begeistert herum und pflückte Blumen, die sie Magdalena dann kichernd in den Schoß warf. Weil Oliver und Julia schnell zu nörgeln begannen, dass sie endlich weiterfahren wollten, brachen sie schon nach einer knappen Stunde wieder auf. Sie drängte Thomas zur Weiterfahrt, obwohl sie gerne noch etwas geblieben wäre. Alleine. Nichts wollte sie lieber, als durch das alte Haus zu schlendern, im Garten zu liegen und ihren Erinnerungen nachzuhängen. Aber es nervte sie, wenn die Kinder quengelig waren, es nervte sie sogar sehr. Wie immer schaffte sie es nicht, sich abzugrenzen, zu sagen, was sie wirklich wollte.
»Fahr mit den Kindern in den Ort, iss mit ihnen ein Eis und hol mich dann später wieder ab«, das hätte sie am liebsten zu Thomas gesagt. Doch sie tat es nicht, wie so oft ging sie den Weg des geringsten Widerstands. Sie brachen also auf und fuhren weiter. Im Auto ärgerte sie sich über sich selbst und schnauzte die Kinder wegen einer Kleinigkeit an.
Wie typisch diese Szene für sie war.
Es dauerte eine halbe Stunde, bis sie die Kraft aufbrachte, die Tür zu öffnen und auszusteigen. Ihre Knie fühlten sich weich an, als sie auf das Haus zuging. Die Haustür hing schief in den rostigen Angeln, Magdalena zuckte zusammen, als sie beim Öffnen penetrant quietschte. Es kam ihr alles eng vor, klein, dunkel, die Räume so niedrig! Als Kind waren sie ihr immer groß erschienen.
Das ehemalige Wohnzimmer war offensichtlich von Jugendlichen für manches Treffen genutzt worden. Graffiti an den Wänden, ein durchgesessenes, verstaubtes Sofa in der Mitte des Raumes, ein zerrissener Schlafsack, zahlreiche leere Flaschen, Zigarettenstummel. Überall Müll. Auf dem Dachboden sah sie, dass dringend ein neues Dach nötig war. In dem Moment verzweifelte sie fast.
Auch im Garten nur Verwahrlosung und Verwüstung. Jemand hatte alte Reifen und Sperrmüll abgeladen. Überall Gestrüpp und Bäume, die seit Ewigkeiten nicht geschnitten worden waren. Jemand hatte ein großes Kreuz in den Baum geschnitzt, der als Kind ihr Lieblingsbaum gewesen war. Sie spürte Zorn in sich hochsteigen. Wie konnte man einen Baum derart malträtieren? Aber was hatte sie um Himmels willen erwartet? Ihre zweite große Anschaffung würde eine Motorsäge sein.
Ihre erste große Anschaffung war ein Wohnwagen gewesen, in dem sie nun in den nächsten Monaten hausen würde. Auf alle Fälle war es besser, als in einem Hotel zu wohnen und jeden Tag zur Baustelle fahren zu müssen. Sie hatte den Wohnwagen einem jungen Paar in der Nähe Innsbrucks abgekauft, gleich am ersten Tag nach ihrer Ankunft in Tirol. Drei Jahre lang waren der Mann und die Frau verheiratet gewesen, zwei Mal waren sie mit dem Wohnwagen, den sie von den Eltern zur Hochzeit geschenkt bekommen hatten, im Sommer in den Urlaub gefahren, jetzt ließen sie sich scheiden und mussten ihn verkaufen.
Magdalena fackelte nicht lange und sagte den beiden zu. Sie brauchte ja schnell etwas, und der Wagen war sehr groß, wie neu und obendrein ein Schnäppchen. Offensichtlich hatten die beiden es mit dem Verkauf und der Scheidung sehr eilig. Der Mann war sehr still gewesen.
Zwei
In den ersten Nächten konnte Magdalena kaum schlafen, weil sie die Kinder nicht aus dem Kopf bekam. Vor allem, wenn sie an Valerie dachte, schmerzte ihr ganzer Körper, und sie wälzte sich herum. Die Grübeleien wollten kein Ende nehmen und raubten ihr fast den Verstand.
Hätte sie nicht doch bleiben sollen? Oder sich zumindest in ihrer Nähe eine Wohnung nehmen? Um weiterhin ein bisschen nach dem Rechten zu sehen? War es die richtige Entscheidung gewesen, ausgerechnet hierherzukommen?
Sie hätte sich auch woanders niederlassen können. Irgendwo. In Chiang Mai zum Beispiel. Sie hätte vielleicht Claudias Angebot annehmen sollen.
»Komm zu mir!«, hatte diese am Telefon gesagt. »Ich brauch dich wirklich. Steig als Partnerin bei mir ein.«
Claudia hatte vor kurzem ein Boutique-Hotel gekauft und war dabei, es auf Vordermann zu bringen, es sollte in einigen Wochen eröffnet werden. Sie hatte lange nicht lockergelassen und immer wieder angerufen.
»Das wäre wirklich was für dich, Magdalena, na, komm schon. Wir zwei wie in guten alten Zeiten. Es tut dir doch nicht gut, jetzt alleine zu sein!«
Sie entschied sich dagegen. Aus dem Bauch heraus. Etwas völlig Neues musste beginnen, Thailand wäre eine aufgewärmte Suppe.
Im Ort schaute man sie an, als wäre sie eine Außerirdische. Out of space, würde Oliver dazu sagen. Sie erinnerte sich an nichts und niemanden, kein einziges Gesicht kam ihr bekannt vor. Falsch, sie hatte Marta sofort wiedererkannt, als sie die Setzlinge für den Garten bei ihr kaufte.
Marta. Das fröhliche Mädchen mit den dicken, roten Haaren und den Sommersprossen, dem sie alles erzählt hatte, was sie bewegte, und von dem sie alles gewusst hatte. Sie hatten nicht nur fünf Jahre lang in der Schule nebeneinandergesessen, sondern waren auch in der Freizeit ständig zusammengesteckt. Erst nach einem Jahr war Marta damals zu Besuch gekommen, ins Heim. Magdalena war so verletzt gewesen, dass sie kein Wort mit ihr geredet hatte, daraufhin war Marta mit hängendem Kopf aus dem Zimmer gegangen, ohne etwas zu sagen. Da war Magdalena dreizehn gewesen. Seither hatten sie einander nicht mehr gesehen.
Marta erkannte sie ebenso wieder und freute sich offensichtlich, sie zu sehen, oder tat zumindest so. Sie musste Magdalena natürlich sofort die Bilderbuchversion ihres Lebens auf die Nase binden: Sie hatte die Gärtnerei ihrer Mutter übernommen, war glücklich verheiratet seit fünfzehn Jahren, ihr Mann besaß ein kleines Möbelgeschäft, sie hatten vier Kinder, sogar die Namen hatte sie ihr genannt, Fabian, Tobias, Marie, Amelie. Seltsam, dass sie sich die Namen merken konnte. War sie etwa neidisch? Nein. Vor ein paar Jahren wäre sie es vielleicht gewesen, mittlerweile hatte sie auch damit abgeschlossen. Mit dem Neid auf andere Leute.
Sie fühlte sich fremd, Heimatverbundenheit kam keine auf, gut, es war achtundzwanzig Jahre her, redete sie sich ein. Und sie war damals ein Kind gewesen. Fremd wäre sie überall, da konnte sie es auch hier sein. Hier, wo ein Grundstück ihr gehörte, ein großes Grundstück in einer wunderschönen Lage, abgelegen, weit weg vom Ort, das ganze Jahr über sonnig. Wie oft hatte sie sich in den letzten Jahren in Prag in der engen Wohnung nach so etwas gesehnt!
Sie sah an den Gesichtern der Leute, dass sie herumrätselten, wer sie war. Ob sie diejenige war, für die sie sie hielten. Fast war das schon amüsant. Sie hatte kein Interesse daran, sie aufzuklären, es würde sich ohnehin herumsprechen, jetzt, nachdem Marta wusste, dass sie nach Kirchberg zurückgekehrt war. Als sie auf dem Gemeindeamt war, um sich anzumelden, füllte das junge Mädchen alles ohne mit der Wimper zu zucken aus, aber ihr älterer Kollege horchte auf und sah von seinem Computer hoch, zu ihr her, als sie ihren Namen nannte.
Im Tierheim suchte sie sich einen Hund aus.
Damit die Selbstgespräche nicht noch mehr überhandnehmen würden. Sie hatte immer schon ab und zu Selbstgespräche geführt, das wusste sie von den Kindern, die sich darüber lustig gemacht hatten: »Was brabbelst du da die ganze Zeit?« Aber momentan musste es besonders schlimm sein, der eine Bauarbeiter, er hieß Milos, schaute einmal ziemlich verstört zu ihr herüber, da wurde es ihr bewusst. Dass sie mit sich selbst redete und es ihr nicht mal auffiel. Sie musste sich zusammenreißen. Eine Bauherrin, die Selbstgespräche führte, würde man kaum ernst nehmen.
Als sie den Namen des Hundes hörte, er hieß Bär, konnte sie sich gar nicht anders entscheiden. Die Frau im Tierheim riet ihr zu einem sehr jungen Terrier, aber sie wollte unbedingt Bär haben. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er wandte seinen Blick ab, und das war es, was ihr so gut an ihm gefiel. Er schaute sie nicht erwartungsvoll und bellend an wie die anderen Hunde, sondern drehte sich traurig weg und legte sich in die hinterste Ecke seines Käfigs. Als hätte er keine Hoffnung mehr, jemanden zu beeindrucken. Magdalena bestand darauf, mit ihm den Probespaziergang zu machen. Der zweijährige Schäferhund war von seinem Besitzer schwer misshandelt worden.
»Er kann aggressiv sein, wenn er jemanden nicht leiden kann«, sagte die Frau zu ihr, »aber gut, wir versuchen es.«
Übrigens biss er sie und nicht Magdalena, als sie ihn herausholten. Sie ging mit ihm spazieren, und zum Schluss leckte er ihr die Hände ab. Sie wusste, Julia und Valerie hätten sich auch für Bär entschieden, die beiden Mädchen hatten sich immer einen Hund gewünscht, es war aber nie möglich gewesen. Die Wohnung in Prag war zu klein, der Vermieter dagegen, Thomas strikt dagegen, er konnte Hunde nicht leiden.
Und erst der Name! Der hätte Valerie am meisten gefallen. Sie hatte früher ihre Stofftiere immer nach anderen Tieren benannt. Ente hieß die Eule. Und wie hieß gleich noch mal das Pferd? Ach ja, Kater.
Schon lange her.
Sie sollte endlich aufhören, die Dinge, die sie wahrnahm oder tat, mit den Augen der zurückgelassenen Familie zu betrachten! Sie fühlte sich wie amputiert. Keine Dreizehnjährige würde mehr auf der Couch neben ihr liegen und mit ihr kuscheln, während man sich gemeinsam eine Komödie im Fernsehen anschaute. Keine lärmenden Teenager am Tisch ihr gegenübersitzen und ihren Frust über die Schule auslassen. Niemand mehr am Frühstückstisch, der ihr euphorisch Passagen aus einer Zeitung oder einem Buch vorlas, niemand, der sie sanft auf die Stirn küsste, bevor er die Wohnung verließ.
Seitdem sie Bär neben sich wusste, schlief sie wie ein Stein.
Mit ihm hatte sie keine Angst mehr, dass irgendjemand in den Wohnwagen eindringen könnte. Und es lag auch an der Erschöpfung, sie hatte angefangen, den Garten auf Vordermann zu bringen und Gemüsebeete anzulegen, sie wollte ihre eigenen Kartoffeln haben, ihren eigenen Salat, Paprika, Gurken, Zucchini. So wie früher, als sie in Thailand gelebt hatte. Und wie noch früher ihre Großmutter. Sie konnte froh sein, dass das Wetter gut war und noch eine Weile so bleiben sollte. Das prophezeite ihr Marta, und Magdalena hoffte, dass sie recht behielt. Marta war plötzlich bei ihr im Garten aufgetaucht, mit einem Karton voller Tomatensetzlinge in der Hand.
»Isst du immer noch so gerne Tomaten?«, fragte sie, stellte den Karton auf dem Boden ab und half ihr eine Stunde lang beim Umstechen der Erde, einfach so, ohne dass Magdalena sie darum bat. Magdalena war perplex, musste sich jedoch eingestehen, dass sie sich darüber freute.
Zum Schluss tranken sie gemeinsam ein Bier. Als Magdalena fragte, wo man günstig eine gebrauchte Motorsäge kaufen könne, sie müsse mehrere Stauden und Bäume umschneiden, riet ihr Marta, das nicht selbst zu machen, sondern Vinzenz Nedden anzurufen, er sei der Richtige dafür.
»Erinnerst du dich nicht an ihn?«, fragte Marta. »Er hat in der Volksschule immer in der letzten Reihe gesessen und Papierkugeln auf uns geschossen.«
»Vinnie?«, fragte Magdalena, und Marta nickte.
Ein Bild stieg in ihrer Erinnerung hoch: ein schlaksiger Neunjähriger, der sie auf dem Nachhauseweg abpasste und ihr schüchtern eine Geburtstagseinladung in die Hand drückte, die sie vor seinen Augen zerriss, weil ihre beste Freundin Marta nicht eingeladen war. Wie sich sein Blick verfinsterte und er auf seinem Fahrrad davonstürzte. Ein zweites Bild: wie sie dann doch auf seiner Party auftauchte, weil ihre Oma darauf bestanden hatte. »So geht man nicht mit seinen Mitmenschen um«, hatte sie freundlich, aber bestimmt gesagt. Wie Vinnie sich übermäßig freute – er strahlte über beide Ohren – und sich ausschließlich um sie kümmerte, wohingegen sie sich langweilte, weil Marta nicht dabei war.
Oh, diese kleinen Probleme, die ihr damals so groß und tragisch erschienen waren! Sie hatte eine verdammt schöne und glückliche Kindheit gehabt, nur das allzu abrupte Ende hatte im Nachhinein einen Schatten darauf geworfen.
Beim Abschied machte Marta eine Bewegung auf sie zu, als wollte sie sie umarmen, sie hielt dann aber inne und streckte ihr die Hand hin. Magdalena hingegen wollte sich für die Hilfe bedanken, tat es dann doch nicht und murmelte nur: »Vielleicht sieht man sich wieder mal.«
Das alte Dach wurde abgetragen. Am Abend saß sie auf dem Dachboden und konnte in den Himmel sehen. Bär lag friedlich neben ihr. Plötzlich fing sie zu weinen an, sie konnte es nicht mehr zurückhalten. Ihr Schluchzen machte ihn ganz nervös, er umkreiste sie und winselte erbärmlich. Sie musste sich zwingen aufzuhören. Sie hatte schon lange nicht mehr geweint. Als Kind war sie eine richtige Heulsuse gewesen, auch als ihre Oma noch gelebt hatte. Wegen jeder Kleinigkeit waren ihr die Tränen heruntergeronnen, oft war es ihr peinlich gewesen.
Sie beschloss, ein Heft zu kaufen und zu schreiben, irgendetwas, vielleicht auch über ihr Leben. Damit Bär nicht mehr nervös zu werden brauchte und sich die Abende nicht mehr so einsam anfühlten. Damit die Selbstgespräche weniger wurden und die Bauarbeiter keine Angst vor ihr bekamen.
Vor ein paar Jahren war Magdalena einmal in Prag zu dem Psychotherapeuten gegangen, den ihre Freundin Sabine empfohlen hatte. Wegen ihrer Depressionen. Sie hatte einem alten, weißhaarigen Mann mit sehr weisem Gesichtsausdruck gegenübergesessen. Nach drei langweiligen Sitzungen hatte er ihr mit spitzen Fingern die Rechnung überreicht und gesagt: »Man sollte keine Gesprächstherapie machen, wenn man nicht gerne redet. Ich empfehle Ihnen: Schreiben Sie alles auf.«
Vielleicht sollte sie das wirklich tun.
Über ihr verkorkstes Leben schreiben.
Drei
Sie wurde drei Wochen zu früh geboren. Im August 1971.
Ihre Eltern waren gerade zu Besuch in Kirchberg gewesen, als die Wehen eingesetzt hatten. Eigentlich hätte sie in Wien zur Welt kommen sollen, wo sie wohnten. Ihr Vater fuhr mit ihrer Mutter in das Krankenhaus in Sankt Johann.
»So als hättest du es gar nicht erwarten können, die Welt zu sehen, du neugieriges kleines Ding«, sagte ihre Großmutter einmal zu ihr, da war sie acht oder neun.
»Nein, ich wollte einfach nicht in Wien zur Welt kommen, Oma Clara«, sagte Magdalena, »sondern in deiner Nähe.«
Daraufhin lachte Clara hell auf. Magdalena liebte ihr Lachen. Sie liebte alles an ihr.
Sie war nicht ganz zwölf, als ihre Großmutter starb.
Sie hatte ein erfülltes Leben gelebt und starb eines natürlichen Todes. Ihr Herz hörte einfach auf zu schlagen, in der Nacht vom 5. auf den 6. August 1983.
»Plötzlicher Herztod«, sagte der Arzt ein paar Tage später zu ihr im Krankenhaus.
Es war die Art des Todes, die sich Clara immer gewünscht hatte, und auch jedem anderen älteren Menschen, vorausgesetzt natürlich, er hatte sein Leben gelebt und ein bestimmtes Alter erreicht. Als Volksschullehrerin auf dem Land hatte sie vieles mitbekommen: Unfälle, die Menschen abrupt aus dem Leben rissen, im Wald bei Forstarbeiten, auf dem Berg, auf den Skipisten. Schreckliche Krankheiten, die oft nicht enden wollten. Und sie hatte die zwei Weltkriege erlebt, den Ersten als Kind, der Zweite hatte sie zur Witwe gemacht.
Oma Clara, so nannte Magdalena sie, war am 10. Oktober 1910 geboren worden. Das Geburtsdatum fand sie sehr lustig.
»Haben das deine Eltern geplant?«
»Nein, wie sollten sie das machen?«, fragte Clara. »Deine Mutter hätte am 10. Oktober in der Früh ein wildes Pferd reiten können«, fügte sie hinzu, »mit ihm über Wiesen und Felder galoppieren.«
Magdalena hatte irgendwo gelesen, dass Reiten Wehen auslösen konnte.
Clara lachte. »Wilde Pferde ritten damals nur reiche Leute oder Adlige, aber sicher keine einfache Bäuerin. Sag mal, was liest du denn für Bücher?«
»Momentan Vom Winde verweht«, antwortete sie. »Hab ich ausgeliehen von Martas Schwester.«
»Aha«, sagte Clara, »bist du nicht ein bisschen zu jung dafür?« Augenzwinkernd fügte sie hinzu: »Pass bloß auf, dass dich der Wind nicht ganz verweht.«
Magdalena war eine Leseratte. Clara versuchte ihren Lesehunger zwar zu lenken, es gelang ihr jedoch nicht immer. Heimlich las Magdalena sogenannte Groschenromane, die in der Klasse unter den Mädchen kursierten.
»Im Jänner und Februar hatten Bauern weniger zu tun und Zeit für die Liebe«, sagte Clara, »und neun Monate später war eben Oktober. Der Zehnte war ganz sicher Zufall.«
Am Tag bevor sie starb, fühlte sie sich schwach und grippig. Nach dem Mittagessen – sie aßen Kaiserschmarrn, daran sollte sich Magdalena immer erinnern – legte sich Clara auf die Couch, wo Magdalena sich von ihr verabschiedete, sie wollte zu ihrer Freundin Marta radeln und mit ihr schwimmen gehen. Es irritierte sie, ihre Großmutter so liegen zu sehen, blass und mit Schweißtropfen auf der Stirn. Sie hatte Oma Clara selten untätig erlebt. Nur wenn sie Musik hörte, legte sie den Kopf zurück und schloss die Augen. Wenn sie nicht im Haus, im Garten oder im Stall arbeitete, sah man sie in ein Buch oder eine Fachzeitschrift vertieft dasitzen. Sie hatten einen großen Garten, ein paar Hühner, eine Kuh und eine Ziege, die Tiere hatte ihre Oma gekauft, als sie in Pension gegangen war. Und natürlich die Haflingerstute Bella, die Magdalena gehörte.
»Legst du mir eine Kassette ein«, bat sie noch, »einen Franzosen, bitte.«
Als »Franzosen« bezeichneten sie die Kassetten mit den französischen Chansons, von denen ihre Großmutter einige besaß. Ein alter Bekannter aus Frankreich, ein Kriegskamerad ihres Mannes, hatte ihr immer wieder eine mit der Post zugeschickt, sie alle standen schön gereiht im Wohnzimmerschrank.
Magdalena wählte eine aus, von der sie wusste, dass es Claras Lieblingskassette war. Sie selbst mochte diese Musik auch gern, sie stellte sich dann immer ihre Großmutter vor, wie sie mit ihrem Liebsten getanzt hatte. Ihr Großvater war schon lange tot, nicht einmal ihr Vater hatte ihn gekannt. In ihrer Phantasie schwebten sie über das knarrende Parkett, Clara in einem atemberaubenden roten Kleid mit Rüschen. Von Fotos wusste sie, dass ihre Großmutter eine Schönheit gewesen war.
Sie legte die Kassette in den Kassettenrekorder ein, schaltete auf Play und eilte hinaus, in die Sonne.
»Bis später«, sagte sie.
Am Abend, als sie zurückkam, saß Clara vor dem Haus auf der Bank. Sie lächelte sie müde an, und Magdalena setzte sich neben sie.
»Es geht mir ein bisschen besser«, sagte sie und nahm ihre Hand. »Hast du es fein gehabt mit Marta?«
Sie erzählte ihr sprudelnd von ihrem missglückten Sprung vom Fünfmeterturm, der ein Bauchklatscher geworden war, und zeigte ihr die roten Flecken auf Hüfte und Bauch und die Stelle am Fuß, wo sie von einer Wespe gestochen worden war. In der Küche aß sie ein Käsebrot, und Clara sah ihr dabei zu. Ziemlich früh ging sie schlafen, Magdalena wollte noch lesen. Später wusste sie nicht mehr, was genau ihre letzten Worte an sie gewesen waren, aber vermutlich war es »Gute Nacht, mein Liebes« gewesen oder »Lies nicht zu lange und träum was Schönes«.
Am nächsten Tag wachte sie früher auf als gewöhnlich. Normalerweise schlief sie in den Ferien bis spät in den Vormittag hinein. Oft hörte sie Clara schon lange in der Küche rumoren oder im Garten arbeiten, da sie bei geöffnetem Fenster schlief, und blieb noch eine Weile dösend liegen. An dem Vormittag weckte sie das laute Muhen der Kuh Lissi. Weil sie nicht aufhörte, kroch sie genervt aus dem Bett und suchte ihre Oma. Sie fand sie schließlich im Schlafzimmer. Sie lag auf dem Rücken, war wächsern und fahl im Gesicht, der Mund stand offen.
Ihr Anblick war schrecklich. Magdalena hatte ihn jahrelang vor Augen, vor allem, als sie im Heim lebte. Erst in Thailand begann er zu verblassen.
Vier
Einen schöneren Tod als den ihrer Oma hätte sich niemand wünschen können.
Das war Magdalena schon als Zwölfjähriger bewusst. Clara schlief einfach ein. Trotzdem: Ihr Sterben war für sie ein wesentlich einschneidenderes Ereignis als der Unfalltod ihrer Eltern sechs Jahre zuvor. Oft fragte sie sich, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn ihre Großmutter zehn, zwölf Jahre länger gelebt hätte. Wie hätte sie sich dann entwickelt? Wäre aus ihr ein besserer, ein glücklicherer Mensch geworden?
Claras Tod war das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Er stellte ihr junges Leben regelrecht auf den Kopf. Alles, was auf diesen heißen Augusttag folgte, waren in den ersten Jahren tägliche kleine Katastrophen, sie mündeten in einer einzigen großen Katastrophe, und die Folgen davon ließen aus ihrem Leben ein Desaster werden.
Eigenartigerweise kamen ihr diese Gedanken nie in den Sinn, wenn sie an ihre Eltern Richard und Linda dachte. Sie hatten Urlaub in den USA gemacht und waren in Kalifornien verunglückt. Irgendwo nördlich von San Francisco. Sie hatte sie kaum gekannt. Was wusste sie über die beiden? Wenig. Ein paar Fakten, Daten, mehr nicht. Sie wusste nicht, was ihre Lieblingsgerichte gewesen waren, was ihre Mutter am liebsten angezogen hatte, ob sie gerne getanzt hatten und, wenn ja, welche Tänze, worüber sie gerne geredet hatten, welche Farbe ihre Lieblingsfarbe gewesen war, ob sie sich noch weitere Kinder gewünscht, wie sie sich kennengelernt hatten. Wo sie sich kennengelernt hatten, wusste Magdalena, wenn auch nur vage. Oma Clara erzählte ihr einmal, dass sie sich in einem Hotel in Kitzbühel getroffen hatten, wo Linda im Sommer 1968 Urlaub gemacht hatte, gemeinsam mit einer Tante. Kurz darauf hatte Richard sie zum Abendessen mitgebracht und sie Clara, seiner Mutter, vorgestellt.
Richard war dreißig, als er starb, Linda zwei Jahre älter. Er hatte Medizin studiert und seine Ausbildung zum Kinderarzt beendet, sie war Schauspielerin. Magdalena besaß ein paar Fotos ihrer Mutter, auf denen sie auf einer Bühne zu sehen war, sie sah sehr schön aus, aber der theatralische Gesichtsausdruck gefiel ihr nicht.
Mit ihrem Auto schossen sie frontal in einen Baum, sie waren beide auf der Stelle tot. So wurde ihr das von Oma Clara erzählt. Sie stellte sich vor, dass ihr Vater in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, weil er genau in dem Moment zu ihrer Mutter hinübersah und somit abgelenkt war. In ihrer Phantasie mussten sie sterben, weil sie sich zu sehr liebten.
Magdalena musste nach den Sommerferien also nicht zurück in die Stadt, sondern durfte bei ihrer geliebten Oma Clara auf dem Hof bleiben. Sie freute sich darüber. Für sie hatte es lange, einsame Nachmittage in ihrem Zimmer in Wien gegeben und Neidgefühle auf andere Kinder, deren Eltern sich Zeit nahmen. Wenn sie am Abend noch ein Buch vorgelesen bekommen wollte, schaute ihre Mutter genervt drein. Mehrmals in der Woche waren Gäste da, deren laute Stimmen in ihr winziges Kinderzimmer drangen und sie nicht schlafen ließen. So oft es ging, brachte ihr Vater sie zu seiner Mutter nach Tirol und lud sie dort ab. Sie verbrachte nicht nur mehrere Wochen im Sommer auf dem kleinen Hof, sondern auch den Großteil der Weihnachtsferien und Osterferien. Sie freute sich jedes Mal wie wahnsinnig darauf, denn sie liebte das alte Haus, die Wiesen, die Tiere, den Wald. Dort gab es eine Freiheit, die sie in der Stadt nicht hatte. Im Sommer lag sie stundenlang im hohen Gras, beobachtete Marienkäfer oder Schmetterlinge oder träumte einfach vor sich hin. Wenn sie an ihr Zuhause in Wien dachte, an das winzige Zimmer, die laute Straße vor dem Fenster, bekam sie Bauchschmerzen.
»Na, da ist ja mein Mädchen«, sagte Oma Clara, wenn sie sie zum Essen holen kam und sich neben sie setzte. »Wovon träumst du heute? Ich wette, du bist eine wunderschöne Fee, die auf dieser Wolke da oben liegt und auf die Welt hinunterschaut. Wenn sie jemanden sieht, dem es schlechtgeht, wedelt sie mit ihrem Feenstab und macht, dass es ihm wieder gutgeht. Alle lieben sie.«
Clara stand ihr sehr nahe, sie kannte sie besser als jeder andere Mensch. Nicht einmal ihrer Mutter vertraute sie so viel an wie ihr. Sie war ihr Leben lang Volksschullehrerin gewesen und hatte viel Erfahrung im Umgang mit Kindern, und die Liebe zu ihnen lag ihr im Blut. Ihre Mutter war mit Leib und Seele Schauspielerin gewesen. Als kleines Kind saß Magdalena da und hörte Linda zu, wie sie in der Wohnung auf und ab marschierte und eine Rolle einstudierte. Sie war ein sehr ehrgeiziger Mensch. Sagte ihre Oma.
Im ersten Frühling nach dem Unfalltod der Eltern kam es manchmal vor, dass Magdalena nach dem Aufwachen so glücklich war, immer noch auf dem Hof zu sein, dass sie Gott dankte, weil sie gestorben waren. Später, als sie im Heim lebte, hatte sie deswegen Schuldgefühle, und vor allem begann sie sie zu vermissen. Zuerst zaghaft, dann, als sie zu begreifen begann, was da gerade mit ihrem Leben geschah, immer schrecklicher. Sie rief sich immer wieder ihren sechsten Geburtstag ins Gedächtnis, um sie nicht ganz zu vergessen.
Um ihre Gesichter vor Augen zu haben, musste sie Fotos anschauen, und dieses eine Foto von ihrer Geburtstagsfeier liebte Magdalena am meisten: Alle vier standen sie vor dem Haus. Ihre wunderbare, wunderbarste Familie. Oma Clara stand hinter ihr, hatte die Hände auf ihre Schultern gelegt. Sie war die Einzige, die nicht in die Kamera schaute, weil sie zu ihr hochsah. Richard stand neben seiner Mutter, er hatte den linken Arm um ihre Schulter gelegt, den rechten um Lindas Bauch geschlungen, sie stand vor ihm, hatte sich an ihn geschmiegt. Er war sehr groß, überragte sie um einen Kopf. Die drei Erwachsenen lachten ausgelassen in die Kamera, sie hatten, nach dem Essen der Schokoladentorte, Wein getrunken, sie hatte Kindersekt bekommen. Magdalena erinnerte sich, dass der Grund für ihr Lachen auch der Selbstauslöser gewesen war, der ein paarmal nicht funktioniert hatte.
Mit ihrer Fotoschachtel lag sie auf dem Bett in ihrem Zimmer im Heim, sah ein Foto nach dem anderen an und weinte sich in den Schlaf. Und noch später, da war sie schon erwachsen, spürte sie, dass sie vielleicht gar nicht so sehr sie selbst vermisst hatte, sie, die beiden Menschen, an die sie sich kaum erinnerte, sondern sich einfach ein gewöhnliches Teenagerdasein in einem richtigen Zuhause herbeigesehnt hatte.
Alles, was sie sich zu der Zeit wünschte, war ein normales Familienleben.
Fünf
Jan lief zu dem kleinen Blumengeschäft, um einen Strauß Nelken zu kaufen.
Jedes Jahr kaufte er dort insgesamt sechs Blumensträuße: einen für seine Tante zu ihrem Geburtstag im Juni und zu Weihnachten und drei für seine Kusinen, wenn sie Geburtstag feierten. Dafür ließ er der Frau, die das Geschäft besaß, freie Hand, es sollte ein großer, schöner Strauß sein, welche Blumen sie dafür verwendete, war ihm gleichgültig. Nicht so aber am 5. April, an dem Tag wollte er rote Nelken haben, etwas anderes kam nicht in Frage.
Eine junge Frau schloss gerade auf, Jan kannte sie. Sophie, die Schwester der Ladenbesitzerin, war ein Jahr jünger als er – zweiundzwanzig – und arbeitete als Kindergärtnerin. Vor ein paar Jahren hatte sie mit ihm im Führerscheinkurs gesessen, sie war der Schwarm aller Burschen gewesen, schon damals hatte sie ihm gut gefallen, aber er war zu feig gewesen, um mit ihr zu reden, geschweige denn, sich mit ihr zu verabreden. Ihre Haut war hell, und ihre grünen Augen waren auffallend groß, die dunkelbraunen Haare trug sie kurz geschnitten. Er mochte kurze Haare bei Frauen, fand es langweilig, dass die meisten sie lang trugen.
Er merkte, dass sie ihn ebenfalls erkannte, und freute sich. Sie helfe für ein bis zwei Stunden aus, erklärte sie, Cornelia hatte mit dem Sohn überraschend zum Arzt fahren müssen.
»Wenn du etwas Kompliziertes haben willst, kommst du besser gegen Mittag wieder her, da ist sie wieder da«, sagte sie und lächelte ihn an.
Er hatte vergessen, dass sie Wangengrübchen hatte.
»Ich brauche rote Nelken«, sagte er zögernd.
Er wollte mit dem Strauß gleich weiterlaufen, so wie er es jedes Jahr tat. Um elf Uhr musste er auf der Piste sein, eine schwedische Familie erwartete ihn. Sie sah sich um und meinte: »Das kriege ich hin. Wie viele?«
»Neun«, sagte er, »und ein bisschen Grünzeug dazu, wenn’s geht.«
Sie nickte und machte sich an die Arbeit. Er wollte sie nicht in Verlegenheit bringen, indem er ihr zusah, deshalb schlenderte er im Laden herum und betrachtete scheinbar interessiert Blumen in Kübeln, fertige Sträuße, Blumentöpfe und Gestecke, aber eigentlich beobachtete er sie. Er überlegte, wie er mit ihr ins Gespräch kommen konnte. Der Strauß, den sie ihm nach einer Weile entgegenstreckte, kam ihm passabel vor. Um in einer Baumkrone zu verrotten.
»Besser geht’s nicht«, sagte sie leicht verlegen. »Ich hoffe, du vergraulst deine Freundin damit nicht.«
»Ich habe keine Freundin«, beeilte er sich zu sagen und freute sich, dass sie in der Hinsicht neugierig war.