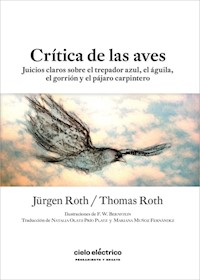Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Monsenstein und Vannerdat
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Jürgen Roth schließt […] so gut wie nahtlos an die thematisch verwandten Texte der Dichter Ror Wolf und Eckhard Henscheid an, hat dabei aber seine ganz eigenen originellen Stoffe und Perspektiven so eigenständig im Griff, daß tatsächlich Neuland als vermessen gemeldet werden darf!" schreibt Dieter Steinmann in dem Magazin Bewegungsmelder. Da will man nicht widersprechen - und läßt auf die Sammelbände Fußball! - Vorfälle von 1996 bis 2007 und Noch mehr Fußball! - Vorfälle von 2007 bis 2010 frohgemut die nächste Chronik allerhand fußballerischer und allgemeinsportlicher Tollheiten folgen. Denn wenn auf etwas Verlaß ist, dann auf die systemische Stupidität in der höllischen Welt der Hochleistungsleibesübungen, auf die, kurzum: ubiquitäre "Sportidiotie" (Karl Kraus). Nur noch Fußball! versammelt im wesentlichen Glossen, Polemiken, Satiren, Rundfunkarbeiten und Homagia aus den vergangenen vier Jahren - und zwar unter dem Motto des großen Muhammad Ali: "Ich weiß nicht immer, wovon ich rede. Aber ich weiß, daß ich recht habe." Ja eben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Roth
Nur noch Fußball!
Jürgen Roth
Nur noch Fußball!
Vorfälle von 2010 bis 2014
Mit Gastbeiträgen von Matthias Egersdörfer,
Stefan Gärtner, Christian Jöricke und Jörg Schneider
sowie Zeichnungen von Teresa Habild und Hannes
Neubauer
© 2014 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung der
Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
www.oktoberverlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Henrike Knopp
Umschlag: Thorsten Hartmann
unter Verwendung eines Photos von Rauchwetter/picture alliance/dpa Zeichnung auf S. 141: Hannes Neubauer; Zeichnung auf S. 192: Teresa Habild
Photo vom Autor: Michael Stein
Herstellung: Monsenstein und Vannerdat
ISBN: 978-3-944369-21-1
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Inhalt
Vorbemerkungen
Wortmilchschaum
Es brodelt, brummt und summt
Versuch, Fußball zu gucken
Homer mal Vergil im Quadrat
Gekasschnitzel
Zu gut zum Siegen?
Es gibt keinen Sand in der Sahara
Der Krampf geht weiter
Zu lahm für Ochs?
Boom, bumm, batsch
Holding door open. 5 seconds
Was meint Graf Eucharius Casimir?
Moskau reicht nicht
Phrase und Gefasel
Das Ohr auf dem Gleis
Ein bißchen was zu meckern
Drei Professoren
Träumer und Treter
Kein Esel, nirgends
Stunden der Wahrheit
Singzwang und Ariernachweis
Revolutionärer Fisch
»Auf, roll eini«
Sechzehn Bananen
Schöne Öde
Ihr Kampf
Die Geisel am Hang
Das Gürzel
Das siegende Gefühl
Offener Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim, Dieter Gummer, oder: Fahren im Falschen
Dreck, Dreck, Dreck
Die Barbarei des Sports
Crazy Carina Vogt: Klassebüchs
Gold für Minderbegabte
Wahnwitz Fußballkultur
Anhang
Gott, Gammler, Genie
Der Gott der flüssigen Worte
Blanker Neid
Kuscheln mit Kerner
Vogts, Berti
Haß auf Holländer oder: Warum Niederländer im Fußball so unbeliebt sind – Von Christian Jöricke
Thomas Berthold: Holzfällen – Von Stefan Gärtner
Das Wunder von Reiskirchen – Von Jörg Schneider
Symphonie in PS
Milchgesichter und Bergziegen
Vom Buben zum Billionär – Co-Autor: Peter Köhler
Das Duell der Weltmeister
Bobby Fischers Sandwiches
Der Tango aus der Sicht der Wissenschaft
Verregeltes Dasein
Nagelneue Epik – Heute: Der Fitneßstudioroman
Transgressive Modellierung
Biene – Von Matthias Egersdörfer
Chlorkehraus
Ein Brief
Nachweise
Vorbemerkungen
Montag – In christlichen Ländern der Tag nach dem Fußballspiel.
Ambrose Bierce: Des Teufels Wörterbuch
Der Titel dieses Buches ist soweit in Ordnung, aber nicht der wahre Jakob. Denn wie in Noch mehr Fußball! – Vorfälle von 2007 bis 2010 sind auch in diese Chronik Ein- und Auslassungen eingewoben, die andere Bereiche und Topvertreter der »Muskel- und Märchenindustrie des Spitzensports« (Thomas Kistner) zum Gegenstand haben, insbesondere eine berükkend aparte Eisschnelläuferin vom Stamme der Deutschen.
Im großen und ganzen jedoch konzentriert sich dieser Balg aus Glossen, Aufsätzen, Artikeln und Rundfunkbeiträgen auf den Fußball. Das spiegelt dessen Stellenwert wider. »Der Fußball übernimmt alle Fernsehmacht«, klagte der Tagesspiegel vom 3. Juli 2013, »der Tag, an dem Sport in Deutschland nicht mehr Sport, sondern Fußball heißt«, sei nahe. »Denn die öffentlich-rechtlichen Sender interessieren sich auch nur für Quote und Fußball und weniger dafür, ob ein Teil ihrer Zuschauer etwas anderes sehen will.«
Oder hören will. Mit einem Bruchteil der wahnwitzigen Summen, die die Öffentlich-Rechtlichen für Fußballübertragungsrechte aus den Fenstern schütten, ließen sich elaborierte Wortprogramme der Radiowellen pflegen und ausbauen, ließe sich politisch-literarischer Journalismus finanzieren, der den Namen Journalismus verdient. Machtpolitisch gewollt ist das Gegenteil, und auf Grund des verbrecherischen Formatierungszwangs läuft alles mehr oder weniger darauf hinaus, zumindest das ohnehin weithin unumkehrbar vergammelte Fernsehen einem einzigen Format zu unterwerfen, dem Format Fußball – respektive darauf, das Fernsehen nach dem Paradigma des vermaledeiten Sports final umzumodeln.
»Man hat manchmal schon das Gefühl, daß sich Deutschland von der Kulturnation zur Sportnation entwickelt«, räumte Michael Steinbrecher am 21. Juni 2013 gegenüber der FAZ ein. »Der Sport ist in fast allen Lebensbereichen präsent: im Fernsehkonsum, in der Mode, im privaten Verhalten. Sport durchdringt fast alle Sendeformen. Wie funktionieren Castingshows? Das ist nichts anderes als eine sportliche Competition mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Schlag den Raab funktioniert auch so. Ich sehe noch keinen Endpunkt – und stelle fest, daß die Dimension und die Akzeptanz enorm gestiegen sind. Die Livepräsentation im Sport ist das letzte kollektive Medienerlebnis, das die Nation verbindet.«
So ähnlich soll das ja bereits am 4. Juli 1954 gewesen sein. Was es mit dem kollektiven Medienerlebnis auf sich hat(te), schildert Gerd Fuchs in seiner Autobiographie Heimwege (Hamburg 2010) – Fuchs war damals einundzwanzig Jahre alt –: »Ich schlenderte die Straße entlang, und weil alle Fenster offen standen, konnte ich das Spiel im Gehen verfolgen – beziehungsweise mußte ich es verfolgen, denn vor dieser Reporterstimme war kein Entrinnen, so daß nicht so sehr ich das Spiel verfolgte als dieses mich. […] Da erhob sich ein Brüllen und explodierte in den Zimmern und stürzte aus den offenen Fenstern heraus und rollte die Straße entlang, ein erlöstes Brüllen, und da richtete es sich auf und riß den Arm befreit hoch: Sieg Heil.«
Der Herr Steinbrecher wird das weder wissen noch wissen wollen, denn er ist mittlerweile tatsächlich und beglaubigt: Professor an der Universität Dortmund. Ich darf aus einem Text aus Noch mehr Fußball! zitieren, der zuerst am 13. Juni 2008 in der Frankfurter Rundschau erschienen war: »Ich mußte so sehr lachen, daß mein Schreibtischstuhl fast zusammenbrach. Vor einem Monat war sie zu lesen gewesen, die Meldung des Jahres: ›Michael Steinbrecher will ›Prof‹ werden‹. Doch, das will er werden, der Michael Steinbrecher: Prof. Beziehungsweise Professor. Die Welt ist voller Wunder. […] Gut, die einen sagen: Das ist der bislang beste Scherz des gar nicht mehr allzu neuen Jahrhunderts. Die anderen interpretieren Steinbrechers Bestreben, den Dortmunder Lehrstuhl für – ja, so was muß es wirklich geben – ›Fernsehjournalismus‹ zu erobern, als Zeichen der vollendeten Verlotterung des deutschen Hochschulwesens, das, nachdem es von neoliberalen Berserkern und Handlangern des Kapitals stranguliert und planiert wurde, jeder opportunistisch-korrupten Pfeife offensteht. Wo Humboldt war, soll Steinbrecher werden. Grandios.«
Fünf Jahre später, im nicht minder famosen Sportjahr 2013, hatte dieser hochoffizielle »Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus« (www.journalistik-dortmund.de) selbstverständlich wenig Besseres zu tun, als den Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt am Main zu moderieren (Motto: »Ice and Fire – von Sotschi nach Rio«) – und zwar »gekonnt«, wie wir in einer achtseitigen Zeitungsschleimbeilage erfuhren, einem unschätzbar wertvollen Dokument der geistigen Verluderung und des Prasserwesens, voller Photos von Trantüten, Gaunern und Abgreifern: Hans-Peter Friedrich, Franz Beckenbauer (ohne den läuft ohnehin nichts mehr), Volker Bouffier, Boris Rhein, Roland Koch, Edmund Stoiber und – Waldemar Hartmann, »der den Sportpresseball in den neunziger Jahren selbst dreimal moderiert und ›mit aus der Taufe gehoben‹ hatte«.
Während Michael Steinbrecher also seine akademische Würde und Distanz durch den engagierten Einsatz als Conférencier bei einer von vorne bis hinten korrupten Gockelveranstaltung unter Beweis stellte – und deshalb keineswegs das Amt des Geschäftsführenden Direktors des Dortmunder Instituts für Journalistik niederlegen mußte, das hat er, Wunder über Wunder, auch noch inne –, konnte der offiziell offenbar nicht zum Einsatz gekommene Waldemar Hartmann immerhin seine vor Sprachwitz, intellektueller Schärfe und selbstreflexiver Bescheidung sprühende Autobiographie Dritte Halbzeit – Eine Bilanz (München 2013) bewerben, in der es konsequenterweise zu geschätzten dreiundneunzig Prozent um Spezltum, politischen Filz, unverblümt eingestandene Schiebereien im Medienbetrieb und Kohle mal noch mal Kohle geht.
Na ja, er sagt’s selber: »Ich war eitel wie ein Depp.« Er meint: in seiner Jugend. Nur, daran änderte sich: nichts. Ob er nun mit seiner Nähe zur Familie Strauß herumrenommiert oder zu irgendwelchen Flaschen-Sozis oder zu Muhammad Ali oder zu sonstwem – es ist eine auf fast dreihundertsiebzig Seiten astrein durchgehaltene goldreine Aufplusterei, die trotz journalistischen Beistandes (schreiben kann Hartmann höchstens Einkaufszettel und sogenannte Fernsehgeschichte) grammatikalisch-orthographisch und stilistisch das Niveau von Möbelhauskatalogen erreicht.
Ausgesprochen gelungen fand ich allerdings diesen Satz: »Bei Henry und mir war von Anfang an klar: Ein Duo funktioniert nur zu zweit.« Henry Maske war Hartmanns Experte bei ARD-Boxübertragungen, und eine Seite vorher lesen wir: »Wir waren uns nicht immer einig, weil Henry das Boxen als Philosophie versteht, als Teil des großen Ganzen, als erhabene geistige Auseinandersetzung. Ich bin dagegen der Meinung, daß Boxen insofern mit Schopenhauer zu tun hat, daß auch der ein ›Hauer‹ war, zumindest dem Namen nach.«
Wem soll man jetzt eine langen? Dem Hartmann? Der weder Schopenhauer kennt noch jemals eine Zeile von ihm gelesen hat? Hartmanns Co-Autor, der diesen Dreck zu verantworten hat? Dem Lektor, der nicht mal die grammatikalische Havarie bemerkt und obendrein den Müll stehenläßt?
Nein, ich bin Pazifist und weise statt dessen mit dem gebotenen Maß an »Eitelkeit« (Hartmann) viel lieber auf das Kapitel »Das müssen wir nicht archivieren – Faire und unfaire Kritiker« hin.
»Hand aufs Herz: Mit Kritikern umzugehen – das mußte ich erst lernen«, heißt es da. »Geärgert habe ich mich immer dann, wenn ich genau gemerkt habe, es geht nicht um eine konstruktive und sachliche Kritik – sondern der Absender kann einfach mit meiner Person nichts anfangen, weil ihm mein Schnauzer nicht gefällt oder was auch immer.«
Er schnallt es halt nicht; er kapiert nicht, daß es weniger um die Realperson Waldemar Hartmann als vielmehr um die von ihm schamlos verkörperte Ersetzung von Journalismus durch Gschaftlhuberei und Propaganda geht. Ich darf ein wenig weiterzitieren: »Für mich war das Schlimmste, als mich Jürgen Roth 2002 in der Frankfurter Rundschau als ›konfusen Krachkopf‹ dermaßen persönlich runtergemacht hat, daß ich ein einziges Mal den Medienanwalt Michael Nesselhauf angerufen habe. In der Kritik (wenn man sie überhaupt so nennen möchte) ging es um ›Waldemar Hartmann, diese aggressiv-heitere, mopsigjoviale Inkarnation von rettungsloser Selbstliebe und intellektuellem Bankrott, diese Heimsuchung des modernen Fernsehens der Kumpelei und nationalistischen Erregung‹. Mehr will ich von dieser Schweinenummer gar nicht zitieren, es wäre zuviel der Ehre« – und zuviel der Wahrhaftigkeit.
Vorausgegangen waren der inkriminierten Passage nämlich folgende Zeilen: »Viel, allzuviel haben wir schon aushalten und durchstehen müssen, Mikrophonexaltationen eines Gerd Rubenbauer zum Beispiel, der den alpinen Skisport mehr orgiastisch kreischend als fachlich kommentierend begleitet und während der Eröffnungsfeier dokumentierte, weshalb einer Pistensau wie ihm selbst lachhafte Showdarbietungen genügen, um bar jeder Kontrolle herumzuwitzeln, bis der belastungsfähigste TV-Zuschauer zerebral kollabiert.
Und dann, und dann – tauchte er auf und toppte jeden, mein alter Spezi Waldi, der ungekrönte König der Anwanzerei. Legendär sind seine Interviewturteleien mit den Spitzenkräften des Münchner Bussifußballs, legendär sind des ehemaligen Augsburger Pilsstubenwirts spezielle Schranzenhuldigungen an ›Welt-Präsident‹ Franz Beckenbauer (so Bild bereits am 22. Februar 1995); doch nun, im weiten Westen Utahs, verlor er final die Besinnung und zog diverse Sportler und Wichtigtuer, vornehmlich Bundesinnenminister Otto Schily, gleichfalls ins verdiente Verderben.«
Hartmann sei »sich, wir müssen das so sagen, für wirklich keine Geschmack- und Gedankenlosigkeit zu schade, und zu seinen Gunsten sei konzediert, daß er das auch nicht mehr merkt«, hatte ich im Anschluß an die von ihm repetierten Äußerungen geschrieben und dann meine Invektiven in einen größeren Zusammenhang gestellt: »Gleich zum Start der Wettkämpfe wurde Waldi aus dem Deutschen Haus zugeschaltet. Dort verkündete er lichterloh froh, der Andrang sei immens, weil man die altbairische Disziplin des Weizenbierstemmens unter perfekten Bedingungen absolvieren könne. Anschließend gab er die intime Information preis, er, der berüchtigte Saufchamp, habe beschlossen, zwei Wochen abstinent zu bleiben.
Das muß man wissen, weiß Gott. Das will, das soll man erfahren, und nicht minder bedeutsam dünkt dem schrankenlosen Narziß die Nachricht, das amerikanische Essen bringe ihn in die Bredouille, lasse nämlich seinen ›Diätplan‹ durcheinanderpurzeln und die Taille anschwellen. So tönt es unter einem aufgepfropften Cowboyhut hervor, und während der mutmaßlich impertinenteste der 10.000 Journalisten aus aller Damen und Herren Länder zur Primetime die wehrlosen Studiogäste angockelt und verbal betatscht, ›deutsche Goldmedaillen‹ vorausschauend ausplärrt und ›den Hackl Schorsch‹ ob dessen vorzüglicher Beherrschung des Englischen (›Utah beer ist not the worst‹) belobigt, kramt er in seinem konfusen Krachkopf nach der nächsten Zumutung, die darin gipfelt, daß er selbst schweinsaugenzwinkernd ein paar besonders protzige Statements in, hahaha, kernig-bayerischem Pidgin-Englisch ausspuckt (›So soag’n mir des‹) […].
›Man darf nicht weiter ins Boulevardeske abgleiten‹, hatte vor den Spielen ZDF-Sportchef Wolf-Dieter Poschmann gemahnt. Zumindest bestimmte Kontingente der ARD verfolgen andere Ziele. Die Selbstinszenierung, die Personalityshow, die Aufbauschung des Moderators zum Medium grenzenloser Mitteilsamkeit und geradezu süchtiger Selbstverausgabung, konterkariert alles, was jemals ›seriöser Sportjournalismus‹ genannt wurde. Ein Mann, der den ›Auftrag‹, ›unterhaltsam zu sein‹ (Poschmann), pausenlos mit dem folkloristisch verschwitzten Gealber über Kondome und andere Spießerverdruckstheiten verwechselt, gibt die Richtung vor. Besonnene Akteure, die eigentlich im Zentrum des Fernsehgeschehens stehen sollten, haben da keine Chance. Sehr schön erläuterte etwa der knarzige Skisprungcheftrainer Reinhard Heß nach Sven Hannawalds Silber von der Normalschanze: ›Mit Biertrinken und Gesprächen ist die Leistung nicht zu provozieren.‹ Hartmann vernahm die Botschaft nicht. Er und sein Team fuhren fort, Bierstilblüten zu produzieren und journalistische Leistungen zu erbringen, die offenbar die vollgedröhnten Bild-Berichte über Anni Friesingers ›Oho-Oberweite‹, über den, klar, ›Busen-Neid‹ zwischen ihr und Konkurrentin Claudia ›Nomen no omen‹ Pechstein und über den Popevent als ›Busen-Duell der Eis-Königinnen‹ noch hinter sich lassen sollen.«
Genug der Aufklärung (und Selbstbespiegelung), weiter in Hartmanns Text: »Jedenfalls habe ich zum Telephonhörer gegriffen und mich beklagt: ›Herr Nesselhauf, ich kann doch nicht alles über mir auskübeln lassen.‹ Und dann hat mir Nesselhauf erklärt: ›Herr Hartmann, wir können leider nichts machen. Und ich sage Ihnen auch, warum: Über dem Artikel steht ›Eine Polemik‹.‹«
Das ist juristisch korrekt. Die Meinungsfreiheit und gewisse Rechte haben für Waldemar Hartmann aber offensichtlich nur dann Gültigkeit, wenn sie sein persönliches und pekuniäres Vorankommen sicherstellen: »Da habe ich gelernt: Wenn man ›Polemik‹ über einen Artikel schreibt, besitzt man einen Freifahrtschein für Unverschämtheiten aller Art. Da kannst du jeden von oben bis unten hemmungslos besudeln. Wenn du nur zehn Prozent davon deinem Nachbarn entgegenschleudern würdest, wären diverse Tagessätze fällig. Ich halte das bis heute für eine schreiende Ungerechtigkeit. Für mich hat das mit Pressefreiheit nicht mehr viel zu tun.«
Der Begriff der Person des öffentlichen Lebens ist Waldemar Hartmann also auch unbekannt. Dafür bekannte er am 15. März 2013 in der WDR-Talkshow Kölner Treff abermals ausgiebig, was für ein souveräner Hecht und unübertrefflicher Wodkavernichter er sei, bis Moderatorin Bettina Böttinger anhob: »Ich muß eine Stelle vorlesen. Sie ham die geschrieben. Und ich hab’ mir … Was hat der Mann für ’n dickes Fell, daß der sich traut, das in seinen eigenen Rückblick, also in seine Autobiographie zu schreiben? Wo stand in der Frankfurter Rundschau, Sie wissen schon, was kommt, da stand mal über Sie, es is’ wirklich zu schön. Zu böse.« Es folgte obiger Abschnitt. Böttinger anschließend: »Sind Sie Masochist?« Hartmann: »Nein, ich wollt’ einfach mal zeigen, weil da kommen ja zwei gute Kritiken auch, im Laufe der fünfunddreißig Jahre ham sich die zwei angesammelt, ja? Nee, ich wollt’ einfach mal zeigen, was heut’, was, was möglich war, wie Pressefreiheit auch genützt werden kann. Jürgen Roth hat das übrigens geschrieben, von dem man mir damals dann gesagt hat, er sei noch im bewaffneten Kampf. […] Also is’ das heutzutage möglich, Pressefreiheit!, wenn man ›Polemik‹ drüberschreibt, kann man Kübel voll Schweinereien und Häme über ein’ schütten, und du hast keine Möglichkeit, dem zu widersprechen. Auch das is’ offenbar – Pressefreiheit.«
Selbst hier lag Hartmann daneben. Ich war damals nicht im bewaffneten Kampf, ich war lediglich extremistischer Berater der Gallus-Guerilla-Gardeners.
»Ja, man darf die Wahrheiten ja auch mal niederschreiben.« (Hartmann, Kölner Treff) Für Hunter S. Thompson bedeutete das, Sportjournalisten als »eine dumpfe und hirnlose Subkultur faschistischer Säufer« und als »eine Bande bösartiger, in einem Zookäfig wichsender Affen« zu titulieren (»sie vermehren sich wie Zuhälter und Immobilienmakler«; Hey Rube – Blutsport, die Bush-Doktrin und die Abwärtsspirale der Dummheit – Zeitgeschichte aus der Sportredaktion [Berlin 2006]); für Waldemar »Ich weiß alles, egal, in welcher Sportart« Hartmann wiederum, bei seinem stellaren Auftritt als sogenannter Telephonjoker in der RTL-Raterunde Wer wird Millionär? (21. November 2013) – er erklärte, die deutsche Nationalmannschaft habe nie eine Fußball-WM im eigenen Land gewonnen (und das als Wahlmünchner und jahrzehntelanger BR-Fußballanchorman) – zu behaupten, die Geschichte mit Deutschland stehe in seiner Autobiographie: »›Da gibt es ja nur eins: Deutschland hat natürlich im eigenen Land keine WM gewonnen!‹ Dann fügte er noch an: ›Noch nie im eigenen Land. Kann man in Dritte Halbzeit, in meinem Buch, nachlesen.‹ Falsche Antwort mit peinlicher Eigenwerbung.« (Spiegel Online)
Mit in die Irre führender Eigenwerbung zudem. Ist da nämlich nicht nachzulesen. Sondern beispielsweise, daß Waldemar Hartmann ganz gern mit Horst Seehofer einen heben würde, »um ihm ein wenig Fußballsachverstand zu vermitteln«. Oder: »So unglaublich viel Ahnung von dem Sport, den wir moderieren, haben wir Moderatoren ja auch nicht immer.«
Nicht allzuviel Ahnung haben offenbar dito einige der Autoren der Buchreihe 111 Gründe, den … zu lieben (sie erscheint in einem Imprint-Verlag von Schwarzkopf & Schwarzkopf, der allen Ernstes Wir sind der zwölfte Mann, Fußball ist unsere Liebe! heißt; nu’ is’ alles zu spät, da hilft nicht mal mehr die Erinnerung an Gustav Heinemanns Wort von der Liebe, die nicht dem Staat und allein seiner Frau gelte). Im Falle des Bandes über den 1. FC Nürnberg kann ich das bestätigen. Zu jenem über die Frankfurter Eintracht schreibt mir F. W. Bernstein am 21. Januar 2014 per Mail: »Auch wenn Du unbegreiflicherweise diesem bayerischen Neureichenverein anhängst, so könntest Du vielleicht doch meine Empörung teilen: In diesem Buch fehlt fast nix, aber es fehlt die Seele der Eintracht – ignoriert wird Toni Hübler!«
Fürwahr, ein Skandal, ein echter. (Zu Toni Hübler siehe bei Bedarf etwa Noch mehr Fußball!, S. 79 ff.) Ich hingegen hege nach wie vor die Absicht, irgendwann zusammen mit Kollegen die Buchgroßprojekte Wahre WM-Geschichte – Große Spiele neu gesehen und Deppen und Helden – Die Dummheit im Fußball anzupacken. Für letzteres vorgesehen sind die Kapitel »Falsche Deutungen – Dumme Fußballhistoriker«, »Fußball und Krieg«, »Quatschige Fußballtheorien«, »Spielsystemtorheiten«, »Effenberg – Kasper«, »Klinsmann – Kasper«, »Netzer – Kasper«, »Maradona – Kasper«, »Hauptsache Italien!«, »Große Trainerfehlentscheidungen«, »Fußballsprache als restringierter Code«, »Elende Vereinsbosse«, »Fußballpresse gestern und heute – Von Richard Kirn bis zur Süddeutschen Zeitung«, »Die FIFA, uuaaahh!«, »Gegendummheitsfiguren – Scholl et alii«, »Interview mit Thomas Berthold«, »Was Glück ist? Dumm sein und Fußball spielen« sowie »Die wunderbare Dummheit des Fußballspieles«.
Zum Beschluß: Im hiesigen Kompendium findet sich neuerlich ein Anhang mit Beiträgen, die chronologisch aus der Reihe fallen und ab und an ein wenig vom Thema Fußball/Sport wegführen – oder in dessen Randbezirke. Zur Not ignoriere man ihn/sie.
Wortmilchschaum
Was hat uns denn im Verlauf der von der FIFA, jenem lustigen Geheimbund mit Sitz in der sauberen Schweiz, organisierten Fußballweltmeisterschaft richtig gefallen? Daß Seppl Blatter, wie die taz schrieb, »die erste Heiligsprechung eines Sportfunktionärs durch die Öffentlichkeit« gewärtigen durfte? Daß der Monetenmessias »dem Fußball die soziale Dröhnung verordnet« hatte? Derweil, so die taz weiter, das Gebaren der Blatterschen Schmiergeldtruppe »von Kommentatoren schon als FIFA-Faschismus bezeichnet« wurde?
Doch, das hat uns sehr gefallen – genauso wie – während der Partie Slowenien gegen England – der Ausruf »Scheiße, fuck, ey!« des ARD-Reporters Gerd Gottlob, eines Mannes, der gleichfalls mitzuteilen wußte: »Dieser Ball war auf einem guten Weg.«
Im »kleinen, süßen Studio« der ARD, in dem Reinhold Beckmann, der meinte, in Vorberichten würden irgendwelche Hintergründe »angeschmeckt«, den üblichen, bereits von Gottfried Benn wahrgenommenen »Eitelkeitsgestank« verbreitete, pflegte in den Abendstunden bedauerlicherweise zum letztenmal das Duo Delling/Netzer seinen von der FAZ gelobten »krampfigen Hang zur versemmelten Pointe« und machte somit gottlob die teils brillanten Einlassungen des Fußballhermeneuten Mehmet Scholl vergessen, der Zufälle von Spielzügen zu unterscheiden vermochte und sich nicht scheute zu sagen: »Ich hab’ eigentlich gar keine große Lust, dazu was zu sagen.«
»Da muß ’ne Menge gutgeh’n, damit das mal klappt«, plapperte anschließend Tom Bartels vor sich hin, münzte diesen fabelhaften Gurkensatz aber keineswegs auf den glänzend katastrophal aufgelegten, intonationswütigen, gottlob nicht mal durch Gerd Gottlobs »Fuck!«-Einwurf zu bremsenden Steffen Simon.
»Kein Spiel mehr, in dem auch nur der argloseste Kurzpaß unkommentiert und vor allem ohne statistisches Beiwerk bliebe«, meckerte darob die Weltzeitung Main-Echo, unterdessen die FAZ über den fürs ZDF an der Flüstertüte hockenden Béla Réthy räsonierte: »Wieviel Réthy von Fußball versteht, ist schwer zu sagen.« Réthy, immerhin, revanchierte sich mit der Sentenz: »Jede Regung, die durch seine Seele wandert, kriegen wir gezeigt.«
Einhellig tadelten die Frankfurter Rundschau und die taz die zusehends hektische, nahezu kinematographische, inflationär mit Superslomomontagen operierende FIFA-Fernsehweltregie, die schon mal den Eindruck eines vollen Stadions vortäuschte und Gefühlskulissen zurechtbastelte. Lasen wir uns zwischendurch nicht im WM-Sonderteil der Süddeutschen Zeitung einen Hungerast und ebenda solch einen geschwefelten Käse: »In der DFB-Elf verschmelzen der ultraleichte Südländerstil des türkischstämmigen Özil und die draufgängerische Ader des bayerischen Brauchtumsstürmers [Müller] zum stilvollen Mentalitäten-Herkunfts-und-Bewegungs-Mix«, dann labten wir uns an den äußerst buntgemischten Darbietungen auf RTL: am Redundanzgequatsche des Frühstücksprofessors Olaf Thon zum Beispiel oder an Herrn Klinsmanns unfaßbar klugen Annotationen zu allerlei »emotionalen Kisten« und zum »positiven Feeling« zumal im Kopfe des unvermindert semmeldummen Sprachvergewaltigers.
Doch, das alles hat uns ausnehmend gut gefallen: die narzißtischen Infantilendebilenaufführungen im Sat.1-Frühstücksfernsehen (»Die WM-Stimmung bei uns heute morgen: Wir sagen yes!«) genauso wie Katrin »innerer Reichsparteitag« Müller-Hohensteins beherzt-selbstloses Engagement im »Qualitätsbeirat« einer Molkerei. Den lauwarmen Wortmilchschaum, den sie am Mikrophon stets zart lächelnd absonderte (»Mein lieber Herr Gerichtsvollzieher!«), garnierte Oliver Kahn aufs holdeste mit feinsinnigen Bemerkungen zu nunmehr »zehntausendprozentig« und volle Kanone »hochmotivierten« Kickern.
»Daß die Leute es aushalten, das Vorher- und Nachhergerede«, darüber wunderte sich Dieter Kronzucker ausgerechnet in der ZDF-Vollpfostensendung Volle Kanne. Wir haben es aus- und durchgehalten. Wir haben gesehen und gehört, wie der Sky-Experte Franz Beckenbauer vergeblich nach dem Wort »Stratege« suchte und dreimal hintereinander einen »Strategiker« am Werk sah. Wir haben Reiner Calmund zugehört, der herumfaselte: »Laß ma’ die Kirche im Dorf lassen«, und Jogi Löw, der versicherte: »Nach so einem Spiel lassen wir uns nicht nervös werden lassen« – sowie dem bemitleidenswerten Guido Buchwald, der erläuterte, eine Mannschaft habe »ein Stück Unerfahrenheit oder ein Stück, daß sie es einfach nicht besser machen können«.
Wir haben sogar das Fußball-Frühstück auf n-tv geguckt, und daß der größte Hohlschädel unter all den heldenhaften Sportjournalisten bei der taz beschäftigt ist, wissen wir jetzt auch. Er heißt Deniz Yücel und schreibt ein grenzenlos ekelhaftes Stummeldeutsch. Das »Sexy-Chilly-Funky-Punky-Trendy-Super-Duper-Knuddel-Wahnsinns-Zauber-Märchen-Deutschland«, das er herbeisehnte, das liegt allerdings wieder am Boden. Fußballgott sei Dank.
Es brodelt, brummt und summt
Im März 1999 habe ich als Exterritorialer und bis dahin ein einziges Mal tatsächlich als Sportreporter tätig gewesener Autor im Sportteil der Frankfurter Rundschau einen kleinen Aufsatz über das delikat-intrikate und zugleich innige Verhältnis zwischen der Eintracht und den Dichtern plazieren und behaupten können, kein anderer Klub sei von den Dichtern »inständiger und kenntnisreicher umworben« worden als die SGE, weil sie »einst einen Stil praktizierte, der ›kunstnah‹ zu nennen war«.
Ich zitierte u. a. Eckhard Henscheids legendäre »Hymne auf Bum Kun Cha« (»Am Abendhimmel blühte ein Frühling auf, und / Sein Name war Cha. Die Eintracht aber, jahrlang / Von Klippe / Zu Klippe / Geworfen, glühte mit dir, o mein Trauter, zu / Neuschönem Glanze«) sowie Henscheids Eloge auf die Epiphanie eines »Quadrupelpasses Bein-Binz-Andy-Möller-Bein, explosiv elektrisierend wie eine Chopinsche chromatische Terzenkaskade«.
Ich hätte mich, cum grano salis, aber ebensogut an die wackeren Männer aus dem FR-Sportressort halten können. Zumindest in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Krieg pflegten sie bisweilen eine nahezu lyrische Beziehung zu den »Riederwäldlern«. Ein »Drahtbericht unseres Fachmitarbeiters Günter Wölbert« vor dem Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Real Madrid in Glasgow am 18. Mai 1960 begann zum Beispiel so: »Der glühende Sonnenball am wolkenlos blauen Himmel über der wildromantischen schottischen Küste, sechzig Kilometer westwärts Glasgows, und der aus den Herzen der Eintracht-Spieler strahlende freundliche Optimismus sorgen für Sonnenschein im Hauptquartier des Deutschen Fußballmeisters.«
Dergleichen ab und an einnehmend keusche Poetereyen, die den gewöhnlich betulich vor sich hin knatternden Berichtston punktuell ins Schief-Schöne verschoben, wurden begleitet von ungeniert parteilichen Einlassungen. »Wir sind alle unruhig und ungeduldig wie kleine Kinder […]. Selten hat ein Sportereignis so die Herzen berührt wie das Spiel am heutigen Abend im fernen Glasgow, das durch das Wunder des Fernsehens in unsere Stuben verpflanzt wird«, hieß es, und die »kritische Einschätzung« nach dem 3:7 gegen den »Kolossalsturm« der Madrilenen zeichnete sich dann auch eher durch melancholische Hingabe denn durch analytische Schärfe aus.
»Stolz« müsse man auf die Eintracht sein – das war der Tenor jener Tage, in denen Ressortleiter Erich Wick in einem Porträt über Paul Oßwald den Meistertrainer vom Main unverkennbar höher einschätzte als Bundestrainer Herberger (womit er womöglich sogar recht hatte) und ihm attestierte: »Der Trainer weiß, daß er die großen Tiere nicht reizen darf« – den »›verriegelten‹ Pfaff« beispielsweise oder den »eleganten, selbstsicheren, jungen Stinka«.
Fünfunddreißig Jahre später führten einige der »›Ballratten‹ vom Riederwald« (Wick) einen ziemlich ridikülen Tanz auf. Anthony Yeboah, Jay-Jay Okocha und Maurizio Gaudino, schwer beleidigt und gedemütigt oder was, verweigerten nach einem von Trainer Jupp Heynckes angeordneten Sonderwaldlauf die weitere Arbeitsverrichtung, und »die Folge war der zweifelsfrei größte Knall in zweiunddreißig Jahren Bundesligazugehörigkeit« (Walther Lücker, 5. Dezember 1994) – sowie ein wochenlang über die Sportseiten der FR sich hinwegwälzendes Gezeter über speziell Yeboahs gekränkte »Ehre«, über die unterdessen traditionelle Herrschaft der »Querulanten« in der notorisch »launischen« ersten Mannschaft, über »Eitelkeiten« und – nun eher Heynckes angelastete – Herrenmenschenallüren (diesbezüglich legte sich vor allem Peter Körte im Feuilleton ins Zeug, vom »Rassismus« bis zum »eisernen Korpsgeist« blieb da nichts unerwähnt). Nein, bei all den Possen und »Irrungen und Wirrungen« ward hier das, was die FR wohl im Kern ausmachte, oftmals aufs prangendste auf seinen Begriff gebracht: die moralische Entrüstung, am prächtigsten verkörpert durch meinen Lieblingstugendwart und Sprachverbieger Harald Stenger, der sich etwa am 11. Januar 1995 bitterlich über den »Schlendrian«, über »Konfusion und Chaos«, »Peinlich- und Niveaulosigkeiten«, den fehlenden »Realitätssinn« und »Dilettantismus« in der Führungsetage der Eintracht beklagte – und zwar in einer einzigen winzigen Kommentarspalte.
Hinter alledem verbarg (und verbirgt) sich, scheint mir, die gekränkte Liebe des Fans, der es auf die andere Seite geschafft hat. In keiner anderen bedeutenden Tageszeitung hierzulande dürfte sich die unverbrüchliche Verbundenheit der Redakteure mit dem Herzensverein derart unverhohlen artikulieren oder artikuliert haben. Das ist, verglichen mit dem manchmal gekünstelt wirkenden Habitus der Distanziertheit in anderen großen Blättern, vielleicht schlicht und einfach ehrlich.
Thomas Kilchenstein schrieb 1998 für eine Anthologie, für die ich als Co-Herausgeber verantwortlich zeichnete, eine herzergreifende Geschichte über seinen Einsatz als Reporter beim zweiten Relegationsspiel gegen den 1. FC Saarbrücken im Sommer 1989 – und machte aus seiner Sympathie für die Adlerträger keinen Hehl. Im Mai 1999 pries er vor dem Bundesligasaisonfinale (nach dem schließlich nicht Frankfurt, sondern skandalöserweise respektive aus blanker Dummheit der 1. FC Nürnberg abgestiegen war) unablässig die »bemerkenswerte« Entwicklung der Mannschaft, ihren »Charakter«, den »bravourösen Torwart« Nikolov, er beschwor die Chance, »aus der Geschichte Nektar [zu] saugen«, und so fort – nahezu jede Zeile Ausdruck einer hoffnungs- und euphoriegesättigten Inflammiertheit. Anders gesagt: »Es brummt und summt am Riederwald« (Kilchenstein, 26. Mai 1999), nein, »es brodelt, brummt und summt« (derselbe, 27. Mai 1999) ebenda.
Die Dramatisierung war bei den Sport-»Recken« der FR nie verpönt. Sie ist ja auch das womöglich angemessenste Mittel, die poetischen und metaphysischen Schichten des Fußballspiels sprachlich zu erschließen. Und die infamen, perfiden. An denen labte sich all die Jahre, zumal angesichts der nicht endenden Lizenz- und Geldgaunereien, leidenschaftlich Harald Stenger. Da ließ sich turnusmäßig »wieder nichts Gutes erahnen«, da litten sie allesamt unter teuflischer »Selbstüberschätzung«, da sollten die öffentlichen Diskussionen »in den nächsten Tagen sicher weiter eskalieren«, da mahnte Stenger »mehr Wahrheitsliebe« an, da tadelte er »Hochmut und Schönfärberei« ad infinitum, und warum es die Eintracht in Anbetracht der wie von höheren Mächten verhängten »düsteren Realität« heute überhaupt noch gibt, das weiß wohl allein Heribert Bruchhagen.
Neben der gutinformierten Sportredaktion der FR freilich.
Versuch, Fußball zu gucken
Mir fällt zum Fußball nichts ein. Nichts mehr. Im Moment. Die Sonne scheint, das genügt. Ich habe einen ansehnlichen Batzen von Texten und Büchern über Fußball geschrieben, und jetzt fällt mir zum Fußball überhaupt nichts mehr ein.
Ich werde keine Zeile über Michael Ballack schreiben. Ich wüßte ja auch gar nicht, was ich über Michael Ballack schreiben sollte. Vielleicht steht in dieser Zeitung etwas über Michael Ballack, das könnte ich lesen, aber ich werde es nicht tun. Ich habe den Fußball satt. Das ist schön.
Vor drei Wochen ging mein Fernseher kaputt. Darüber bin ich froh. Kein Videotext mehr, kein süchtiges Suchen nach Nachrichten aus der Welt des Fußballs mehr, wenn man aufwacht und Ablenkung sucht vom grauenhaften Wetter da draußen oder von den Verwüstungen im eigenen Kopf.
Die Sonne scheint, mein Kopf schmerzt, und das einzige, was ich über den Bundesligaspieltag weiß, ist, daß die Eintracht auswärts 4:0 gewonnen hat. Das hat Fipps am Samstagabend in meiner Stammkneipe gesagt, daran erinnere ich mich. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen Spiele ausgegangen sind, man glaube es mir, oder man glaube es mir nicht.
Die Sonne scheint, der Kaffee schmeckt, der Kopf ist eine Ruine, und am Nachmittag werde ich mich wieder um mein neues Heim kümmern.
Ich hatte es ja fest vor. Ich wollte es versuchen. Ich wollte versuchen, mal wieder Fußball zu gucken, seit der WM zum erstenmal wieder. Ich bin gescheitert, und es macht mir nichts aus.
Am Samstag kamen um die Mittagszeit die Freunde M. und M. vorbei. Sie hingen Türen aus, schraubten Handläufe ab und wuchteten für mich einen schönen alten, massiven Schreibtisch aus der Waschküche, trugen ihn Treppen hoch und durch Gänge und über die Straße zu meinem neuen Heim. Das war eine ungeheure Leistung, die die beiden durch Dialoge von wahrhaft Beckettschem Zuschnitt krönten.
Als der Schreibtisch im Hof vor meinem neuen Heim stand, meinten M. und M., daß jetzt ein paar Belohnungsbiere fällig seien, die Bundesliga fange ja erst in eineinhalb Stunden an. Ich ging zur Trinkhalle und kaufte sechs Balkonbiere, die wir dann auf dem Balkon meines neuen Heims in uns hineinlaufen ließen.
»Es gibt nichts Besseres als was Gutes«, sagte M. Die Biere in der Sonne schmeckten vorzüglich. Eine Stunde später kam der freundliche Sami, der Inhaber der Trinkhalle, vorbei, mit einer Tüte voller Balkonbiere. »Ein Geschenk zum Einzug«, sagte er und lachte.
Nach achtzehn Balkonbieren latschten wir in meine Stammkneipe und laberten und tranken weiter. Irgendwann fiel mir ein, daß ich ein paar Zeilen über den Bundesligaspieltag würde schreiben müssen, und ich fragte die beiden Freunde, was ich schreiben solle.