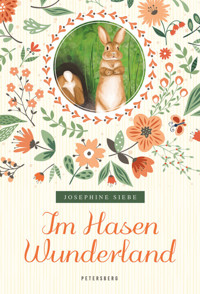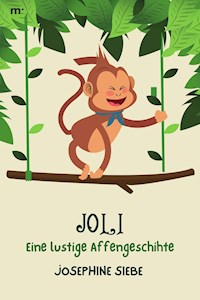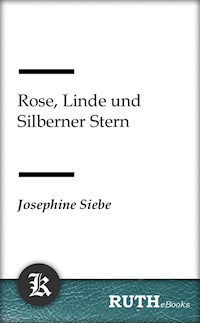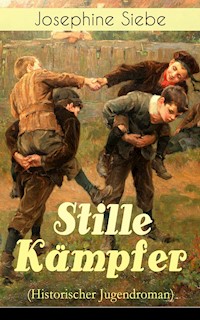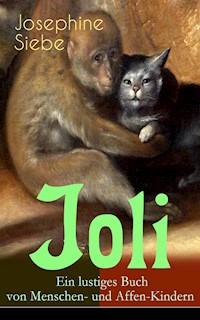Oberheudorfer Buben- und Mädelgeschichten (44 Kindergeschichten in einem Buch) E-Book
Josephine Siebe
0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Oberheudorfer Buben- und Mädelgeschichten (44 Kindergeschichten in einem Buch)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Josephine Siebe (1870-1941) war eine deutsche Redakteurin und Kinderbuchautorin. Sie verfasste zwischen 1900 und 1940 fast 70 Bücher für Kinder und heranwachsende Mädchen, daneben eine Vielzahl von Beiträgen in Jahres- und Sammelbänden. Inhalt: Oberheudorfer Buben- und Mädelgeschichten Oberheudorf, wo es liegt, und wie es darin aussieht Wie es Heine Peterle in der Stadt erging Der Schulrat in Oberheudorf Zwei Feinde Ehrenjungfern und Buben Die Roggenmuhme Das besinnliche Trinchen Sommergäste in Oberheudorf Das Vogelschießen in Niederheudorf Muhme Lenelis und ihre Freunde Die Prinzessin mit dem seltsamen Namen Die klugen Gänse von Oberheudorf Das Glück im Suppentopf Friederikes Abenteuer Das Ständchen Es brennt überall Neue Kindergeschichten aus Oberheudorf Ein Fastnachtsscherz Vorsicht, Gespenster! Es hat in der Zeitung gestanden Ein kleiner Held Das Hünengrab Nachtwächter sein ist manchmal schwer Schauspieler sind da! Die schöne Flickerin Das zornmütige Annchen Wir wollen die Bahn! Ein Wundervogel Ferienarbeiten, und was daraus wird Der unsichtbare Kaspar Traumfriedes Glück Die Oberheudorfer in der Stadt Auf dem Johannesplan Traumfriedes Abschied Die Grünmützen von Feldburg Ein böser Tag Heine Peterles Brief Eine Stadtfahrt Verkehrte Gedanken Das Abenteuer im Schloß Der kleine Teufel hilft Fräulein Wunderlich über die Dornenhecke Allerlei Geschenke, und was aus ihnen wird Die Denkmalsbuben von Schwipperlingen Sommerferienlust Im Zirkus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Oberheudorfer Buben- und Mädelgeschichten (44 Kindergeschichten in einem Buch)
Inhaltsverzeichnis
Oberheudorfer Buben- und Mädelgeschichten
Oberheudorf, wo es liegt, und wie es darin aussieht.
An einem Frühlingstage kamen drei junge Männer auf ihrer Wanderung durch das deutsche Land nach Oberheudorf, das zwischen Gebirg und Ebene liegt. Als sie in das Dorf einzogen, lief ihnen unversehens ein Schweinchen in den Weg. Da rief der erste, der sich leicht über jeden Quark ärgerte: „Pfui, ist das ein abscheuliches, schmutziges Dorf! Hier laufen ja die Schweine auf der Straße herum! Und was für häßliche, baufällige Häuser das Dorf hat!“ Er sah dabei immer nur des Schnipfelbauers alten Ziegenstall an, die andern Häuser würdigte er keines Blickes. Schnurstracks eilte er von dannen, und in sein Reisebuch schrieb er: „Oberheudorf ist klein, schmutzig und häßlich.“
Der zweite, der zu denen gehörte, die alles besser haben wollen, sah, als er durch das Dorf ging, immer in die Luft und rief: „Wie niedrig die Berge sind! Und wie weit der Wald entfernt ist! Auf einem der Berge müßte eine Burg stehen. Der Bach müßte breiter sein und brausend bergab stürzen. Ja, dann möchte mir das Dorf gefallen!“
Flugs lief auch er von dannen, und in sein Reisebuch schrieb er: „Es lohnt sich nicht, Oberheudorf anzusehen, es hat keine schöne Lage.“
Der dritte der jungen Leute aber blieb mitten im Dorf stehen und schaute sich um. Er sah die blühenden Fliederbüsche in des Schnipfelbauers Garten und übersah darüber den baufälligen Ziegenstall. Er sah die kleine weiße Kirche, deren spitzes Türmchen sich scharf von dem lichten Frühlingshimmel abhob. Er sah die roten Ziegeldächer der Bauernhäuser in der Sonne leuchten und sah, wie liebevoll der große Apfelbaum seine blütenschweren Zweige über Muhme Lenelis' Häuschen breitete. Wohl waren die Berge nicht allzu hoch, aber schöner, dichter Tannen- und Laubwald bedeckte sie, auf dessen Boden weiche Moosteppiche lagen und zarte, helle Blumen blühten. Wohl war das Bächlein schmal, aber es plätscherte und brauste vergnügt durch das grüne Wiesental und sah aus wie ein aus Silberfäden gesponnenes Gürtelband. Kein Winkelchen im Dorf ließ der junge Mann unbesehen. Er trat auch ein in die Häuser, und freundlich hießen ihn die Bauern willkommen. Er saß dann in den niedrigen, holzgetäfelten Stuben, freute sich über die alten, buntbemalten Truhen, über die großen Schränke mit den dunklen Schnitzereien und die grünen Kachelöfen in den Ecken. Er ließ sich die Milch und das Brot schmecken, das die Bäuerinnen ihm vorsetzten, und freute sich, wie sauber die Höfe und Ställe aussahen, und wie viele, viele Blumen in den winzigen Gärten blühten.
Er saß dann noch lange auf der grünen Bank vor Schuster Pechdrahts Haus unter dem dicken Pfingstrosenbusch und ließ sich allerlei von dem Schuster erzählen. Mit lachendem Behagen sah er den Kindern zu, die auf der Dorfstraße spielten.
Da kam ein dicker, blonder Bub heran und sagte: „Ich bin Schulzens Jakob.“
Und ein anderer, der lang und dünn war und struppige schwarze Haare hatte, rief: „Ich bin Anton Friedlich, und das da ist der blaue Friede!“ Er zeigte dabei auf einen Buben, der blaue Hosen, eine blaue Jacke, blaue Strümpfe und blaue Augen hatte.
„Ich bin Heine Peterle!“ rief ein anderer und spielte sehr vergnügt mit seinen Holzpantoffeln Fangball.
Ein kleines Mädchen trippelte an des Schusters Haus vorbei. Sie hatte braune Zöpfe und braune Schelmenaugen und flüsterte: „Ich heiße Annchen Amsee, und dort kommt Waldbauers Mariandel!“
Hinter ihr kam ein Mädelchen, rosig wie ein Borsdorfer Apfel, mit Haaren, die so gelb waren wie das reifende Korn. Es kamen noch mehr Buben und Mädel, die ihren Namen nannten, es kamen blonde und braune, kleine und große, kecke und schüchterne.
Der junge Fremde nickte allen zu und sprach mit ihnen, und sie zeigten ihm ein großes, rotes Haus, das inmitten grünender und blühender Bäume lag, und sagten: „Das ist die Schule!“ Als der Fremde aber mehr von der Schule wissen wollte, liefen sie fort und lachten.
Als die Sonne sank und ihr Widerschein rot glühend auf den Dächern der Häuser lag und die Wipfel der Bäume aussahen, als wären sie in flüssiges Gold getaucht, nahm der Fremde Abschied von Oberheudorf. Leise rauschte der Abendwind, die Vögel tauschten zwitschernd ihre Abendgrüße, und die Ferne versank in blauer Dämmerung. Heiter ging der Fremde von dannen, und in sein Reisebuch schrieb er: „Oberheudorf ist ein anmutiges, freundliches Dörfchen in schöner Lage. Es ist dort gut sein, ich werde es bald wieder aufsuchen!“
Das tat er auch. Er reiste im Sommer hin, als das Korn reif war und schwerbeladene Erntewagen in das Dorf einfuhren. Dann kam er im Herbst wieder, als alle Äpfel-, Birnen- und Pflaumenbäume voll Früchte hingen und die Kinder von früh bis abend Obst aßen; ja manche nahmen sich Pflaumen oder Äpfel mit ins Bett. Der Fremde kam auch im Winter wieder, aber da wäre er beinahe an Oberheudorf vorbeigelaufen. Das lag so in Schnee gebettet, daß gerade noch die roten Ziegeldächer herausguckten. Das ganze Tal glich einem riesigen Backtrog voll Mehl, und die Häuser lagen darin wie Rosinen im Teig; alles hatte weiße Mützen auf, der Kirchturm, die Dächer, selbst die Fahnenstange vor dem Schulhaus. Und überall standen Schneemänner. Jeder Bube, ja selbst jedes Mädel hatte seinen Schneemann, einer war immer schöner als der andere.
So sah der Fremde Oberheudorf zu jeder Jahreszeit, und immer gefiel es ihm, und jedesmal dachte er: „Wirklich, hier ist es doch gut sein!“
Vielleicht gefällt den Kindern, die dieses Buch lesen, Oberheudorf auch so gut, und wenn sie einmal nicht hinreisen können, so denken sie vielleicht manchmal an das freundliche Dörfchen, das irgendwo im deutschen Vaterland liegt, und in dem sich Buben und Mädel so herzensfroh ihres Lebens freuen.
Wie es Heine Peterle in der Stadt erging.
In Oberheudorf kennt wohl jeder den Heine Peterle, selbst die Pferde, Kühe, Schafe und Hunde kennen ihn, auch die Gänse, Hühner und Enten auf der Dorfstraße, sogar Leinwebers lahme Ziege. Kommt der Bube pfeifend die Straße entlang, die Hände in den Hosentaschen, die kleine, dicke Stupsnase keck in die Luft gereckt, mit seinen Holzpantoffeln klappernd wie die Wassermühle im Tal, dann sagt gewiß der oder jener: „Aha, da kommt Heine Peterle, der Städter!“ Und Schuster Pechdraht, der ein Spaßmacher ist, der zwinkert mit den Augen und ruft: „Heine Peterle, du, morgen fahre ich zur Stadt, magst mit?“
Hei, da wird Heine Peterle rot wie die Glaskirschen im Pfarrgarten, und patzig begehrt er auf: „Mag net!“ und dann läuft er davon, so schnell er nur kann, und seine Holzpantoffel klappern, daß man es im letzten Haus des Dorfes noch hört.
Mit Heine Peterle und der Stadt ist das nämlich eine eigene Sache, und fuchsteufelswild kann der Bube werden, wenn seine Kameraden ihn spottend den „Städter“ nennen.
Lange ist es noch nicht her, da gefiel es auf einmal dem Heine Peterle nicht mehr zu Hause. Im Frühjahr war ein Vetter der Mutter aus der Stadt zu Besuch dagewesen. Der hatte viel erzählt, wie schön es in der Stadt sei, und beim Abschied hatte er Heine Peterle eingeladen, ihn einmal zu besuchen. Seitdem dachte der Bube viel an die Stadt, manchmal sogar in der Schule, und gerade mußte ihn dann der Lehrer nach etwas fragen, was Heine Peterle natürlich nicht wußte, und dann tanzte der Stock des Herrn Lehrers mitunter recht unsanft auf seinem Rücken herum.
Einmal war es ihm nun in der Schule wieder recht schlecht gegangen. Darum sagte er beim Mittagessen, als ihm die Mutter gerade den fünften Speckkloß auf den Teller legte: „Ich möcht' zur Stadt!“
„Heine Peterle!“ schrie die Mutter und ließ vor Schreck den Kloß fallen.
„Heine Peterle!“ jammerte die alte Muhme Rese, und ein großer Bissen blieb ihr im Halse stecken, und Martin, der Knecht, mußte ihr erst tüchtig auf den Rücken klopfen, ehe sie wieder sprechen konnte.
„Zur Stadt?“ fragte der Vater und ließ die Gabel sinken.
„Ja,“ rief Heine Peterle keck, „ich mein', mir gefällt's dort besser als hier!“
„Heine Peterle!“ schrien nun auch Knecht und Magd.
„Halt den Mund, dummer Bub!“ sagte der Vater, da waren alle still.
Weil es aber dem Heine Peterle am andern Tage in der Schule wieder schlecht ging, begann er bei Tisch von neuem: „Ich möcht' zur Stadt zum Herrn Vetter!“
Diesmal sagte niemand etwas, nur der Vater brummte: „Meinetwegen geh in die Stadt!“
Und nach drei Tagen durfte Heine Peterle wirklich in die Stadt fahren. Friede Hopserling, der Müllerknecht, der Mehl zur Stadt bringen mußte, meinte, er wolle den Buben gern mitnehmen, früh um drei Uhr solle die Fahrt beginnen.
Und Heine Peterle stand zur rechten Zeit in seinem Sonntagsanzug vor der Haustür. Es war zwar ein recht warmer Sommermorgen, aber er hatte doch seine runde Pelzkappe aufgesetzt, die er besonders schön fand. Seine Mutter hatte ihm noch einen dicken, hellgrünen Schal um den Hals gebunden. Weil seine Stiefel gerade zerrissen waren, mußte er in Holzpantoffeln gehen, aber Muhme Rese hatte gemeint, das schade nichts, weil er so wunderschöne, hellrote Strümpfe trage. Die Mutter brachte einen großen Sack Kartoffeln und ein Körbchen voll Eier für den Herrn Vetter, ihrem Buben aber gab sie noch ein tüchtiges Stück Kirschkuchen mit auf den Weg. Schuster Pechdraht kam aus seinem Hause, und als er Heine Peterle so ausgerüstet stehen sah, fragte er: „Kannst du auch einen Diener machen? Das ist in der Stadt die Hauptsache!“
„Freilich kann ich das,“ rief Heine Peterle geringschätzig und verneigte sich so schnell und so tief, daß er dabei Muhme Rese den Kaffeetopf aus der Hand stieß und seine Pelzmütze bis auf die Dorfstraße kugelte.
„Bewahre, was ist das für ein Junge!“ schrie die Muhme, ihren zerbrochenen Topf betrachtend, und Schuster Pechdraht sagte lachend: „Na, dir wird es schon gut gehen in der Stadt! Auf Wiedersehen – heute abend!“
Da wurde Heine Peterle krebsrot vor Zorn über diesen Spott, und hochfahrend erwiderte er: „Gar nicht komme ich wieder! Ein Herr werde ich in der Stadt!“ Darauf nahm er Abschied von Vater, Mutter, Muhme, Knecht und Magd, kletterte zu Friede Hopserling auf den Wagen, und fort ging die Reise. Unterwegs erzählte er viel, was er alles in der Stadt werden wolle, Prinz wenn möglich oder mindestens General. Die Fahrt dauerte ziemlich lange. Heine Peterle wurde stiller und stiller, zuletzt schlief er ein und schlief, bis Friede Hopserling ihm einen derben Rippenstoß gab und rief: „Wir sind da!“
Weit riß der Bube seine Augen auf. Da war er ja wirklich in der Stadt! Rechts und links schaute er sich um, da waren Häuser, lauter Häuser, nichts wie Häuser. „Du, Friede Hopserling,“ fragte er, „warum sind denn hier so arg viel Häuser?“
„Na,“ gab der zur Antwort, „eben weil's eine Stadt ist. In welcher Straße wohnt denn der Herr Vetter?“
„In der – in der – der – in, halt ein Mannsname ist's,“ stotterte Heine Peterle verlegen, „und eine 5 hat's Haus, soviel Finger ich hab',“ und dabei hielt er eine seiner kleinen, braunen Hände dem Friede vor die Nase.
Der sann ein Weilchen nach, dann sagte er: „Hier ganz nahe gibt's eine Albertstraße, könnt's die wohl sein?“
„Freilich, freilich,“ rief Heine Peterle, „das ist ja ein Mannsname, der Schmied heißt ja so!“
Bald hielt der Wagen vor einem großen, weißen Hause mit einem sehr zierlichen Vorgarten, den ein reich verziertes eisernes Gitter von der Straße trennte. „Fein wohnt der Herr Vetter, das muß man sagen,“ meinte Friede Hopserling bewundernd und warf den Kartoffelsack vom Wagen. Heine Peterle nickte stolz, nahm seinen Eierkorb und sah sich nach dem Kirschkuchen um.
„Halt, hinten auf den Hosen klebt dir ja der Kuchen,“ rief Friede lachend. „Du Dösbartel, hast dich im Schlaf auf deinen Kuchen gesetzt!“
Beschämt legte Heine Peterle den zerquetschten Kuchen in eine Wagenecke und kletterte dann herab. „Laß dir's gut gehen, und wenn ich einmal wiederkomme, besuche ich dich. Adjüs, hüh hott!“ sagte Friede Hopserling und fuhr die Straße hinab.
Da stand nun Heine Peterle vor dem hohen Gitter und versuchte mit bange klopfendem Herzen die Türe zu öffnen, aber soviel er auch rüttelte, schüttelte und klopfte, die Tür ging nicht auf. Ein Herr, der gerade vorbeikam, lachte und rief: „Klingle doch, Junge!“
„Hm,“ sagte Heine Peterle, „'s ist ja keine Schelle da!“
„Drück nur auf den weißen Knopf dort,“ riet der Herr und ging weiter.
Und Heine Peterle folgte dem Rat und drückte auf den weißen Knopf, drückte und drückte, aber es wollte nicht klingeln, er drückte fester, aber er hörte nichts. Auf einmal aber kam ein Mann aus dem Hause gelaufen, der einen feinen, mit goldenen Tressen besetzten Rock trug. Als er Heine Peterle sah, schrie er zornig: „Infamer Bengel, warum klingelst du denn so stark?“
„Ich hör's doch nicht,“ sagte Heine Peterle und drückte ruhig weiter auf den Knopf. Aus dem Hause kam ein zweiter Mann gelaufen. „Aufhören, aufhören!“ schrie er und fuchtelte wild mit einem Stock in der Luft herum.
Verdutzt sah Heine Peterle ihn an. Er konnte nicht begreifen, daß er es nicht klingeln hörte. „Was willst du denn hier?“ herrschte der Mann mit dem Tressenrock ihn an.
„Ich bin Heine Peterle aus Oberheudorf und möchte den Herrn Vetter besuchen,“ stammelte der Bube.
„Dummer Bengel, hier wohnt der Herr Graf von Dippelskirchen und nicht dein Vetter. Mach, daß du weiter kommst!“
Die beiden Männer entfernten sich, und Heine Peterle stand ganz verdattert da. Auf einmal aber besann er sich und rief: „Herr Graf, Herr Graf, wo wohnt denn der Herr Vetter?“
Der eine der Männer kam einige Schritte zurück, sah den Buben an und lachte ein wenig. „Ja, weißt du denn die Straße nicht?“
„Halt ein Mannsname ist's,“ meinte Heine Peterle kleinlaut.
„Ein Mannsname? Nein, so ein dummer Junge! Was denn für ein Mannsname? Kann's vielleicht Karlstraße sein?“
„Freilich, freilich, so heißt ja Schnipfelbauers Knecht!“ rief Heine Peterle.
„Na, dann geh mal rechts um die Ecke herum, dann links, dann die Straße hinunter, dann wieder rechts, dann bist du da. Verstanden?“
„Freilich,“ sagte Heine Peterle, nahm seufzend seinen Sack auf den Rücken, den Eierkorb in die Hand und trollte davon. Erst ging er links statt rechts, weil er ein Linkshänder war, dann ging er rechts, dann wieder links. Klipp, klapp, klipp, klapp! trappten seine Holzpantoffel auf dem Steinpflaster. Die Leute, die auf der Straße gingen, blieben stehen und schauten lächelnd dem Buben nach, dem die hellen Schweißtropfen über das runde, rote Gesicht liefen. Endlich meinte dieser, er sei nun oft genug links und rechts gegangen, und als er ein Haus mit einer Fünf fand, trat er ein. Im Hausflur kam ihm eine Frau entgegen, die fragte er: „Wohnt hier der Herr Vetter? Ich bin Heine Peterle aus Oberheudorf.“
„Ich kenne deinen Vetter nicht,“ entgegnete die Frau. „Geh mal eine Treppe hinauf, dort wohnt der Wirt.“
„Ei,“ dachte Heine Peterle, „ich wußte doch gar nicht, daß der Herr Vetter ein Wirtshaus hat. Aber ein feines Wirtshaus ist das!“ Keuchend kletterte er die Treppe hinauf. Oben war wieder so ein weißer Knopf, den der Bube mißtrauisch betrachtete; mit dem Ding ließ er sich nicht mehr ein, und kräftig schlug er mit der Faust an die Türe.
Scheltend öffnete eine Magd. „Warum machst du denn solchen Lärm und klingelst nicht?“
Heine Peterle wurde verlegen und stotterte sein Sprüchlein hervor. Die Magd sah ihn etwas verwundert an; weil sie aber noch nicht lange im Hause war, dachte sie, die Sache könnte wohl richtig sein, und führte den Buben in ein großes, helles Zimmer und hieß ihn warten. Der sah sich mit erstaunten Augen um. Hui, war es hier aber fein! So etwas Schönes hatte er in seinem Leben noch nicht gesehen. Bilder hingen an den Wänden, und die Stühle waren mit heller Seide bezogen und – beinahe wäre Heine Peterle hingefallen vor Schreck, da stand ja ein Bube, der gerade so aussah wie er selbst. Heine Peterle grinste verlegen und kratzte sich hinter den Ohren. Der Bube tat dies auch. Da merkte Heine Peterle erst, daß er in einen Spiegel sah. Es dauerte und dauerte, der Herr Vetter kam nicht. Heine Peterle war müde. Verlockend winkten die hellen Seidenstühle, und so leise er konnte mit seinen Holzpantoffeln, schlich er näher und setzte sich. Potztausend, saß sich das gut auf dem Polster! Gerade hatte er sich so recht bequem hingesetzt, da öffnete sich die Türe, und eine Dame trat ein und betrachtete Heine Peterle erstaunt von oben bis unten.
Der starrte die Dame, die ein langes, hellrotes Kleid trug, mit offenem Munde an. Ja, war das vielleicht gar eine Prinzessin? So fein sah sie aus.
„Was willst du denn von mir, mein Kind?“ fragte diese freundlich.
Heine Peterle stand auf, hielt seinen Eierkorb mit beiden Händen an seinen Leib gepreßt und stotterte: „Ich bin Heine Peterle aus“ – Da fiel ihm mitten in seiner Rede Schuster Pechdrahts Ermahnung ein, in der Stadt den Diener nicht zu vergessen, und flugs verneigte er sich, verneigte sich so tief, daß er ausrutschte. Platsch lag er, so kurz er war, auf dem Boden, der Eierkorb kam gerade unter sein Bäuchlein zu liegen, und eine gelbe Tunke rann über den hellen Teppich. „Himmel, was soll das?“ schrie die Dame händeringend, und auf ihr Geschrei eilten der Hausherr, die Tochter und die Magd herbei und schrien weh und ach, als sie den Heine Peterle in seiner Eiertunke auf dem Boden liegen sahen.
„Was ist denn das für ein Bengel?“ rief der Hausherr.
„Der schöne Teppich!“ klagten Frau und Magd, und das Töchterlein quiekte: „Mama, Papa, seht doch her, er hat auf den Sessel einen großen Fleck gemacht,“ und zeigte auf das helle Seidenpolster, das Spuren von Heine Peterles Kirschkuchen trug, auf dem er während der Fahrt gesessen hatte.
Dem Buben war es himmelangst. „Könnt' ich nur raus!“ dachte er. „Das ist ja gar nicht der Herr Vetter! Oh je, oh je, wie wird mir's gehen!“
Na, es ging noch glimpflich ab. Ein paar Maulschellen gab's, ein paar Ermahnungen, sich nie wieder blicken zu lassen, und dann saß Heine Peterle auf einmal draußen auf der Treppe neben seinem Kartoffelsack und heulte vor Hunger, vor Schmerz und Müdigkeit.
Einige Leute kamen herbei und fragten teilnahmsvoll nach seinem Kummer, und Heine Peterle erzählte, und als er sagte, einen „Mannsnamen“ sollte die Straße haben, da lachten sie alle, und eine Dame meinte freundlich: „Aber mein Kind, die Straße hier heißt Rosengartenstraße. Das ist doch kein Männername. Kann es vielleicht Friedrichstraße sein? Die ist hier in der Nähe.“
„Freilich, freilich,“ schluchzte Heine Peterle, „so heißt ja der Schneider bei uns.“
Freundlich zeigte ihm die Dame den Weg, und müde und hungrig schleppte Heine Peterle seinen Sack weiter und war froh, als er endlich vor dem Haus mit der Nummer 5 anlangte. War das Haus einmal groß! Schier unheimlich erschien es dem Buben, und zaghaft trat er ein. Innen war alles feierlich still. Heine Peterle kletterte eine Treppe empor und betrat einen langen Gang, auf den viele Türen mündeten. „Arg viele Stuben scheint der Herr Vetter zu haben,“ dachte Heine Peterle und klopfte kräftig an die erste Türe. „Herein!“ klang es von drinnen, und Heine Peterle trat ein. Ja, aber was war denn das?
„Uf!“ schrie Heine Peterle vor Schreck. Das war ja eine Schule! Hilf Himmel, er war in eine Schule geraten! Lauter kleine Mädchen saßen da und starrten ihn an, und am Pult stand der Herr Lehrer und – hielt einen großen Stock in der Hand. „Nur raus, nur fort!“ dachte Heine Peterle, und wutsch war er draußen. Aber da, potz Apfelkern und Pflaumenmus! ihm gegenüber öffnete sich auch eine Tür, und heraus kamen viele, viele kleine Mädchen, rechts und links; hinter ihm, überall taten sich Türen auf. Er sah viele Lehrer kommen und eine Unzahl kleine und größere Mädchen, und eine namenlose Angst ergriff ihn. Keuchend, den Kartoffelsack nach sich ziehend, wollte er die Treppe hinunterlaufen, aber der schwere Sack kam ihm zwischen die Füße, und holter die polter purzelten und kollerten Holzpantoffel, Pelzmütze, Heine Peterle und die Kartoffeln die Treppe hinunter. Das rumpelte und pumpelte nur so, und oben schrien, quietschten, lachten und kicherten all die großen und kleinen Mädchen, wie junge Böcklein sprangen einige von ihnen die Treppe herab dem Buben nach. Es war ein Höllenlärm, und als Heine Peterle verwirrt aufsah, da sah er mehrere Lehrer neben sich stehen, der mit dem Stock war auch dabei.
Heine Peterle besann sich nicht lange. Er ließ Holzpantoffel und Kartoffeln im Stich, nahm nur seine Mütze und raste in wilder Hast aus dem Hause hinaus, die Straße entlang. Hinter sich hörte er rufen, aber er sah nicht rechts, nicht links, er lief und lief immer weiter und weiter, stieß alle Menschen an, denen er begegnete, und es regnete Verwünschungen auf ihn herab. Man suchte ihn zu fangen. Bald lief eine Anzahl Menschen hinter ihm her, und einige Buben schrien: „Es brennt, es brennt!“ Aber je mehr sie schrien, desto mehr rannte Heine Peterle, und zuletzt lief er einem Schutzmann in die Arme. Der hielt ihn fest, und nun sollte Heine Peterle Rede und Antwort stehen.
„Was hat er getan?“ „Was hat er getan?“ „Warum rennt er so?“ „Warum hat er keine Schuhe an?“ so riefen und fragten die Menschen um ihn herum, aber Heine Peterle sagte immer nur: „Heim! Heim!“ weiter nichts.
„Heine Peterle, was machst du denn da?“ rief in dieser Not plötzlich eine Stimme, und Friede Hopserling hielt mit seinem Wagen an, er hatte von seinem erhöhten Sitz aus den Buben an seiner Pelzmütze erkannt.
„Ich will heim,“ schrie Heine Peterle, „heim!“ aber der Schutzmann ließ ihn nicht so schnell los, erst sollte er sagen, was er getan, und schluchzend erzählte er seine Erlebnisse. Da fingen alle an zu lachen, Friede Hopserling schüttelte sich ordentlich vor Lachen, selbst der Schutzmann lachte mit und hob den Buben selbst auf den Wagen.
Muckstill saß Heine Peterle, solange der Wagen noch durch die Stadt fuhr. Erst als das freie Feld kam, wagte er sich umzusehen, und da erblickte er in der Wagenecke auch seinen zerdrückten Kirschkuchen. Heisa, der schmeckte ihm wie noch nie! Daß er breitgesessen war, schadete gar nichts.
Der Wagen rollte auf der Landstraße dahin, Friede Hopserling war schweigsam wie immer, und wieder schlief Heine Peterle ein, und wieder weckte ihn sein Reisegefährte mit einem Rippenstoß: „Wir sind da!“ und Heine Peterle riß die Augen auf. Der Wagen fuhr die Dorfstraße entlang, da schrien einige Buben: „Da kommt Heine Peterle, Heine Peterle ist wieder da!“ Der Ruf pflanzte sich fort, die Mutter und Muhme Rese kamen aus dem Hause gelaufen, die Nachbarn kamen herbei, alle wollten sie wissen, warum Heine Peterle schon zurück sei.
Der Vater stand in der Haustür und lachte, und Friede Hopserling erzählte alles. „Dösbartel,“ rief der Vater, „Christianstraße heißt's, wie der Schäfer, und Nummer 10 ist es, dummer Junge, du hast doch zwei Hände!“
Da lachten ihn alle aus, aber Heine Peterle machte sich nichts daraus, er war nur froh, daß er wieder daheim war. An diesem Abend aß er sieben Brotschnitten, eine halbe Schlackwurst und einen Handkäse, und sicher hätte er noch mehr gegessen, wenn er nicht beim siebenten Butterbrot eingeschlafen wäre, so fest, daß er gar nicht merkte, wie ihn die Mutter ins Bett trug.
Der Schulrat in Oberheudorf.
Wie Buben und Mädel wohl manchmal denken, so dachten auch die Oberheudorfer Kinder mitunter: „Wenn heute doch keine Schule wäre!“ – Sie dachten das bei den verschiedensten Gelegenheiten, zum Beispiel wenn im Winter schöne Eisbahn war oder im Frühling die ersten Veilchen blühten, wenn im Sommer die Kirschen reiften oder in Niederheudorf Vogelschießen war. Hundert Gründe gab es für den Wunsch, und die faulsten Buben und Mädel fanden wohl noch den hundertundeinsten Grund.
Einige ganz besondere Faulpelze, wie Bäckermeisters Mariele, Anton Friedlich und Schulzens Jakob, die wünschten sogar, es möchte gar keine Schule geben. „Wenn doch der Kaiser mal die Schule verbieten möchte!“ seufzte Anton, wenn er seine Rechenaufgabe nicht gemacht hatte.
„Oder der Sturm das Dach abdeckte!“ rief Mariele.
Letzthin hatte nämlich der Wind drei Ziegel vom Backofendach heruntergeworfen, seitdem ärgerte sich die Kleine, daß bei der Gelegenheit nicht das Schuldach ein bißchen kaput gegangen war.
Aber nichts dergleichen geschah. Breit und stattlich stand das Schulhaus da, von roten Ziegeln erbaut und von einem hübschen Garten umgeben. Schien die Sonne darauf, dann sah das Schulhaus so lustig aus, als lachte es alle faulen Buben und Mädel aus. Der Herr Lehrer war auch immer freudig bei seiner Arbeit, die nicht gerade leicht war, und für schulfreie Tage außerhalb der Ferien war er nicht sehr eingenommen.
Im Juni war es. Die Sonne brannte so heiß, daß es einem schon leicht zu warm werden konnte, und die Oberheudorfer Kinder meinten, es könnte schon gut mal hitzefrei sein, – zumal im Walde die Erdbeeren reif waren. Aber an so etwas dachte der Herr Lehrer jetzt weniger als je, denn in diesen Junitagen wurde der neue Herr Schulrat zur Inspektion erwartet. Da gab es dreimal so viel Hausarbeit als sonst, und wehe dem, der schlecht gelernt hatte. In dieser Zeit verstand der Herr Lehrer keinen Spaß, denn er wollte Ehre einlegen mit seiner Klasse. Und doch guckte die Sonne so vergnügt in die Schulstube hinein, und der Gedanke an die Erdbeeren im Kuhberger Walde saß wie ein kleiner Kobold in den Kinderköpfen.
„Ach, der Herr Schulrat!“ seufzte Heine Peterle, als er eines Morgens seinen Ranzen nahm, um in die Schule zu gehen.
„Wie heißt er denn?“ fragte Muhme Rese.
„Müller,“ brummte Heine Peterle und stapfte davon; er konnte es nämlich nach seinen Erlebnissen in der Stadt nicht leiden, wenn man ihn nach einem Namen fragte.
„Ach, der Herr Schulrat!“ seufzte Anton Friedlich, und Bäckermeisters Mariele heulte ein wenig, weil ihr alles mögliche tausendmal mehr Freude machte als der Schulrat.
„Bim bam, bim bam,“ dröhnte die Schulglocke, und flink liefen alle Faulpelze in das rote Schulhaus, es half ja doch nichts.
In der gleichen Stunde betrat ein hübscher, junger Mann das Dorfwirtshaus und verlangte ein Glas Milch und eine Schnitte Brot. Der Wirt brachte ihm selbst das Verlangte, und der Fremde, der vor dem Hause Platz genommen hatte, begann ein Gespräch. Ob das die Schule wäre, fragte er und deutete auf das Schulgebäude, das rot und lustig hinter grünen Bäumen hervorsah.
Der Wirt, genannt Kaspar auf dem Berg, weil sein Gasthaus einen halben Meter höher als das Nachbarhaus lag, war ein schlauer Mann, und darum kam ihm bei dieser Frage gleich der Gedanke, der Fremde könnte vielleicht der erwartete Schulrat sein.
Schmunzelnd fragte er daher nach dem Namen seines Gastes. „Müller,“ sagte der junge Herr freundlich.
„Ei, das dachte ich mir doch gleich,“ rief der Wirt und machte eine ungeheuer tiefe Verbeugung. „Willkommen, hochgeehrter Herr Schulrat!“
„Was?“ fragte der Fremde verdutzt, „wer bin ich?“
„Der Herr Schulrat Müller, zu dienen,“ sagte der Wirt und verbeugte sich zum zweiten Male.
„Na nu?“ rief der junge Mann erstaunt.
„Zu dienen, Herr Schulrat,“ sagte der Wirt, sich zum dritten Male verbeugend, und dann lief er flugs ins Haus. „Mine, Mine,“ schrie er seiner Magd zu, „flink, lauf in die Schule und sage dem Herrn Lehrer, der Schulrat wäre da; spute dich, Mädel!“
Hui, wie lief da die Mine! Sie war erst seit drei Jahren aus der Schule heraus und wußte noch ganz genau, was das heißt, wenn ein Schulrat kommt. Die jüngeren Kinder schrieben gerade: „Der Hase läuft in das Feld“, und die älteren rechneten, als Mine mit dem Rufe: „Der Herr Schulrat ist da!“ in das Klassenzimmer stürmte.
Potzhundert, gab das eine Aufregung!
Dem Herrn Lehrer fiel vor Schreck der Rohrstock aus der Hand, und drei Mädel fingen an zu heulen, während dem dicken Friede, dem ewig Hungrigen, das Frühstücksbrot, das er just in aller Heimlichkeit verzehren wollte, in die unrechte Kehle kam. Er wurde krebsrot, hustete und würgte, einige Kinder kicherten, die andern stöhnten, und der Herr Lehrer lief, gefolgt von Mine, nach dem Wirtshaus, um dort den Schulrat zu begrüßen.
Der Fremde saß und trank behaglich seine Milch, als der Lehrer und der Schulze, den der Wirt selbst geholt hatte, kamen und ihn mit so schwungvollen Worten begrüßten, daß er zuerst ganz erstaunt dreinsah. Aber plötzlich fing er an zu lachen, er lachte so laut und lustig, daß der Wirt den Lehrer und der Lehrer den Schulzen ansah; so einen lustigen Schulrat hatten sie noch nie gesehen, – freilich auch noch keinen so jungen. Dem Herrn Lehrer kam die Sache etwas sonderbar vor, aber der Wirt hatte ja gesagt, der fremde Herr wäre der Schulrat, also mußte es wohl richtig sein.
„Also, mein lieber Herr Lehrer, da wollen wir einmal in die Schule gehen,“ rief der lachende Schulrat und stand auf und ging mit dem Lehrer und dem Schulzen auf das rote Schulhaus zu.
Das muß man sagen, mucksmäuschenstill saßen die Kinder, als der Schulrat eintrat. Der ging auf das Katheder, sah die Buben und Mädel eine Weile vergnügt an und sagte dann: „Liebe Kinder, ich bin überzeugt, daß ihr fleißig seid und eure Pflicht tut!“ Hier wurden einige sehr rot und verlegen, aber der Herr Schulrat schien das gar nicht zu bemerken, sondern fuhr fort: „Ich will euch darum nicht mit einer Prüfung quälen, nein, ihr sollt heute einmal frei haben, weil gar so schönes Wetter ist. Gefällt euch das?“
„Ja!“ brüllten da alle und lachten, daß sich bei manchen der Mund von einem Ohr bis zum andern zog. „Na, dann nehmt eure Bücher und lauft! Ich habe im Walde gesehen, daß die Erdbeeren reif sind, also geht in die Erdbeeren!“
Das ließen sich die Kinder nicht noch einmal sagen, holter, polter wurden die Bücher gepackt, und dann rannten die Kinder alle hinaus wie Hasen, wenn sie den Jäger erblicken.
„Leben Sie recht wohl, Herr Lehrer,“ sagte der Schulrat, „ich komme bald wieder. Ich denke, Ihnen wird ein ruhiger Tag auch mal gut sein,“ und wutsch war der Herr Schulrat draußen.
„Na,“ meinte der Lehrer, „so ein Schulrat ist mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen!“
„Mir auch nicht,“ sagte der Schulze.
„Mir auch nicht,“ sagte einige Minuten später der Wirt, als der Schulrat lachend von ihm Abschied nahm und fröhlich singend das Dorf verließ.
Die Buben und Mädel aber sagten gar nichts. Die rannten nur, was sie konnten, um ihre Schulmappen nach Hause zu bringen und sich ein Körbchen oder ein Töpfchen zu holen, und fünf Minuten später zogen die Oberheudorfer Kinder in den Kuhberger Wald in die Erdbeeren. Kein Schulkind blieb daheim. „Der Herr Schulrat hat's befohlen,“ sagten sie, wenn Vater oder Mutter meinten, sie sollten doch lieber bei der Heuernte helfen.
War das ein vergnügter Tag!
Als wären sämtliche Erdbeeren noch in aller Geschwindigkeit gereift, so viele gab es. Es sah an manchen Stellen aus, als hätte Schnipfelbauers Kathrine ihren feuerroten Sonntagsrock auf den Waldboden gelegt, so dicht standen die Beeren beisammen. Aber freilich, es hätte doch noch zehnmal mehr Erdbeeren geben können, die Oberheudorfer Kinder hätten sie doch gepflückt und gegessen. In einen richtigen Oberheudorfer Kindermagen geht nämlich unglaublich viel hinein, gar nicht zu sagen wie viel.
Wie alle schönen Tage, so ging auch dieser schulfreie Tag zu Ende. Aber er endigte nicht, wie das manchmal vorkommt, mit Zank und Tränen, Verdruß, Leibschmerzen und zerrissenen Kleidern, sondern er blieb schön, bis die Kinder in ihre Federbetten krochen. Anton Friedlich träumte in dieser Nacht, der Schulrat säße an seinem Bette und sagte, er, Anton, brauche von jetzt ab nur in die Schule zu gehen, wenn er Lust dazu hätte. Und Heine Peterle sagte, als er am andern Morgen die Augen aufschlug: „Wenn doch heute wieder der Schulrat käme!“
Aber er kam nicht, und es war Schule wie alle Tage.
Und drei Tage später hatten die Kinder wieder einen sehr wichtigen Grund, um sich „schulfrei“ zu wünschen.
Es war ein ereignisvoller Tag für Oberheudorf. Eine neue Feuerspritze wurde erwartet und sollte gleich probiert werden. Bisher hatten die Oberheudorfer eine Spritze besessen, die allemal erst spritzte, wenn das Feuer bereits vorbei war, und das war manchmal recht unangenehm. Einmal hatte da zum Beispiel das Dach vom Schulzenhaus gebrannt; die Spritze wurde angefahren, ehe sie aber in Ordnung war, hatte der Schulze eigenhändig drei Eimer Wasser auf das Dach gegossen, und aus war das Feuer. Und als dann alle so recht beim Begucken und Bereden waren, ging auf einmal die Spritze los, und quatsch! war die ganze Schulzenfamilie und einige Nachbarn dazu von unten bis oben naß. Man hatte darum in der Stadt eine neue Spritze bestellt, und der Schulze hatte angeordnet, daß die Spritze gerade kommen sollte, wenn Schule war. „Das neugierige Kindervolk ist nur im Wege,“ hatte er gemeint. Man muß sagen, nett war das nicht vom Schulzen, und die Kinder jammerten auch gehörig über diese Härte. Die Schule hatte noch nicht lange angefangen, als das Rollen eines Wagens erklang. „Ob das die Spritze ist?“ flüsterte der blaue Friede seinem Nachbarn zu, und Annchen Amsee puffte Mariele: „Du, die Spritze!“
Aber es war nicht die Spritze, sondern ein Wägelchen, in dem ein älterer Herr mit einer goldenen Brille auf der Nase saß. Das Wägelchen hielt vor dem Schulhause, und Heine Peterle schrie: „Herr Lehrer, 's kommt wer!“
„Dummer Junge, wer denn?“ rief der Lehrer ärgerlich.
„Ein dicker Herr, da ist er schon!“ rief Heine Peterle und zeigte mit einem rabenschwarzen Tintenfinger auf die Tür, die der Fremde gerade öffnete.
Weil just der Herr Lehrer die Türe und nicht sie ansah, wollte Krämers Trude, die so flink und keck wie ein Eichkätzchen war, den günstigen Augenblick benutzen und dem dicken Friede einen Papierball an den Kopf werfen, weil ihr der auf dem Schulwege die Schürze abgebunden hatte. Doch der Ball verfehlte sein Ziel und flog dem fremden Herrn an die Nase. „Oha,“ sagte der verblüfft, „das ist ja ein netter Empfang!“
„Pschrr,“ platzte Annchen Amsee heraus und „hahaha, hihihi, pschrr,“ kicherte und prustete das auf einmal an allen Ecken und Enden.
„Still!“ rief der Lehrer ärgerlich; aber wenn die Oberheudorfer Buben und Mädel einmal ins Lachen kamen, hörten sie so bald nicht wieder auf. Sicher, sie hatten den besten Willen, still zu sein, aber sie konnten es einfach nicht.
Der fremde Herr schüttelte erstaunt den Kopf, und der Lehrer nahm seinen Rohrstock, schlug auf das Pult und sagte streng: „Gleich seid ihr still!“
Da trat wirklich etwas Ruhe ein, und der Lehrer verneigte sich nun höflich vor dem Fremden und fragte: „Was wünschen Sie, mein Herr?“
„Ich bin der Schulrat Müller,“ gab der freundlich zur Antwort.
„Pschrrhu, hahaha, hihihi!“ ging das Gelächter wieder los, und Schnipfelbauers Fritz, der naseweiseste Bube im Dorf, rief: „Der war doch erst da!“ Dem Lehrer trat der Schweiß auf die Stirn, ihm erschien der heutige Schulrat viel glaubwürdiger als der andere, und er sagte ruhig und bestimmt: „Wer jetzt noch ein Wort spricht, der muß eine Woche lang jeden Tag eine Stunde dableiben!“
Da wurden die Kinder alle still, denn sie wußten, wenn der Herr Lehrer den Ton anschlug, hatte der Spaß ein Ende. Aber ein Spaß war es auch nicht, daß der fremde Herr wirklich der Schulrat war; der lustige junge Mann vor drei Tagen hatte des Wirtes Irrtum benutzt und aus Übermut die Rolle des Schulrates gespielt.
Ein klein wenig lachte der echte Schulrat, als er die Geschichte erfuhr, ans Freigeben aber dachte er nicht, sondern er schickte sich an, eine strenge Prüfung abzuhalten. Mit ernster Miene, die Hände auf den Rücken gelegt, spazierte er vor dem Katheder auf und ab und musterte scharf die Buben und Mädel. Denen wurde angst und bange bei diesen forschenden Blicken, das Lachen verging ihnen ganz und gar, und sie bekamen rote Köpfe vor Verlegenheit.
„Sage mir mal,“ fing der Herr Schulrat an und sah auf Schulzens Jakob, „wer war Karl der Große?“
Nun kannte Jakob jedes Pferd, jede Kuh und jedes Schaf im Dorfe, aber von den deutschen Kaisern hatte er keine Ahnung. Er sperrte denn auch seinen Mund auf, daß man ganz gut ein Dreierbrot hätte hineinstecken können; das war das Zeichen, daß Schulzens Jakob nachdachte. Auf einmal aber verklärte sich sein Gesicht, und mit strahlenden Augen rief er: „Windmüllers Ältester ist das!“
„Wer?“ fragte der Herr Schulrat verdutzt, der natürlich nicht wissen konnte, daß Windmüllers Ältester seiner ungewöhnlichen Länge wegen „der große Karl“ genannt wurde. Ärgerlich runzelte er daher die Stirn und rief: „Höre mal, mein Sohn, du bist“ – – – schiiih ging das da plötzlich draußen, und schwapp kam ein dicker Wasserstrahl durch das offene Fenster und überflutete den Schulrat und die Kinder. Schulzens Jakob bekam so viel Wasser in den Mund, daß er ihn vor Schreck schloß.
„Na, was soll denn das bedeuten?“ schrie der Schulrat prustend. „Das ist doch“ – – schiiih – kam ein zweiter Wasserstrahl in das Schulzimmer und traf gerade auf die Mädel, die quiekend unter die Tische krochen.
„Die neue Spritze,“ riefen der Lehrer und die Kinder ahnungsvoll, „sie probieren“ – – schiiih kam ein dritter Strahl und überschwemmte das Schulzimmer so gründlich, daß sich der Herr Schulrat auf das Katheder flüchten mußte, während die Kinder auf Tische und Bänke kletterten. Der Herr Lehrer aber rannte hinaus, und flugs folgten ihm einige Buben. Draußen auf dem freien Platz vor dem Schulhaus stand die neue Feuerspritze, und mehrere Bauern arbeiteten aufgeregt an ihr herum. Aufgedreht war die Spritze, aber zudrehen konnte sie niemand, und da sie außerdem mit einem Rad in ein tiefes Loch geraten war, konnte sie nicht einmal zur Seite gefahren werden. – Schiiih, schiiih, schoß das Wasser ins Schulzimmer hinein, und triefend, weinend und lachend, wie Fröschlein im Sumpfe hopsend, flohen die Schulkinder.
„Jetzt hab' ich's,“ rief der dicke Bäckermeister und drehte mit einem Ruck die Spritze zu.
Und der Schulze, der vor Aufregung rot geworden war wie ein Ziegeldach, sagte: „Ach, ach, Herr Lehrer, mir scheint, 's ist Wasser ins Schulzimmer gekommen!“
„Na, mir scheint auch,“ riefen der Schulrat und der Lehrer wie aus einem Munde; sie trieften alle beide, als hätten sie in einer Badewanne gelegen.
„Huhuhu, ich bin naß,“ heulte Mariele, und „Huhuhu, ich auch, ich auch,“ schrien einige andere Kinder.
„Geht doch nach Hause, Kinder,“ rief der Herr Schulrat, „mit der Schule ist es jetzt doch nichts!“
Das war ein Wort! Einige Kinder quiekten vor Freude, und Buben und Mädel vergaßen auf einmal ihre nassen Kleider so vollständig, daß sie gar nicht daran dachten, nach Hause zu gehen. Wie eine Mauer standen sie um die neue Spritze herum, während der Schulrat und der Lehrer in das Haus gingen. Der Schulze ärgerte sich zwar sehr über das neugierige Kindervolk, aber was half es? Die Kinder waren da und blieben da, soviel er auch darüber brummte.
Die Schulstube sah aus wie ein See, einzelne Hefte, die bei der hastigen Flucht zu Boden gefallen waren, schwammen wie blaue Fische im Wasser. Ein Glück war es, wie Anton Friedlich sagte, daß das Wasser auch in die Nebenstube gelaufen war, es konnte auch darin am Nachmittag keine Stunde abgehalten werden. Also hatten die Oberheudorfer Kinder wieder einen schulfreien Tag, was sie ungemein vergnüglich fanden. Der Herr Schulrat war liebenswürdig genug, über die Spritzengeschichte mehr zu lachen als sich zu ärgern. Er blieb im Pfarrhause als Gast, und am nächsten Tag hielt er die Schulprüfung ab, die ohne jeden Zwischenfall verlief. Und um die Wahrheit zu sagen, die Kinder wußten mehr, als der Schulrat erwartet hatte. Schulzens Jakob behauptete zwar kühnlich, es gebe sieben Erdteile, und Bäckermeisters Mariele sagte, China sei eine Provinz von Deutschland, auch verwechselte sie die Mark Brandenburg mit Afrika, und Heine Peterle versicherte, 10 × 7 sei 90 und die Hälfte von 100 sei 200: na, aber das schadete weiter nichts, – so etwas kann schon vorkommen.
Zwei Feinde.
In Oberheudorf gab es drei Buben, die alle drei den Namen Friede trugen. Sie waren ziemlich in einem Alter, und ihre Kameraden hatten ihnen, damit sie beim Spielen nicht verwechselt wurden, Spitznamen gegeben: den einen nannten sie den dicken Friede, den andern den blauen Friede und den dritten Traumfriede.
Der dicke Friede trug seinen Namen eigentlich mit Unrecht, denn so dick war er gar nicht. „Er kann's noch werden, weil er so viel ißt,“ meinten aber die Oberheudorfer Kinder, und damit hatten sie freilich recht. Hungrig war der dicke Friede eigentlich immer, und er konnte zu jeder Tageszeit und Nachtzeit essen. Schlug er früh seine Augen auf, so schrie er schon: „Hab' ich mal 'nen Hunger!“ und eine Viertelstunde nach dem Mittagbrot, bei dem er so lange aß, als noch etwas in der Schüssel war, pflegte er zu sagen: „Mir rumpelt's so im Magen, 's scheint, ich könnt' 'ne Schnitte essen!“
Es war ein Glück, daß er als eines wohlhabenden Bauern Sohn zur Welt gekommen war. In ein Häusel, in dem Schmalhans Küchenmeister war, hätte er schlecht gepaßt. Übrigens war der dicke Friede ein kreuzbraver Junge; er lernte fleißig und vertrug sich mit allen seinen Kameraden, nur mit seinem Namensvetter, dem blauen Friede, nicht.
Die Mutter vom blauen Friede hatte einmal ein graues Tuch blau färben wollen, und da sie eine Färberstochter war, wollte sie auch das Färben selbst besorgen. Die Botenmarie sollte ihr darum Farbe aus der Stadt mitbringen. Die Frau schrieb also auf einen Zettel: Ein viertel Pfund Farbe, und darunter: Zehn Pfund Zucker; sie wollte nämlich Kuchen backen. Aber die Botenmarie verwechselte beides miteinander und brachte zehn Pfund Farbe und ein viertel Pfund Zucker. Mit der Farbe hätte ganz Oberheudorf blau gefärbt werden können. Die Bäuerin war auch sehr böse, aber was half es, der Kaufmann in der Stadt nahm die Farbe nicht zurück, und seitdem färbte Friedes Mutter alles, was ihr unter die Finger kam, schön kornblumenblau. Der Mann, die Frau, die Kinder, ja auch die Knechte und Mägde gingen immer in blauen Sachen. Die Farbe mußte doch verbraucht werden! Friede wurde darum der blaue Friede genannt, und sein Vaterhaus hieß der blaue Hof.
Der dritte Friede war ein armer Waisenjunge. Er war beim Kohlbauern, der im ganzen Dorfe seiner Härte und seines Geizes wegen verrufen war, in Pflege. Gut ging es ihm im Hause seines Pflegevaters wirklich nicht; es gab viel Arbeit, Schelte und Schläge, aber wenig zu essen. Niemand kümmerte sich sonst um den Buben, der still und verschlossen seines Weges ging. Auch in der Schule blieb Friede immer einsam. Er hätte wohl manchmal gern mit den andern Kindern gespielt, aber er traute sich nicht heran, und wenn er wirklich einmal gerufen wurde, dann wich er aus, denn er schämte sich, weil er immer in Lumpen ging. Das Lernen wurde ihm leicht, und er lernte auch gern, aber er hatte nie Zeit, ordentlich seine Arbeiten zu machen, und galt darum in der Schule als faul. Oft war er in der Schule auch so müde von all der schweren Arbeit, die er bei seinem Pflegevater verrichten mußte, daß er schon etliche Male eingeschlafen war. Darum wurde er auch spottend Traumfriede genannt. Der Name paßte gut für ihn, denn der Bube träumte wirklich viel, aber nicht, wenn er im Bett lag und schlief, sondern am hellen Tage mit offenen Augen. Lichte, heitere Träume, die wie Märchen waren, kamen dann zu ihm und machten sein Leben froh, und leicht vergaß er, wenn er so träumte, sein hartes Los.
Mit Traumfriede gaben sich die beiden andern Friede so wenig ab wie die andern Kinder; sie sprachen nicht mit ihm und zankten nicht mit ihm, sondern ließen ihn seines Weges gehen. Schlimm aber war es zwischen dem dicken Friede und dem blauen Friede: die konnten einander nicht leiden. Warum, wußte niemand, und sie selbst wußten es am allerwenigsten. Doch sie waren wie Hund und Katze zusammen. Ging einer hier, so ging der andere da; lachte der eine, so brummte der andere, und wenn einer dem andern einen Schabernack spielen konnte, tat er es mehr als gern. Vielleicht konnten sie sich darum nicht leiden, weil sie immer zusammen genannt wurden. Zu ihrem größten Ärger saßen sie auch nebeneinander in der Schule; denn weil der dicke Friede fleißig war, lernte auch der blaue Friede eifrig, und so kam es, daß sie gleich gut standen.
Die andern Kinder neckten die beiden Friede: „Du, Dicker,“ schrien sie, wenn der gerade sein Frühstück aß, „da kommt der Blaue,“ und dem armen Dicken verging dann beinahe der Appetit.
Einmal war der dicke Friede auf einem Kirschbaum eingeschlafen, da holte Anton Friedlich den blauen Friede und sagte, Heine Peterle sitze oben, er möchte ihn herunterholen. Flugs kletterte der Blaue hinauf, und als er oben den Dicken sah, wurde er fuchswild. Der Dicke, der durch diesen unverhofften Besuch unsanft aus seinem Schlaf gerissen wurde, schrie: „Gleich gehst runter, marsch!“
„Nä, das fällt mir net ein!“ trotzte der Blaue. „Das ist doch net dein Baum!“
„Aber ich war zuerst oben,“ knurrte der Dicke.
„Nachher kannst ja auch zuerst runter,“ gab sein Feind patzig zur Antwort.
So saßen sie eine Weile auf dem Baume und fauchten einander an wie zwei Katzen, und keiner wollte zuerst herunterklettern. Und unter dem Baum standen einige Buben und Mädel und riefen lachend: „Aber kommt doch nur! Komm, Blauer! Komm, Dicker!“
Die beiden Friede aber säßen wohl heute noch auf dem Baume, wenn die Schulglocke nicht geläutet hätte. Heidi, da fuhr ihnen der Schreck in die Glieder, und sie wollten beide zugleich hinunter. Darüber aber verloren sie das Gleichgewicht – und plumpsten herab wie zwei reife Kirschen.
Schaden tat ihnen der Fall nichts, und in die Schule kamen sie auch noch zur rechten Zeit, aber so böse waren sie aufeinander, als hätte einer dem andern etwas ganz Schlimmes zugefügt.
Ungefähr eine Viertelstunde von Oberheudorf entfernt lag ein großer Teich und dicht daneben ein kleiner Bauernhof, auf dem ein altes Ehepaar wohnte. Die beiden Alten hatten ihren großen Hof im Dorfe ihrem Sohne übergeben und lebten nun still und friedlich in dem kleinen Hause. Im Winter kamen die Oberheudorfer Kinder oft und liefen auf dem Teiche Schlittschuh; die alte Bauersfrau hatte dann stets einen großen Topf voll Kaffee auf dem Ofen stehen, und manch ein blaurot gefrorenes Bübchen oder Mädelchen kam zu ihr und erhielt eine Tasse des warmen Trankes.
An einem mäßig kalten Wintertage liefen die Kinder wieder auf dem Eise Schlittschuh; der dicke Friede und der blaue Friede waren auch dabei.
Schuster Pechdraht, der von Niederheudorf kam, rief den Kindern zu: „Nehmt euch in acht, das Eis ist noch nicht ganz fest!“
„Ach, es hält schon!“ schrien die Kinder und liefen kreuz und quer, als hätte der Schuster seine Warnung an die alte, krumme Weide am Teichrand gerichtet. Der blaue Friede besonders, der ein guter Schlittschuhläufer war, schoß wie ein Pfeil über das Eis. Der dicke Friede konnte nicht so gut laufen und ärgerte sich weidlich darüber. „Wollen sehen, wer zuerst an der Weide ist,“ schrie da Heine Peterle.
Der blaue Friede fuhr, so schnell er konnte, auf das Ziel los, und keuchend folgte ihm der dicke Friede. „Er darf nicht zuerst kommen,“ dachte der und nahm alle Kraft zusammen. Da hatte der Blaue schon die Weide erreicht, und ritsch – griff auch der Dicke nach den kahlen Zweigen.
In diesem Augenblicke ertönte ein dumpfes Krachen.
„Das Eis bricht!“ schrien die Kinder entsetzt und stoben auseinander wie eine Schar Tauben, auf die ein Habicht stößt.
Ein zweiter Krach ertönte. Schreiend purzelten die Kinder an das Ufer, und im Nu war der Teich wie abgekehrt. Nur der dicke Friede und der blaue Friede waren noch darauf, oder vielmehr sie saßen darin, denn das Eis war gerade dicht an der alten Weide geborsten, und die beiden Buben saßen bis an den Hals in dem eisigen Wasser.
Aber schreien konnten sie noch, und sie schrien gellend um Hilfe, während die andern Kinder wehklagend in das nahe Bauernhaus rannten. Zum Glück waren der alte Bauer und sein Knecht daheim, und sie kamen auch beide eiligst herbei, um die verunglückten Buben zu retten. Es gelang auch, die beiden, die bereits ganz blau gefroren waren, schnell aus dem Wasser zu ziehen. Sie wurden in das Haus getragen. Dort hatte die Bäuerin, als sie von dem Unglück gehört hatte, hurtig einen Topf Fliedertee auf das Feuer gestellt und ein Bett gewärmt. Flink zog sie die Verunglückten aus, und der Bauer und sie rieben die pudelnassen Buben mit einem dicken Tuche so kräftig ab, daß den Taugenichtsen Hören und Sehen verging. Dann wurden die beiden in das Bett gelegt, das breit und groß in der Stube stand und mit feuerroten Sternblumen und himmelblauen Bändern bemalt war. Die Bäuerin gab den beiden Fliedertee zu trinken und deckte ihnen ein ungeheuer dickes Federbett über. „Gelle, das ist gut?“ fragte sie.
Wie zwei Brote in einem Backofen, so lagen die beiden Feinde ganz friedlich nebeneinander in dem warmen Federneste. Nur ihre runden, roten Gesichter, die vor Hitze glühten und glänzten, waren zu sehen.
Rühren konnten sich die Buben nicht, dazu waren sie viel zu dick eingepackt, und wenn einer wirklich eine leise Bewegung machte, dann schrie gleich die alte Bäuerin: „Nä, nä, nich' die gute Wärme rauslassen! Ich behalt' euch hier bis morgen, – gelle, das gefällt euch?“
„Hm!“ brummten alle beide, und der Blaue sah nach rechts und der Dicke nach links.
„Na, ä bißchen plappern könnt ihr schon!“ sagte die Bäuerin gutmütig. „Gelle, 's ist doch gemütlich, so zusammen zu sein?“
„Hm!“ knurrten die beiden wieder und starrten zur Zimmerdecke empor.
Die Alte schüttelte den Kopf. „Nä, sagt doch, könnt ihr nich' reden?“
„Ich kann schon,“ knurrte der Dicke, „aber –“
„Ich auch,“ ächzte der Blaue, „aber –“ Und nun sah einer wieder nach rechts, der andere nach links, und dann stöhnten sie herzbrechend.
„So'n dummes Gehabe!“ brummte der Bauer in seiner Ofenecke und zündete sich ein Pfeifchen an.
„Nu sagt doch, wo fehlt's bei euch denn?“ ermunterte seine Frau die Buben.
„Hm!“ seufzten beide, und der Blaue schielte den Dicken an und der Dicke den Blauen, und plötzlich platzten beide heraus: „Wir sind Feinde!“
„Was seid ihr?“ fragte die Bäuerin verdutzt.
„Feinde!“ sagten beide kleinlaut.
Die Alte sah beide mit ihren hellen Augen freundlich an. „Warum denn?“ fragte sie.
Wenn es möglich gewesen wäre, daß die Buben rot geworden wären, dann würden sie alle beide errötet sein, aber das ging nicht, weil sie ohnehin schon aussahen wie zwei Klatschrosen. „Ich weiß nicht,“ sagte der Blaue kläglich. „Ich auch nicht,“ ächzte der Dicke.
„Nä, potz tausend, so ä paar dämliche Jungen hab' ich noch nie gesehen!“ rief der alte Bauer, der die Unterhaltung mit angehört hatte. „Sind Feinde und wissen nicht, warum! Nä, so was!“
Die alte Bäuerin aber faltete die Hände still im Schoß und guckte mit ihren klaren, guten Augen die Buben ernsthaft an. „Gelle, 's macht viel Freude, 'nen Feind zu haben?“ fragte sie.
„Nä!“ riefen die Buben wie aus einem Munde, und einer schielte verlegen den andern an.
Die Alte stand auf, holte zwei große Tassen Fliedertee herbei und sagte freundlich: „Den Tee trinkt jetzt, und wenn ihr fertig seid, stoßt ihr an. Eigentlich macht man das ja mit 'ner vollen Tasse, aber ihr schwappert mir sonst noch das Bett voll. Und nachher hat's 'n Ende mit der Feindschaft, gelle?“
„Ja,“ sagten die Buben ganz demütig und tranken tapfer den Tee, obgleich es ihnen schon war, als sollten sie geschmort werden. Sie stießen auch wirklich miteinander an, und ob es nun der Fliedertee machte oder die Hitze oder das freundliche Zureden der alten Bäuerin, dem Dicken und dem Blauen kam die Sache auf einmal komisch vor. Sie prusteten alle beide los vor Lachen und zwickten und schubsten sich, und bums! fiel das dicke Federbett mitten in die Stube.
„Nä, die gute Wärme!“ schrie die Bäuerin und packte das Bett schnell wieder auf die Buben drauf und stopfte es rechts und links fest, damit die Hitze nur ja im Bette blieb. „Dann seid ihr morgen gesund,“ tröstete sie die schwitzenden Buben.
Dann holte sie sich einen großen, roten Strickstrumpf, setzte sich an das Bett und begann ihren Gästen eine Geschichte zu erzählen. Die alte Standuhr tickte laut dazu, und manchmal schnarrte sie, als wollte sie auch etwas sagen. Der Bauer saß in der Ofenecke und rauchte sein Pfeifchen, und neben ihm lag schnurrend ein dicker, schwarzer Kater.
„Klappklapp, klappklapp,“ machten die Stricknadeln, als müßten sie mit erzählen helfen, und je schneller die Bäuerin sprach, je flinker klapperten die Nadeln. Immer heißer wurde es im Zimmer, denn der braune Kachelofen fauchte ordentlich vor Hitze. Den Buben wurde es auch immer wärmer in ihrem Bett; sie schwitzten wie zwei Teekessel, aber dabei wurde es ihnen immer friedlicher ums Herz. Sie vergaßen allen Streit und allen Trotz. Der dicke Friede blinzelte seinen einstigen Feind an, dann legte er seinen Kopf an dessen Schulter, und der tat ganz sacht seinen Arm um des andern Hals.
Leiser und leiser wurde die Stimme der alten Bäuerin, die Stricknadeln klapperten kaum hörbar, zuletzt verstummte die Erzählerin, und in den dicken Federkissen schnarchten die beiden Friede um die Wette, und bald schnarchte auch der Bauer in der Ofenecke mit.
Als die beiden Buben am nächsten Morgen aufwachten, da waren sie putzmunter, und ihre Augen blitzten wie lauter dumme Streiche. Nicht einmal einen Schnupfen hatten sie, und die allerbesten Freunde waren sie. Sie sind es auch seitdem geblieben.
Ehrenjungfern und Buben.
Eine Stunde von Oberheudorf entfernt, an einem kleinen See, lieblich von Wald und Wiesen umgrenzt, lag ein Schloß. Es gehörte dem Herrn Grafen Dachhausen, der es immer im Sommer mit seiner Familie bewohnte. Wie man anderswo vielleicht sagt: „Die Störche sind da!“ so sagte man in Oberheudorf: „Grafens sind da!“ Das war das Zeichen, daß der Frühling kam. „Grafens“ besuchten in Oberheudorf die Kirche, und die Frau Gräfin kam auch manchmal in die Schule. Das war aber nicht so anstrengend, als wenn der Schulrat kam, sondern immer ein Festtag, denn die Frau Gräfin brachte gewöhnlich eine unglaublich große Zuckertüte mit, die freilich, wie leider alle Zuckertüten, im Umsehen leer war. Dann ließ die freundliche Dame sich einige Lieder vorsingen und verließ, nachdem sie noch der Frau Lehrerin einen Besuch abgestattet hatte, die Schule, und die Kinder riefen ihr immer sehr bittend nach: „Auf Wiedersehen!“
Wieder einmal waren „Grafens“ gekommen, und zugleich war mit Sonnenglanz und Blütenpracht der Frühling eingezogen. Im Schloß herrschte große Aufregung. Maler und Tapezierer arbeiteten darin herum; der Gärtner grub und pflanzte mit seinen Gehilfen vom frühen Morgen bis zum späten Abend im Park, und in der Küche saß stöhnend Mamsell Bertchen, die Wirtschafterin, und sagte: „Nächstens sterbe ich ganz gewiß!“ Sie wußte nämlich nicht, was für eine Pastete sie backen sollte. Schließlich gab sie das Stöhnen auf, blieb am Leben und buk drei Pasteten, „zur Auswahl“, wie sie sagte, eine aß sie aber ganz allein auf.
Im Schloß wurde hoher Besuch erwartet: der Landesfürst selbst sollte kommen. Ihm zur Ehre wurden alle Vorbereitungen getroffen, und der Graf und die Gräfin dachten sich allerlei aus, womit sie den vornehmen Gast erfreuen wollten. Unter anderem sollten ihm bei seiner Ankunft im Schloß kleine Mädchen in Landestracht Blumen überreichen.
In der Gegend, in der Oberheudorf liegt, haben die Dorfleute früher eine hübsche malerische Tracht getragen. Aber wie manchmal Kindern ihre schönen Spielsachen langweilig werden, so waren den Oberheudorfern auch ihre schönen Gewänder langweilig geworden, und nur die alten Frauen trugen sie noch hin und wieder. In manchen Familien lagen aber noch solche schöne, alte Sachen in den buntbemalten Truhen; an ihnen konnte man erkennen, wie stattlich früher die Oberheudorfer einhergegangen waren. Nach dem Muster dieser Gewänder wollte nun die Gräfin Dachhausen vier kleine Mädchen gekleidet haben, die sollten Verse sagen und Blumen bringen.
Annchen Amsee, Tischlers Liese, Schulzens Röse, die nicht faul wie ihr Bruder Jakob, sondern sehr eifrig in der Schule war, und des Waldbauers Mariandel waren die vier Auserwählten. Sie sagten, wo sie gingen und standen, ihre Verschen her, und als Waldbauers Mariandel einmal Kaffee und Spiritus holen sollte, sagte sie zu dem Krämer. „Wir grüßen dich, erlauchter Fürst!“ Und der Krämer dachte nichts anderes, als das Mariandel habe seinen Verstand verloren.
In Oberheudorf vertrugen sich die Buben und Mädel sonst immer recht gut miteinander. Sie zankten sich mal und pufften sich auch hin und wieder, aber dann spielten sie auch wieder miteinander und vollführten in der allerschönsten Eintracht die allerdümmsten Streiche. Seit aber die Frau Gräfin die vier Mädchen zum Empfang des Fürsten erwählt hatte, waren die Buben wütend auf die Mädel, und die faulsten und unnützesten waren am ärgerlichsten. „Nur Mädels,“ sagte Schnipfelbauers Fritz entrüstet, obgleich er doch sicher nicht ausgewählt worden wäre, selbst wenn die Frau Gräfin auch Buben genommen hätte.
„Und unsere Röse ist ein Jahr jünger als ich,“ rief Schulzens Jakob empört.
„Es ist frech von ihnen,“ schrien Anton Friedlich und Heine Peterle. Als ihnen aber Annchen Amsee am gleichen Tage eine Zuckerstange gab, die noch von ihrem Geburtstag stammte, da nahmen sie die Stange und aßen sie auf, aber böse waren sie darum doch. Aber aller Ärger half ihnen nichts: die vier Mädel waren zum Empfang eingeladen und blieben es, mochten die Buben brummen, soviel sie wollten.
Der Festtag kam heran. Erst hatten alle Oberheudorfer zugleich mit den vier Mädeln nach dem Schlosse ziehen wollen, um den Empfang zu sehen. Der Herzog jedoch liebte zu große Empfänge nicht, und darum hatte der Graf die Dorfbewohner bitten lassen, sie sollten erst am Abend kommen; es solle ein wundervolles Feuerwerk abgebrannt werden, und dazu könne jeder kommen, der Lust habe. Der Herzog, der mit seinem eigenen Wagen von seinem einige Stunden entfernten Jagdschloß Adlershorst kam, wurde am Nachmittag erwartet. Um Mittag traten daher, gefolgt von dem halben Dorf, die vier kleinen Ehrenjungfern ihren Weg nach dem Schlosse an. Bis zum Ende des Dorfes wurde ihnen das Geleit gegeben, dann ließ man sie mit vielen guten Wünschen und Ermahnungen ziehen, und die andern kehrten alle heim, um später den gleichen Weg zu wandern.
Die vier Mädel aber zogen stolz in ihren hübschen Gewändern fürbaß. Sie hatten bunte Röckchen, schwarze Mieder und schneeweiße, mit Spitzen besetzte Hemden an. Die schwarzen Hauben, die sie trugen, waren sehr reich mit schönen farbigen Bändern geschmückt. Weiße, feingefaltete Schürzen, weiße Strümpfe mit roten Zwickeln und blitzblanke, schwarze Schnallenschuhe gehörten noch zu dem Anzug. Es war eine Pracht, die vier anzuschauen, und sie gingen auch so steif und vorsichtig einher, wie die Puthähne Kaspars auf dem Berge, aber freilich so eingebildet und wütend wie diese waren die vier Mädel nicht.
Ein Stückchen waren Annchen, Liese, Rose und Mariandel auf der Landstraße dahingezogen, als plötzlich aus einem Graben am Wege vier Buben kletterten.
Die Mädel schrien laut auf vor Schreck, aber dann erkannten sie ihre Schulgefährten Anton Friedlich, Schnipfelbauers Fritz, Heine Peterle und Schulzens Jakob, die alle vier wie aus einem Munde riefen: „Aber ihr seid fein, uh je!“
Die Mädchen glaubten nicht anders, als die Bewunderung sei echt. Sie nickten vergnügt und zupften an ihren Bändern herum, und Annchen Amsee fragte freundlich: „Wollt ihr uns begleiten?“
„Freilich, freilich!“ rief Heine Peterle, und Schnipfelbauers Fritz meinte verschmitzt: „Grad' dazu sind wir ja gekommen!“
Wie sie so miteinander gingen, sagte Waldbauers Mariandel auf einmal: „Ihr schaut ja immer unsere Schuhe an, gelt, die können euch gefallen?“
„Na ob!“ rief Schnipfelbauers Fritz. „Aber dumm seid ihr Mädel doch!“
„Pfui!“ quiekten die vier Ehrenjüngferchen entrüstet, „du bist mal ein Grober!“
„Na, wahr ist's doch!“ behauptete Fritz lachend. „Bis ihr ins Schloß kommt, sind eure Schuhe schmutzig. Zieht sie doch aus! Gelt, ihr seid zu vornehm, um barfuß zu gehen?“