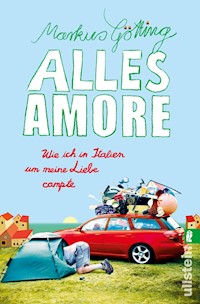8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Spätestens Anfang 40 entdecken Männer den Sport wieder für sich — nachdem sie allmählich verfettet sind. Markus hielt sich immer für einen Durchschnittsathleten, bis er bei diversen Tests feststellen muss: Er ist nicht mal das. Also holt er sich für zehn Sportarten legendäre Stars als Trainer; Olympiasieger, Weltmeister, Tour de-France-Helden, die frühere Nummer 1 im Tennis. Wenn die ihn nicht fit kriegen, wer denn dann? Dieses Buch ist ein Roadtrip zu unseren Idolen, voller Leiden und Leidenschaft. Ein urkomischer Selbstversuch mit vielen hilfreichen Tipps zum Nachmachen und einer guten Nachricht für alle Couchpotatoes. Wenn dieser Schlaffi hier sein Fett wegbekommt, schafft das jeder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Spätestens ab vierzig stellt sich jedem Mann die Frage: Wie altert man in Würde? Am besten fit und möglichst ohne Wampe, meint Markus Götting – und macht sich auf, genau diesen Zustand zu erreichen. Um sich dabei nicht in Trendsportarten lächerlich zu machen, übt er sich in zehn Disziplinen, die längst bewiesen haben, dass sie nicht nur gesund für den Körper, sondern auch gut für den Geist sind. Und von wem lernt es sich besser als von den Besten ihres Fachs? Am Ende von vielen schmerzensreichen und ermattenden, aber immer unterhaltsamen Begegnungen mit Olympia-Assen, Tennis-Cracks und anderen Hochleistungssportlern weiß Götting: Schwitzen lohnt sich – denn es ist nie zu spät, dem Bauchumfang per Sport zu Leibe zu rücken.
Der Autor
Markus Götting, Jahrgang 1971, lebt in München. Nach Stationen bei der Süddeutschen Zeitung, dem SZ-Magazin und dem stern ist er seit 2014 Textchef beim Focus. Seine Bücher Nachts im Sägewerk und Alles Azzurro wurden zu Bestsellern.
In unserem Hause sind von Markus Götting bereits erschienen:
Alles AmoreAlles AzzurroNachts im Sägewerk
Markus Götting
Mein 10-Kampf gegen die Papa-Plauze
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1298-9
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: FinePic®, MünchenLektorat: Oliver DomzalskiIllustrationen im Innenteil: Adobe Stock (Kapitel »Baden gehen«, »Der Absturz«, »Ruhig, Alter, läuft!«),FinePic®, München (Kapitel »Du gewinnst mit deinem Kopf!«, »Laufen und laufen lassen«, »Quäl dich!«, »Heavy Metal«, »Der weiße Riese«, »Abgefahren«, »Finde deine Mitte!«)
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für meine wunderbare Familie
Inhalt
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Widmung
Vorlauf
Du gewinnst mit deinem Kopf!
Serviceteil: Boxtraining
Baden gehen
Serviceteil: Schwimmtraining
Laufen und laufen lassen
Serviceteil: Lauftraining
Quäl dich!
Serviceteil: Radtraining
Heavy Metal
Serviceteil: Muskeltraining
Der weiße Riese
Serviceteil: Tennistraining
Der Absturz
Serviceteil: Klettertraining
Abgefahren
Serviceteil: Skitraining
Ruhig, Alter, läuft!
Serviceteil: Biathlontraining
Finde deine Mitte!
Serviceteil: Yogatraining
Siegerehrung
Ehrenrunde
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Vorlauf
Wieso geraten Männer mit Mitte vierzig plötzlich auf den Sporttrip?
Sie meint das sicher nicht böse. »Muffin Top«, sagt Kati, als sie auf den Computermonitor schaut. Dann lächelt sie mich an. Rotblondes Haar, Gesicht wie ein Engel. Ehrlich jetzt, sie kann das einfach nicht böse meinen.
Auf dem Bildschirm ist ein Männchen zu sehen, das verblüffende Ähnlichkeit mit mir hat. Wobei ich mir wünschte, es wäre anders.
Ich hatte mich bis auf die Unterhose frei gemacht. Eigentlich bester Dinge. Brust raus und nicht mal den Bauch eingezogen. Es war wohl Übermut. Dann stieg ich auf ein Podest in einer kleinen Kammer, die sich 3-D-Bodyscanner nennt. Ein Sound wie bei der Kernspintomographie setzte ein, ein roter Laserstreifen fuhr einmal ringsherum an meinem Körper runter – und nach ein paar Sekunden erschien eine Figur auf dem Monitor. Die Figur war ich. Meine rausgestreckte Brust war nicht zu sehen, dafür eine Wampe. Um meine Hüfte ein trauriger Rettungsring, der den Kampf gegen die Schwerkraft offensichtlich verloren hatte.
Kati, angehende Doktorin der Biomechanik, schaute auf den Bildschirm. Sie sagte nicht »Rettungsring«, das war ein Wort, das meine Eltern benutzt hätten. »Wir nennen es ›Muffin Top‹«, sagte das Engelsgesicht. Kürzlich hatte ich gelesen, woher das Wort Muffin kommt: aus dem Altfranzösischen. Moflet bedeutet »weich«.
So ein 3-D-Bodyscan ist unbestechliche, unumstößliche, kalte algorhythmische Faktizität. Computergenerierte Wahrheit. Ich, Markus »muffin top« Götting, hatte das gewollt. Ich wollte wissen, wo ich körperlich stehe.
Nun könnte man natürlich sagen: Wenn du keine Antworten willst, dann frag nicht. Aber genau das macht man in meinem Alter irgendwann: Man fragt. Einen Mann um die vierzig kann man sich wie einen Dreijährigen vorstellen. Ständig hat er Fragen. Große, gewichtige Fragen. Lebensfragen. Fragen wie: Führe ich das richtige Leben? Habe ich meine besten Jahre genutzt? Was wird von mir bleiben? Was soll von mir bleiben? Finden mich Frauen eigentlich noch sexy – außer meiner eigenen natürlich, die das vermutlich längst nicht mehr tut?
Der Unterschied zwischen Männern und Dreijährigen besteht darin, dass wir die Fragen für uns behalten. Wir werden schweigsam. Kaufen uns lieber eine grummelnde Harley und reiten damit melancholisch in den Sonnenuntergang. Wenn das nicht geht, versuchen wir es mit einem Hobbykeller – oder stürzen uns in sportliche Abenteuer.
Auch ich habe mir also diese Fragen gestellt, und das Ding ist: Hätte ich mich in einen Scanner gestellt, der nicht nur meinen Körper, sondern gleich mein ganzes Leben seziert, wäre vermutlich herausgekommen, dass ich in jeder – und zwar in absolut jeder – Beziehung kompletter Durchschnitt bin. 44 Jahre alt, eine Frau und zwei Kinder. Ich fahre eine Familienkutsche, die zu den meistverkauften Autos in Deutschland gehört, und wenn ich’s mir leisten könnte, besäße ich auch ein Reihenhäuschen innerhalb des zweiten Münchner U-BahnRings. Ich bin 1,76 groß, 72 Kilo schwer, mein Body-Mass-Index beträgt 23; normalerweise schlafe ich acht Stunden. Ich kann nur wenige Dinge besser als andere, aber eine richtige Niete bin ich auch nicht. Verdammt, ich trinke sogar Medium-Mineralwasser.
Man könnte also sagen: Mein Leben hat keine Ausschläge, weder nach unten noch nach oben. Ist das gut? Einige würden sagen: »Ja, natürlich ist das gut. Sei zufrieden, sei dankbar.« Aber es ist ja nun auch nicht gleich undankbar zu sagen: Zu den vielen Dingen, die ich mir als junger Mann mal für »später« vorgenommen hatte, gehörte sicher nicht der Satz: »Ich führe ein Leben ohne Ausschläge.«
Ich sage nicht, dass es nur Ausschläge nach oben sein müssen. Nein, mir reicht es, dass die Dinge in Bewegung kommen – und falls sie in die Hose gehen, dann ist das eben so. Bei dem, was ich vorhabe, spricht ja auch alles dafür, dass sie in die Hose gehen. Irgendjemand hat mal gesagt: »Vor die Wahl zwischen dem Schmerz und dem Nichts gestellt, wähle ich den Schmerz.« Bisher habe ich meist das Nichts gewählt. Ich finde, es wird Zeit, dass ich das ändere.
In der Zeitung habe ich kürzlich gelesen, dass Männer zwischen dreißig und vierzig im Schnitt knapp eineinhalb Kilo pro Jahr zunehmen. Viele ersitzen sich im Büro einen gramgebeugten Rücken und eine Papa-Plauze, von der nur ihre Mutter sagt, dass sie ihnen steht. Alle wissen, dass schleichende Verfettung eine Frage des Stoffwechsels ist und letztlich simple Mathematik: Man führt mehr Energie zu, als man verbraucht.
Natürlich habe ich mich lange selbst belogen. Männer sind sehr gut darin. Nehmen wir den sogenannten Dad Bod, der gerade in den Medien omnipräsent ist. Er kam wie gerufen für Typen wie mich. Ein Dad Bod ist der Körper eines Vaters, der ziemlich genauso aussieht wie das Männchen, das ich vor ein paar Minuten auf dem Computerbildschirm gesehen hatte. Frauen finden ihn angeblich schnuffig. Heißt es jedenfalls in der Presse. Ich glaube kein Wort. Würde man bei genau diesen Frauen genauer nachfragen, käme ziemlich schnell heraus, dass an diesen Bauch einige Bedingungen geknüpft sind. Zum Beispiel sollte er an einem Hollywood-Star hängen. Zieht aber der eigene Kerl am See sein T-Shirt aus und präsentiert seine Plauze, verdrehen dieselben Frauen die Augen.
Ich liebe meine Frau. Und meine Kinder. Aber je älter sie werden, desto schneller mutierst du für sie von Daddy Cool zu einer Art mobilem Geldautomaten. Für deine Gattin bist du eh nur noch der Typ, dem Haare an den falschen Körperstellen wachsen – und für den Rest der Frauenwelt verschwindest du völlig vom Radar; du wirst einfach unsichtbar. Ein sozialer Tarnkappenbomber. Exakt das ist dann der Zeitpunkt, an dem manche Männer die blonde Praktikantin flachlegen, weil sie die Einzige ist, von der sie noch aufrichtig bewundert werden.
Ich hingegen finde, die zeitgemäße Kompensation einer massiven Midlife-Crisis ist Sport. Die Vorteile liegen nahe. Im Gegensatz zum Fremdgehen ist das Scheidungsrisiko zunächst erheblich geringer. Und du reduzierst bei entsprechendem Trainingsumfang auch noch dein biologisches Alter.
Wenn wir ehrlich sind, tun wir ewigen Jungs uns verdammt schwer damit, zu realisieren, dass unsere körperliche Leistungsfähigkeit schon mit Ende zwanzig nicht mehr so ausgeprägt ist wie noch zehn Jahre zuvor. Und selbst wenn wir es merken – müssen wir das wirklich akzeptieren?
Darum stehe ich hier, in Unterhose und beschämt bis auf die Knochen, im ifd cologne, dem Institut für funktionelle Diagnostik. Diese Wunderwelt hat erst im Sommer 2014 eröffnet und sieht aus wie der Wellness-Bereich eines überteuerten Designerhotels; dabei ist es ein wissenschaftliches Gemeinschaftsprojekt der Biomechaniker der Sporthochschule Köln mit den Sportmedizinern aus der Kölner MediaPark-Klinik, wo die Fußballer des 1. FC Köln und die Eishockeyspieler der Kölner Haie betreut werden. Ich bin also in guten Händen.
Kati, der Engel im Arztkittel, hat meinen Körper am Computer auf den Millimeter genau vermessen. Im Boden der Scan-Kabine sind zwei Präzisionswaagen eingelassen, die Rückschlüsse darauf geben, wie symmetrisch sich meine Körperlast verteilt. Ob meine Beinachsen in Ordnung sind, die Beine unterschiedlich lang, Becken oder Schultern schief stehen – all das kann sie mit diesem Modell nachvollziehen und hochrechnen.
Kati ist noch immer mit ihrer Computermaus beschäftigt. Sie lässt das dicke Männchen über den Bildschirm tanzen, dreht es zur Seite, und ich denke: Um Himmels willen, da sieht man ja jede einzelne Speckfalte. Dann lässt sie mein Alter Egoauch noch nach vorn kippen, und irgendwie erinnert mich mein Ranzen in dieser Position an ein Hängebauchschwein.
Kati sagt: »Das könntest du jetzt auch in einem 3-D-Drucker als Figur ausdrucken lassen. Cool, oder?«
Während dieser durch und durch erniedrigende Satz, den sie vermutlich nicht mal böse meint, in der Luft hängt, betrachte ich das Männchen genauer. Mit war schon klar, dass da noch eine Menge passives Gewebe meinen Körper beschwert. Aber es so in aller Deutlichkeit illustriert zu bekommen, das ist dann schon ziemlich demütigend. Dabei war ich guter Dinge.
Kurz nach Ostern hatte ich angefangen, einigermaßen regelmäßig zu laufen. Zuerst steigerte ich meine Strecke von seniorigen vier Kilometern auf acht bis zehn; seit Frühsommer hatte ich mein Pensum auf viermal die Woche getrieben – immer schön vor dem Frühstück, damit der Körper nach und nach die Fettreserven wegknabbert. So zumindest meine laienhafte Theorie, die von Hörensagen gestützt wurde.
Eine Weile hatte ich mich morgens um kurz vor sechs aus dem Bett geschält, weil meine Gattin findet, dass so ein Sportprogramm zwar ganz okay ist – aber nur, solange ich es außerhalb der beruflichen und familiären Geschäftszeiten praktiziere. »Wenn du schon mal zu Hause bist«, sagte sie, »dann bringst du auch die Kids in die Schule und in den Kindergarten.« So stand ich also morgens um sieben, die frischen Semmeln unterm Arm, vor den Betten der Kinder und ließ meinen Schweiß auf sie herabtropfen, wenn sie nicht aufstehen wollten. Ich fühlte mich gut. Jünger und voller Energie. Und irgendwann, vermutlich beim Laufen, kam mir diese Idee. Eine Idee, die man mit Fug und Recht als kompletten Unsinn verwerfen kann. Verwerfen sollte. Aber sie war da. Groß und klar. Und ganz gleich, wie oft ich mir sagte, dass daraus nichts werden würde, sie ging einfach nicht weg.
Was ist das Problem, das alle Männer wie ich haben? Woran mangelt es uns? Sicher nicht an Vorsätzen. Gäbe es für jeden guten Vorsatz einen Euro, dann hätte ich längst mein Reihenhaus. Es mangelt mir, wie den meisten anderen auch, an Disziplin, an Entbehrung, an Opferbereitschaft. Aber wie lernt man das? Sicher nicht mit einem Men’s Health-Abo. Der Mensch lernt am meisten von anderen Menschen. Am besten von den echten Vorbildern, den Idolen: von den Weltmeistern, den Olympiasiegern, den Gewinnern. Von den Legenden. Also von den Besten im absoluten Wortsinn. Und zwar nur von denen.
Die Idee, die meinen Kopf nicht mehr verlassen sollte, bestand darin, dass ich mich in zehn Disziplinen versuchen und dabei die großen Stars jeder Sportart als Coach verpflichten wollte. Also rief ich sie an: den größten deutschen Box-Champion, einen Olympiasieger im Laufen, einen Schwimmweltmeister, einen Davis-Cup-Sieger im Tennis, den stärksten Mann Deutschlands, Extremisten und Gurus aller Art. Wenn die mich auf den richtigen Weg bringen und fit machen könnten, dann gäbe es Hoffnung. Und zwar für alle. Wenn einer wie ich – Familienvater, Zehnstundentag im Büro, zwei Tage pro Woche im Flieger –, wenn also so einer es schafft, dann kann es jeder. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Für niemanden.
Natürlich ist das verrückt. Für einen wie mich würde auch der Praktikant aus dem Fitness-Studio an der Ecke reichen. Aber was machen Leute wie ich, die das Mittelmaß personifizieren? Sie träumen. Die besten Geschichten in Hollywood funktionieren so. Früher habe ich viel geträumt. Jetzt bin ich erwachsen, heißt es, und nachdem ich jetzt viele, viele Jahre nicht geträumt habe, werde ich einfach wieder damit beginnen. Ich werde den größten Sportlern unserer Zeit so lange auf die Nerven gehen, bis sie einwilligen. Bis sie sagen: »Okay, ich trainiere mit dir. Ich schau, was ich machen kann.«
Um das gleich zu sagen: Es hat funktioniert. Man wundert sich immer wieder, was man bekommt, wenn man nett fragt. Nicht einer dieser unglaublichen Menschen hat Geld von mir verlangt. Nicht einen Cent. Sie hielten die Idee einfach nur für so durchgedreht, so absurd, so lächerlich, dass sie zugesagt haben. Man sollte nicht vergessen: Spitzensportler sind keine normalen Menschen. Die sind alle ein wenig schräg. Ihnen gefallen schräge Ideen.
Ähnlich – nun ja – überdimensioniert mag mein Untersuchungsprogramm in Köln anmuten. Aber wenn ich schon mit den Besten trainiere, will ich auch von den Besten betreut werden. Ich hatte meinem Freund Mike von der Idee erzählt. Er ist Kommunikationsberater und Marathonläufer (schwer zu sagen, was davon er hauptberuflich macht), war früher exzessiver Raucher und wog schon mal ungefähr das Doppelte von dem, was er heute auf die Waage bringt. Einer, der sich ein bisschen auskennt. Nachdem er mir lange erklärte hatte für wie absurd er das Ganze hielt, wies er mich darauf hin, dass ich ganz am Anfang, bevor ich die Elite des deutschen Sports mit meinem »Ansinnen belästigen« würde, einen Gesundheitstest machen solle.
»Würde mich nicht wundern, wenn es dich irgendwann mit einem Herzinfarkt umhaut, weil dein Pensum nicht ganz im Verhältnis zu deiner Leistungsfähigkeit steht. Deshalb empfehlen ja auch alle Ratgeber, dass man sich erst mal untersuchen lassen sollte.«
»Meinst du wirklich?«, fragte ich.
»Sagen wir so: Deine Eigenwahrnehmung ist nicht unbedingt faktenbasiert.«
In diesem Moment dachte ich: Okay, dann fang ich mit dem Wahnsinn sofort an. Ich gehe nicht einfach nur zum Arzt, ich mache auch das extrem. In der Zeitung hatte ich gelesen, dass der Bayern-Spieler Mario Götze in der Bundesliga-Sommerpause einen zweitägigen Mega-Monster-Check-up an der Kölner Sporthochschule absolviert hatte. Seither hatte er seine Ernährung und sein Training umgestellt, hieß es, und sogar ein paar Kilo abgespeckt.
Ich erzählte Mike davon und sagte: »Genau das will ich auch. Das ganze Paket.«
»Ich glaube, du unterliegst da einem Missverständnis«, sagte Mike. »Klar, der Götze sieht schon ein bisschen moppelig aus. Das heißt aber nicht, dass ihr beiden ungefähr auf einem – wie soll ich’s dir sagen? –, nun ja, auch nur annähernd auf einem körperlichen Leistungsniveau seid. Verstehst du, was ich meine?«
Klar verstand ich das. Götze: Fußballprofi. Ich: Fettsack. Aber das heißt ja nicht, dass man mich nicht vermessen kann.
»Du bist doch Kölner«, sagte ich.
»Und?«
»Ihr kennt euch doch da alle.«
Mike schüttelte den Kopf und rührte seine fettarme Latte macchiato um. »Du bei so einem Test – das wäre ungefähr so, als würdest du die Feuerwehr rufen, um ein Teelicht auszupusten.« Dann schaute er mich lange an. »Aber ich werde sehen, was sich machen lässt.«
So komme ich nach Köln. Zu meiner Standortbestimmung. Für mich als Sportler – und irgendwie auch für mich als Mensch. So ein Test ist neben der körperlichen auch eine charakterliche Prüfung.
»Du musst dich selbst aus voller Überzeugung im Spiegel anlächeln können.« So was in der Art sagen Motivationspsychologen sehr gern. Nun, ich bin einigermaßen gut auf mich zu sprechen und ließ im Sommer am See zum ersten Mal gern das T-Shirt weg. Aber was ich wirklich draufhabe, zeigt mir dieser Mario-Götze-Check.
Bei der sogenannten Bio-Impedanzanalyse wird mein Körperfettanteil gemessen – damit fängt alles an. Und offenbar bestehe ich zu fast einem Viertel aus Fett. Muskelmasse ist quasi keine vorhanden. »Aber für dein Alter ist das normal«, heißt es dann. Das soll ein Trost sein. Nur: Wie tröstlich ist schon ein Satz, der mit »Für dein Alter« anfängt?
In der Klinik in Köln-Porz geht es dann wenig später um mein Herz. Martin Gorr ist hier der Oberarzt, und ein Bild an der Wand zeigt ihn auf dem Mannschaftsfoto der Kölner Haie. Ein bisschen peinlich ist mir das im Moment schon. Normalerweise behandelt Dr. Gorr lebende Kleiderschränke auf Kufen – und nun stehe ich vor ihm.
Doktor Gorr fährt mit einem Ultraschallgerät meine Halsschlagader entlang. Er schaut auf seinen Monitor und sagt: »Ah, sehr gut. Nichtraucher.«
»Öh, ja, aber erst seit drei Wochen. Und es macht auch keinen Spaß.«
»Ach, echt? Dann hast du aber nicht viel geraucht. Man sieht jedenfalls nichts, keine Ablagerungen.«
Mit meinem Herzen ist also alles bestens. Zumindest im Ruhezustand. Wie es sich aber bei sportlicher Aktivität verhält, klären wir beim Herzultraschall unter Belastung, dem sogenannten Stressecho.
Die sehr nette und irgendwie auch sehr kölsche Krankenschwester klebt mir ein gutes Dutzend EKG-Elektroden an den Oberkörper, dann schnallen sie mich an einer Art Gynäkologenstuhl mit Fahrradpedalen fest, den sie seitwärts nach links kippen lassen – ich glaube, damit das Blut besser zum Herzen fließen und der Arzt mich besser untersuchen kann. Doktor Gorr erzählt, seine Abteilung arbeite mit der Raumfahrtbehörde zusammen. So ähnlich sieht dieses Gerät hier auch aus.
Ich soll strampeln, und alle drei Minuten stellen sie den Widerstand ein wenig höher, damit meine Herzfrequenz ganz allmählich steigt. Bei 200 Watt bin ich allerdings schon knallrot im Gesicht und leuchte wie eine entsprechende Glühbirne. Auf dem Bildschirm sieht man mein Herz schlagen.
»125er Puls«, sagt die Krankenschwester. Bis 150 oder 160 soll ich mich hocharbeiten. Das Problem ist bloß: Ich kann die Pedale kaum noch treten. Und während ich keuche und mein Puls immer noch nicht über 135 klettert, spuckt der Drucker neben mir viele bunte Grafiken und Diagramme aus. 225 Watt Widerstand, Puls 140. Ich kann nicht mehr. Und allmählich klopft auch mein Mittagessen unangenehm an.
Doktor Gorr findet, dass ich erstaunlich lange durchgehalten habe. Dass mein Puls nur so langsam hochging, spricht sogar eher für mich. Mein Herz hat jedenfalls, selbst als mir fast die Beine explodiert sind, unerschütterlich weiter gepumpt, sehr rhythmisch, geradezu vorbildlich, meint Doktor Gorr. Er sagt: »Aber hier geht es ja weniger um die Leistung – das machen wir dann beim Laktattest.« Warum klingen manche Komplimente bloß wie eine Drohung?
Inzwischen hat sich ein fulminantes Kompetenzteam um mich herum gebildet, in dem offenbar jeder einigermaßen ernstzunehmende Sportarzt der Stadt vertreten ist. Für eine Wurst wie mich ist das zugegebenermaßen etwas übertrieben, aber es ist Teil meines Plans. Teil des ganzen Wahnsinns.
Diesmal begrüßt mich im Souterrain der Klinik von Köln-Porz eine beneidenswert schlanke Frau, blondes Haar, schlaue Nerd-Brille. Bettina Kuper überwacht die Spiroergometrie, sprich: einen Laktattest unter verschärften Bedingungen.
Wir fangen mit einer Untersuchung der Lungen an: alles fein. Das Rauchen scheint keine bleibenden Schäden hinterlassen zu haben. Die nette kölsche Krankenschwester verkabelt mich wieder mit allerhand Elektroden und einem Polar-Gurt an der Brust; das Ganze befestigt sie mit Verbandszeug, damit auch nichts rutscht, wenn ich nachher über das Laufband sprinte wie Usain Bolt. Dann setzt sie mir eine Atemmaske auf den Mund, deren Gummibänder an meinem Hinterkopf angebracht werden. »In das Loch der Atemmaske kommt jetzt ein Sensor«, erklärt Bettina, die Ärztin, »der misst, wie viel Sauerstoff du aufnimmst und wie viel CO2 du ausatmest.« Auf dem Computermonitor wird sie, sobald der Test beginnt, die Werte in Echtzeit kontrollieren können.
Zum Schluss legen sie mir ein Gurtgeschirr an, wie man es vom Fallschirmspringen kennt, und ich werde in ein Seil eingeklinkt, das von oben herabbaumelt. »Das hält dich, falls du nachher auf dem Laufband ins Straucheln gerätst«, sagt Bettina, »oder für den Fall, dass du bewusstlos zusammenbrichst.«
Ach ja?
Und los geht’s. Nach intensiver Beratung haben sie entschieden, am Laufband nicht die sogenannte »Leistungssportler-Rampe« einzustellen, sondern doch eher das Programm für Durchschnittsathleten. Bettina ist wirklich sehr charmant. »Ich hoffe, das unterfordert dich nicht«, sagt sie.
Der Test beginnt mit beschleunigtem Gehen bei 6 km/h; alle zwei Minuten wird um einen km/h schneller geschaltet. Auf den Monitoren sieht man die EKG-Daten und meine Sauerstoffversorgung beziehungsweise die CO2-Produktion. In dem Moment, wo die rote CO2-Kurve über die blaue für die Sauerstoffaufnahme hinauswächst, nähere ich mich auch rasch meiner Leistungsgrenze.
Vor jeder neuen Tempostufe muss ich einmal kurz vom Laufband hüpfen, damit mir die Krankenschwester Blut aus dem Ohrläppchen zapfen kann. Das Laufen mit der Gasmaske ist zwar nicht gerade ein Spaß, verglichen mit dem morgendlichen Joggen in den Isarauen, sieht aber beeindruckend elitär aus. Nach Labor, nach Leistungssport eben.
Ich laufe jetzt mit zwölf Stundenkilometern. Ordentliches Tempo – aber nichts, womit man sich unsterblich macht. Sauerstoff- und CO2-Kurve kreuzen sich gerade – und driften dann recht zügig auseinander. »Jetzt wird’s wohl nicht mehr allzu lange gehen«, sagt Bettina. Will man so was von einer Ärztin hören?
13 Minuten habe ich schon geschafft. »Bisschen kämpfen!«, sagt die Krankenschwester.
»Super machst du das, zieh!«, ruft Bettina.
15 km/h. Es wird schnell. Es wird zäh.
Keine Ahnung, wie lange ich noch durchhalte, ob es Minuten sind oder doch nur ein paar Sekunden. Ich kann mich gerade noch auf meine Füße konzentrieren. Bloß nicht in dieses Geschirr fallen.
Ein paar Meter noch, dann erwischt mich der Hammer. Es ist, als würde mir der Stecker gezogen. Nix geht mehr. Ich springe auf den Rand des Laufbands, die Krankenschwester zapft wieder Blut ab und fährt das Laufband auf Schritttempo runter. Und während ich – in die Atemmaske keuchend – weiter auf dem Laufband vor mich hin schlendere, nehmen sie mir nun minütlich Blut ab, um zu testen, wie schnell ich mich erhole.
Dabei ist die Kernfrage doch eher, ob ich mich überhaupt erhole.
Jemals.
Als ich bei Dr. Paul Klein in der Mediapark-Klinik auf der Pritsche lag, betrat sein Kollege Dr. Peter Schäferhoff das Zimmer. Als Mannschaftsärzte des 1. FC Köln sind die beiden auch für den sogenannten Medizincheck vor der Verpflichtung eines neuen Spielers verantwortlich. Sie nennen zwar keine Namen, aber nur so viel: Außer mir sind schon ganz andere durchgefallen.
Peter Schäferhoff fuhr meinen Körper entlang, fühlte, tastete, knetete. Das dauerte vielleicht fünf Minuten, dann sagte er: »Wat meinste, Paul – ’nen Schlangenmenschen machen wir aus dem hier nicht mehr, oder?«
Und das war noch der humoristische Teil des Befunds. Die angeschwollene Achillessehne ist eine Folge meiner Fehlbelastungen beim Laufen. Schon bei einer simplen einbeinigen Kniebeuge kollabiert meine gesamte Kniegelenksachse; mangels Kraft in den Waden und rund ums Knie habe ich Probleme, meine Beinachsen zu kontrollieren, und knicke beim Laufen ein. Klassische X-Bein-Geschichte. Sieht schrecklich aus. Hinzu kommen gravierende Einschränkungen im Hüft- und Beckenbereich, in der Brustwirbelsäule und den Schultern. Kurz gesagt, ist mein Rücken dermaßen krumm, als würde die Evolution wieder rückabgewickelt: ein Primat in bunten Funktionsklamotten.
Insgesamt erzählen die Leistungstests und Untersuchungen die traurige Geschichte eines gebeugten Büromenschen, der im Lauf seines Berufslebens allmählich seine Haltung verliert. Sich kleinmacht. Die Schultern hängen lässt. Und es ist eben kein Zufall, dass viele psychologische Metaphern der Körpersprache entlehnt sind: Sich gerade machen. Haltung bewahren. Den Rücken stärken. Jemanden aufrichten. Unsere Körperhaltung, so hat eine Studie der Harvard University ergeben, ist ein Spiegel unseres Seelenzustands.
Apropos Funktionsklamotten: Narzissmus ist ja auch eine Form der Motivation. Selbst wenn du körperlich nicht ganz weit vorne bist, willst du ja immer noch bella figura machen. Und genau für solche Leute wie mich hat die Sportartikelindustrie diese Textilfasern erfunden, die irgendwann schlauer sein werden als wir selbst. Und wir sind Millionen. Millionen von Männern, die erst mal mit vorgehaltener Kreditkarte ein Sportgeschäft überfallen, bevor sie sich überhaupt auf eine Sportart einlassen. Die, noch ehe ein Schweißtropfen fließt, eine Grundausstattung im Gegenwert eines netten All-inclusive-Familienurlaubs zusammenstellen. Inzwischen bekomme ich nahezu jeden Tag eine freundliche Mail von der Firma Nike, die mich über ein paar in der Tat unverzichtbare Dinge informiert. Dabei besitze ich längst vier oder fünf Paar Laufschuhe – also für jeden Untergrund genau den perfekten Schuh. Und ich schwöre: Das muss sein!
Mein Kumpel Mike hat neulich einmal ausgerechnet, was da so zusammenkommt. Jedes Jahr eine ziemlich gute Rolex, meinte er fassungslos, »und wenn du immer schön im Takt der Kollektionen bleibst, hast du nach ein paar Jahren einen Porsche Boxster beisammen. Okay, einen gebrauchten.« Im Englischen gibt es einen wunderbaren Begriff für etwas eitle Herren wie uns: MAMIL. Das Akronym steht für »middleaged men in Lycra«.
Auch nach den Kölner Tests habe ich weiter diesen Traum: Noch einmal meinen Fettwert deutlich unter die 20 Prozent pushen und mir einen Bauch antrainieren, auf dem sich ein paar anatomische Strukturen zumindest andeuten. Solche Sachen. Angeblich ist das gar nicht so schwierig. Du musst es nur machen. Und letztlich lockt auch ein großes Versprechen: Mit der Fitness holt man sich schließlich ein bisschen was von seiner Jugend zurück – von jener Zeit, als man noch mehr Muskel- als Hirnmasse hatte und gar nicht wusste, wohin mit seiner Energie.
In den fünfziger Jahren war ein dicker Bauch noch ein Wohlstandsbeweis. Heute ist er ein Armutszeugnis. Dicksein ist ein Zeichen von mangelnder Disziplin und Überforderung, so ähnlich wie der volle Aschenbecher auf dem Schreibtisch. In unserer Leistungsgesellschaft hat sich spätestens seit Beginn des neuen Jahrtausends die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir unseren Körper als Investitionsgut betrachten sollten. Zunächst war es die Wellnessbewegung, die der Idee von Askese eine ganz neue ästhetische Aufwertung verschaffte. Entsagung konnte mit einem Mal richtig Spaß machen, sich wie eine Belohnung anfühlen. Jetzt wird die Qual zum Ideal.
Sport ist ja immer auch ein Weg zur Selbsterkenntnis: Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wo liegen meine Grenzen? Und wie kann ich sie überwinden? Du lernst, Schmerzen zu tolerieren und Rückschläge wegzustecken. Im Prinzip sind Training und Wettkampf eine Schule fürs Leben, und viele Einsichten, die man sich mit Schweiß auf der Stirn erarbeitet, lassen sich eins zu eins auf den Alltag im klimatisierten Büro übertragen.
Unser Leben wird immer mobiler und komplexer, und den Körper benötigen wir als Kraftwerk, um mit diesen ständig steigenden Anforderungen klarzukommen. Wer verfettet, ist meist auch geistig einigermaßen träge. Das zeigt schon die Empirie – aber der Zusammenhang zwischen körperlichem Zustand und kognitiven Fähigkeiten ist auch in etlichen Studien wissenschaftlich belegt worden. Mit der Digitalisierung haben die Selbstoptimierer nun auch die Werkzeuge zur Hand (besser gesagt: am Handgelenk), um das Maximum aus sich selbst zu schöpfen. Darum geht es im Sport wie im Job – beide Wettkämpfe funktionieren nach denselben Mechanismen.
Über diesen Punkt habe ich mich lange mit Ingo Froböse unterhalten. Froböse ist Professor an der Kölner Sporthochschule und einer der klügsten deutschen Experten in Sachen Leibesübungen. Er war so nett, mir zu jeder Sportart, die ich betrieben habe, zu erklären, welche Anforderungen sie tatsächlich stellt, körperlich wie geistig, und welchen Profit ich daraus ziehen kann. Und er hat Freude an pointierten Formulierungen.
Als wir über Männer in der Midlife-Crisis sprachen, musste er laut lachen. »Das ist tatsächlich typisch. Wissen Sie, wir Männer werden ja als Kämpfer geboren.« Wir ließen uns zwischendurch vielleicht ein bisschen ausbremsen durch Schule, Studium, erste Schritte im Beruf und familiäre Verpflichtungen, aber dann, wenn das Korsett ein wenig gelockert werde, gehe alles wieder von vorn los. »Da geht es um Selbstverwirklichung«, sagt Froböse, »und das ändert sich auch bis ins Alter von sechzig oder siebzig nicht.«
Männer lieben es, sich zu vergleichen. Der Sport macht ihnen das leicht – und die sozialen Medien verstärken das noch. »Das Self-Tracking ist Posing in reinster Form«, sagt Froböse, »sozusagen das Selfie in Datenform, mit dem man sich profilieren und selbst darstellen kann.«
Im doppelten Sinne: Leistung zeigen.
Zu der ursprünglich intrinsischen Motivation (sprich: ich will mir selbst etwas beweisen) kommt somit auch extrinsischer Druck. Wenn du einmal angefangen hast, den Freundeskreis mit deiner morgendlichen Performance zu beeindrucken, dann darfst du keinesfalls nachlassen. Sonst werden schnell ein paar unangenehme Fragen gestellt.
»Das Grausame am Sport ist bloß«, sagt Froböse, »dass es eigentlich immer einen Besseren gibt.« Der Sport ist mehr noch als das brutalste berufliche Umfeld ein darwinistisches System, in dem in der Regel der Stärkere triumphiert. Und genau deshalb ist er die beste Schule des Lebens, eben auch für den Charakter. Nicht nur, dass wir lernen, Regeln zu akzeptieren, sondern auch, wie man mit Niederlagen umgeht. Wer das nicht frühzeitig begriffen hat, wird erbärmlich scheitern. »Und genau das«, sagt Froböse, »ist bei erfolgsverwöhnten Managern das Problem, wenn sie mit Mitte vierzig anfangen, Sport zu treiben.«
Auch vor diesem Hintergrund habe ich mich aufgemacht, mit den Größten und Besten zu trainieren. Und Gespräche mit ihnen zu führen. Denn das führt ebenfalls zur Erkenntnis. Was hat diese Menschen zu Stars gemacht? Was hat sie aus der Masse herausgehoben? Wie haben sie sich durchsetzen können, und was braucht es dazu?
Es ist ein Roadtrip voller Leidenschaft geworden. Und voller Leiden. Ich habe mich dafür in einem Kölner Boxstudio vermöbeln lassen, karge Berge in den Kitzbüheler Alpen erklommen und eine Häuserwand im Berchtesgadener Land. Ich wäre in einem Essener Schwimmbad um ein Haar ersoffen – und das am Warmwassertag. Ich bin durch Tübinger Wälder gerannt, bis meine Polar-Uhr Alarmsignale sendete, und habe mich so heftig über den Tennisplatz hetzen lassen, dass Bettina, meine Ärztin, die für mein Online-Trainingstagebuch freigeschaltet ist, am nächsten Tag anrief, um zu fragen, ob wirklich alles in Ordnung sei mit mir. In der wohl abgefahrensten Berliner Muckibude habe ich zu Heavy Metal Baumstämme gewuchtet und in Zehlendorf zu Panflötenmusik meine innere Mitte gesucht. Gefunden habe ich aber noch viel mehr.
Du gewinnst mit deinem Kopf!
Im Ring mit Box-Champion Henry Maske
Und dann kommt der Moment, in dem es kippt und du nicht mehr weißt, ob das jetzt immer noch Spaß ist oder doch vielleicht schon ein bisschen Ernst. Jedenfalls wird mir noch viel heißer. Dabei schwitze ich schon seit mehr als einer Stunde wie irre.
Diese Hitzewallung – ist Angst. So einfach.
Der Gentleman beugt seinen Oberkörper nach vorn und pendelt ganz leicht zur Seite, hin und her; er bewegt sich auf mich zu, drängt mich in die Ringecke und verpasst mir dabei noch schnell ein paar ansatzlose Watschen links und rechts. Patsch, patsch. Ich versuche noch, die Fäuste vors Gesicht zu halten – Deckung hoch und hoffen, dass es bald vorbeigeht. Aber die Kraft weicht aus meinen Armen wie die Luft aus einem porösen Fahrradreifen, meine Hände sacken ganz allmählich ab.
»Und? Was machste jetzt?«, ruft Henry und lacht. »Los, komm schon, verteidige dich!«
Okay, kann er haben. Das ist auch eine Frage der Ehre. Hatte nicht RTL seinen Kampf gegen Graciano Rocchigiani so genannt?
Ich ziehe also eine Rechte in Henrys Richtung, so entschlossen ich nur kann. Er fängt den Schlag lässig ab und lässt mir sofort eine Linke als leichte Ohrfeige zukommen.
Natürlich weiß man, dass es nur Spaß ist. Wenn du gegen Henry Maske in den Ring steigst, dann solltest du das ausschließlich zum Spaß machen. Es sei denn, du bist Wladimir Klitschko.
Und natürlich weiß ich auch, dass er mir nie richtig eine reinhauen würde. Aber das sagt einem der Verstand. Gefühlt bin ich gerade im Krieg, und das Adrenalin tanzt Samba in meinem Körper. Wenn so ein ausgewachsener Box-Weltmeister auf einen zukommt und man zum ersten Mal in seinem Leben in so einem Ring steht, dann wird die Situation sehr schnell verdammt real.
Henry stoppt seine Schläge millimetergenau, bevor’s weh tut. Er versetzt mir einen kurzen Haken in die Magengrube – umpf. Ich stehe, den Oberkörper zusammengeklappt, auf einem Fuß in der Ecke, meine Beine über Kreuz. Wie einer, der fürchterlich dringend zum Klo muss und vor der verschlossenen Tür wartet.
Es ist tatsächlich ein Kampf. Gegen meine Erschöpfung, gegen mein Ungeschick. Und, das vor allem, gegen den Blick des Meisters, der sagt: Himmel, was für ein müder Krieger!
Am anderen Ende des Gyms lümmelt Rüdiger May auf einem der Plastikstühle; Basecap, Lederjacke, schmale Jeans, ziemlich coole Bikerboots. Rüdiger war früher Nummer eins der WBO-Rangliste im Cruisergewicht, jetzt betreibt er mit seinem älteren Bruder Torsten und seinem Vater dieses angenehm testosteronarme Boxstudio. Es kommen immer wieder Anfänger hierher, weil Boxen das vielseitigste Fitnesstraining überhaupt ist, speziell für jämmerliche Bürogestalten wie mich. Rüdiger kennt das also. »Sei nicht so streng, Henry«, sagt er grinsend. Und mir ist nicht ganz klar, ob ich einen neuen Maßstab setze – quasi das low end definiere.
Der Maylife-Boxclub liegt am nördlichen Kölner Stadtrand, direkt am Fühlinger See, einem übergroßen Baggerloch, das als Regattastrecke und Naherholungsgebiet dient. Naherholung hat Henry Maske für diesen Vormittag allerdings nicht vorgesehen. Sondern Nahkampf.
Er meint es ernst. So wie er alles, was er anfängt, mit beachtlicher Ernsthaftigkeit macht. Das ist wohl eine Charakterfrage. Genauso wie die Tatsache, dass er eine Viertelstunde vor dem vereinbarten Termin vor der Tür zum Studio steht. Leichte Daunenjacke, lässiger Schal, Sporttasche über der Schulter.
Es hatte einer gewissen Penetranz bedurft, den Champ zu einem neuerlichen Comeback zu überreden. Sein letztes war deutlich lukrativer, und immerhin sahen gut 17 Millionen Leute vor dem Fernseher dabei zu. Hier sind wir ziemlich unter uns.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.