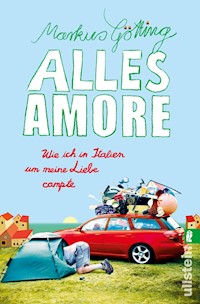7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kaum hat Markus in eine Familie von Camping-Fans eingeheiratet, sitzt er auch schon im Auto zu seinem ersten Wohnwagenurlaub in Italien –beladen mit Sonnencreme, Dosenbier und noch mehr Vorurteilen. Am Strand trifft er sie alle: notorische Nackensteak-Griller und Gartenzaun-Aufsteller, die in ihren Wohnmobilen Lindenstraße gucken.Wie kann ein Mann das alles für seine Liebe ertragen? Die Geschichte einer unglaublichen Integrationsleistung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
»Ich habe meine Urlaube bislang in überdrehten Ferienclubs verbracht oder in Hotels, die mindestens vier Sterne hatten. Okay, das ist auch nicht wirklich originell und womöglich ein wenig schnöselig, aber ein Campingplatz? Das war für mich immer der denkbar größte Alptraum. Hinzu kommt, dass sich mein handwerkliches Geschick auf das Anreichen von Werkzeug und das Öffnen von Bierflaschen beschränkt …«
Dies ist die verrückte Geschichte eines Mannes, der für seine Liebste einen Besuch in der Hölle macht. Skeptisch am Anfang, beladen mit Vorurteilen, aber später immer neugieriger und am Ende voller Eifer dabei, wann immer es gilt, Vorzelte aufzubauen und fettige Nackensteaks zu grillen. Ein schrecklich amüsanter Camping-Urlaub in Süditalien – die moderne Version von »Man spricht deutsch«.
Der Autor
Markus Götting, Jahrgang 1971, lebt in München. Nach Stationen bei der Süddeutschen Zeitung, beim Süddeutschen Magazin und dem stern, für den er als Auslandsreporter unterwegs war, arbeitet er seit 2012 bei der Zeitschrift Bunte.
Von Markus Götting ist in unserem Hause bereits erschienen:
Nachts im Sägewerk
Markus Götting
Alles Azzurro
Unter deutschen Campern in Italien
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet: www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Juni 2012© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012Umschlaggestaltung: semper smile, München Titelillustration: Frau am Strand: © Getty Images / Trujillo-Paumier; Wohnwagen: © Corbis / Caterina Bernardi; Häuser: © iStockphoto / Marina Zlochin Satz und eBook Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin ISBN978-3-8437-0263-8
Für Frida und Matti
Uno
Der Sonnenaufgang in der Ferne über dem Apennin. Der blühende Oleander, dessen Duft selbst auf der AutostradaAdriatica durch unser geöffnetes Seitenfenster hereingezogen war. Der Blick über den Lago di Varano hinweg auf das glitzernde Mittelmeer. Das war alles in Ordnung, ja sogar sehr schön. Ich ließ mir auch klaglos im Autogrill den Schreck meines Lebens einjagen, als hinter mir an der Kasse ein Plüschäffchen mit einem Mal blechern lachte.
Aber jetzt habe ich die Faxen dicke. Wenn ich schon in die Urlaubs-Hölle muss, dann will ich nicht noch stundenlang ihren bezaubernden Vorhof bewundern, sondern meinem Schicksal furchtlos ins Auge blicken. Und zwar subito.
Lena und ich waren am frühen Abend aufgebrochen, 1200 Kilometer immer Richtung Süden, bis hinunter an »den Sporn des Stiefels«, wie Lena das auf ihre spezielle Art beschrieben hatte. Das Einzige, was mich neben ein paar Dosen Red Bull die Nacht über wach hielt, war das bedrohliche Schnaufen meines betagten bordeauxroten Fiestas, dessen ehemals stolze Metallic-Lackierung im Laufe der Jahre zu einer stumpfen Außenhaut geworden war; so folienhaft matt wie man es von BMX-X6-Modellen kennt, deren Besitzer auch noch einen Haufen Kohle dafür bezahlen.
Ich hatte den Wagen vor zwei Wochen überhaupt erst nach einer ausgedehnten Suche wiedergefunden, nachdem ich ihn im Frühjahr als hoffnungslos defekt eingeschätzt, achtlos in unserem Viertel abgestellt und dann ein paar Monate lang vergessen hatte. So gesehen war es schon eine ziemlich smarte Idee, am frühen Abend aufzubrechen. Stehst du wenigstens nicht eine Ewigkeit im Megastau vor der Mautstelle. Und kannst dich mit deiner abgerockten 54-PS-Gurke im Schutz der Dunkelheit den Brenner hoch von LKWs überholen lassen, ohne das Gesicht zu verlieren.
Meine kleine subversive Hoffnung war ja, dass der Motor irgendwo hinter Bologna mit einem infernalischen Knall verrecken würde und wir dann doch notgedrungen in eines dieser coolen Boutique-Hotels bei Riccione einchecken könnten. Aber mein alter vierrädriger Gefährte ist verdammt zäh. Oder einfach nur Teil einer miesen Verschwörung, die mich auf diesen Trip geführt hat. Allmählich dämmert mir, dass ich dem Schicksal nicht entkommen werde: meinem allerersten Urlaub auf einem Campingplatz.
Als Kind habe ich Ferien bei bayerischen Bauern gemacht und auf dem Ponyhof. Wir sind mit dem Charter-Bomber in mallorquinische Betonburgen gereist, wo man sich schon beim Einchecken entscheiden musste, in welcher Schicht man zu Mittag- und Abendessen gehen wollte. Das alles habe ich geduldig über mich ergehen lassen. Nun also ein Urlaub im Wohnwagen. Das ist eine dermaßen spezielle Herausforderung – da will ich mir erst gar nicht vorstellen, ihr gewachsen zu sein.
Inzwischen geht es bergauf, bergab durch spitze Serpentinen, die dazu führen, dass mein Gesicht die Farbe der Kreidefelsen von Rügen annimmt. Im Prinzip hätte ich mir sogar Rügen eher gefallen lassen als das hier.
Seit einer halben Ewigkeit sind wir nicht mehr durch besiedeltes Gebiet gekommen, ganz zu schweigen von einem Dorf oder sonstigen Anzeichen von Zivilisation. Wir fahren durch ein kleines Wäldchen, noch eine Kurve, dann eine lange Gerade. Links unten die Adria, davor schwindelerregende Klippen. »Daaaa! Da vorne, da ist es!«, kreischt Lena in einer irren Mischung aus Euphorie und Hysterie.
Da vorne. Ein paar weiße Häuschen, die sich inmitten des bewaldeten Nichts auf einem ins Meer ragenden Felsen zu ducken scheinen. Andere Häuser sehen so aus, als würden sie wild durcheinandergewürfelt die Klippen hinunterwachsen. Unterhalb des Ortes glaube ich einen kleinen Hafen zu erkennen. Und einen Strand, auf dem verschiedenfarbige Sonnenschirme vermutlich die jeweilige Zone des Campingplatzes markieren. Immerhin: Nach dröhnendem Massentourismus sieht das nicht gerade aus.
Da ist es also. Sepiana.
Objektiv betrachtet ein Fischerdorf in der apulischen Region Gargano, wo sie früher im Winter wahrscheinlich noch am getrockneten Fisch nagten, so arm waren die hier. Mit »früher« meine ich: vor dem Hereinbrechen des Touristen-Tsunami. Für Lena ist es ihr absoluter Sehnsuchtsort. Ihr ganz persönliches Arkadien, über das sie seit ihrer Kindheit Regalwände voller Tagebücher engzeilig vollgeschrieben hat. Verziert mit allerlei Klebebildchen und niedlichen Zeichnungen.
Vermutlich ist dieses Kaff nicht viel mehr als ein von Pubertätserinnerungen befeuerter Mythos. Aber meine Meinung ist in unserer Beziehung nicht besonders oft gefragt. Und wenn Lena doch mal fragt, hört sie der Antwort schon nicht mehr zu.
Sie fummelt jetzt an ihrem iPhone rum, das sie ans Autoradio angeschlossen hat. Eine Posaunen-Fanfare ertönt, die Stimme von Adriano Celentano, der aber augenblicklich von Lena niedergesungen wird: »Cerco l’estate tutto l’anno / e all’improvviso eccola qua. / Lei è partita per le spiagge / e sono solo quassù in città, / sento fischiare sopra i tetti / un aeroplano che se ne va.« Sie holt kurz Luft, bevor sie erst richtig lostrompetet: »Azzurro, / il pomeriggio è troppo azzurro / e lungo per me. / Mi accorgo / di non avere più risorse, / senza di te, / e allora / io quasi quasi prendo il treno / e vengo, vengo da te, / ma il treno dei desideri / nei miei pensieri all’incontrario va.«
Dann knöpft sie wild schunkelnd ihre Bluse auf, reißt sie sich geschmeidig vom Leib, und im Takt von »Azzurro« lässt sie das Teil über ihrem Kopf kreisen wie Fußballfans nach einem Tor ihren Vereinsschal. Nach dem zweiten Refrain landet die Bluse als Stoffknüll auf der Rückbank.
Il treno dei desideri – wenn das mal keine klassische Papagallo-Poesie ist. »Der Zug der Begierden«, »Ich komme, komme zu dir«. Himmel! Ich meine, ich mag zwar ein notorischer Nörgler sein und alles, aber auch mir geht manchmal ein bisschen das Herz auf, wenn mir aus der Ferne die Antenne auf dem Kitzbüheler Horn einem Leuchtturm gleich den Weg weist. Und ich liebe Lenas Enthusiasmus, er ist absolut umwerfend – im Moment weiß ich nur noch nicht, ob eher auf mitreißende oder abstoßende Weise.
Lena wippt jetzt im radikalen Urlaubsmodus und weißen Feinripp auf dem Beifahrersitz, und ich muss sagen, dass so ein Unterhemd bei Frauen doch erheblich erotischer wirkt als bei Männern. Wenn mich meine Vorurteile nicht enttäuschen, werde ich in den kommenden drei Wochen noch hinreichend Gelegenheit haben, diese Annahme zu überprüfen.
Drei Wochen Urlaub an einem Ort habe ich seit der Schulzeit nicht mehr verbracht, aber vermutlich werde ich ohnehin mindestens eine Woche brauchen, um mich von dieser Anreisetortur zu erholen. Dabei musste ich nicht mal den Wohnwagen zum Campingplatz schleppen. Das, hat Lena jedenfalls versichert, erledigt irgendein apulischer Bauer aus der Umgebung, bei dem die Kiste immer untergestellt wird, wenn niemand sie braucht. Abgesehen davon, dass mein alter Fiesta mit einem Wohnwagen am Haken garantiert sogar von Traktoren überholt werden würde, macht mir allein die Vorstellung Angst, mit so einem Gespann das schmale Sträßchen zum Campingplatz runterzukurven.
Ein Schild mit der Aufschrift »Campeggio« weist nach links, ich biege ab und schalte die nervige Musik aus, kurbel das Fenster bis ultimo runter und genieße, soweit es die konzentrierte Kurverei zulässt, die vogelgezwitscherfreie Stille des Morgens. Keine zwanzig Kurven sind es von der Hauptstraße bis runter zum Wasser, rechts des Weges ein mächtiger Pinienwald und am Ende der Straße zwei Pfähle mit einem gewaltigen Holzbogen, auf dem wie Hohn »Il Grande Paradiso« steht. Der weißgetünchte Rumpf eines abgetakelten Fischerboots unterteilt die Einfahrt in zwei Spuren: für die Ankömmlinge – und jene, die wieder heimfahren. Dürfen oder müssen. Ich bin da noch nicht sicher.
Lena greift von rechts ins Lenkrad und drückt dreimal energisch auf die Hupe. Derweil ich erfolglos versuche, verschämt im Fußraum abzutauchen.
Aus dem Rezeptionskabuff nähert sich ein Mann von Anfang fünfzig in bequemen schwarzen Ledertretern und einer selbstbewusst den Zeitgeist ignorierenden Jeans. Er trägt ein kurzärmeliges Karo-Hemd über seinem gemütlichen Bäuchlein und schlendert mit albatrosartig ausgebreiteten Armen auf unser Auto zu.
»Lena, come stai?«, ruft er, gefolgt von einer Umarmung, die bei der biblischen Rückkehr des verlorenen Sohnes nicht sehr viel herzlicher ausgefallen sein kann. Dann kurzer, prüfender Blick nach rechts zu mir, woraufhin er Lena skeptisch ansieht. »Che cosa fai? Un altro esperimento?«
Du elender süditalienischer Bauerntölpel, denke ich, das mit dem Experiment habe ich verstanden. Also, rein sprachlich jedenfalls. Die Mitteilungsebene allerdings sollte sich mir erst ein paar Tage später erschließen.
Ein veritabler Sturzbach einheimischer Wörter ergießt sich über Lena. In meinem zweiten Lehrbuch habe ich mich tapfer bis lezzione undici vorgekämpft. Das reicht allerdings nicht ansatzweise, um den Bauern-Dialekt der Region Gargano zu verstehen. Für mich klingt der finstere Akzent Apuliens wie Finnisch. Giovanna, meine Lehrerin, ist eine kulturbegeisterte lombardische Edelfrau. Und die Menschen aus dem Süden nennt sie immer nur verächtlich terrone, was so viel heißt wie »Erdfresser«. Mein Problem ist, dass man hier in Apulien offenbar nicht nur Erde frisst, sondern dazu auch noch jede zweite Silbe eines Wortes verschluckt, quasi als Beilage. Ich verstehe niente.
»Das ist Markus«, sagt Lena nicht ohne Stolz, »mein Mann. Wir haben vor einem Monat geheiratet.«
Bis vor fünf Jahren war Lena meine Nachbarin. Sie wohnte im Hochparterre und ich in der zweiten Etage. Wir hatten uns eines Tages an der Mülltonne kennengelernt, was als Ort für ein erstes Treffen vielleicht nicht besonders romantisch ist, aber die Romantik kam dann ja noch. Jedenfalls im Rahmen meiner Möglichkeiten. So wurde also aus der schönen Nachbarin meine Gattin. Und inzwischen wohnen wir in der ersten Etage.
»Ah, was für eine tolle Überraschung«, sagt der Empfangschef und wendet sich nun auch mir zu. Große Albatros-Geste: »Ich bin der Massimo.«
Na Donnerwetter, denke ich, der terrone spricht sogar deutsch, wenn auch mit so einem putzigen Roberto-Begnini-Akzent. Und wie ich das mal in Lektion eins von »Allegro Uno« gelernt habe, erwidere ich ein eher holprig artikuliertes piacere – »sehr erfreut«. Wobei ich es eher stöhne, während mir Massimo mit einem fröhlichen Haifischlächeln die Hand zerquetscht.
»Ich hab euch einen wunderschönen Platz reserviert«, sagt Massimo. »Prima fila«, sagt er bedeutsam zu Lena, und während ich noch darüber rätsele, ob das jetzt ein geheimer Code zwischen den beiden ist, dreht sich Lena zu mir und sagt: »Erste Reihe. Meerblick. Da stehen wir fast auf dem Strand. Wie geil!«
Sollte Massimo verheiratet sein, war er seiner Frisur in den letzten drei Jahrzehnten garantiert treuer als seiner Gattin. Den Style kannte ich jedenfalls bisher nur aus Perückenläden, in denen ich zu Fasching gelegentlich herumstöbere. Er steigt jetzt in seine Ape, so eine Art motorisiertes Dreirad von Piaggio, wie es von Don Camillo gefahren wurde. »Kommt mir hinterher!«
Er knattert einen Hügel zum Meer hinunter, vorbei an Wohnwagen und Zelten und an Badeschlappenmenschen mit aufgeblasenen Gummitieren unter dem Arm. Auf einer Freifläche stehen drei Wohnmobile vom Format eines Reisebusses in U-Form zusammen, zu einer Wagenburg ausgerichtet, als erwarteten die Pilgrim Fathers einen Überfall heulender Indianer.
»Und?«, fragt Lena, dabei sieht sie aus, als würde sie platzen vor Euphorie. »Wie gefällt’s dir?«
»Frag mich nächste Woche. Ich bin müde, ich bin wehrlos. Ich habe keine Meinung. Ich will das alles nicht.«
»Jammerlappen! Pass auf, am Ende willst du gar nicht mehr weg von hier.«
Eine Bar, zwei Tennisplätze, ein kleines Fußballfeld. Fast wie ein Robinson Club, nur im, sagen wir mal, shabby chic. Massimo tuckert auf eine Wohnwagenkolonie zu, die von einem kleinen Holzpfeil als »Zona Dragone« ausgewiesen wird.
»Die stehen hier enger zusammen als in einer Reihenhaussiedlung, da hörst du doch jede Nacht deinen Nachbarn schnarchen.«
»Wenn, dann ist es doch wohl umgekehrt«, zischt Lena. »Die Nachbarn hören dich.«
Touché. In der Tat, die Leute um uns herum werden mich und meine Terror-Nase noch schneller kennenlernen, als ihnen lieb ist. Mit geröteten Augen und tiefen dunklen Rändern darunter werden sie spätestens übermorgen genervt abreisen. Oder aber mich zum Teufel jagen. Beides wäre mir nur recht.
Massimo stoppt vor einer leicht vergilbten weißen Blechwand, bestimmt fünf Meter lang, deren Hänger sich in den Sand gebohrt hat. Der apulische Bauer, der immer den Wagen auf den Platz zieht, hat offenbar Wort gehalten – wahrscheinlich war er bloß froh darüber, diese gewaltige Kiste von seinem Hof zu kriegen. »Wow«, jubelt Lena, »was für ein Riesen-Gerät. Das ist ja echter Luxus!«
»Das kommt aber sehr auf die Definition von Luxus an.«
»Früher haben wir zu sechst in so einem Teil Urlaub gemacht.«
»Dann sollen deine Eltern bloß froh sein, dass das Jugendamt damals nicht Wind von der Sache bekommen hat. Sorry, aber gegen das hier wirkt ein Zimmer im Etap-Hotel wie ein Ballsaal.«
Lena öffnet die Autotür und steigt aus. Sie sagt: »Jetzt wart’s doch mal ab. Wir haben ja noch ein Vorzelt und ein Sonnensegel. Das wird dir schon noch vorkommen wie die Präsidenten-Suite.«
Das Vorzelt. Shit. Das hatte ich ganz vergessen. Oder verdrängt? Lenas Vater hatte mir in einem dreiviertelstündigen Monolog die Grundlagen des Vorzeltaufbaus nähergebracht, Tücken und Fallen nicht ausgespart. Er hatte sogar verschiedene kleine Zeichnungen angefertigt, wie eine Montageanleitung von Ikea. Die hab ich allerdings in der plötzlichen Hektik unserer Abreise irgendwo daheim liegen lassen. Kann ja nicht so schwer sein, ein Zelt aufzubauen.
Massimo verabschiedet sich. »Ci vediamo stasera«, ruft er Lena im Wegfahren zu. Ich schaue irritiert seinem eigenartigen Gefährt hinterher, bis es um die Biegung am Ende der Straße verschwunden ist. Punkt eins: Hätte er mich auch mal fragen können, ob ich ihn gleich heute Abend schon wiedersehen will. Und Punkt zwei: Vielleicht rechnet er gar nicht mit mir?
Lena fummelt den Wohnwagenschlüssel aus ihrer Handtasche, Strahlen der Vorfreude im Gesicht. Sie schließt die Tür auf – und ein Gestank schlägt uns entgegen, als hätten wir die Gruft einer kürzlich verstorbenen Waschbärenfamilie geöffnet.
»Boah, was ist das denn?« Mir wird augenblicklich kotzübel. So hab ich mir den Geruch der Freiheit nicht vorgestellt.
»Oh, stimmt, das hatte ich vergessen. Mein Vater hat gesagt, dass sie beim letzten Mal im strömenden Regen abbauen mussten. Kann sein, dass das Vorzelt noch ein bisschen klamm ist.«
»Bisschen? Das riecht komplett vermodert. In dieser Karre hier ist es feuchter als im Dampfbad. Nur ohne den Duft von ätherischen Ölen.«
»Entspann dich«, sagt Lena ganz entspannt. »Wir legen das Zeug in die Sonne, da ist es im Nu getrocknet. Und in der Zwischenzeit lüften wir halt ein bisschen durch.« Sie sagt: »Bevor du das Zelt einspannen kannst, musst du sowieso erst mal alle Stangen aufbauen. Und bei deinem handwerklichen Geschick ist bis dahin eh alles trocken.«
Herzlichen Dank. Ich weiß selbst, dass mein Talent maximal dafür ausreicht, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Und im Baumarkt interessiere ich mich auch eher für die Putzmittel, die sie in diesen irren Werbefilmen anpreisen. In unserer Ehe bin ich quasi das Mädchen.
Wir hängen die miefenden Zeltwände über die brusthohen Hecken, die unseren Stellplatz begrenzen, räumen Tische und Stühle raus, einen Kühlschrank und etliche seltsame Taschen, in denen ich weiteren Kleinkram vermute. Unfassbar, was die alles in diesen Wagen reingestopft haben. Unfassbar auch, was man offenbar alles fürs Campen braucht.
Dabei habe ich noch gar keine Ahnung, was man so alles braucht.
Einen Wohnwagen-Stellplatz muss man sich so ähnlich wie eine Gartenlaube vorstellen. Nur unter Italiens Sonne. Der Wagen selbst ist dermaßen zwischen die Hecken gequetscht, dass er uns wie eine Mauer den Rücken zur kleinen geteerten Straße abschirmt. Er lässt gerade mal Platz für einen schmalen Durchgang in unser Reich. Vor uns die Parzelle: eine Art sandiger Garten mit Meerblick. Hinter einem Mäuerchen, das mir bis zu den Waden reicht, beginnt der Strand. Immerhin. Näher kann man tatsächlich nicht dran sein. »Hier hast du eine Schaufel«, sagt Lena, »als Erstes müssen wir den Platz mit Sand einebnen.«
»Hast du einebnen gesagt?« Ich bin doch kein Bauunternehmer. Ich blicke auf das vertrocknete Gras zu meinen Füßen, das vorwitzig aus dem Sand lugt. Nun gut, ich werde es in eine planierte Wüste verwandeln.
»Und vergiss nicht, die Gräben zu ziehen«, befiehlt Lena, während sie sich daranmacht, die versifften Campingmöbel zu schrubben.
Gräben ausheben. Das sollten wir Deutschen in fremden Ländern besser nicht mehr tun, denke ich.
»Wozu soll ich einen Graben ausheben? Wir sind doch völlig unbewaffnet.«
»Falls der Regen kommt, du Depp. Dann kann das Wasser abfließen.«
»Moment mal. Von Regen war vorher nie die Rede!«
Ich blicke aufs Meer. Den Strand davor werde ich nun also nach und nach sorgfältig auf unseren Stellplatz verlagern. Mit einem Klappspaten und einem Kindereimerchen.
Die Sonne knallt mir auf die Rübe, ich schwitze schlimmer als die D-Promis, die fürs Fernsehen in einen australischen Dschungel ziehen. Schippen, kippen, planieren – nach einer guten Stunde ist die Vorarbeiterin mit meinem Werk zufrieden. Jetzt kommt die Königsdisziplin: der Zeltaufbau.
Es gibt unzählige Zeltstangen. Sie sehen ein wenig aus, als wären sie aus Karbon, und sind mit kleinen Aufklebern versehen, auf denen VL steht, VM, VR und so weiter. Vorne links, vorne Mitte, vorne rechts. Im Prinzip kein Problem. Wäre da nicht die Frage der Perspektive. »Sag mal, wenn dein Vater vorne links auf die Stange schreibt, meint er dann mit dem Rücken oder mit Blick zum Wohnwagen?«
»Keine Ahnung. Macht das einen Unterschied?«
»Das weiß ich doch nicht. Wer ist denn hier der Camper?«
»Ich sehe den Wagen doch auch zum ersten Mal«, meckert Lena zurück.
Ich krame mein Handy aus der Tasche, um meinen Schwiegervater anzurufen. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber wir müssen eh noch Bescheid geben, dass wir gut angekommen sind. Dann kann ich das kleine Verständnisproblem in einem Nebensatz unterschmuggeln.
Mein Handy sagt: kein Netz.
»Gibst du mir mal eben dein Handy? Ich hab hier irgendwie keinen Empfang. Ich ruf jetzt deinen Vater an.«
»Hier gibt’s keinen Empfang. Du kannst es vorne in der Kurve am Ende der Straße versuchen, das ist der einzige Ort, an dem man ein Signal hat.« Das »manchmal«, das sie leise vor sich hin murmelt, habe ich dennoch nicht überhört.
»Das ist nicht dein Ernst, oder?«
Vielleicht war Lena genau deshalb in den Tagen vor unserer Abreise mit ihrem Handy schier verwachsen. Manchmal telefonierte sie auf ihrem Blackberry und dem iPhone parallel, was ich im Sinne der Geschäftigkeit äußerst sexy fand. Sie arbeitet seit einigen Jahren in einer Fernsehproduktionsfirma und verhandelte, noch während sie unsere Taschen packte, mit irgendwelchen TV-Redakteuren, denen sie zwei Showformate verkaufen wollte.
Das eine sollte eine Quizshow mit Prominenten sein, bei der die Kandidaten für jede falsch beantwortete Frage eine zweistöckige Sahnetorte ins Gesicht geschleudert bekommen würden. Fand ich nett, aber das andere war mein absolutes Lieblingskonzept. Sie nannte es »Ich will ein Kind von dir«, eine Art Castingshow nach Vorbild des »Bachelor«, nur dass es nicht ums Heiraten geht. Eine junge Frau, die zwar einen Kinderwunsch hat, aber blöderweise keinen passenden Mann, würde diesen aus einem Dutzend Kandidaten wählen. Ich fand ja, »DSDS2.0« wäre auch ein hübscher Titel für die Sendung – »Deutschland sucht den Samenspender«.
Aber wie dem auch sei. Wenn ich Lena richtig verstanden habe, gehen die Verhandlungen erst nach unserem Urlaub weiter. Mir schwante, wieso.
Jedenfalls laufe ich jetzt den Teerweg vor bis zur Kurve, dabei halte ich das Handy vor mir ausgestreckt wie die Arbeiter von Fukushima ihren Geigerzähler. Es ist Mittagszeit; Familien sitzen neben ihren qualmenden Grills und betrachten mich mitleidig. Die Assoziationskette ist recht simpel: Kreidebleiche Haut und versucht zu telefonieren – haha, das muss ein Neuer sein!
Nach einer halben Stunde gebe ich’s auf. Als ich zurück zu unserem Platz komme, hat Lena die Stangen ordentlich sortiert und aufgeschichtet. »Mir ist das jetzt egal«, sage ich, »links oder rechts – kann doch nicht so wichtig sein. Die sind eh alle gleich groß.«
Das Zusammenstecken ist noch recht einfach, und als ein einigermaßen stabiles Gerippe vor dem Wohnwagen steht, betrachte ich stolz mein Werk. Lena holt die Zeltplanen. Die sind zwar inzwischen tatsächlich getrocknet, stinken aber immer noch nach Verwesung. Die Planen einzuziehen, ist ein gruseliges Gefummel. Während ich immer wieder vor mich hin fluche, ermahnt mich Lena immer wieder zur Geduld. Mit einem Mal rumst es. Eine der Stangen hat sich verabschiedet, und nun wankt und schwankt das halb verkleidete Gerippe wie ein Fischerkahn bei Windstärke acht. Ich springe nach vorne links – oder war das doch vorne rechts? – und versuche mit aller Macht, den Einsturz zu verhindern. Vergeblich. Schon im nächsten Moment klappt meine Konstruktion an beiden Enden zusammen wie das Bierdeckelhäuschen eines Stammtisch-Architekten. Lena schreit auf und will in Deckung gehen, wird dann aber von einem scharfkantigen Metallstück einer umfallenden Stange am Kopf getroffen. »Scheiße, du Idiot!« Vor Zorn wird sie knallrot im Gesicht, fast so rot wie der tiefe Cut, der sich über ihre Stirn zieht. Und aus dem es blutet wie unterm Chirurgenmesser.
Das Geschepper hat mittlerweile auch unsere sogenannten Nachbarn alarmiert, die von links und rechts zusammengelaufen kommen. Es mag der Thrill eines Unglücks sein und natürlich auch ernsthaft empfundenes Mitleid. Knapp ein Dutzend Leute versammelt sich jenseits der Hecke. Mir ist nicht entgangen, dass sie schon seit einer Weile meine Bemühungen mit einem gewissen Amüsement verfolgt haben. Nun haben sie also ihr lang erwartetes Spektakel: ein streitendes, keifendes Ehepaar inmitten der Ruinen eines Campingvorzeltes, dazu ein bisschen Blut – für die Uhrzeit eine bemerkenswerte Bilanz.
Ein älterer Herr, der beigefarbene Bermudas zu seinem Bierbauch trägt, zwängt sich an der Hecke vorbei auf unsere Parzelle. Er sagt: »Ach du Scheiße!« Was als Bewertung der Gesamtsituation durchaus eine präzise Zusammenfassung ist. Und dann mit einem Blick auf Lenas Stirn: »Mädchen, das musst du nähen lassen.«
Lena ist nicht die Sorte Frau, die bei der kleinsten Krise losheult wie ein Kind an seinem ersten Tag in der Krippe. Jetzt aber laufen ihr einige Tränen übers Gesicht. Sie sagt kein Wort, als sie in den Wagen verschwindet, um ihre Verletzung im Spiegel zu betrachten.
»Willi«, sagt der Bermuda-Mann, als er mir eine mächtige Pranke entgegenstreckt, die ihn schon mal nicht als professionellen Pianisten ausweist.
»Piacere«, sage ich zerstreut und auf italienische Höflichkeitsfloskeln konditioniert. Willis Blick formt Fragezeichen.
»Äh, ich meine – Markus.«
Willi blickt auf das Stangen-Chaos. »Alles halb so schlimm«, sagt er, als von drinnen ein dumpfer Schlag ertönt. Ich ziehe die sandigen Schuhe aus und springe die drei Stufen hoch. Lena liegt auf dem Boden. Ohnmächtig geworden.
»Willi!«
Er kommt hinterher, zusammen heben wir Lena aufs Bett. Mein Herz rast. Auch das noch! So etwas Ähnliches hatte ich schon zwei-, dreimal bei ihr erlebt: dass ihr plötzlich erst schwindelig und dann schwarz vor Augen wurde und sie einfach zusammengesackt ist. Das hier erscheint ernster. Die lange Autofahrt, die Arbeit in der Mittagshitze, der Anblick von Blut. Das war wohl zu viel. Ich streichele ihr über die Wange, die Stirn blutet immer noch, und Lena schlägt langsam die Augen auf. »Trinken«, stöhnt sie schwach. Vielleicht ist sie ja tatsächlich nur ein bisschen dehydriert. Willi reicht mir die Wasserflasche von der Ablage, ich halte ihren Kopf leicht schräg und führe die Flasche an ihre Lippen. Lena nippt ein paar Schlucke. Nach einer Viertelstunde rappelt sie sich auf. Ich gebe ihr noch ein Stück Traubenzucker, vielleicht kommt sie dann ja wieder zu Kräften.
Wir stützen sie von beiden Seiten auf dem Weg zu meinem Fiesta. »Willi, wir sehen uns später«, sage ich, bevor wir uns zum Arzt in Sepiana aufmachen – hinter uns ein Wohnwagen-Stellplatz, der ein wenig an einen verunglückten Selbstmordanschlag in Kandahar erinnert: kleinere Krater im Boden, eine zerfetzte Behausung, aber nur Leichtverletzte unter der Zivilbevölkerung.
Due
Das Drama begann mit unserer Hochzeitsfeier. Mir war klar, dass ich in eine Familie von Camping-Enthusiasten einheiraten würde, eine Familie, die seit etwa drei Jahrzehnten jeden ihrer Urlaube in Sepiana verbrachte, gern auch mal zwei pro Jahr.
Mein Schwiegervater hatte unseren großen Tag liebevoll gekapert. Als Biologe empfand er es als seine Pflicht, sich um den Blumenschmuck zu kümmern – er sollte dem alpinen Ambiente der Tiroler Berge entsprechen, wo wir unsere Lieblingshütte gemietet hatten. Und als Sohn einer Gastronomin sorgte er selbstverständlich persönlich für die üppige Getränkeauswahl. Wie auch dafür, dass der Pfarrer innerhalb kürzester Zeit so betrunken war, dass er sich nur noch an die Hälfte der zehn Gebote erinnern konnte. Halt machte Lenas Vater einzig vor der Küche, was allerdings auch daran lag, dass der in Festivitäten erfahrene Koch sie lange genug zur eigenen Sicherheit von innen verschlossen hatte.
Wir waren kurz vor dem Dessert, als Peter mit einem Teelöffel gegen sein bedrohlich gefülltes Rotweinglas schlug. Er hatte das mal in einem Film gesehen, und ich glaube, die Geste hatte ihm imponiert. »Es waren die Osterferien 1978«, begann er scheinbar harmlos, »und ich als Vater von drei Kindern – Benjamin, unser Jüngster, war ja noch nicht mal geboren – konnte mir nicht mehr leisten als einen geliehenen Wohnwagen und einen VW-Bus, mit dem wir bis tief in den Süden Italiens fuhren.«
Während ich mich noch fragte, ob er wohl auch meine Schwiegermutter noch erwähnen würde, stieß Toni, mein bester Freund und Trauzeuge, mich von rechts mit dem Ellbogen an. »Wenn der bei 1978 anfängt, dann sollten wir uns ein paar Kurze bestellen. Die Zeit verkürzen, hehe.«
Nach fünf Minuten war Peter in seiner Rede gerade erst am Brenner angekommen. Ich hielt Tonis Vorschlag für eine gute Idee und winkte einem der Kellner, der klappernd das Geschirr vom Hauptgang entfernte. Sehr zum Verdruss des Redners. »Äh, hm«, sagte Peter und machte mit dem Handgelenk eine Geste in Richtung Kellner, als wollte er eine lästige Fliege verjagen: »Jetzt lassen Sie das doch!«
»… Wir standen also am heruntergelassenen Schlagbaum des Campingplatzes, die drei Kinder müde von der zweitägigen Fahrt, nur ein Platzwächter da, und ich ließ im Dorf nach dem Chef suchen …«
Die Geschichte ging in etwa so: Peter hatte im ADAC-Heftchen von einem malerischen Campingplatz in Apulien gelesen, nur die Sache mit den Öffnungszeiten hatte er wohl überblättert. Also standen sie einigermaßen blöde vor der Schranke, und während Peter mit dem Aufpasser diskutierte, kümmerte sich seine Frau Maria um die quengelige Brut. Schließlich gab es damals noch keine tragbaren DVD-Player, geschweige denn iPads. Und als Massimo kam, der junge Campingplatzverwalter, der seinerzeit sicher die gleiche Frisur und dieselben Jeans getragen hatte wie heute, da öffnete er ihnen schließlich den Platz, allerdings nicht ohne darauf hinzuweisen, dass es erst eine Woche später Strom und funktionierende Duschen geben würde.
»Hast du eine Ahnung, was dieser Campingplatz mit dieser Feier zu tun hat?«, flüsterte Toni zu mir rüber.
»Wart’s ab, in spätestens einer Viertelstunde kommt die Pointe.«
»… Und so verbrachten wir eine Woche im Paradies, einsam wie Robinson …« Peter senkte die Stimme, als würde er jetzt zur Sache kommen. Ich wusste, dass er seit geraumer Zeit an einer die Jahrhunderte umspannenden Familienchronik arbeitete. Und bei diesem Urlaub muss es sich um eine Art Gründungsmythos des letzten Familienzweigs handeln; eine Geschichte, die vom Aufbruch in ein fremdes Land erzählte, von Entbehrung und einer Sippe, die den kargen Umständen tapfer trotzt und sich dabei auf sich selbst besinnt. Der Treck gen Süden sozusagen, auf der Suche nach dem Glück.
Toni klopfte mir krachend auf den Rücken: »Alter, da kannst du aber stolz sein auf deine neue Familie!« Bei Toni sind die Grenzen zwischen Aufrichtigkeit und Ironie traditionell fließend. Schwer zu sagen, wie er das gemeint hatte. »Die machen noch einen richtigen Kerl aus dir.«
»Klar, aber einen mit Anti-Aging-Creme für die Augen im Gepäck.« Ich spülte einen doppelten Obstler runter.
Für meinen Schwiegervater war es selbst mit dem Gehalt eines Biologieprofessors wohl die einzige Möglichkeit, mit seiner sechsköpfigen Familie jedes Jahr einen vierwöchigen Sommerurlaub zu finanzieren. Kinder – zumal seine – pfeifen auf Komfort, solange sie genügend Sonne und Sandspielzeug haben. Und Sepiana, so viel wurde während seiner Ausführungen klar, ist im Laufe der Jahrzehnte zu einer zweiten Heimat seiner Familie geworden. Dort kennen sie jeden, gelten schon fast als Einheimische. Und wenn ich mich nicht täusche, träumt er davon, dass wir eines Tages dort seine Asche ins Meer streuen.
In Sepiana hatte Lena sich zum ersten Mal verliebt und ganz offensichtlich jedes Jahr aufs Neue: in irgendeinen anderen italienischen Surfer-Schönling. »Für uns war immer klar«, sagte Peter, »dass Lena irgendwann einen Italiener heiraten wird.« Er machte eine Pause und drehte sich lächelnd zu mir. »Aber jetzt haben wir ja dich, mein Lieber.«